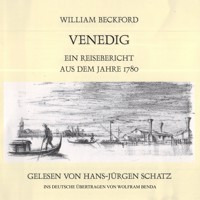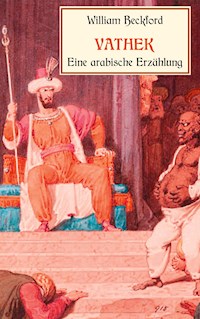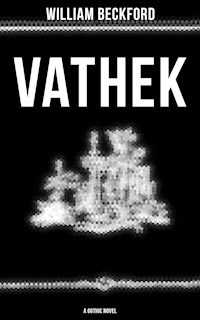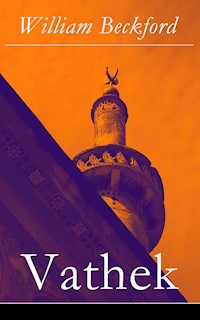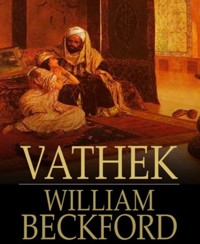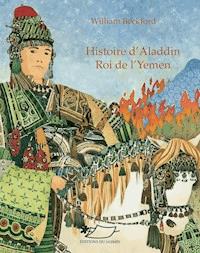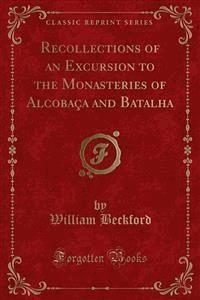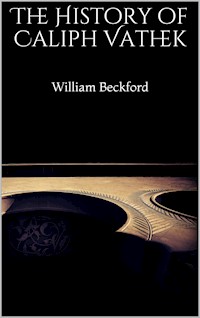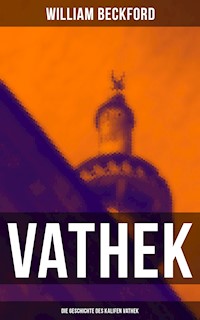
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
William Beckford's 'VATHEK: Die Geschichte des Kalifen Vathek' ist ein Werk, das die Leser in die exotische Welt des Orients entführt. Das Buch spielt im alten Persien und erzählt die Geschichte des kalifen Vathek, der nach Macht strebt und dadurch den Zorn der Götter auf sich zieht. Beckford's literarischer Stil ist geprägt von einer opulenten Sprache und einer faszinierenden Darstellung des Übernatürlichen. 'VATHEK' gehört zu den frühen Werken der Gothic Fiction und hat sowohl historische als auch romantische Elemente, die den Leser in einen Bann ziehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 168
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
VATHEK: Die Geschichte des Kalifen Vathek
Books
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Inhaltsverzeichnis
Dieses Buch schrieb um das Jahr 1781 der damals zwanzigjährige William Beckford »hintereinander und auf französisch in drei Tagen und zwei Nächten intensivster Arbeit – ich habe die ganze Zeit die Kleider nicht vom Leib getan und wurde schwer krank davon«. Das Manuskript wurde ohne Wissen Beckfords ins Englische übersetzt und erschien als Buch 1784. Die französische Originalausgabe kam erst drei Jahre später heraus: Vathek, Conte Arabe. A Paris, Chez Poinçot, Libraire, rue de la Harpe, près Saint-Côme, No. 135. 1787. Im Jahre 1820 hat Beckford selber eine englische Übersetzung gemacht und herausgegeben.
Hätten die zeitgenössischen Memoiristen und Journalisten den Vathek nicht ignoriert – weder der Mercure, noch Frérons Année Littéraire, weder Métra, noch Bachaumont sagen ein Wort darüber – so hätten sie vielleicht etwas von Voltaire gesprochen, von den Feenmärchen aus Chinaporcellan und dem Arabischen des Galland; und Bachaumont hätte zu erzählen gewußt, daß man diesen schlanken, sehr modisch angezogenen Engländer in den ersten Jahren der Revolution zu Pferde als Zuschauer überall sah, wo auf Straßen und Plätzen sich etwas begab. Die Karikaturenzeichner der Zeit kannten ihn so, als den exzentrischen Lord; als den Dichter des Vathek kannte man ihn so wenig wie den Vathek selber.
Das Buch kam zu früh in die Zeit; erst eine spätere entdeckte es: Mérimée, dieser Delikate, wollte es neu herausgeben: er mußte ein seinem eisgekühlten Temperament Verwandtes darin spüren, wie da die Dämonie eines Schicksals mit moralischer Gleichgültigkeit aber ästhetischem Raffinement erzählt wird und die Ironie des Weltmannes dem Ganzen die Distanz gibt. Mallarmé führte die Absicht Merimées aus: er ließ den Vathek 1876 für 220 Freunde drucken und nennt ihn in seiner préface »un des jeux les plus fiers de la naissante imagination moderne«.
Die pathetische Architektur des Buches – die Architektur ist der essentielle Orient: Raum, Zahl – umspielen groteske Linien. Vathek läßt sich den hohen Turm bauen, er will die Sterne erreichen, ganz zu ihnen hin, um ihnen ihre Geheimnisse zu nehmen, aber die Sterne sind ganz fern. Da läßt sich sein formidabler Appetit ein großes Essen servieren. Die perverse Keuschheit seiner Mutter hetzt ihn zum Abenteuer, und die ganze Cortège von Reitern, Damen, Eunuchen, Pagen, Zwergen, in Sänften, in Käfigen, zu Pferd, zu Dromedar zieht durch Wüsten, Felsen, brennende Zypressenwälder, Paradiese in das Unterirdische.
Der Vathek ist ein Buch, das jeder gute Engländer in seiner Bibliothek hat. Schon weil Beckford die berühmte Fonthill-Abbey gehörte, die er 1822 öffentlich versteigern ließ samt all ihren Schätzen, was die berühmteste Vente einer Bibliothek gab; weil er drei Millionen jährliches Einkommen hatte, Englands wealthiest son war, wie ihn Byron im ersten Canto des Childe Harold anruft. Aber es haben sich um William Beckford die Engländer sonst nicht gekümmert, die keinen kleinsten Dorfpfarrer gestorben sein lassen, ohne ihm einige Monate später seine zweibändige Biographie auf die frische Graberde zu legen. Es wird mit Beckfords Popularität in England sein wie mit der Popularität des Genies auch anderswo: mehr Respekt von ferne, als nahe Liebe. Dann schlug Beckford den Ton an, der nicht mehr verklungen ist und der in englischen Ohren keine Resonanz zu finden scheint. Vathek ist da und dort im de Quincy, in der Geste Oskar Wildes, in der Imagination Beardsleys.
Soll etwas aus seinem Leben erzählt werden? Der Sohn des verstorbenen Lordmajor Beckford wächst unter der Leitung der Lords Chatham und Littleton auf dem Lande auf. »Das alte Haus von Fonthill mit seinem riesigen Saale, den vielen Türen und Korridoren, dunklen, langen – das ist Eblis. Die Frauen im Vathek sind nach meiner Ansicht outrierte Portraits jener guten und bösen Frauen, die auf Fonthill wohnten.« Langes Reisen über den Kontinent, allein, mit einer Frau, differenzieren die Sensibilität dieses Genußmenschen bis zum persönlichsten einsamen Geschmack. Er ist unermeßlich reich, hat gar keine äußeren Ambitionen, baut Paläste und sammelt unerhörte Schätze. Sein Zusammenhängen mit den Menschen beschränkt sich auf die Formen des Anstandes; moralische Beziehungen sind keine; er trifft sich mit keinem Zweiten und Dritten auf dem Boden starken Meinungsaustausches. Er sieht Menschen bei sich nur zu Festen, den Nelson mit der Hamilton und allem Gefolge: Staffage für seine Architektur. Er hält nie einen guten Freund am Kamin zurück für spätere Stunden.
William Beckford starb am 2. Mai 1844 im Alter von vierundachtzig Jahren.
Es sind außer dem Vathek noch ein paar kleine Schriften von ihm im Druck erschienen. Ein Liber Veritatis, das er auch Buch der Narrheit immer nennen wollte, wird in der Handschrift verwahrt. Ein Biographical memoir of extraordinary painters schrieb und druckte er mit siebenzehn Jahren; mit der sehr seltenen Schrift mystifizierte er die Besucher der väterlichen Bildergalerie. Dann Reiseeindrücke: Familiar letters from Italy, 1805, später – 1832 – um einen Band vermehrt und mit dem Titel: Italy, Spain and Portugal, neu von ihm herausgegeben. Weiter: Excursions to the Monasteries of Bathala and Alcobaça, 1835. Die Memoirs of William Beckford, London 1859 in zwei Bänden, sind zum größten Teil nach Beckfords Diktaten und Angaben niedergeschrieben.
Der Vathek und sein Dichter sind kaum in die historische oder eine ästhetische Ordnung zu bringen. Sind schon Beziehungen zum Geiste seiner Zeit – das achtzehnte Jahrhundert – schwer aufzuweisen, so sind Relationen des Vathek zum Moralismus überhaupt nicht vorhanden, wenn man nicht die Ironie als eine solche Beziehung ansprechen will. Aber es ist eine Ironie, die bloß von der Persönlichkeit des Dichters die Richtung erfährt, nicht von gesellschaftlichen Oppositionen und Meinungen, die Beckford teilte.
Der Vathek ist das stolzeste Spiel der werdenden modernen Imagination – die Definition Mallarmés bestimmt das Wesentliche.
Franz Blei.
Vathek
Inhaltsverzeichnis
Vathek, der neunte Kalif aus dem Hause der Abbassiden, war der Sohn des Motassem und Enkel des Harun Al-Raschid. In jungen Jahren bestieg er den Thron. Die großen Eigenschaften, die er ganz jung schon besaß, ließen seine Völker hoffen, daß seine Regierung lang und glücklich sein würde. Sein Ansehen war hoheitsvoll und schön; aber wenn er zornig wurde, da blickte sein eines Auge so schrecklich, daß man es nicht ertragen konnte: der Unglückliche, den dieser Blick traf, fiel nach rückwärts und manchmal hauchte er sogar auf der Stelle den Geist aus. Und deshalb gab sich der Kalif, aus Furcht, seinen Staat zu entvölkern oder aus seinem Palaste eine Öde zu machen, seinem Zorne nur sehr selten hin.
Er war den Frauen und den Genüssen des Tisches gleich stark ergeben. Seine Freigebigkeit kannte keine Grenzen, und seine Ausschweifungen keine Zurückhaltung. Denn er glaubte nicht, wie der Kalif Omar Ben Abdalaziz, daß man aus dieser Welt eine Hölle machen müsse, um in der andern sich des Paradieses zu erfreuen.
Er übertraf an Glanz alle seine Vorfahren. Der Palast Alkorremmi, den sein Vater Motassem auf dem Wildenpferdhügel erbaut hatte und der die ganze Stadt Samarah beherrschte, war ihm nicht weit genug. Er ließ noch fünf Flügel daran bauen, oder vielmehr fünf neue Paläste, und er bestimmte jeden davon der Befriedigung eines seiner Sinne.
In dem ersten dieser fünf Paläste waren die Tische stets mit den ausgesuchtesten Speisen bedeckt. Man erneuerte sie Tag und Nacht, sobald sie kalt geworden waren. Die feinsten Weine und die besten Liköre flossen in Strömen aus hundert Springbrunnen, die nie versiegten. Dieser Palast hieß das Ewige Fest oder der Unersättliche.
Den zweiten Palast nannte man den Tempel der Melodie oder den Nektar der Seele. Ihn bewohnten die besten Musiker und bewundertsten Dichter der Zeit. Nachdem sie ihre Talente an diesem Orte geübt hatten, zerstreuten sie sich in Banden und überfluteten die ganze Umgebung mit ihren Liedern.
Der Palast Das Entzücken der Augen oder die Unterstützung des Gedächtnisses war ein einziges Wunder. Die größten Seltenheiten aus allen Ecken der Welt waren hier gesammelt, in Massen und in der schönsten Ordnung. Man sah in einer Galerie die Bilder des berühmten Mani und Statuen, die zu leben schienen. Hier reizte eine glücklich gewählte Aussicht den Blick; dort wurde das Auge angenehm durch die Künste der Optik getäuscht; an einer andern Stelle fand man alle Schätze der Natur. Mit einem Worte: Vathek, der neugierigste unter den Menschen, hatte in diesem Palaste nichts vergessen, was die Neugierde der Besucher befriedigen konnte, nur nicht seine eigene, denn er war unersättlich.
Der Palast der Wohlgerüche, den man auch den Stachel der Wollust nannte, war in mehrere Säle geteilt. Aromatische Lampen und Fackeln brannten da auch am hellen Tage. Um sich von der köstlichen Trunkenheit zu erholen, in die man hier geriet, stieg man in einen weitläufigen Garten hinab, in dem alle Blumen eine kühle und erfrischende Luft atmen ließen.
Der fünfte Palast hieß die Wohnung der Freude oder der Gefährliche. Hier waren viele junge Mädchen und Frauen. Sie waren schön und verführerisch wie die Huris und nie ermüdet, diejenigen wohl zu empfangen, die der Kalif in ihre Gesellschaft zulassen wollte. Denn er war gar nicht eifersüchtig und verwahrte zudem seine eigenen Frauen in dem Palast, den er bewohnte.
Trotz all dieser Wollüste, denen sich Vathek ergab, wurde er doch von seinen Völkern nicht minder geliebt. Man glaubte, daß ein Herrscher, der sich den Lüsten des Lebens ergibt, mindestens ebensogut zum regieren tauglich ist, als einer, der sich als Feind dieser Lüste erklärt. Aber sein unruhiger und brennender Geist konnte da nicht stehen bleiben. Zu Lebzeiten seines Vaters hatte er aus Langeweile so viel studiert, daß er nun vieles wußte; nun wollte er Alles wissen, selbst die Wissenschaften, die es gar nicht gibt. Er liebte es, mit den Gelehrten zu disputieren; sie durften aber ihren Widerspruch nicht zu weit treiben. Den einen stopfte er den Mund mit Geschenken; die andern, deren Überzeugungen seiner Freigebigkeit Widerstand leisteten, wurden ins Gefängnis geschickt, daß sie sich da ihr Blut abkühlen: ein Mittel, das oft half.
Vathek machten auch die theologischen Streitigkeiten Vergnügen, und es war nicht die allgemein anerkannte orthodoxe Partei, für die er sich erklärte. Damit hatte er alle Zeloten gegen sich: also verfolgte er sie, denn er wollte immer und um jeden Preis Recht haben.
Der große Prophet Mahomet, dessen Statthalter die Kalifen sind, war im siebten Himmel über dieses irreligiöse Treiben eines seiner Nachkommen entrüstet. »Lassen wir ihn nur machen«, sagte er zu den Dschinnen, seinen Geistern, die stets seiner Befehle harren, »wir wollen sehen, wieweit seine Narrheit und Ungläubigkeit geht; treibt er es zu bunt, so wissen wir ihn schon zu züchtigen. Helft ihm diesen Turm bauen, den er in Nachahmung Nimrods zu bauen angefangen hat; aber nicht, um sich wie jener darauf vor einer neuen Sintflut zu retten, sondern aus schamloser Neugierde, in die Geheimnisse des Himmels zu dringen. Er mag tun, was er will, er wird das Schicksal, das ihn erwartet, nie erraten.«
Die Dschinnen gehorchten, und während die Arbeiter tagsüber den Turm um Ellenbogenhöhe in die Höhe brachten, mehrten die Geister ihn des Nachts um zwei. Die Schnelligkeit, mit der dieses Gebäude gebaut wurde, schmeichelte der Eitelkeit Vatheks nicht wenig. Er glaubte, daß sogar der fühllose Stoff seinen Absichten entgegenkomme. Dieser Fürst bedachte trotz all seiner Wissenschaft nicht, daß die Erfolge der Unsinnigen und der Bösen die ersten Ruten sind, mit denen sie geschlagen werden.
Als er das erstemal die elftausend Stufen seines Turmes hinaufstieg und hinunterschaute, erreichte sein Stolz den Gipfel. Die Menschen erschienen ihm wie Ameisen, die Berge wie Schneckenhäuser und die Städte wie Bienenkörbe. Die Vorstellung, die diese Höhe ihm von seiner eigenen Größe gab, verdrehte ihm vollends den Kopf. Schon wollte er sich selbst anbeten, als er die Augen erhob und sah, daß die Sterne noch ebensoweit von ihm entfernt waren, als da er auf der Erde stand. Über das unwillkürliche Gefühl seiner eigenen Kleinheit tröstete ihn der Gedanke, daß er in den Augen der andern doch groß wäre, und daß das Licht seines Geistes dasjenige seiner Augen übertreffe; er wollte den Sternen sein Schicksal ablesen.
Zu diesem Zwecke verbrachte er die meisten Nächte auf dem Gipfel seines Turmes und glaubte sich in die astrologischen Geheimnisse eingeweiht und bildete sich ein, daß die Planeten ihm die wunderbarsten Abenteuer voraussagten. Ein außergewöhnlicher Mensch sollte aus einem Lande kommen, dessen Name man nie gehört hatte, und der Held werden. Seine Neugierde hatte ihn immer sehr höflich gegen Fremde sein lassen; jetzt verdoppelte er seine Aufmerksamkeit für sie, und ließ durch Trompetenstöße in den Straßen Samarahs verkünden, daß keiner seiner Untertanen einen Fremden aufnehmen dürfe, sondern jeder müsse in seinen Palast geführt werden.
Einige Zeit nach dieser Proklamation erschien in der Hauptstadt ein Mensch, dessen Gesicht so entsetzlich war, daß die Wächter, die ihn in den Palast führten, die Augen schließen mußten. Der Kalif selber schien über das fürchterliche Aussehen erschrocken; aber bald folgte Freude diesem ersten Grauen. Der Unbekannte breitete vor dem Fürsten solch kostbare Seltenheiten aus, wie er sie nie zuvor gesehen und deren Dasein nicht einmal für möglich gehalten hatte.
Es gab auch wirklich nichts, das außerordentlicher gewesen wäre, als die Waren dieses Fremden. Die mehreren seiner Geschmeide waren ebenso schön gearbeitet wie prächtig. Sie besaßen zudem noch ganz besondere Eigenschaften, die auf einem Pergamentstreifen geschrieben standen, der an jeden Gegenstand geheftet war. Es gab da Pantoffeln, die den Füßen beim Gehen halfen; Messer, die ohne Handbewegung schnitten; Säbel, die bei der geringsten Bewegung den Schlag ausführten; und all diese Gegenstände waren mit wertvollen Steinen besetzt, die niemand kannte.
Unter diesen Kostbarkeiten fanden sich Säbel, deren Schneiden ein unsägliches Feuer ausstrahlten. Der Kalif wollte sie haben und er versuchte, die fremden Schriftzeichen zu entziffern, die darauf graviert waren. Ohne nach dem Preise zu fragen, ließ er vor den fremden Menschen alles gemünzte Gold des Schatzes bringen und hieß ihn nehmen so viel er wolle. Der nahm nur ganz wenig und sprach kein Wort.
Vathek zweifelte nicht daran, daß das Schweigen des Unbekannten keinen andern Grund habe als die Hochachtung, die ihm seine Gegenwart einflöße. Er hieß ihn wohlwollend näher treten und fragte ihn herablassend, wer er wäre, woher er komme und woher er diese schönen Sachen habe. Der Mensch, oder vielmehr das Ungeheuer, rieb sich statt aller Antwort dreimal seine Stirne, die schwärzer war als Ebenholz, schlug sich viermal auf den Bauch, dessen Umfang ungeheuer war, öffnete weit die Augen, die zwei glühenden Kohlen glichen und lachte ein entsetzliches lautes Lachen, wobei er breite, ambrafarbige, grün gefleckte Zähne zeigte.
Der Kalif wiederholte, etwas beunruhigt, seine Frage; aber er erhielt keine andere Antwort. Da wurde der Fürst ungeduldig und rief: »Weißt du denn, Unglücklicher, wer ich bin? Und bedenkst du, mit wem du da spielst?« Er wandte sich darauf an seine Garden und fragte, ob sie den Menschen hätten reden hören, ob er stumm sei. Die Garden antworteten, daß er gesprochen hätte, aber was er gesagt habe, sei nichts besonderes gewesen. »So soll er noch einmal sprechen«, befahl Vathek, »und er soll sprechen wie er kann und soll mir sagen, wer er ist, woher er kommt, woher er die seltsamen Dinge bringt, die er mir angeboten hat. Ich schwöre beim Esel des Balaam, wenn er weiter schweigt, will ich ihn seinen Eigensinn bereuen lassen.« Bei diesen Worten konnte sich der Kalif nicht enthalten, einen seiner gefährlichen Zornblicke auf den Unbekannten zu werfen; dieser aber verlor nicht nur nicht seine Haltung, sondern das schreckliche und mörderische Auge des Kalifen machte nicht den geringsten Eindruck auf ihn.
Worte können den Schrecken der Höflinge nicht ausdrücken, als die sahen, daß der unhöfliche Kaufmann eine solche Probe bestand. Sie hatten sich alle platt auf die Erde geworfen und wären auch da liegen geblieben, wenn der Kalif ihnen nicht wütend befohlen hätte: »Steht auf, Feiglinge, und ergreift diesen Elenden! Daß man ihn ins Gefängnis werfe und von meinen besten Soldaten bewachen lasse! Er kann das Gold mitnehmen, das ich ihm gegeben habe; er soll es behalten, aber er soll sprechen, ich will, daß er spricht!« Bei diesen Worten fiel man von allen Seiten über den Fremden her; man fesselte ihn um die Gurgel mit festen Ketten und führte ihn in das Gefängnis des großen Turmes, das sieben Gürtel von eisernen Stangen mit langen Spitzen, scharf wie Dolche, von allen Seiten umgeben.
Der Kalif aber war in der größten Aufregung. Er sprach kein Wort; kaum wollte er sich zu Tisch setzen und aß von den täglich gereichten dreihundert Gerichten nur zweiunddreißig. Diese Diät, an die er nicht gewöhnt war, wäre allein schon genügend gewesen, ihm den Schlaf zu rauben. Wie aber erst, da sich dazu diese Unruhe gesellte, die ihn nicht losließ! Sobald es Tag geworden war, eilte er selbst zum Gefängnis, um neuerliche Versuche bei dem starrköpfigen Fremden zu machen. Aber seine Wut läßt sich nicht beschreiben, als er sah, daß der Fremde fort, die Eisengitter zerbrochen und die Wächter ohne Leben waren. Ein wilder Wahnsinn erfaßte Vathek. Er stieß mit den Füßen nach den Leichen, die vor ihm lagen und hörte den ganzen Tag nicht auf, sie auf diese Weise mit Fußtritten zu bearbeiten. Seine Hofleute und Vessire taten alles, um ihn zu beruhigen; aber als sie sahen, daß es ihnen nicht gelinge, schrieen sie alle auf einmal: »Der Kalif ist verrückt geworden! der Kalif ist verrückt geworden!«
Dieser Schrei widerhallte bald in allen Straßen von Samarah. Und kam schließlich an die Ohren der Prinzessin Carathis, Vatheks Mutter. Ganz bestürzt kam sie herbei, um ihre alte Macht über den Geist ihres Sohnes zu versuchen. Ihren Tränen und Küssen gelang es, den Kalifen zu beruhigen, und auf ihren Wunsch ließ er sich in den Palast führen.
Carathis hütete sich, ihren Sohn allein zu lassen. Nachdem man ihn zu Bett gebracht hatte, setzte sie sich zu ihm und versuchte, ihn durch ihre Unterhaltung zu trösten und zu beruhigen. Niemandem wäre das besser gelungen. Vathek liebte und verehrte sie nicht nur als eine Mutter, sondern auch als eine mit höherem Geiste begabte Frau. Sie war Griechin und hatte ihn alle Philosophien und Wissenschaften ihres Volkes gelehrt, zum großen Entsetzen der braven Muselmanen. Die Astrologie war eine dieser Wissenschaften, und Carathis beherrschte sie vollkommen. Ihre erste Sorge war daher, ihren Sohn an das zu erinnern, was die Sterne ihm geweissagt hatten und sie schlug vor, sie neuerlich zu befragen.
»Ah!« sagte der Kalif, sobald er seine Sprache wiedergefunden hatte, »ich bin ein Sinnloser, nicht weil ich meinen Wächtern vierzigtausend Fußtritte dafür gegeben habe, weil sie sich blöde totschlagen ließen; aber weil ich nicht bedacht habe, daß dieser außergewöhnliche Mensch der war, den mir die Gestirne angekündigt haben. Statt ihn zu mißhandeln, hätte ich versuchen sollen, ihn durch Güte und Schmeichelei zu gewinnen.«
»Das Vergangene kann nicht widerrufen werden«, antwortete Carathis, »man muß an die Zukunft denken. Vielleicht siehst du noch den, den du bedauerst; vielleicht zeigen dir die Schriftzüge auf den Säbeln den Weg. Iß und schlafe, mein lieber Sohn, morgen werden wir sehen, was da zu tun ist.«
Vathek befolgte diesen weisen Rat so gut er konnte. Am nächsten Tag stand er in besserer Verfassung auf und ließ sich die wunderbaren Säbel bringen. Um nicht von ihrem Glanz geblendet zu werden, betrachtete er sie durch ein farbiges Glas und versuchte die Schriftzüge zu entziffern; aber umsonst; er schlug sich vergeblich vor die Stirne, er kannte nicht einen Buchstaben. Dieses Mißgeschick hätte ihn wieder in seine frühere Wut gebracht, wäre Carathis nicht eingetreten.
»Nimm Geduld an, mein Sohn«, sagte sie zu ihm; »du besitzest gewiß alle Wissenschaften, aber Sprachen zu kennen, das ist eine Bagatelle und nur Pedanten geben sich damit ab. Versprich Belohnungen, die deiner würdig sind, demjenigen, der dir diese barbarischen Worte übersetzt, die du nicht verstehst und die zu verstehen deiner unwürdig wäre; bald wird deine Neugierde befriedigt sein.«
»Möglich«, sagte der Kalif, »aber inzwischen werde ich von einer Menge von Halbgelehrten und Schwätzern gelangweilt werden, die es versuchen wollen, sowohl um sich gelehrt reden zu hören als um die Belohnung zu bekommen.« Nach einigem Nachdenken fügte er hinzu: »Ich will dieses Mißliche vermeiden. Ich werde alle sterben lassen, die mich nicht zufriedenstellen; denn dank dem Himmel habe ich genug Verstand, um zu unterscheiden, ob man übersetzt oder ob man erfindet.«
»Daran zweifle ich. nicht«, sagte Carathis. »Aber die es nicht wissen sterben lassen, ist eine etwas strenge Strafe, die gefährliche Folgen haben kann. Begnüge dich damit, ihnen den Bart abbrennen zu lassen – die Bärte sind in einem Staatswesen nicht so wichtig wie die Menschen.«