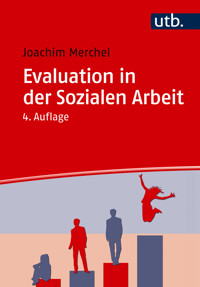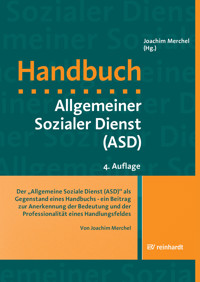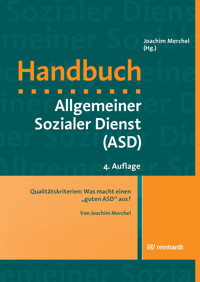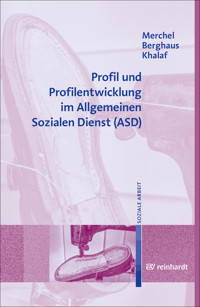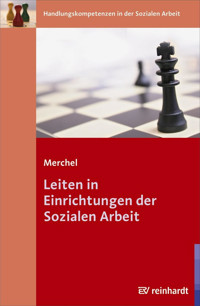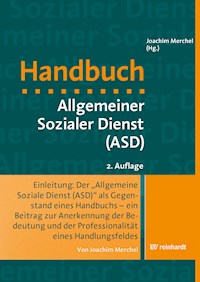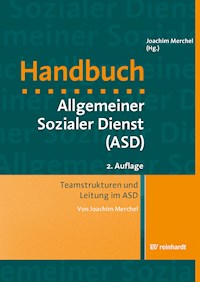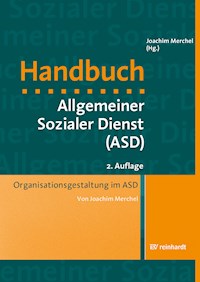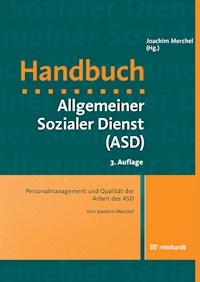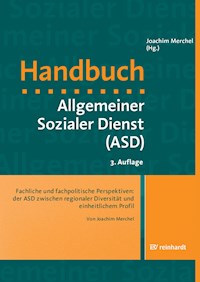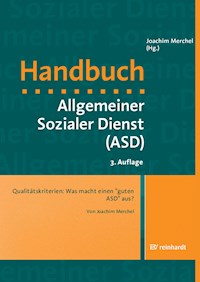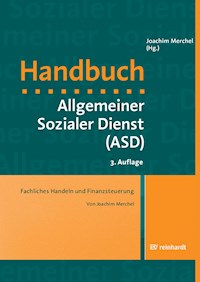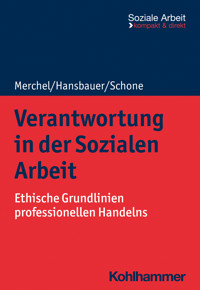
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Dimension "Verantwortung" hat in der Sozialen Arbeit eine große Bedeutung: Entscheidungen von Fachkräften greifen zum Teil tief in das Leben und die Zukunftsgestaltung ihrer Adressatinnen und Adressaten ein. Sich dieser Verantwortung bewusst zu sein und über die eigene Machtposition zu reflektieren, ist grundlegend für eine professionelle Praxis. Dies betrifft neben der formalen (Zuständigkeit) und rechtlichen Verantwortung insbesondere die Dimension der ethischen Verantwortung, die im Zentrum des Buches steht und anhand von Spannungsfeldern aus der sozialarbeiterischen Praxis erörtert wird. Abschließend wird unter dem Schlagwort "Organisationsethik" die Rolle von Einrichtungen und Trägern im Kontext von Verantwortung in der Sozialen Arbeit erklärt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 149
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
Vorwort der Reihenherausgeber*innen
Zu diesem Buch
1 Entscheidung und Verantwortung in der Praxis der Sozialen Arbeit
1.1 Fallkonstellationen
1.2 Eine erste Annäherung an den Begriff »Verantwortung«
2 Professionalität in der Sozialen Arbeit: Warum Verantwortung ein elementarer Bestandteil von Professionalität ist
3 Verantwortung: Was ist das?
3.1 Formale Verantwortung – »Zuständigkeit«
3.2 Rechtliche Verantwortung
3.3 Verantwortung in ethischer Hinsicht
3.4 Individuelle und kollektive moralische Verantwortung
4 Verantwortung in Handlungsfeldern Sozialer Arbeit: Reflexionen und Entscheidungen in Spannungsfeldern
4.1 Verantwortung zwischen professioneller Distanz und persönlichem Interesse am Wohlergehen eines*einer Leistungsadressat*in
4.2 Zwischen Entmündigung und Überforderung – Zur Beachtung der Einsichtsfähigkeit von Klient*innen
4.3 Zeitliche Dimension: Zwischen kurzfristiger und langfristiger Bedeutung von Entscheidungen/Interventionen
4.4 Vormundschaftliche Advokatorik zwischen Autonomiewahrung und »Fürsorglichkeitsverantwortung«
4.5 Verantwortung im Spannungsfeld zwischen »Sehen und Übersehen«
4.6 Verantwortung zwischen individuell verantwortlichem Handeln und der sozial-kollegialen Ebene zur Fall-Erörterung
5 Mehr als nur individuelles Thema der Fachkräfte – Reflexion von Verantwortung als Teil einer »Organisationsethik« in Organisationen der Sozialen Arbeit
Literatur
Die Autoren
Soziale Arbeit – kompakt & direkt
Herausgegeben von Rudolf Bieker und Heike Niemeyer
Eine Übersicht aller lieferbaren und im Buchhandel angekündigten Bände der Reihe finden Sie unter:
https://shop.kohlhammer.de/soziale-arbeit-kompakt-direkt
Joachim Merchel,Peter Hansbauer,Reinhold Schone
Verantwortung in der Sozialen Arbeit
Ethische Grundlinien professionellen Handelns
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2023
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:ISBN 978-3-17-041906-3
E-Book-Formate:pdf:ISBN 978-3-17-041907-0epub:ISBN 978-3-17-041908-7
Vorwort der Reihenherausgeber*innen
Ergänzend zu klassischen Lehrbüchern geht es in der neuen Reihe »Soziale Arbeit – kompakt & direkt« um die vertiefende Bearbeitung spezieller Themen- und Fragestellungen aus der Sozialen Arbeit und ihren Bezugsdisziplinen, z. B. theoretische Konzepte, spezifische Methoden, Arbeitsfelder oder soziale Probleme. Kompakt und direkt heißt die neue Reihe, weil sie in der Präsentation der Inhalte auf das konzentriert ist, was Lernende über das ausgewählte Thema wissen und für Studienleistungen und Prüfungen zielgenau aufbereiten können sollten.
Zielgruppen der Reihe sind jedoch nicht nur Studierende im Bachelor- oder Masterstudium, sondern auch Berufseinsteiger*innen und Praktiker*innen, die autodidaktisch oder in Fortbildungen Anschluss an den aktuellen wissenschaftlichen Diskurs halten wollen.
Der fokussierte Zuschnitt der Bände spiegelt sich in einem innovativen Buchformat, das Leser*innen Überschaubarkeit im Umfang und eine gut strukturierte Textpräsentation bietet. Zentrale Sachverhalte werden anhand von Praxisbeispielen und Abbildungen veranschaulicht. Didaktische Elemente wie Begriffserläuterungen, Textcontainer, Reminder, Essentials, kurze Zusammenfassungen, Piktogramme etc. erleichtern das Erfassen, Speichern und Wiederaufrufen der Inhalte.
Die Autor*innen der Bände sind durch ihre wissenschaftliche Expertise ausgewiesen, schreiberfahren und stehen in der Regel mit Studierenden und Praxisfeldern in engem Kontakt.
Rudolf Bieker und Heike Niemeyer, Köln
Zu diesem Buch
»Verantwortung von Fachkräften« ist ein gleichermaßen zentrales wie auch schwieriges und diffuses Thema in der Sozialen Arbeit. Von »Verantwortung« ist in vielen und sehr unterschiedlichen Zusammenhängen die Rede, z. B wenn organisatorische Zuständigkeiten angesprochen werden (»Die Kollegin X ist verantwortlich für die Moderation der Sitzung und dafür, dass ein angemessener Raum für die Fallberatung zur Verfügung steht.«), aber auch in der Kennzeichnung von sozialpädagogischen Zielen (»Der Jugendliche Y soll lernen, dass er Verantwortung für sein Handeln, auch für seine aggressiven Ausbrüche, übernehmen muss.«). Sozialpädagogische Fachkräfte grenzen sich ab und nehmen Distanz, wenn sie darauf verweisen, dass sie vor allem »für das Angebot verantwortlich seien«, jedoch nicht für das, was die Klient*innen daraus machen, dafür seien diese selbst verantwortlich. Um eine strafrechtliche Verantwortung geht es, wenn z. B. im Fall eines fehlgelaufenen Kinderschutzes gerichtlich überprüft wird, ob eine sozialpädagogische Fachkraft in den Grenzen fachlich und rechtlich legitimierbaren Handelns angemessen – also »verantwortlich« – vorgegangen ist.
Die Frage nach der Verantwortung der Sozialen Arbeit ist im Alltag der Fachkräfte allgegenwärtig. Fachkräfte treffen Entscheidungen für bestimmte Handlungsweisen oder auch für Nicht-Handeln, die tief in das Leben und in die Zukunftsgestaltung von Menschen eingreifen. Hilfen werden gewährt oder nicht gewährt oder anders strukturiert, als vorher vereinbart. Lebenssituationen werden als »interventionsbedürftig« oder als »im Rahmen von Normalität« definiert. Entscheidungen für bestimmtes Handeln oder Nicht-Handeln haben kurz- und längerfristige Auswirkungen für das Wohlergehen von Klient*innen. Insofern ist die Tätigkeit von Fachkräften der Sozialen Arbeit immer in einem ethischen Sinne mit Verantwortung verbunden.
Obwohl das Thema »Verantwortung« im Alltag der Sozialen Arbeit allseits präsent ist und einen zentralen Aspekt professionellen Handelns darstellt, ist es erstaunlich, dass dieses Thema in Erörterungen zur Professionalität und zu den Methoden Sozialer Arbeit kaum vorkommt. Lehrbücher zur Ethik in der Sozialen Arbeit (u. a. Martin 2001; Maaser 2010) behandeln es relativ abstrakt, weitgehend abgelöst von der sozialpädagogischen Fachlichkeit oder kommen völlig ohne Erwähnung dieses zentralen Aspekts der Ethik in der Sozialen Arbeit aus (Schneider 1999). In Büchern zu Methoden Sozialer Arbeit bleibt es zumeist ausgespart, nur in wenigen (z. B. Heiner 2007) wird es marginal erwähnt. In den Methodenbüchern wird zwar zur wichtigen Bedeutung von »Haltungen« geschrieben, jedoch findet man in den Konkretisierungen kaum etwas zu Verantwortung, obwohl diese doch ein zentraler Bestandteil der »Haltungen« sein sollte.
Es ist uns ein Anliegen, mit einem Band in der Reihe »Soziale Arbeit – kompakt & direkt« die elementare Bedeutung des Themas »Verantwortung« im Kontext der Professionalität in der Sozialen Arbeit hervorzuheben und dabei mitzuhelfen, dass dieses Thema einen entsprechenden Stellenwert in der Profession zugestanden bekommt. Um die praktische Bedeutung des Themas zu verdeutlichen, werden wir in Kapitel 1 beispielhaft einige Praxiskonstellationen markieren, in denen verschiedene Facetten von Verantwortung in der Sozialen Arbeit erkennbar werden (▸ Kap. 1). Daraus resultiert eine kurze konzeptionelle Darstellung von Verantwortung als Teil eines Verständnisses von »reflexiver Professionalität« in der Sozialen Arbeit (▸ Kap. 2). Kapitel 3 widmet sich dem Begriff »Verantwortung« und den verschiedenen Dimensionen, die in diesem Begriff enthalten sind (▸ Kap. 3). Die Komplexität von Verantwortung in ihrer ethischen Dimension entfaltet sich insbesondere in Spannungsfeldern, die das sozialarbeiterische und sozialpädagogische Handeln durchziehen und die dementsprechend genauer in den Blick zu nehmen sind, wenn es um die Reflexion der ethischen Konstellationen von Verantwortung im professionellen Handeln geht (▸ Kap. 4). Übernahme und Reflexion von Verantwortung ist zunächst zwar ein an die Person (die einzelne Fachkraft) gebundener Vorgang, jedoch steht die einzelne Fachkraft immer in einem Bezug zu der Organisation, in der sie tätig ist und der gegenüber sie sich und ihr Handeln legitimieren muss. Verfahrensweisen und organisationskulturelle Konstellationen in der Organisation wirken sich in Haltung und Praxis des Umgangs mit Verantwortung auf Seiten der Mitarbeiter*innen aus. Kapitel 5 behandelt diesen aus unserer Sicht bedeutsamen Aspekt (▸ Kap. 5). Damit wird der Umgang mit Verantwortung auch als Anforderung für Leitungspersonen in Organisationen der Sozialen Arbeit als »deren Verantwortung« platziert.
Münster, im Oktober 2022Joachim Merchel, Peter Hansbauer, Reinhold Schone
1 Entscheidung und Verantwortung in der Praxis der Sozialen Arbeit
T Überblick
Um sich dem Gegenstand »Verantwortung in der Sozialen Arbeit« zu nähern, werden zunächst verschiedene Fallkonstellationen skizziert, die in ambivalenten Konstellationen schwierige, das Schicksal von Menschen bestimmende Entscheidungen von Fachkräften der Sozialen Arbeit verlangen. Diese Konstellationen werden im weiteren Verlauf des Buches immer wieder aufgenommen. Das Kapitel schließt nach diesem Themenaufriss mit einer ersten Annährung an den Begriff »Verantwortung«.
1.1 Fallkonstellationen
Fachkräfte in der Sozialen Arbeit müssen vielfältige Entscheidungen treffen. Sie müssen mehrdeutige Situationen interpretieren und sich – zumindest im Sinne einer begründeten, plausiblen fallbezogenen Arbeitshypothese (Was liegt hier vor? Was macht den Fall zum Fall? Wo zeigen sich Ansatzpunkte für unterstützende Interventionen? Welche Wirkungen können von solchen Interventionen erwartet werden?) für eine bestimmte Sichtweise entscheiden. Sie müssen entscheiden, welches Vorgehen sie wählen und nach welchen Gesichtspunkten sie die Wirkungen und Nebenwirkungen ihrer Interventionen beobachten und bewerten. Manchmal stehen sie vor der Frage, ob sie ihrem Gegenüber eigene Entscheidungsfähigkeit zusprechen oder ob ihr Gegenüber nach ihrer Auffassung die Folgen eigener Entscheidungen nicht überblicken kann und sie daher zum Wohle des*der Adressat*in selbst entscheiden oder den*die Adressat*in zu einer bestimmten Entscheidung drängen sollen. Vielfach sind Entscheidungen mit Unsicherheiten und mit (latenten oder offenen) Konflikten verbunden.
Entscheidungen sind immer mit Verantwortung verknüpft. Jede Fachkraft muss sich die Frage stellen, welche Implikationen und welche Folgen ihre Entscheidung für das Wohlergehen und für die Autonomie ihrer jeweiligen Adressat*innen mit sich bringt und in welcher Weise weitere Beteiligte von den Entscheidungen betroffen sein können.
Einige nachfolgend skizzierte Beispiele aus verschiedenen Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit sollen erkennen lassen, dass und wie sich Anforderungen und Fragen zur Verantwortung im Alltag professionellen Handelns zeigen.
Beispiel 1: Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)
Der 10-jährige Marc lebt mit seiner Mutter und zwei jüngeren Geschwistern in einer 80 qm großen Wohnung; der Partner der Mutter ist vor kurzem aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen, steht jedoch weiterhin im Kontakt zur Mutter und zu den Kindern. Die Klassenlehrerin des Jungen wendet sich – entsprechend den Kinderschutz-Absprachen mit dem Jugendamt – an das Jugendamt bzw. den ASD und weist auf mögliche sexuelle Übergriffe auf den Jungen durch den Partner der Mutter hin; sie interpretiert Andeutungen des Jungen und sexualisierte Verhaltensweisen in Pausen und im Sportunterricht als mögliche Hinweise. Die Sozialarbeiterin F. hat Gespräche mit der Mutter geführt und einen Termin für Gespräche mit dem Jungen in der Beratungsstelle vereinbart. Die Gespräche haben keine ausreichende Klarheit gebracht und wenig Gesichtspunkte für Entscheidungen zum weiteren Handeln erzeugt. F. hat den Fall in das Teamgespräch eingebracht. Im ASD besteht die Regelung, dass alle Fälle, für die möglicherweise eine Hilfe zur Erziehung eingeleitet werden soll, ins Team eingebracht und dort erörtert werden; den Beratungen im Team wird eine nicht unerhebliche Bedeutung im Entscheidungsprozess zugesprochen. Die Kolleg*innen plädieren dafür, den Jungen zunächst zur »diagnostischen Abklärung« für vier Wochen in einer »Diagnosegruppe« unterzubringen. F. ist unsicher, ob dies von der Mutter und dem Jungen akzeptiert würde und ob dies – trotz der noch unklaren Sachlage – zur Stigmatisierung des Jungen und der beteiligten Personen beitragen würde – mit möglicherweise problematischen Folgen für die Erziehungskonstellationen in der Familie. Andererseits befürchtet sie Versäumnisse, wenn der Verdacht sich als richtig erweisen sollte. Sie weiß nicht, wie sie entscheiden soll und gibt den Fall erneut ins Team in der Erwartung, dass das Team kollegial entscheidet und ihr dadurch den Druck nimmt.
Fragen zur Verantwortung
·Kann eine »Team-Entscheidung« Verantwortungsdruck von der Einzelperson nehmen oder bleibt letztlich eine individuelle Fall-Verantwortung mit individuellem Entscheidungsdruck bestehen?
·Ist Verantwortung für die Entscheidung teilbar: Verantwortung für die Bearbeitung des Falls bei der Fachkraft – Verantwortung für Entscheidung beim Team?
·Wofür trägt die fallzuständige Fachkraft die Verantwortung und wie lässt sich die Verantwortung der Teammitglieder genauer konturieren?
Beispiel 2: Suchtberatung
Eine 35-jährige Frau mit erheblichen Alkoholproblemen ist seit ca. sechs Monaten in der Suchtberatung. Sie lebt mit einem gleichaltrigen Partner und ihrer 7-jährigen Tochter zusammen; ihr Partner ist nicht der Vater ihrer Tochter. In letzter Zeit gab es häufiger Situationen, in denen beide stark alkoholisiert waren und sich in der Wohnung aufhielten. In diesen Situationen konnten sie ihre Tochter nicht versorgen. Das Kind versorgte sich notdürftig selbst, aber versäumte den Unterricht in der Schule, zog sich von Sozialkontakten zu anderen Kindern zurück, wurde zur Besorgung von Einkäufen geschickt, musste sich in der zunehmend desorganisierten Wohnung aufhalten. Die Suchtberaterin versucht, das Bekanntwerden der Situation beim Jugendamt zu vermeiden und im Beratungskontakt mit der Mutter auf deren bessere Übernahme der Mutterrolle hinzuwirken. Die Beraterin sieht in der Tochter einen letzten Stabilisierungsfaktor für die Mutter. Wenn durch eine Intervention des Jugendamts dieser Stabilisierungsfaktor wegfiele, befürchtet sie eine krisenhafte Zuspitzung der psychischen Situation der Mutter, die sie an der Bearbeitung ihres Suchtproblems fast vollständig hindere.
Fragen zur Verantwortung
·Existiert für die Suchtberaterin eine Lösung für das Verantwortungsdilemma, in dem sie sich befindet: Fühlt sie sich stärker in der Verantwortung gegenüber der Mutter und deren Chancen zur Bewältigung ihres Suchtproblems oder gegenüber dem Kind und dessen Entwicklungsbedürfnissen? Welcher Person gegenüber steht sie in einer stärkeren Loyalität?
·Besteht ein akzeptabler Umgang mit dem Problem darin, dass die Suchtberaterin sich primär an ihrer »Zuständigkeit« für die suchtabhängige Mutter ausrichtet, weil die Mutter schließlich zu ihr gekommen und ihr den »Beratungsauftrag« erteilt hat?
Beispiel 3: Vormundschaft
Herr Schwaber ist Amtsvormund und in dieser Funktion seit einigen Monaten zuständig für den 13-jährigen Jackson, der seit seinem achten Lebensjahr stationär untergebracht ist und seither verschiedene Einrichtungen durchlaufen hat, aus denen er immer wieder entlassen wurde. Auch in der jetzigen Einrichtung war Jackson schon häufig über Nacht abgängig und wurde einmal mitten in der Nacht angetrunken von der Polizei in die Einrichtung zurückgebracht. Überdies ist er wegen mehrerer Delikte polizeibekannt, darunter nicht nur gemeinschaftlich begangene Sachbeschädigungen, sondern auch Körperverletzung, Nötigung und Diebstahl.
In der nächsten Hilfeplankonferenz, an der Herr Schwaber erstmals als Vormund teilnimmt, fordert deshalb der fallzuständige ASD-Mitarbeiter, Jackson müsse jetzt geschlossen untergebracht werden, um Schlimmeres zu verhindern: Er entzöge sich der Erziehung, wäre unfähig eine Bindung zu seinen Betreuern einzugehen und wenn die »Sache« weiter eskaliere, dann sähe er ihn mit 14 in der Jugendarrestanstalt. Es gebe deshalb keine Alternative zu einer geschlossenen Unterbringung. Alle Versuche, Jackson selbst eine Stellungnahme zu entlocken, scheitern.
In der Hilfeplankonferenz wird (noch) keine Entscheidung getroffen. Herr Schwaber beschließt, sich nochmals alleine mit Jackson zu treffen, um mit ihm über den Verlauf der Hilfeplankonferenz und das Vorgefallene zu sprechen. Als Herr Schwaber das nächste Mal den ASD-Mitarbeiter im Jugendamt trifft, fordert dieser ihn dazu auf, einen Antrag nach § 1631b BGB beim Familiengericht zu stellen, um das Mündel geschlossen unterzubringen.
Fragen zur Verantwortung
·Ist eine kurzfristige Internierung Jacksons in pädagogischer Absicht zu verantworten, um eine spätere Verengung von Optionsspielräumen durch einen Gefängnisaufenthalt zu verhindern?
·Ist es zu verantworten, eine derart schwerwiegende Entscheidung zu treffen, obwohl Herr Schwaber erst kurze Zeit Vormund für Jackson ist?
·Welche Verantwortung hat Herr Schwaber gegenüber seinem Kollegen im ASD und wird dieser eine Weigerung, Jackson geschlossen unterzubringen, nicht als Affront auffassen?
Beispiel 4: Sozialarbeit im Strafvollzug
Petra, 25 Jahre alt, ist alleinerziehend mit drei Kindern (zehn, acht und sechs Jahre). Die Hauptschule hat sie ohne Abschluss verlassen. Sie ist Empfängerin von Hilfe nach SGB II (Hartz IV). Sie befindet sich in Strafhaft wegen wiederholter größerer Bestellungen aus dem Internet, deren Rechnungen von ihr nicht bezahlt wurden (Betrug), und vereinzelter Ladendiebstähle. Dadurch entstanden mehrere Verurteilungen mit einer Gesamtfreiheitsstrafe von 24 Monaten ohne Bewährung. In der Haft (zunächst geschlossen, aber dann sehr bald im offenen Vollzug) begann sie eine Ausbildung zur Malerin und Lackiererin. Sie ist engagiert, lernt zuverlässig und erhält sehr gute Bewertungen von ihrem Meister. Ein Betrieb für die Fortführung der Lehre nach der Haft wurde bereits gefunden.
Petras Kinder sind bei ihrer hierdurch sehr belasteten Mutter untergebracht. Petra darf sie und die Kinder als Freigängerin regelmäßig (dreimal wöchentlich) nach ihrer Arbeit und an Wochenenden dort besuchen. Die Kinder freuen sich sehr auf diese Besuche.
Bei einem Gespräch zur Vorbereitung auf eine anstehende vorzeitige Haftentlassung wegen guter Führung mit der in der Vollzugsanstalt angestellten zuständigen Sozialarbeiterin will Petra sich eine Zigarette drehen, dabei fällt ein Stück Cannabis aus ihrem Tabaksbeutel auf den Tisch.
Die Sozialarbeiterin ist rechtlich in ihrer Stellung verpflichtet, Kenntnis von Drogenbesitz zu melden. Diese Meldung hätte zur Folge, dass der offene Vollzug aufgehoben und die Bewährung ausgesetzt würde. Zudem bekäme Petra eine Anzeige und ein neues Strafverfahren. Für Petra hieße dies u. a. auch, dass sie möglicherweise ihren Ausbildungsplatz für die Zeit nach der Haft verlieren würde.
Fragen zur Verantwortung
·Sollte die Sozialarbeiterin ihre rechtliche Verantwortung hintanstellen und unter dem Risiko, dafür ggf. selbst disziplinarisch belangt zu werden, ihre Beobachtung gegenüber der Anstaltsleitung verschweigen?
·Kann sie es andererseits verantworten, wenn durch diese Meldung die Ausbildung von Petra in Gefahr gerät?
·Hat die Sozialarbeiterin auch eine Verantwortung gegenüber den Kindern von Petra?
Beispiel 5: Hilfen zur Erziehung
In einer Wohngruppe lebt ein 17-jähriger Ghanaer, der als unbegleiteter Flüchtling nach Deutschland gekommen ist und noch keinen gesicherten Aufenthaltstitel hat. Während seines Aufenthalts in Deutschland hat er relativ schnell Deutsch gelernt und ist hoch motiviert, sich in den deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren. Mittlerweile hat er mehrere Kurzpraktika (Maler, Fahrradmechaniker, Koch, Schornsteinfeger u.a.m.) absolviert und sich dabei als pünktlich und zuverlässig erwiesen. Vor seiner Flucht hat er sechs Jahre lang eine Dorfschule in Ghana besucht. Auch nach der Integrations- und Ausbildungsvorbereitungsklasse in Deutschland beherrscht er die vier Grundrechenarten noch nicht sicher. Er ist zwar sehr bemüht, die vorhandenen Defizite aufzuarbeiten, liegt aber schulisch so weit hinter dem Rest der Klasse, dass der Klassenlehrer zu einer Beendigung der Schule und einer ›einfachen‹ Ausbildung rät.
Alle Versuche, ihn für eine Bäcker-, Konditor- oder Malerlehre zu begeistern, scheitern jedoch an seinem Wunsch, eine Ausbildung zum Industriemechaniker zu machen, die als ausgesprochen schwer gilt. Nur widerwillig schickt er ein paar Bewerbungen für eine Ausbildung zum Bäcker oder Maler los, nachdem alle anderen Bewerbungen erfolglos waren. Kurz vor Beginn der Sommerferien geschieht ein kleines ›Wunder‹ und innerhalb einer Woche erhält der 17-Jährige zwei Zusagen: eine für die Ausbildung als Industriemechaniker bei einem Anlagenbauer, zu dessen Ausbildungsmeister der Heimleiter freundschaftliche Beziehungen unterhält, sowie eine weitere in einer Bäckerei. Wozu sollte man dem Jugendlichen raten?
Fragen zur Verantwortung
·