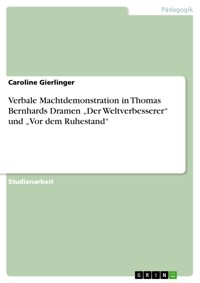
Verbale Machtdemonstration in Thomas Bernhards Dramen „Der Weltverbesserer“ und „Vor dem Ruhestand“ E-Book
Caroline Gierlinger
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich Didaktik für das Fach Deutsch - Pädagogik, Sprachwissenschaft, Note: 1,0, Universität Wien (Germanistik), Veranstaltung: Ps Poesie und Sprache, Sprache: Deutsch, Abstract: Bernhard spielt in vielen seiner Dramen mit Machtverhältnissen zwischen Figuren und der Großteil der Machtausübung funktioniert dabei über Sprache und Schweigen. Zu Beginn der Arbeit wird eine literaturwissenschaftliche Definition von Macht erarbeitet, um diese dann auf die beiden Dramen anwenden zu können. Gewählt wurden diese Dramen, da es sich in beiden um ähnliche Figuren- und Beziehungskonstellationen handelt und jedes eine Herr-Knechtdialektik aufweist. In beiden Stücken herrscht eine Asymmetrie des Kommunikationsgefüges, denn es gibt jeweils eine schweigende Figur, die jedoch ebenso Macht auf die anderen Figuren ausübt, wie die Sprechenden. Beide Dramen werden auf Machtausübung durch Sprache und Schweigen untersucht. Dabei soll herausgearbeitet werden mit welchen sprachlichen Mitteln Bernhard vorgeht und welche rhetorischen Figuren er einsetzt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt bei www.grin.com hochladen und weltweit publizieren.
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Zur Definition von Macht
3. Machtrhetorik und die Macht des Schweigens bei Thomas Bernhard
4. Verbale und nonverbale Machtdemonstration in Bernhards Dramen
4.1. Der Weltverbesserer (1978)
4.2. Vor dem Ruhestand. Eine Komödie von deutscher Seele (1979)
5. Muster der verbalen Machtausübung
6. Conclusio
7. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Die vorliegende Arbeit setzt sich mit der Machtausübung und Machtdemonstration durch rhetorische Mittel in Thomas Bernhards Dramen Der Weltverbesserer[1] und Vor dem Ruhestand[2] auseinander.
Bernhard spielt in vielen seiner Dramen mit Machtverhältnissen zwischen Figuren und der Großteil der Machtausübung funktioniert dabei über Sprache und Schweigen.
Zu Beginn der Arbeit wird eine literaturwissenschaftliche Definition von Macht erarbeitet, um diese dann auf die beiden Dramen anwenden zu können.
Gewählt wurden diese Dramen, da es sich in beiden um ähnliche Figuren- und Beziehungskonstellationen handelt und jedes eine Herr-Knechtdialektik aufweist.
In beiden Stücken herrscht eine Asymmetrie des Kommunikationsgefüges, denn es gibt jeweils eine schweigende Figur, die jedoch ebenso Macht auf die anderen Figuren ausübt, wie die Sprechenden.
Beide Dramen werden auf Machtausübung durch Sprache und Schweigen untersucht. Dabei soll herausgearbeitet werden mit welchen sprachlichen Mitteln Bernhard vorgeht und welche rhetorischen Figuren er einsetzt.
2. Zur Definition von Macht
Um unter dem Aspekt der rhetorischen Machtausübung an Bernhards Dramentexte herangehen zu können, ist eine kurze Definition von Macht erforderlich.
Niklas Luhmann beschreibt Macht als ein soziales Phänomen, das ungreifbar und doch allgegenwärtig zu sein scheint: „Die Macht der Macht scheint im Wesentlichen auf dem Umstand zu beruhen, daß man nicht genau weiß, um was es sich eigentlich handelt.“[3]
Max Weber definiert Macht als jede Chance „innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben, gleichviel worauf diese Chance besteht“[4] durchzusetzen. Weber plädiert für den präziseren Begriff der Herrschaft, den er als Chance definiert „für einen Befehl bestimmten Inhalts bei angebbaren Personen gehorsam zu finden“[5]. Herrschaft setzt also immer eine konkrete Ordnung voraus, in der die betreffenden Akteure, ob Herrschende oder Beherrschte, lokalisiert werden können. Diese Ordnung bündelt die Macht und sie wird manifest. Macht bezeichnet aber keine an sich bestehende Realität, die dieser Ordnung eingeschrieben ist, sondern existiert immer nur in seiner Ausübung:[6]
Macht beschreibt also das Handeln von Menschen, und zwar in der wechselseitigen Bezugnahme aufeinander, und ist dadurch gekennzeichnet, dass sie unterschiedlichste Handlungsweisen zwischen Individuen oder Gruppen ins Spiel bringt.[7]
Kommunikation ist ein wesentlicher Indikator für Macht. Kommunikation impliziert zielgerichtetes Handeln und zugleich erzeugt dieses bereits Macht, indem das Informationsfeld und das Wissen des Kommunikationspartners verändert werden.[8]
Macht gehört also zu den wesentlichen, tiefenstrukturellen Komponenten von Rhetorik[9] und gleichzeitig fußt Macht umgekehrt zu einem großen Teil auf Rhetorik.
Welche kommunikativen Strategien und rhetorische Mittel Bernhard aufbietet, um seine Figuren Macht demonstrieren zu lassen, gilt es im Folgenden zu analysieren.
3. Machtrhetorik und die Macht des Schweigens bei Thomas Bernhard
Im Zentrum der Überlegungen zu Thomas Bernhards Machtrhetorik, stehen jene rhetorischen Praktiken, deren sich die Figuren bedienen um im Kampf um Macht und Ohnmacht als Sieger hervorzugehen. Bernhards Protagonisten monologisieren meist in einer Suada über das Leben vor sich hin und lassen die anderen Figuren kaum zu Wort kommen. Die Rede der Figuren scheint „kein Innehalten zu kennen, in der permanenten Wiederholung zieht sie ihre perpetuierenden Kreise“[10].
Uneingeschränkte Äußerungsmöglichkeiten sind sowohl ein Ausdruck von Dominanz und Herrschaft, als auch ein Sinnbild für das Ausüben von Macht über andere Figuren.[11]
Durch ihr unermüdliches Artikulieren setzen sie permanent Sprechakte und bauen sich so eine Welt zusammen, in der allein sie schalten und walten können. Die Sprache ist gleichsam ihre Welt, in der sie über all jene Macht ausüben können, die als Teil dieser Welt ihrem Sprachduktus ausgeliefert sind.[12]
Doch Bernhard stellt der wie manisch, pausenlos sprechenden Figur immer eine zweite, schweigende Figur gegenüber, die der Gewalt der Rede, jene der Sprachlosigkeit entgegensetzt.[13] Da die Charaktere ohne Unterlass sprechen, wird unausgesprochen deutlich wovon die Rede ablenkt. Durch ihre übersteigerte Präsenz an Worten verwirklicht sie geradezu ihre widerhallende Negation: Schweigen.
Das Schweigen jedoch ist ebenfalls eine effektive Art der Machtausübung. Durch den Nichtkommentar zum Gesagten gewinnt die Figur an Erhabenheit. Die schweigenden Figuren Thomas Bernhards sind immer die Überlegenen, die Wissenden und zugleich die Ungeliebten. Sehr deutlich ist dies bei der Figur der Clara in Vor dem Ruhestand zu sehen.Durch ihr Schweigen lässt Clara ihre Verachtung ihren Geschwistern und deren Machenschaften und politischer Einstellung gegenüber erkennen. Sie gibt ihre Gedanken über den Himmlerphanatismus ihrer Geschwister nicht explizit preis, durch ihr verachtendes Schweigen wird ihre Haltung jedoch eindeutig. Die Vorwürfe, die Vera und Rudolf Clara machen, werden entkräftet und verlieren durch ihr Schweigen ihre Wirkung.
Das bewusste Schweigen der Figur gewinnt an Signifikanz und stellt scheinbar klare Machtverhältnisse in Frage:[14]
VERA zu Clara
Du bist schuld | mit deinem Schweigen | du mit deinem ewigen Schweigen (VDR, 133)





























