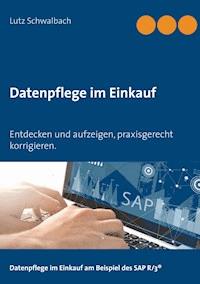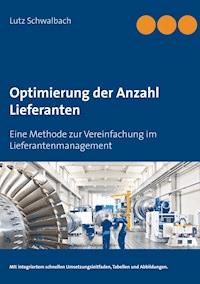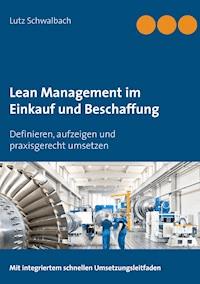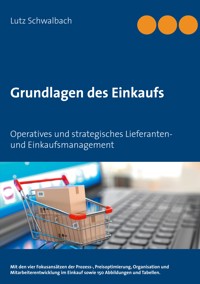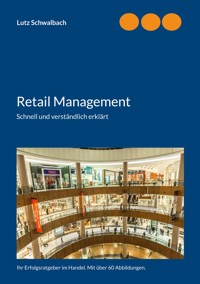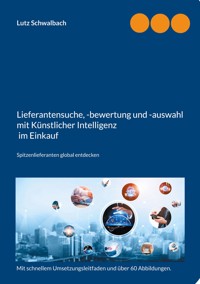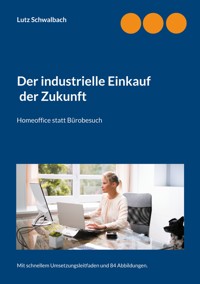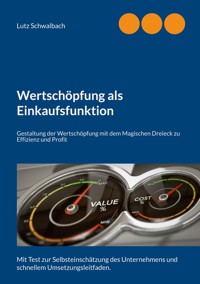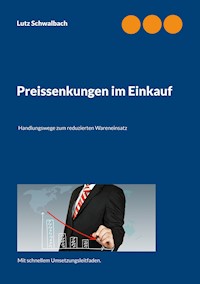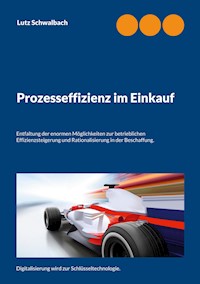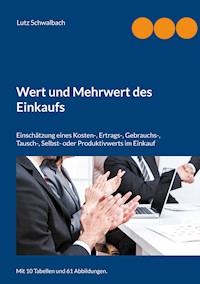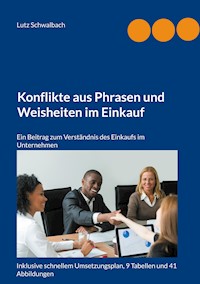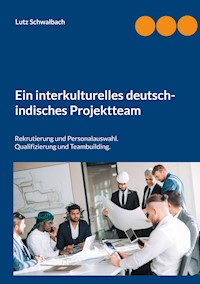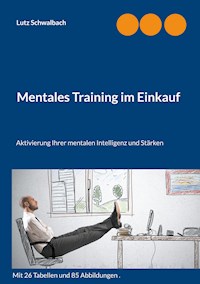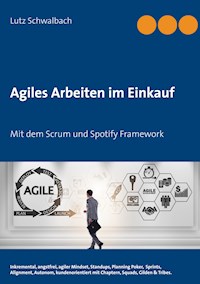Verbessern der Lieferzuverlässigkeit als Lean Management und Six Sigma Projekt E-Book
Lutz Schwalbach
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Konfrontiert mit dem Thema Lieferzuverlässigkeit überraschte es mich, wie viel Bedarf es in Unternehmen gibt nach einem systematischen Leitfaden zur Analyse der Zusammenhänge, deren Erläuterung und notwendigen Lösungsansätze. Mit Lean Management und Six Sigma ist eine solche Methodik gegeben. Der Aufbau des Buches ist in zwei Abschnitte unterteilt. In der bewusst kurz gefassten Einleitung in Abschnitt eins wird Lean Management und Six Sigma auf 44 Seiten vorgestellt. Im zweiten Abschnitt, dem Hauptteil dieses Buches, wird ein vollständiges Lean Management und Six Sigma Projekt zur Lieferzuverlässigkeit praxisorientiert und nachvollziehbar auf 120 Folien aufgezeigt. Das Beispielprojekt leitet den Anwender und Praktiker strukturiert zum Ziel und versetzt den Leser in der Lage, schematisch und inhaltlich ein eigenes Lean Six Sigma Projekt (durchaus mit an-derem Thema) durchzuführen. Die Erfolgsbausteine des Lean Sic Sigma, wie die DMAIC Vorgehensweise, die Toolbox und die Rollenverteilung sowie deren Anwendung werden anschaulich aufgezeigt. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg auf Ihrem neuen erfolgsversprechenden Weg zu optimaler Lieferzuverlässigkeit und der Anwendung des Lean Managements und Six Sigma Methode.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 85
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zur Person
Dipl. Ing., Dipl. Wirtsch. Ing. (FH), MBA Lutz Schwalbach.
Mit 25 Jahren Berufserfahrung als Führungskraft mit profit & lost Verantwortung deckt er ganzheitlich die materialwirtschaftlichen Belange eines Unternehmens von der Beschaffung, Arbeitsvorbereitung, Produktion bis zur Sortimentspflege ab.
Profunde Erfahrung im Lean Management, Six Sigma (black belt), Supply Chain Manager DLA, REFA, QMB, im interkulturellen Arbeiten und dem Projektmanagement.
Geprägt aus den unterschiedlichsten Stationen seines Arbeitslebens als Abteilungsleiter, Senior Berater und Projektmanager formuliert er für sich die Arbeitsthese
„Früher lag das Geld im Einkauf, heute im Prozess“ denn„Sie steuern den Prozess (und nicht der Prozess Sie)“.
Aktuell arbeitete er für den Weltmarktführer in der Umformtechnik, davor in national und international geprägten mittelständischen Unternehmen der Branchen Elektrotechnik, Baustoff, Handel und der Industrie.
Besuchen Sie mich auf URL http://www.xing.com/de
Was ist Lean Six Sigma
Die DMAIC Vorgehensweise
Die Toolbox
Lean Management und S5
Praxisorientiertes Kopier- und Beispielprojekt
Mit 120 Kopier- und Beispielfolien und 14 Abbildungen
Veröffentlichungen
Liefertreue und Lieferzuverlässigkeit, BoD Verlag, 2015.
Bestands- und Vorratssenkung, BoD Verlag, 2. Auflage, 2012.
Auswahl, Auslistung und Eliminierung von Artikeln, BoD Verlag, 2010.
Ein interkulturelles deutsch-indisches Projektteam, BoD Verlag, 2006.
„Bester Beweis einer guten Erziehung ist die Pünktlichkeit“(Gotthold Ephraim Lessing)
Inhaltsverzeichnis
1 Die Einführung
2 Die Aufgabenstellung
2.1 Die Problemstellung und Ziele
2.2 Die Vorgehensweise
2.3 Die Basis- und Quelldaten
2.4 Die Abgrenzung
3 Die Begriffsklärung
3.1 Die Lieferzuverlässigkeit
3.2 Die Lieferpünktlichkeit
3.3 Die Zielkonflikte und Erfolgsfaktoren
3.4 Die Voraussetzungen
3.5 Die Grenzen der Anwendung
4 Die Lean Six Sigma Methodik
4.1 Die Tools
4.2 Die DMAIC Vorgehensweise
4.3 Die Rollenverteilung
4.4 Das Lean Management
4.5 Das Projektmanagement
5 Das Lean Management und Six Sigma Beispielprojekt:
5.1 Die Define Phase
5.2 Die Measure Phase
5.3 Die Analyse Phase
5.4 Die Improve Phase
5.5 Die Control Phase
6 Die Zusammenfassung
7 Verzeichnisse
7.1 Literaturverzeichnis
7.2 Abbildungsverzeichnis
1 Die Einführung
„Alle guten Dinge sind Drei“ pflegte meine Großmutter immer zu sagen. Ob Sie wusste, dass dieser Sinnspruch einer germanischen Gerichtsversammlung zugehörig war, bezweifle ich. Der Sinnspruch gründet in der Bedeutung der Zahl Drei im germanischen mittelalterlichen Rechtswesen.
Es wurde drei Mal im Jahr Gericht gehalten, drei Mal musste der Beklagte geladen werden, bevor man Ihn trotz Abwesenheit verurteilen durfte.
Das hier vorgestellte Thema besteht ebenfalls aus drei einfachen Worten: Lean Six Sigma (LSS).
Abbildung 1: Drei Worte Lean Six Sigma
Die Zahl Drei ist weiterhin in vielen Sprichwörtern und Weisheiten in Deutschland tief verwurzelt. Hierzu einige Beispiele (Lueder, O.):
Drei Generationen Regel: Die erste baut es auf, die zweite erhält es und die dritte verlebt es
In der Theorie der Erkenntnis: Erkenntnis, Einsicht und Überzeugung oder auch abweichend intelligent formuliert als Einsicht, Umsicht und Voraussicht
Wissenschaftlich als These, Antithese und Synthese
Staatspolitisch mit der Einteilung der Gewalt in Legislative (gesetzgebend), Executive (ausführende) und Judikative (rechtssprechende)
Wirtschaftsraum mit den Teilnehmern Staat, Industrie und Arbeitnehmer (= Kunde)
Als Mensch aus Körper, Geist und Seele
In Redensarten (Wikipedia, 2014), wie: Ewig und drei Tage, nicht bis drei zählen und drei Kreuze schlagen
Mit Biblischen Ursprung, wie: Die drei heiligen Könige, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes oder die heilige Familie Joseph, Maria und Jesus.
Der Erfolg von Lean Six Sigma begründet sich in der Vorgehensweise, der tooolbox (Werkzeugbox) und der Einbindung der Prozessoptimierung (Lean) in die Prozesszentrierung (Six Sigma)
Meine drei persönlichen Eindrücke des Jahres 2014 in Deutschland waren: (Kimmling, 31.12.2014)
13.07. Gewinn der Fußballweltmeisterschaft,
13.03. Uli Hoeneß drei Jahre und sechs Monate Haft und
05.06. Europäische Zentralbank erhebt erstmals Strafzins.
In meinem beruflichen Wirken als Arbeitnehmer oder Berater im Tätigkeitsschwerpunkt Supply Chain Management, Prozessanalyse, strategischer und operativer Einkauf lassen sich, die an mich angetragenen Themenstellungen, interessanter Weise meist auf drei ganz einfache Schlüsselworte/ KPI´s 1 vereinfachen.
Dem Wareneinsatz aus Sicht der betrieblichen Kalkulation und dem Einkaufspreis in einer Währungseinheit
Die Durchlaufzeit, von Anbeginn bis Ende eine Aktion/Interaktion gemessen in einer Zeiteinheit
Der Vorratsbestand, gemessen in einer Währungseinheit, Anzahl Lagerplätze und Volumen mit Ort und Risikoübergang
Abbildung 2: Drei Schlüsselwörter
Hohe Bedeutung des Wareneinsatzes für das Unternehmen begründet sich auf zwei Säulen. Erstens, dass häufig vorherrschende Zuschlagskalkulation auf dem Urwert Einkaufspreis basieren, sowie zweitens, dass die alte Weisheit „das Geld wird im Einkauf gemacht2“ noch tief verwurzelt ist in der Gesellschaft, denn die Preisfindung war und ist die Aufgabe des Einkauf und die Schnittstelle zum Lieferanten (Wildemann, 1993, S. 116– 121).
Der Vorratsbestand ist mit der Durchlaufzeit verbunden. In der Bezeichnung „work in progress (WIP)3“ bewertet er die Vorräte vor Fertigstellung im Prozess der Herstellung. Multipliziert mit dessen aktuellen Wert, ergeben sich eine einfach für das Controlling zu ermittelnde Kapitalgröße, die Kapitalbindung und –kosten durch den Finanzierungzinssatz.
Die Kausalität der Zusammenhänge zeigt auf, dass, um die Durchlaufzeit zu verkürzen, es notwendig ist in einander greifende und in Reihenfolge ablaufende Herstellprozesse zu schaffen.
Je genauer die Taktungumso geringer die Durchlaufzeit und Kapitalbindung.
Im Idealfall ist die Kapitalbindung Null, wenn durch längere Zahlungsziele zum Lieferanten die Produktions- und Lieferzeiten überdeckt werden.
Die Durchlaufzeit beschreibt die gesamte Zeitspanne von Beginn einer Aktion (z.B. erste Materialentnahme/ Bereitstellung) bis zum Abschluss einer Aktion (z.B. Produktionsende) mit einem Gutstück. Sie ergibt sich aus der Summe aller Teilzeiten wie SAP Datenpflege, Rüsten, Warten, Liegen und Lagern, Reifen etc…
Interessant sind eigentlich die Verhältniszahlen. Teilt man die reinen Bearbeitungszeiten durch die gesamte Durchlaufzeit, so erhält man in der Regel eine Quote von kleiner als 5%.
Dies will sagen, dass die eigentliche Bearbeitung (= der Zeitanteil, welche der Kunden eigentlich bereit ist zu bezahlen!) minimal ist zur Durchlaufzeit. Ursachen der 95% Restzeiten begründen sich i.d.R. durch Qualität der Arbeitsplanung, unausgeglichene Kapazitäten, Eilaufträgen oder Reparaturen/ Ausschuss.
Um die Taktung, Sequenz oder Ablauffolge zu verbessern ist eine unverzichtbare Voraussetzung, die Forderung nach Lieferzuverlässigkeit und Lieferpünktlichkeit. Darauf aufbauend, sind weitere Entwicklungen und Verbesserungen erst möglich.
Nehmen wir die letztgenannten und kausalen Argumente
Bearbeitungszeit 5% und 95% Ruhezeiten
Forderung nach Lieferzuverlässigkeit und Lieferpünktlichkeit
als Verbesserungsprojekt an, so haben wir die Voraussetzungen für ein Lean Six Sigma Projekt begründet, die lauten:
2 Anmerkung: Die korrekte Aussage wäre „das Geld liegt im Prozess“, basierend auf einem Supply Chain Prozess
3 WIP bezeichnet die Materialmenge * Wert, welcher im Fortschritt der Herstellung/ Produktion im Werk befindlich ist. Er grenzt gegen die Fertigware/-lager ab.
2 Die Aufgabenstellung
Zu einer qualitativen Bewertung der unternehmerischen Leistungserstellung, bestehend aus der Lieferleistung und der Produktionsleistung, werden herangezogen:
Wertschöpfung (%)
Warenbestände (WIP)
Durchlaufzeiten (DLZ)
Lieferzuverlässigkeit (Soll/Ist)
Zu der Auseinandersetzung mit der Wertschöpfung mit dem Verkauf, Herstellkosten und der Preisbildung gibt es ausreichend Literatur, sodass hier auf weitere Ausführungen der Politik der Gegenleistungen verzichtet wird.
Der Warenbestand richtet sich nach dem Vorratsbestand, den Bewertungsrichtlinien und der Dauer der Lagerung. Auch zu diesem Thema gibt es ausreichend Literatur und Techniken, sodass auf weitere Ausführungen der Bewertung des Warenbestandes (WIP work in process) verzichtet wird.
Kommen wir zu dem eigentlichen Inhalt und der Aufgabenstellung des Lean Six Sigma Beispielprojekts:
Die Streuung der Lieferzuverlässigkeit bedingt
zu lange Durchlaufzeiten und
zu hohen Vorratsbestand (WIP)
Genauso wie sie sich privat um 20.00 h in Nicos Café4 verabreden und Ihr Partner sich um Minuten verspätet, reagiert ein Wirtschaftsunternehmen zur Pünktlichkeit und Lieferzuverlässigkeit. Die üblichen Reaktionen wären:
Verärgerung
Vertrauensverlust
Sicherheitsdenken
Im Wortlaut: „Der kommt immer zu spät, so unzuverlässig wie der ist und am besten kommst Du erst 30 Min später, vielleicht ist er dann schon da!“.
Dieselbe Beziehung und Konflikte entstehen in einem Industrieunternehmen ebenfalls, nur doppelt in zwei Beziehungen.
In der externen Sicht: Lieferant und Kunde (Einkauf)
In der internen Sicht: Einkauf an Bedarfsträger (Produktion)
Der Einkauf hat den verärgerten Kunden (Produktion), welcher Ihn mit Folgekosten, Auftragschaos, Mehrarbeit, Terminverzug und Umplanung konfrontiert, sowie seinen Lieferanten, der Ihn mit Ausreden aller Art versorgt.
Kunden-Zufriedenheit erlangen beide nur, wenn die Lieferung störungsfrei in der beiderseitigen verabredeten und bestätigten Form erfolgt. Duplex Kommunikation ist geboten und wirkt mildernd.
Lieferzuverlässigkeit und –pünktlichkeit sind die Mutter der Sequenz.
Abbildung 3: Lieferpünktlichkeit, die Mutter der Sequenz
Frei nach Vera F. Birkenbihl5 „hat ein Nein genauso viel Information, wie ein ja“. Somit ist die Kommunikation (oder bewusste Nicht-Mitteilung) „es wird pünktlich zugestellt“ ebenso wertvoll, wie die Mitteilung „die Lieferung wird verspäten um 4 Stunden“. Gegenmaßnahmen sind frühzeitig möglich.
Diskutiert wurde das Thema Lieferzuverlässigkeit ebenfalls auf dem am 08. Nov. 2005 stattgefundenen Forum „Handelslogistik“ in Köln (o.V., Vorräte auf dem Prüfstand, 11.10.2005.). „Von den Handelslogistikern und ihren Dienstleistern wird erwartet, dass sie Out-of-Stock-Situationen auf jeden Fall vermeiden. Allerdings nicht für den Preis von üppigen Sicherheitsbeständen.
Im Gegenteil: Entlang der gesamten Lieferkette sollen Vorräte abgebaut werden. Haupthindernis ist nach wie vor die lückenhafte informatorische Verkettung zwischen Konsumgüterindustrie, Logistikdienstleistern und Handel. Dies liegt weniger daran, dass entsprechende Systeme nicht zu haben sind. Viele Unternehmen scheuen allerdings davor zurück, Verkaufs- oder Planungsdaten an ihre Partner weiterzugeben. Gemeinsame Initiativen werden durch Streitigkeiten darüber belastet, wie die Einsparungen aufzuteilen sind.“
Lieferzuverlässigkeit und Lieferpünktlichkeit zu messen, zu verbessern und dauerhaft zu erhalten ist Inhalt dieses Buches und die Motivation für den Autor, an einem Buch „Lieferzuverlässigkeit und Lieferpünktlichkeit“ zu arbeiten.
2.1 Die Problemstellung und Ziele
Wir alle kennen das Phänomen einer Warteschlange. Gerät ein System, beispielsweise der Produktionsplan (stellvertretend für einen Produktionsablauf) außer Takt, so gerät alles aus den gewohnten Regeln und Bahnen. Wir sagen „es gerät aus den Fugen“. Vom „Peitschenschlag Effekt“ aus dem Supply Chain Management wissen wir, dass eine geringe Veränderung in die Nachfolgesysteme eine vielfach höhere Auswirkung (Welle) schlägt, als im Ursystem.
Die Störungen des Ursystems haben einerseits unmittelbare Auswirkungen auf die Folgesysteme, sowie auf das bereitstellende/ eingeplante Ursystem. Die Vernetzung, Lieferkette oder Auftragsfolge fordert ihren Tribut und Aktionismus6 in bester Absicht.
„Loben Sie nicht die Feuerwehr, sondern sorgenSie für Brandschutz und Brandmelder“.