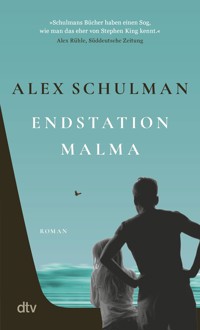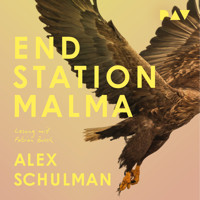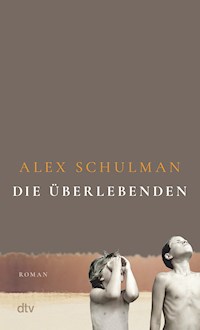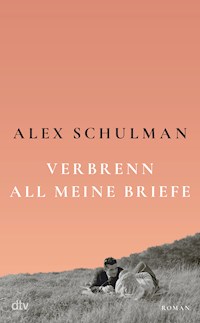
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Intensiv und mitreißend.« Mirjam Marits, Die Presse Drei Menschen. Zwei Generationen. Ein Geheimnis. Woher kommt diese tiefe Wut, die Alex in sich trägt? Auf der Suche nach Antworten stößt er auf die Geschichte seiner Großmutter, die zeigt, wie sich Leidenschaft und Eifersucht über Jahrzehnte und Generationen hinweg in eine Familie graben können. Sommer 1932: Die 24-jährige Karin verliebt sich in den jungen Schriftsteller Olof. Aber es gibt ein Problem: Karin ist mit Sven verheiratet, einem stürmischen, hochrangigen Schriftsteller mit einer grausamen Ader. Wird sie es wagen, ihren Mann verlassen und ein anderes Leben mit ihrer neu entdeckten Liebe beginnen? 68 Jahre später fragt sich Karins Enkel Alex, Autor und dreifacher Vater, warum er eine solche Wut in sich trägt; eine Wut, die seinen Kindern Angst macht und eine Kluft zwischen ihm und seiner Frau schafft. Er stößt auf die Geschichte zweier unglücklich Liebender, deren Wogen bis zu ihm reichen. »Sein Buch ist kein Krimi und könnte doch aufregender nicht sein.« Christine Westermann, Stern »Ein wahnsinnig klug gebauter, faszinierender, erschütternder Roman.« Frank Dietschreit, rbb Kultur Ebenfalls von Alex Schulman bei dtv erschienen sind: ›Die Überlebenden‹ ›Endstation Malma‹
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Alex Schulman
Verbrenn all meine Briefe
Roman Aus dem Schwedischen von Hanna Granz
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Für Karin
Prolog
»Ich weiß nicht, wie oft ich das noch ertragen kann.«
Es ist der Satz, der alles verändern wird. Er fällt eines Abends, nach einem Streit in der Küche, ich mache Essen, und wir vergreifen uns beide im Ton. Wir sagen so schreckliche Dinge zueinander, und ich fürchte, dass wir es nie wiedergutmachen können. Die Gemeinheiten eskalieren, und am Ende verliere ich die Fassung und werfe die Bratpfanne an die Wand. Es wird still, Hühnerleber überall auf dem Boden. Ich bereue es sofort und strecke die Hand nach Amanda aus. Sie zuckt zusammen und schaut mich an, und es lässt sich nicht anders deuten: Da ist Angst in ihren Augen.
Ich spüre die Gefahr sofort. Versuche, die Konsequenzen meines Ausbruchs zu überblicken. Ich weiß, dass ich wieder einen Schritt in die falsche Richtung gegangen bin, und jetzt wird es eng. Wenn ich nichts unternehme, wird sie mich verlassen.
Diese Einsicht folgt auf eine Reihe von Erkenntnissen, eine unangenehmer als die andere. Angefangen hat es ein paar Monate zuvor, als ich Weinen aus dem Zimmer meiner Tochter hörte. Ich öffnete vorsichtig die Tür, um nachzusehen, was los war. Da saß sie auf dem Boden, mit dem Rücken zu mir, und rieb über einen Fleck auf dem Teppich. Um sie herum lag Toilettenpapier in kleinen, schmutzfarbenen Haufen – sie musste schon eine Weile zugange sein. Der Fleck dehnte sich unter ihr aus, und ich erkannte die dunkelrosa Farbe wieder, es war der Slime, den ich ihr etwas früher am Tag gekauft hatte. Ich sah ihr dabei zu, wie sie hysterisch wischte.
»Oh, was ist denn da passiert?«, fragte ich, und sie erstarrte und blickte zu mir auf. Haare, Rotz und Tränen und dahinter zwei Augen.
»Entschuldigung, Papa«, sagte sie.
Sie blickte auf ihre Knie.
»Das war nicht extra.«
Ich ging zu ihr, hob sie hoch und setzte mich mit ihr aufs Bett.
»Macht doch nichts«, sagte ich.
Ich spürte ihr Herz, wie es klopfte.
»Entschuldigung, Papa«, sagte sie noch einmal, und ich befreite ihr Gesicht, strich ihr das nasse Haar hinter die Ohren und trocknete ihr die Wangen mit meinem Ärmel. Ganz kurz trafen sich unsere Blicke, dann schaute sie wieder weg, und es ließ sich nicht anders deuten. Ich sah direkt in ihre Angst.
Ich spürte ein verwirrtes Unbehagen. Warum hat meine Tochter Angst vor mir?
Später am selben Abend, nachdem die Kinder eingeschlafen waren, erzählte ich Amanda davon und fragte: »Warum hat meine Tochter Angst vor mir?« Sie antwortete, dass sie vor ein paar Tagen ihr Zimmer aufgeräumt hätte. Unter dem Bett hätte sie an die zehn Frühstücksbrote gefunden. Frances hatte sie von der Küche nach oben geschmuggelt und versteckt, um sie nicht essen zu müssen. Amanda hatte ihr gesagt, dass man belegte Brote nicht einfach verstecken dürfe. Frances wurde seltsam panisch und fing an zu weinen, und Amanda tröstete sie und sagte, sie brauche nicht traurig zu sein.
»Bitte«, hatte Frances da gesagt, »sag es nicht Papa.«
Ich verstand es nicht. Wann war das so geworden? Ich hatte das Verhalten der Kinder mir gegenüber immer als eine Art Respekt gedeutet. Ich fand, das war etwas Gutes – die Kinder hörten auf mich, und so sollte es ja auch sein. Aber das hier war etwas anderes. Und vor allem gab es mir ein Rätsel auf.
Was an mir machte ihnen Angst?
Mir war klar, dass ich noch nie ein lockerer Typ gewesen bin. Ich wusste, dass ich voller Konflikte steckte und vielleicht auch missmutig, manchmal extrem angespannt war wie eine Violinsaite, vor allem, wenn ich mit Menschen zu tun hatte, mit denen ich mich nicht wohlfühlte. Und mir war klar, dass immer eine unterschwellige Gereiztheit in mir schlummerte, die unnötig schnell entflammte. Bis zur Katastrophe war es oft nur ein kurzer Weg, und ich reagierte heftig und unmittelbar auf kleine Misserfolge, laute Geräusche, Stress, Missverständnisse. Ich mochte diese Seite an mir nicht, hatte aber immer geglaubt, dass ich selbst am meisten darunter litt; es fühlte sich an, als verschwände ich in einer Dunkelheit – während es draußen noch hell ist. Eine unangenehme Möglichkeit tat sich auf: Ich trug eine Wut in mir, die nicht nur mich, sondern auch meine Familie vergiftete.
Ich begann, auf mein Verhalten und auf das meiner Kinder zu achten. Und ganz allmählich begriff ich: Es waren viele kleine Zeichen.
Ich versuche, meine Tochter anzurufen, die nicht drangeht, und nach einer Weile meldet sie sich zurück, außer Atem, und das Erste, was sie sagt, ist: »Entschuldigung, Papa! Entschuldigung, dass ich nicht drangegangen bin.«
Warum sagt sie das?
Wir sind im Vergnügungspark Gröna Lund, und die Kinder wollen Nyckelpiga, eine Berg-und-Tal-Bahn, fahren. Auf einer Anzeigentafel steht, dass die Wartezeit dreißig Minuten beträgt. Ich murmele: »Ach, du Scheiße«, und wir stellen uns hinten an, aber meine Tochter hat gemerkt, dass ich mich ärgere und zupft mich am Ärmel.
»Wir brauchen nicht hiermit zu fahren, Papa. Wir können was anderes machen.« Sie zieht mich zu den Elefanten hinüber. »Komm, Papa!« Damit ich nicht zu warten brauche.
Warum tut sie das?
An einem der ersten Frühlingstage gehen wir in den Humlegården-Park. Die Kinder verschwinden und kehren nach einer Weile mit einem Strauß Leberblümchen zurück, die sie von einem Hügel gepflückt haben, wo die Blumen gerade anfangen zu blühen. Stolz überreichen sie mir den Strauß, ich reagiere instinktiv. »Was habt ihr gemacht?«, sage ich. Sie halten inne, und ihr Lächeln erlischt. »Ihr hättet die Blumen stehen lassen sollen, damit alle was davon haben.« Plötzlich wissen sie nicht, wohin mit ihren Sträußen. Sie legen sie ins Gras. Wir gehen weiter zu den Schaukeln. Eines der Mädchen blickt verstohlen zu mir auf.
Warum sieht sie so erschrocken aus?
Kleine Zeichen, in Blicken und Gesten. Wie meine Kinder ständig die Situation analysierten und überlegten, wie ich wohl reagieren könnte. Sie reagierten nicht auf die Welt, sondern auf meine Reaktion auf die Welt. Das war so unangenehm vertraut. Was ich sie tun sah, wie sie sich zu meiner Wut verhielten – darin erkannte ich mich als Kind.
Meine Mutter fährt mit den Händen unter mein T-Shirt, um mir den Rücken zu kratzen. Ihre rissigen Nägel tun mir weh, sie kratzt zu stark, deshalb weiche ich zurück, gehe zur Seite. Sie sagt: »Dann halt nicht«, und dreht sich zum Fernseher. Ich begreife sofort, dass das gefährliche Folgen haben könnte, also mache ich wieder einen Schritt auf sie zu, stelle ihr meinen Rücken zur Verfügung. Sie tut, als würde sie es nicht bemerken, starrt stur auf den Bildschirm. »Mama«, sage ich. »Du kannst mich kratzen.« Sie antwortet nicht, und ich gehe, bin aber fortan auf der Hut. Ich weiß jetzt, dass etwas dabei ist, kaputtzugehen.
In meiner Kindheit entwickelte ich eine Superkraft: Ich konnte Konflikte weit vor allen anderen vorhersehen. Ich bildete einen Radar aus für Wut, und den habe ich mit ins Leben genommen. Erst jetzt begreife ich, dass dieser Radar für alle außer für mich selbst funktioniert. Ich war blind für mein eigenes Verhalten.
Amanda hatte mich schon früher darauf aufmerksam gemacht, aber immer nur vor anderen und immer anekdotisch. »Du kannst schon sehr wütend werden.« Unterhaltsame Geschichten über einen missmutigen Charakter. Zum Beispiel über meine Reaktion auf das Essen in der Entbindungsstation am Tag nach der Geburt unserer Tochter. »Kann es denn so schwer sein, hier etwas Vernünftiges zu essen zu bekommen?«, hatte ich eine Hebamme angefahren.
Aber es gibt Situationen, über die wir im Nachhinein nicht reden. Mein Ausfall gegenüber Amanda, im Auto, auf einem heißen Parkplatz irgendwann mitten im Sommer. Ich sah die erschrockenen Gesichter der Kinder im Rückspiegel. Ein andermal in einem Lebensmittelgeschäft. Ich erinnere mich nicht an Einzelheiten, irgendetwas Belangloses. Ich warf ein Produkt in den Einkaufswagen und ging nach Hause.
Wir reden nicht darüber.
Aber unterschwellig eskaliert es immer weiter.
Der Streit in der Küche zeigt, wie ernst es tatsächlich ist.
Später in der Nacht sitzen wir in zwei Decken gehüllt auf dem Balkon und rauchen. Amanda sagt, sie weiß nicht mehr weiter. Es muss etwas geschehen. »Ich weiß nicht, wie oft ich das noch ertragen kann.« Es ist so klar, so unausweichlich. Als würde im Stillen etwas vor sich gehen, ein Countdown zur Katastrophe. Ich sage nichts, dort auf dem Balkon, aber in mir tobt die Angst.
Das kleine Herz meiner Tochter, das so heftig durch die Bluse klopft. Die ängstlichen Blicke meiner Familienmitglieder, die jede meiner Bewegungen verfolgen. Amandas Hoffnungslosigkeit auf dem Balkon. Sie sind der Grund, weshalb ich hier gelandet bin. Sie haben mir deutlich gemacht, dass ich etwas tun muss, bevor alles um mich herum zerbricht und verschwindet.
Ich trage eine Wut in mir, und dagegen muss ich etwas unternehmen.
Kapitel 1
Es sieht aus wie immer.
Zwei Sessel, und über dem einen hängt eine Wanduhr – darunter soll der Patient sitzen, damit der Therapeut oder die Therapeutin diskret einen Blick auf die Uhr werfen kann, ohne dass es verletzend wirkt. Ein Tisch mit einer Wasserkaraffe und Taschentücher, für diejenigen, die weinen müssen. Kunst an den Wänden, die wahrscheinlich genau deshalb ausgesucht wurde, weil sie absolut gar nichts aussagt. Ich setze mich und werde verlegen, als sie fragt, ob ich schon mal eine Therapie gemacht habe. Ich bin acht Jahre in Therapie gewesen. Es ist natürlich keine Schande, dennoch ist es mir unangenehm, und ich will es nicht zugeben. Was sagt es über einen Menschen aus, wenn er so lange in Therapie gegangen ist? Es muss seltsam erscheinen, wenn man Woche für Woche, jahraus, jahrein, auf einen Sessel zurückkehrt, um ungestört über sich selbst reden zu können.
Ich sage ihr, dass es nicht das erste Mal sei, dafür aber das erste Mal, dass ich das machen will, was ihr Fachgebiet ist: eine Familienaufstellung. Ich sage ihr, dass mir die Idee, dass alle Individuen einer Familie einander beeinflussen, logisch erscheint. Dass man, indem man die Verbindungen der Familienmitglieder untereinander aufzeichnet, ein Bild davon bekommen kann, wie alles zusammenhängt, und sich selbst als Summe all derer erkennt, die in der Familie vor einem waren.
Sie zieht ein Flipchart heran und fordert mich auf, von meiner Familie zu erzählen. Da sind ich und meine beiden Brüder und unsere verstorbenen Eltern. Das ist die Basis, von hier weisen die Strahlen zu den verschiedenen Familienmitgliedern. Wir gehen sie sorgfältig durch, eine Person nach der anderen. Wir reden über Familiengeheimnisse, Trauer, Scheidungen und Todesfälle und machen uns Notizen am Rand. Es löst etwas in einem aus, so viele Leben konzentriert und zusammengefasst auf einer so kleinen Fläche zu sehen. Lebensgeschichten werden auf ein paar Zeilen reduziert. Ein Onkel trank zu viel und starb jung. Eine Tante verlor ihre beiden Söhne, als diese in einer Kiesgrube spielten. Einer bekam Krebs. Ein anderer nahm sich das Leben.
Die Therapeutin fordert mich auf, die Verbindung der Familienmitglieder zueinander zu verdeutlichen. Wenn die Beziehung zwischen zwei Personen gut ist, soll ich einen geraden Strich zwischen ihnen ziehen. Wenn es Konflikte gibt, eine Zickzacklinie. Als ich fertig bin, fragt sie, ob ich ein Muster erkenne, in dem, was ich da aufgezeichnet habe. Ich trete ein paar Schritte zurück. Verblüfft betrachte ich das Durcheinander von Namen, Jahreszahlen und Strichen. Ich habe es noch nie so klar gesehen, es ist beinahe, als hätte man mich einem Zaubertrick ausgesetzt, den ich nicht erklären kann.
»Oh Gott«, sage ich.
»Erzählen Sie mir, was Sie sehen«, sagt sie.
Ich trete wieder an das Flipchart. Ich führe den Stift zu meinem Namen. Sehe die gerade Linie zwischen mir und meinem Vater und die gezackte Linie zwischen mir und meiner Mutter. Dann schaue ich mir die ganze Familie an.
»Auf der Seite meines Vaters gibt es nur gerade Linien«, sage ich. »Von meinem Vater, seinen Kindern, seinen Geschwistern und seinen Eltern aus. Alles ist harmonisch.«
Ich führe den Stift auf die Seite meiner Mutter und ihrer Familie.
»Aber hier …«
Ich blicke auf ein Schlachtfeld, auf ein Durcheinander aus gezackten Linien. Überall sind Markierungen von Streit, Trennungen und Auseinandersetzungen. Niemand wurde verschont.
»Hier herrscht Chaos.«
Meine Mutter war die Jüngste von vier Geschwistern, sie hatte zwei Brüder und eine Schwester. Ich versuche mich zu erinnern, aber ich glaube, ich habe nie alle vier zusammen gesehen. Sie hassten einander in wechselnden Konstellationen, Konflikte zogen sich über Jahrzehnte hin. In meiner Kindheit waren diese Wendungen für mich natürlich unbegreiflich.
Morgens früh an einem Weihnachtsfeiertag, Anfang der Achtzigerjahre. Wir sind bei meinem Onkel mütterlicherseits zu Besuch, um mit seiner Familie zu feiern. Mama weckt uns. »Kommt, Kinder, wir fahren«, flüstert sie. Wir raffen schlaftrunken unsere Sachen zusammen, schleichen uns durchs schlafende Haus und begeben uns zum Auto. Wir fahren los, ohne Tschüss zu sagen. Niemand erklärt uns, warum, aber wir hören das Flüstern vorne im Auto. »That’s it – mit denen wollen wir nichts mehr zu tun haben.«
Immer war irgendetwas Unverzeihliches geschehen, das man nie vergessen würde. Und so brach der Kontakt für ein paar Jahre ab, aber dann kehrte sich etwas um, und plötzlich sollten wir zusammen Urlaub machen. Cousins und Cousinen wurden zusammengesteckt, Fremde, die miteinander spielen sollten und wieder auseinandergerissen wurden, sobald der Streit neu entflammte. Abgesagte Mittsommerfeiern, Essen, die stets in wütendem Geschrei endeten und damit, dass Stühle zurückgestoßen wurden und jemand wütend im Auto davonrauschte. Ich erinnere mich an einen Brief auf dem Schreibtisch meiner Mutter, unterschrieben von ihr, adressiert an einen ihrer Brüder. Gierig las ich ihn, es kam mir vor wie die Spur zu einem großen Geheimnis. Etwas, das er getan hatte, war »unverzeihlich«, und bis er seine Fehler nicht einsah, hatte sie keinerlei Interesse, ihn zu treffen. Ich erinnere mich noch an die letzte Zeile: »Jeglicher Kontakt wird hiermit abgebrochen.« Das war so unheimlich, endgültig.
Einmal rief die Schwester meiner Mutter bei uns an, ich war am Telefon. Sie wollte meine Mutter sprechen.
»Nein, danke!«, rief diese aus der Küche.
»Aber Mama …«, sagte ich.
»Kein Interesse!«
Einer meiner Onkel hasste nicht die Familie – er stand mit der ganzen Welt überkreuz. Einmal fuhren er und ich zusammen mit dem Bus von Filipstad nach Stockholm. Die Angestellte der Busgesellschaft ging herum und nahm alle Namen auf, und als er an der Reihe war, fauchte er gehässig: »Wozu wollt ihr das wissen?« Die Frau erklärte, dass sie alle Passagiere registrieren müsse.
»Dann heiße ich Johan Johansson«, erwiderte er und schaute aus dem Fenster. Als sie weg war, flüsterte er mir ins Ohr:
»Sie haben Spione überall.«
»Wer?«
»Die Gesandten von Satan.«
Nachdem ich zu Hause meiner Mutter davon erzählt hatte, beschloss sie, dass wir nichts mehr mit ihm zu tun haben wollten – er war schließlich offenkundig verrückt.
Noch einmal: »Jeglicher Kontakt wird hiermit abgebrochen.« All die Konflikte, die zwischen den Familienmitgliedern tobten, wurden im Lauf der Jahre zu etwas Vertrautem, und ich stellte ganz allmählich fest, dass ich Geschmack daran fand.
Als Jugendlicher machte ich einen Sommer lang mit einem Kumpel Interrail durch Europa. »Ruft meinen Bruder an, wenn ihr in Griechenland seid«, sagte meine Mutter. »Er kümmert sich um euch. Ihr könnt bei ihm übernachten.«
Er traf sich mit uns in einer Bar des kleinen Dorfes, in dem er lebte. Als wir fragten, ob wir bei ihm übernachten könnten, reagierte er überrascht. Er hatte an dem Abend Besuch, es passte ihm nicht so richtig. Wir verabschiedeten uns, und vom Hafen aus rief ich meine Mutter an und erzählte ihr alles, und ich hörte die verhaltene Wut, als sie sich nach Einzelheiten erkundigte.
»Ihr durftet also nicht einmal auf dem Grundstück zelten?«
»Nein.«
»Er hat euch kein Geld für den Bus gegeben?«
»Nein.«
Ich verspürte eine seltsame Zufriedenheit darüber, dass es jetzt wieder losging.
Ich wurde selbst zu einem Spieler, beobachtete ihr Verhalten und verteilte die Informationen so, dass sie maximalen Schaden anrichteten.
Mein kleinerer Bruder und ich waren bei meiner Tante zu Besuch. Sie hatten ein Klavier, und er spielte darauf das einzige Lied, das er konnte: »Kalle Johansson, Kalle Johansson, Kalle Johan-Johan-Johansson«, sang er laut und vergnügt, und irgendwann hatte unsere Tante genug und rief: »Schluss jetzt mit dem Geklimper!« Ich schlich mich in eines der Schlafzimmer und rief zu Hause an. Ich beförderte die heiße Information weiter.
Tags darauf wurden wir nach Hause geschickt. Und wieder ging es los. Ein paar Jahre später starb die Tante. Meine Mutter hatte die Qual der Wahl – sollten wir zur Beerdigung fahren oder nicht? Es endete damit, dass wir hingingen. Und so war es wohl: Nur Todesfälle konnten die Konflikte in dieser Familie beenden.
Ich schaute mir die Übersicht an und all die Verwüstungen auf der Seite meiner Mutter. Die Wut, die sich weitervererbt hatte. Wie sehr hatte sie mir eigentlich geschadet? Ich habe bisher nicht viel darüber nachgedacht, aber ich erinnere mich, wie eine Cousine sich vor ein paar Jahren vorsichtig per E-Mail bei uns meldete. Sie schlug vor, dass sich alle Cousins und Cousinen doch mal zum Essen treffen könnten. Sie fragte, ob wir Interesse hätten, es könnte doch schön sein, nach all den Jahren miteinander zu reden. »Nur weil unsere Eltern sich gestritten haben, brauchen wir es ja nicht zu tun.«
Wir trafen uns. Tastende, wohlwollende Gespräche. Wir tranken Wein und erkundigten uns, was jeder so machte. Aber es schwang etwas Trauriges mit: Da saßen wir, zerzaust und verwirrt durch vierzig Jahre andauernder Konflikte zwischen unseren Eltern. Wir wussten nicht, wie wir uns verhalten sollten. Als hätte man uns wieder zusammengesteckt. Als befänden sich unsere Eltern nebenan, und bald würden harte Worte durch die Wände dringen, jemand würde eine Tür zuknallen und mit dem Auto davonbrausen. Wir redeten und tranken, waren aber die ganze Zeit darauf gefasst, unterbrochen und auseinandergerissen zu werden.
Kapitel 2
1988
Es ist 1988 und hat gerade angefangen zu schneien. Ich sitze in einem Bus, der für die Strecke von Stockholm nach Filipstad die maximal mögliche Zeit braucht. Umwege so lang, dass sie schon fast interessant werden. Seltsame Halte an der E18, bei denen wir uns die Beine vertreten und dann auf unseren Plätzen darauf warten, dass es endlich weitergeht. Immer wieder steigt jemand Neues ein, der Busfahrer verstaut das Gepäck, dabei die Zigarette im Mundwinkel, dann fahren wir weiter. Eine junge Angestellte der Busgesellschaft kümmert sich besonders um mich, sie achtet darauf, dass ich nach jedem Halt auch wieder einsteige. Sie sitzt ganz vorn neben dem Fahrer. Ab und zu wechseln die beiden ein paar Worte, ansonsten ist es still. Sie sieht so traurig aus, wenn sie mit leerem Blick auf die Straße starrt.
Ich kenne diese Strecke auswendig, so oft bin ich sie schon gefahren. Selbst bei Dunkelheit weiß ich genau, wo wir uns gerade befinden, die Landstraßen werden schmaler, je näher wir der Endhaltestelle kommen, und schließlich hält der Bus am Busbahnhof Filipstad. Ich entdecke meine Oma sofort, sie steht mit einem Regenschirm am Unterstand, um sich vor dem Schnee zu schützen. Wir umarmen uns, ich bohre meine Nase in ihren Pelzmantel, der nach einem Parfüm riecht, das nur sie trägt. Sie greift nach meinem Koffer, aber ich sage, dass ich das schon schaffe. Auf dem Nachhauseweg kaufen wir im Lebensmittelladen ein, Oma lässt sich viel Zeit. Mama hätte sich darüber aufgeregt, aber ich höre Oma gern zu, wie sie teils mit mir, teils mit sich selbst redet, während wir zwischen den Regalen entlanggehen. »Du bist ja jetzt bald ein Jugendlicher – was essen Jugendliche denn gern?« Und dann zu sich selbst, murmelnd, als wäre ich nicht mehr im selben Raum: »Ob er wohl Fleisch isst?« Oma kauft Kartoffeln, Hackfleisch, Sahne und Erbsen. Sie sagt, plötzlich leicht verärgert, dass es doch komisch sei, dass sie angefangen hätten, »junge Erbsen« auf die Packung zu schreiben, einfach »Erbsen« würde doch reichen, oder?
»Sagst du junge Erbsen oder Erbsen?«
»Erbsen.«
»Ja, genau, so ist es ja auch richtig.«
Einmal im Monat komme ich für ein Wochenende, um sie und meinen Großvater zu besuchen. Ich freue mich immer darauf, während der Wochen in Stockholm sehne ich mich nach diesem Ort. Es ist hier ein bisschen wie in einer gehobenen Pension. Gemangelte Bettwäsche im Gästezimmer. Und auf den Nachttisch hat Oma eine Flasche Mineralwasser gestellt und Schokolade danebengelegt. Am meisten mag ich die Abende nach den Nachrichten, wenn Großvater schlafen gegangen ist. Dann sitzen Oma und ich im Dunkeln am Tisch. Wir lösen Kreuzworträtsel, und manchmal bittet sie mich, zum Lexikon zu gehen, um ein Wort nachzuschlagen, bei dem sie sich nicht sicher ist. Sie macht sich eine Tasse Tee, und wenn sie die Süßstofftabletten hineinrührt, kichert sie vor sich hin und sagt: »Jetzt kann ich bestimmt überhaupt nicht mehr schlafen.«
Wir kommen an dem großen Haus am Rand von Filipstad an, und Oma stellt die Einkaufstüten auf der Spüle ab. Ich setze mich an den Küchentisch, um ihr Gesellschaft zu leisten. Ich will Oma gerade fragen, wo Großvater ist, als ich das Klopfen von oben höre. Fünf Schläge, immer fünf, die durchs Haus dröhnen. Das ist Großvater, der mit voller Kraft seinen Spazierstock gegen den Heizkörper in seinem Schlafzimmer donnert. Es ist seine Art, mit Oma zu kommunizieren: Er will, dass sie kommt. Oma erstarrt kurz, ihre Augen weiten sich, dann legt sie schnell ein Paket Butter auf die Spüle und eilt die Treppe hinauf. Nach einer Weile kehrt sie zurück und packt weiter ihre Einkäufe aus.
»Was wollte er?«
»Er wollte nur wissen, ob du angekommen bist.«
»Kommt er runter?«
»Ja, er muss sich nur noch anziehen.«
Noch einmal dröhnt es durchs ganze Haus, fünfmal hintereinander, dann ein paar Sekunden Stille, dann erneut fünf Schläge. Es ist kaum zu glauben, was für ein Getöse ein Spazierstock machen kann, der gegen einen Heizkörper kracht. Oma verschwindet. Ich bleibe sitzen und fahre mit der Hand über das Wachstuch. Ich höre die Wanduhr schlagen, im Radio auf der Fensterbank läuft der Sender P1. Wieder klopft es, und Oma ruft, schon auf der Treppe: »Ich komme!«
Ich gehe aus der Küche, durch die kalte Eingangshalle. Vorsichtig drücke ich die Klinke zu Großvaters Arbeitszimmer herunter, die mit einem Knall aufspringt. Ich schaue zum riesigen Schreibtisch in der Mitte des Raums. Etwas zieht mich immer in dieses Zimmer. Ich möchte meinem Großvater nah sein. Ich kenne die Regeln hier drinnen. Man darf sich hier aufhalten, aber wenn Großvater am Schreibtisch sitzt und arbeitet, muss man leise sein. Man darf nur etwas sagen, wenn er etwas fragt. Und man darf unter keinen Umständen eines der Papiere auf seinem Schreibtisch anfassen. Ich erinnere mich an ein Mal, als ich sieben oder acht war und mit der ganzen Familie für ein Wochenende zu Besuch. Ich hatte mich mit einem meiner Brüder gestritten und war weinend ins Arbeitszimmer gerannt. Ich wusste nicht, dass mein Großvater dort arbeitete, ich erkannte den Ernst der Lage sofort, aber ich konnte nicht aufhören zu weinen. Ich stand wie angewurzelt da. Großvater sah mich an, ging zur Tür und rief durchs ganze Haus: »Kann mal jemand dieses Geheule abstellen!« Mama kam angelaufen und zog mich schnell weg.
Ich gehe zum Schreibtisch. Bücherstapel zu beiden Seiten der Schreibmaschine. Herausgerissene Zeitungsartikel mit Unterstreichungen und Randnotizen, von einer unsicheren Hand mit Tinte geschrieben. Aufgeschlagene Bücher liegen überall verstreut, als wäre eben noch jemand hier gewesen und nur kurz rausgegangen, um etwas zu erledigen. Ich setze mich auf Großvaters Schreibtischstuhl, Spannung und Nervosität durchfahren mich, denn ich weiß nicht, ob ich hier sitzen darf. Neben dem Schreibtisch steht ein Sideboard, auf dem große Notizbücher in gelbem Leder aufeinandergestapelt liegen. Ich nehme eines und öffne es auf gut Glück. Die Schrift ist winzig und kaum lesbar, da sind Wörter auf jeder noch so kleinen freien Fläche, auch an den Rändern, wo mit einem anderen Stift und zu anderen Zeiten etwas hinzugefügt wurde. Ich blättere in dem Buch, jede Seite ist auf dieselbe Weise gefüllt, es wimmelt von Wörtern, als wäre derjenige, der sie geschrieben hat, irgendwie krank, es erinnert mich an Notizbücher, wie man sie in Filmen über Serienmörder sieht, die im Keller sitzen und Informationen über die Frauen sammeln, die sie ermorden wollen.
Ich ziehe ein paar weitere Notizbücher heran. Alle sind zum Bersten mit Wörtern gefüllt. Ich betrachte die Stapel auf dem Sideboard. Es müssen an die hundert Bücher sein, vielleicht sogar noch mehr. Was ist das für ein gigantisches Projekt, an dem mein Großvater arbeitet?
Ich gehe wieder in die große Eingangshalle mit dem kalten weißen Marmorboden, dem runden Perserteppich und der riesigen weißen Holztreppe. Eine schwarze Metallschiene führt an einer Wand die Treppe hinauf. Sie ist vor ein paar Jahren angebracht worden, daran befestigt ist ein Stuhl, der als Aufzug zwischen den Stockwerken dient. Ebenerdig kann mein Großvater sich relativ ungehindert bewegen, aber Treppen kann er seit einer Weile nicht mehr steigen. Der Stuhl hat ihm diese Freiheit zurückgegeben. Großvater nennt ihn »den elektrischen Stuhl«, und das finden wir Enkel lustig.
Hier steht eine Kommode, in der man manchmal Süßigkeiten findet. Ich durchsuche sie jedes Mal gründlich. Ich finde eine Schachtel Gelee-Bonbons und stecke mir schnell eines in den Mund. Neben der Tür steht ein Schrank aus dunklem Holz, mit Türen so dick wie Bootsplanken. Man braucht Kraft, um sie aufzustemmen. Ein Anflug von Panik bei der Erinnerung, wie ich einmal Münzen aus den Mänteln im Schrank gestohlen hatte, und Mama mich erwischte.
Plötzlich ist Poltern zu hören. Ich drehe mich zur Treppe um. Der elektrische Stuhl hat sich in Bewegung gesetzt. Zunächst sehe ich ihn noch nicht, höre lediglich das ohrenbetäubende Lärmen der Mechanik, doch dann zeigt er sich am oberen Ende der Treppe, erst sehe ich nur die Füße, dann schwebt der Rest heran. Es geht unglaublich langsam, aber da kommt er, auf seinem Thron aus Metall und Gummi. Auf halber Strecke entdeckt er mich.
Großvater winkt mit seinem Stock und lächelt.
Kapitel 3
In meinem Kellerverschlag liegt eine tote Ratte. Sie liegt da schon lange auf einer Matratze, umgeben von kleinen braunschwarzen Punkten – ihrem eigenen Kot. Vor einem halben Jahr wollte ich etwas aus dem Keller holen, sah sie, kehrte um und beschloss, nie wieder zurückzukommen. Ich ertrage den Gedanken nicht, sie entsorgen zu müssen, dazu gezwungen zu sein, sie irgendwie anzufassen.
Jemand von der Hausverwaltung rief an und verlangte, ich solle das Problem lösen, die Ratte hätte angefangen zu stinken, aber ich brachte es einfach nicht über mich. Hielt mich fern, betrachtete den Kellerraum als verlorenes Gelände.
Jetzt aber bin ich zurück in der feuchten Dunkelheit, um den nächsten Schritt meines Projekts in Angriff zu nehmen, das den Großteil meiner wachen Stunden einnimmt. Ich will die Dunkelheit in mir verstehen, die dabei ist, mein Verhältnis zu meiner Familie zu zerstören. Ich bin auf der Jagd nach meiner Wut. Und ich glaube, dass mein Großvater Sven Stolpe der Schlüssel dazu ist. Mit ihm hat alles angefangen.
Im Kellerraum lagern sechs Kartons mit seinen gesammelten Werken. An die hundert Bücher, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich bin mir nicht sicher, denn ich habe die Kartons nie geöffnet. Vor fünf Jahren klingelte es an der Tür, und da stand eine Dame und erzählte, ihr Mann sei vor Kurzem gestorben. Jetzt wollte sie in eine kleinere Wohnung umziehen, und die Bücher des Toten hatten keinen Platz mehr. Der Mann hatte sich viele Jahre seines Lebens mit Sven Stolpe beschäftigt, und irgendwann war seine Sammlung komplett gewesen. Die Dame fand, es wäre schade, wenn die Bücher weggeworfen würden, und fragte, ob ich sie nicht haben wolle. Ich sei schließlich Stolpes Enkel. Also nahm ich sie an und verstaute sie im Keller, und seither stehen sie dort.
Die Ratte liegt immer noch auf der Matratze, und sie ist seltsam erhalten geblieben, ihre Augen glänzen in dem trüben Neonlicht. Aber sie ist verdorrt, und ich vermute, dass nur noch ihre Haut mit Pelz übrig ist; wenn man darauf tritt, verschwindet sie in einer Staubwolke. Ich trage einen Karton nach dem anderen nach oben, stelle sie in meinem Arbeitszimmer auf den Boden und packe anschließend die Bücher auf meinen Schreibtisch, einen Stapel nach dem anderen, und am Ende erinnert er in seinem geordneten Chaos an den Schreibtisch meines Großvaters in Filipstad. Ich lese die Titel, lasse den Finger über die Buchrücken gleiten.
Sven Stolpe hat mich immer fasziniert, sein Schatten fiel über meine Kindheit, er war nie richtig anwesend, aber immer da, eine bedrohliche Gestalt im Nebenzimmer. Dieses Schweigen in Erwartung, dass er kommen würde, Enkelkinder, die sich aufstellen mussten, um sich zu verbeugen und ihm die Hand zu reichen, und dann wurden sie weggeschickt, damit sie ihn nicht störten. Ich hatte Angst vor ihm, das hatten alle Enkel, dennoch wollte ich ihm gern nah sein. Er war ein geheimnisvolles Kraftfeld, selbstleuchtend und unergründlich.
Sven Stolpes Bücher jedoch haben mich nie interessiert, sie kamen mir vor wie Relikte aus einer anderen Zeit. Bücher über das Christentum, über historische Figuren wie Königin Christina von Schweden und Jeanne d’Arc, Studien über russische Philosophen und eine große Sammlung Romane in altertümlicher Sprache, Thesenromane über Dinge, die heute keine Rolle mehr spielen. Ich nehme eines der Bücher zur Hand. Es heißt Nikolai Berdjajew. Ich weiß nicht, wer das ist. Das Foto auf dem Umschlag zeigt einen älteren Mann mit Ziegenbart und umflortem Blick. Ich lese auf der Rückseite über seine »christlichen Renaissance-Ideen, die weder mit der alten Orthodoxie noch mit dem Marxismus vereinbar waren«. Ich muss lachen. Nichts könnte mich weniger interessieren.
Auf vielen Büchern ist Sven Stolpe selbst abgebildet. Schwarz-Weiß-Fotos, auf denen er mit strengem Blick an seinem Schreibtisch sitzt oder vor irgendeinem Bücherregal, in Nadelstreifenanzug oder Tweed-Jackett. Manchmal trägt er eine Fliege. Oder er zieht an einer Pfeife. Er sieht so unglaublich ernst aus. Er ruft aus einem anderen Jahrhundert herüber, und dort wird er wohl auch bleiben, denke ich, hinter seinem Schreibtisch im Jahr 1935, in den Jahren vor dem Krieg, und zu diesem Publikum wird er sprechen. Denn dieses liebt und achtet ihn. Den Schriftsteller, Übersetzer, Literaturwissenschaftler, Journalisten, Lehrer, Religionshistoriker, Literaturkritiker. Einen der gebildetsten Männer Schwedens, der fließend Schwedisch, Französisch, Deutsch und Italienisch konnte. Er hat die schwedische Literaturkritik auf den Kopf gestellt, und er hat einen Roman geschrieben, dessen Titel für viele Jahrzehnte zu einem geflügelten Wort wurde: Im Wartezimmer des Todes.
Mir wird plötzlich klar, dass ich nicht ein einziges seiner Bücher gelesen habe. Was ich über meinen Großvater weiß, bezieht sich hauptsächlich auf mündliche Anekdoten. Svens Stolpes Wesen ist ein einziger Mythos.
Die Krankheit, die immer Teil seines Lebens war. 1927 bekam er Tuberkulose und lag anschließend siebzig Jahre auf dem Totenbett. Er selbst sagte, er habe keine Schmerzen, obwohl er die meisten Rippen und anderthalb Lungen eingebüßt hatte. Dagegen, so äußerte er spät in seinem Leben, habe er ab 1938 ständig Fieber gehabt. Immer war er frisch operiert, immer war ihm ein weiteres Stück seiner Lunge entfernt worden. Dazu die Versicherung des Arztes, nun habe er wirklich nicht mehr lange zu leben. Briefe an seine Feinde, etwa an Rezensenten, die eine negative Kritik geschrieben hatten, oder auch andere, begann er oft mit dem Satz: »Entschuldigen Sie, dass ich immer noch lebe.«
All diese Feinde. Manche waren es vorübergehend, andere dauerhaft – etwa zwanzig wurden zu lebenslangen Antagonisten. Diese bezeichnete Stolpe als seine »festangestellten Feinde«. Für die Familie war es manchmal schwierig, auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Manche Autoren durften zu Hause plötzlich nicht mehr erwähnt werden, und tat man es doch, sagte er »vielen Dank auch« und verließ das Zimmer.
Er war tiefgläubiger Christ, und in der Mitte seines Lebens konvertierte er zum Katholizismus. Dass er gläubig war, fiel mir als Kind nicht auf, außer bei den Mahlzeiten, wenn wir mit gesenkten Köpfen dastanden und zuhörten, wie er das Tischgebet sprach. Manchmal, wenn er betete, klang es, als würde er singen.