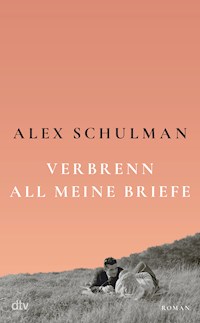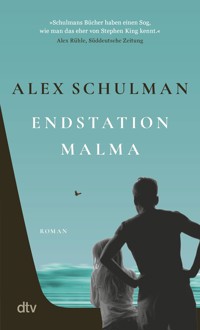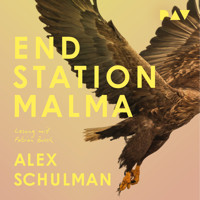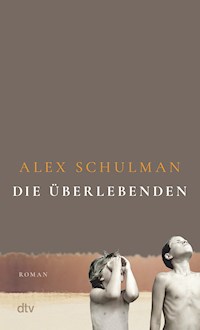16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Wann hat jemals ein Romancier derart offen und wahrhaftig über die Liebe eines Mannes zu seiner Mutter geschrieben? Das ergreifendste Buch dieses Jahres, wenn nicht gar seit sehr langer Zeit!« Björn Hayer, Cicero Es ist Sommer. Alex Schulman kommt ins Landhaus seiner Mutter, um sie davon abzuhalten, sich zu Tode zu trinken. Und sie zu überzeugen, sich in eine Entzugsklinik einzuweisen. Und er fragt sich: Was genau ist passiert, wie ist aus der schillernden, liebevollen Mutter dieses geisterhafte Wrack geworden? In Erinnerungen erzählt Alex Schulman vom Auseinanderbrechen der Beziehung zwischen Mutter und Sohn und vom verzweifelten Versuch des erwachsenen Kindes, ihr die Hand zu reichen, als die Kluft zwischen ihnen am größten ist. Eine ergreifende Erzählung von der Liebe eines Kindes zu seiner Mutter, über Co-Abhängigkeit, Sehnsucht und das Bedürfnis nach Versöhnung. Die autobiographische Vorlage zum SPIEGEL-Bestseller ›Die Überlebenden‹.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
»Wie kann ich nach alldem noch ihr Sohn sein, und sie meine Mutter?«
Es ist Sommer. Alex Schulman kommt ins Landhaus seiner Mutter, um sie davon abzuhalten, sich zu Tode zu trinken. Und sie zu überzeugen, sich in eine Entzugsklinik einzuweisen. Und er fragt sich: Was genau ist passiert, wie ist aus der schillernden, liebevollen Mutter dieses geisterhafte Wrack geworden? In Erinnerungen erzählt Alex Schulman vom Auseinanderbrechen der Beziehung zwischen Mutter und Sohn und vom verzweifelten Versuch des erwachsenen Kindes, ihr die Hand zu reichen, als die Kluft zwischen ihnen am größten ist.
Eine ergreifende Erzählung von der Liebe eines Kindes zu seiner Mutter, über Co-Abhängigkeit, Sehnsucht und das Bedürfnis nach Versöhnung.
Alex Schulman
Vergiss mich
Aus dem Schwedischen von Hanna Granz
Für meine Brüder Calle und Niklas, im Bewusstsein, dass dies meine Geschichte ist und dass Eure eine andere sein kann.
18. Juli 2013
Ich fahre einen Weg entlang, den ich sehr gut kenne. Es ist ein staubiger Kiesweg, Steine spritzen unter den Reifen zu beiden Seiten weg, und eine Kurve folgt auf die nächste. Mich aber kann er nicht überraschen. Ich kenne ihn in- und auswendig. Jetzt geht es den letzten Anstieg hinauf, der in der Abendsonne im Juli oft so schwierig zu fahren ist, an dem mein Vater immer langsamer wurde und konzentriert die Sonnenblende an der Windschutzscheibe herunterklappte. In wenigen Hundert Metern bin ich am Sommerhaus der Familie in Värmland angekommen.
Neben mir sitzt mein Bruder Calle. Viele Male haben wir schon so gesessen, in einem überhitzten Auto, das durch den Sommer pflügt, das letzte Stück zum Ferienhaus. Diese Strecke ist so sehr mit einem Erster-Ferientag-Gefühl verbunden. Wir sind acht, neun Jahre alt, wir sitzen auf der Rückbank und trinken warme Limonade, Chipskrümel zwischen den Beinen. Der Wind in Papas Haar, wenn Mama zum Rauchen die Scheibe herunterkurbelt. Die Sonne zwischen den Birken. Einer von uns quengelt: »Wann sind wir endlich da?«, und von vorne antwortet einer: »Jetzt ist es wirklich nicht mehr weit, den letzten Berg noch, dann sind wir da.«
Diesmal aber ist es anders. Zu Beginn der Fahrt haben wir laut Musik gehört, Calle trommelte mit der Hand auf seinen Knien. Doch je näher wir dem Sommerhaus kommen, desto weniger reden wir miteinander. Wir überqueren den kleinen Bach, auf dem wir als Kinder Kanu gefahren sind. Es ist ganz still jetzt im Auto.
Wir wissen nicht viel. Wir wissen nur, dass Mama sich im Schlafzimmer eingesperrt hat und dort schon seit Tagen trinkt. Wir wissen, dass vor drei Tagen etwas vorgefallen ist. Unser Bruder Niklas war mit seinen Kindern dort. Mama war betrunken. Sie hat sich unmöglich benommen und sich im Schlafzimmer eingesperrt, und da hat Niklas die Kinder eingesammelt und ist wieder abgefahren. Seitdem können wir Mama nicht erreichen. Wir müssen sie nach Hause holen. Uns beiden ist klar, dass sie sich sonst zu Tode trinken wird.
Wir fahren den holprigen Weg zum Sommerhaus hinunter, und ich bin mir bewusst, dass dies das Finale ist. Es ist das Ende einer Reise, die vor über dreißig Jahren begonnen und sich durch meine Kindheit und Jugend und mein Erwachsenenleben fortgesetzt hat, durch all die Jahre, die vergangen sind, und durch alles, was passiert ist. Es ist wie einem Theaterstück beizuwohnen, einer Tragödie, die letzte Szene, das Ende von allem. Und es ist so vollkommen unfassbar, dass es hier geschehen wird, an diesem Ort.
Dies ist Ground Zero. Alles in meinem Leben geht von diesem Sommerhaus aus.
Jetzt taucht es zwischen den Birken auf. Die rote Farbe ist im Lauf der Jahre von der Sonne verbrannt und nachgedunkelt. Unten liegt der See still da. Es ist der schönste Tag des Sommers.
Wir fahren bis ans Haus heran und steigen aus. Es ist so still, dass es sich wie Druck auf den Ohren anfühlt. Von unserer Mutter keine Spur.
»Wahrscheinlich ist sie oben im Schlafzimmer«, sage ich.
»Ja«, sagt Calle. »Vielleicht gehe ich erst mal allein hoch, und du wartest hier unten.«
»Ist wahrscheinlich am besten.«
Calle betritt den Flur.
»Mama?«, ruft er die Treppe hinauf. Dann wartet er kurz, mit gesenktem Kopf. Er ruft noch einmal. Keine Antwort. Er geht hoch. Ich bleibe stehen und blicke auf den See hinaus, lausche auf die wohlbekannten Geräusche von früher. Die röhrende Wasserpumpe der Toilette. Eine Mücke, die heransurrt und verschwindet. Schwalben, die mit ihren Krallen über das Holz scharren, wenn sie in ihre Nester unter dem Dachbalken fliegen und wieder hinaus. Ich höre Calles Schritte auf der Treppe. Das leise Knallen der Schlafzimmertür, als er die Klinke herunterdrückt. Ich höre sie miteinander reden, leises Murmeln von oben. Ich verstehe kein Wort, aber ihre Stimmen klingen ruhig. Keine Wutausbrüche. Dann höre ich sie die Treppe herunterkommen. Calle tritt als Erster ins Freie, wir wechseln einen Blick. Ich kann nicht deuten, was er mir sagen will. Mama ist im Morgenmantel, das Haar steht ihr zu allen Seiten ab, sie blinzelt in die Sonne. Dann entdeckt sie mich und wendet sich ab.
»Was hat denn der hier zu suchen?«, fragt sie und geht mit unsicheren Schritten zum Sitzplatz hinüber. Sie lässt sich auf einen der Plastikstühle fallen, mit dem Rücken zu mir.
»Wir sind hier, weil wir uns Sorgen um dich machen«, erklärt Calle.
»Ach so.«
Sie zündet sich eine Zigarette an und schaut zum Ufer hinunter. Ausdruckslos. Sie wirkt vollkommen leer. Alles ist still, nichts rührt sich, der Zigarettenrauch steht über dem Tisch. Mücken hängen wie an unsichtbaren Fäden in der Luft. Keiner sagt was.
»Und du bist heute hierhergekommen?«, fragt Mama.
»Ja, aus Stockholm.«
»Schön.«
Mama lächelt sanft und streift die Asche ihrer Zigarette an der Hauswand ab. Sie wirft einen Blick auf die Zeitung, Svenska Dagbladet liegt aufgeschlagen auf dem Tisch. Dann schaut sie wieder zum See.
»Möchtest du irgendwas? Im Kühlschrank ist noch Wurst, glaube ich«, sagt Mama.
»Nein, danke«, sagt Calle. »Wir haben verzweifelt versucht, dich anzurufen.«
»Aha. Ich weiß gar nicht, wo ich mein Handy gelassen habe.«
»Was war denn eigentlich mit Niklas?«, fragt Calle.
»Wieso mit Niklas?«
»Er war doch hier und ist dann wieder gefahren, er meinte, ihr hättet euch gestritten.«
»Ach so, das. Ja, ich werde wohl mal wieder was falsch gemacht haben, wie immer.«
»Er meinte, du hättest dich den Kindern gegenüber unmöglich verhalten.«
Mama zuckt mit den Schultern. Sie lacht.
»Kann sein.«
Schweigen. Eine Mutter, die über den See blickt, zwei Söhne, die mit gesenkten Köpfen danebenstehen. Wir sind dreißig, wir sind fünf Jahre alt.
»Können wir über deine Probleme reden?«, fragt Calle.
»Nein, können wir nicht.«
»Warum nicht?«
»Ich wüsste nicht, was euch das angeht.«
»Wir machen uns Sorgen um dich.«
»Ach so. Nett von euch.«
Calle seufzt lautlos.
»Komm, Mama. Lass uns fahren.«
»Nein.« Sie schaut zum See. Sie streckt die Hand nach Calle aus. Er ergreift sie.
»Möchtest du nicht ein bisschen Wurst?«, fragt Mama. »Es ist so ein schöner Abend heute.«
Ich trete ein paar Schritte näher. Wieder wechsle ich einen Blick mit Calle. Ich setze mich ihr gegenüber. Sie drückt ihre Zigarette auf einem Teller aus. Gründlich, fast als wäre es ein Ritual. Klopft mit der glühenden Spitze darauf und drückt und dreht dann gleichzeitig, wieder und immer wieder. Ich fummle an einem der Tischtuchhalter aus Plastik. Ziehe ihn ab und stecke ihn an, wieder und immer wieder.
»Mama, du kannst nicht hierbleiben«, sage ich. »Das geht nicht. Komm, wir gehen rauf und packen deine Sachen, und dann fahren wir.«
Mama sieht auf. Zum ersten Mal treffen sich unsere Blicke.
»Mit dir rede ich nicht«, sagt sie.
Acht Monate vorher
Mama ist spät dran.
Vor einer halben Stunde hat sie mir eine SMS geschickt, dass sie im Bus säße. Sie müsste also längst da sein. Alle anderen sind schon eingetroffen, die ganze Verwandtschaft hat sich auf dem Ecksofa in unserem Wohnzimmer versammelt. Unsere Tochter Frances wird heute drei Tage alt. Um es uns einfacher zu machen, haben wir alle auf einmal eingeladen, damit sie sie kennenlernen können. Jetzt sitzen sie da und warten darauf, das Baby auf den Arm nehmen zu dürfen. Das kleine Bündel wandert von Schoß zu Schoß.
Amanda winkt mich zu sich in die Küche und sagt, sie könne nicht länger auf Mama warten, sie würde jetzt den Kaffeetisch decken. Dann packt sie den Kuchen aus, raschelt mit dem Papier. Sie legt die Zimtschnecken in eine Schüssel. Ich kann nichts sagen, aber ich mache mir Sorgen. Ständig versuche ich, alles so zu organisieren, dass Mama möglichst wenig Anlass hat, sich über irgendetwas aufzuregen. Potenziell ist das hier gefährlich: den Kaffeetisch zu decken, ehe sie da ist. Ich sehe schon vor mir, wie sie hereinkommt und auf den halb aufgegessenen Kuchen blickt. Was meine Mutter angeht, kann ich fünfzehn Schritte vorausschauen. Ich weiß, dass sie wütend werden wird, noch bevor sie selbst es weiß.
Es klingelt, und ich eile zur Tür.
Wir umarmen uns, Mama und ich. Diese Umarmung, die zwischen uns üblich geworden ist, bei der wir uns nie richtig berühren, sondern nur kurz unsere Wangenknochen aneinanderlegen. Erste Kontrolle: Ist sie betrunken? Ich stelle fest, dass sie ein Halsbonbon lutscht, und das verheißt nichts Gutes, denn so versucht sie immer, den Alkoholgeruch zu überdecken. Ich merke außerdem, dass sie schlecht geschminkt ist. Die Grundierung ist fleckig.
»Soll ich dir den Mantel abnehmen?«, frage ich.
»Ach, das schaffe ich schon.«
»Scheußliches Wetter da draußen.«
»Ja, stimmt.«
Dieser kurz angebundene Ton.
Umständlich hantiert sie mit ihrem Mantel und sucht etwas in ihrer Tasche, ein paar Sekunden lang ist es still. Dann sagt sie: »So«, und ordnet sich das Haar vor dem Flurspiegel, bevor sie weitergeht. Ich folge ihr dicht auf den Fersen. Sie betritt das Wohnzimmer, jemand ruft: »Hej, Lisette!« Mama winkt zum Gruß und setzt sich aufs Sofa.
Sie schaut nicht zu unserem Baby hinüber. Würdigt es keines Blickes.
»Möchtest du Kaffee?«, frage ich.
»Gern.«
Ich eile in die Küche. Es muss schnell gehen, denn Mama ist jetzt allein da drinnen, ich muss aufpassen, dass nichts passiert.
Mama trinkt ihren Kaffee. Das Zimmer ist ganz und gar auf Frances ausgerichtet, die gesamte Verwandtschaft hat sich versammelt, alle wollen sie einmal halten. Nur Mama schaut noch immer nicht in ihre Richtung.
Plötzlich werde ich tieftraurig. Es kommt völlig unvorbereitet und trifft mich so heftig, dass ich verstumme. Warum schaut sie nicht einmal in Frances’ Richtung? Sie tut ja so, als gäbe es sie gar nicht.
Ich verstehe es nicht.
Warum tut sie das?
Alle reden, nur Mama und ich sitzen schweigend da. Ich beobachte sie von der Seite, wie sie ihren Kaffee trinkt. Sie entdeckt das Stück Sahnetorte, das Amanda ihr hingestellt hat. Sie beugt sich vor und sticht mit dem Finger hinein. Dann leckt sie die Sahne ab. Ich reagiere instinktiv.
»Was machst du denn da?«
»Wieso?«, fragt Mama.
»Du kannst doch die Torte nicht mit den Fingern essen.«
»Fine«, sagt sie, steht auf und geht zur Tür. Raschen Schrittes, mit klappernden Absätzen über das Parkett.
Amandas Eltern und Schwestern tun so, als hätten sie nichts mitbekommen, sie streicheln weiter das Baby. Doch sie tun es jetzt schweigend, sie haben alles gesehen und gehört. Ich laufe meiner Mutter hinterher. Sie ist mit ihrem Mantel zugange.
»Bleib doch noch, Mama.«
Sie fischt eine Zigarettenschachtel aus der Tasche, entschuldigt sich, schiebt mich beiseite und geht zurück ins Wohnzimmer. Ich folge ihr. Sie tritt auf den Balkon. Ich sehe sie in der Kälte stehen und rauchen. Ausdruckslos starrt sie die Fassaden an. Ich komme mit nach draußen.
»Hast du für mich auch eine?«, frage ich.
Sie reicht mir ihre Schachtel rote Prince. Amanda hat auf dem Balkon kleine Lämpchen angezündet und Lammfelle und Decken auf den Stühlen verteilt, denn sie weiß, dass Mama immer hier raucht.
»Du brauchst doch nicht gleich wütend zu werden«, sage ich.
»Du findest also, ich bin wütend? Ich habe das Gefühl, gar nichts tun zu können, ohne dass du dich darüber aufregst.«
»Aber es ist doch klar, dass ich reagiere, wenn du mit den Fingern isst.«
»Äh«, sagt Mama.
Dann schweigen wir beide. Ich sehe, dass Mama ihr rotes Kleid anhat. Sie trägt es nur zu besonderen Anlässen, wenn sie sich hübsch machen will. Zärtlichkeit überkommt mich. Sie hat sich extra fein gemacht für diesen Besuch. Es ist ihr wichtig, heute gut auszusehen. Eine Welle von Empathie überrollt mich und gleichzeitig Schuldgefühle: Bin ich zu hart zu ihr? Vielleicht hat sie ja recht. Vielleicht rege ich mich wirklich über alles an ihr auf.
»Möchtest du eine Decke?«, frage ich.
»Gerne.«
Ich weiß nicht, wie oft wir so gestanden haben, abseits, nach irgendeinem Streit, in einem Schweigen, das an sich schon die Versöhnung war. Ich kann das sehr gut. Ich bin schlecht darin, unsere Beziehung zu reparieren, aber Situationen retten kann ich gut. Wir stehen auf dem Balkon und rauchen, niemand hört uns, alle sind drinnen beschäftigt. Es könnte der Ausgangspunkt für ein richtiges Gespräch sein. Aber wir sagen nichts. Wortlos beschließen wir, nicht mehr darüber zu reden. Wir lecken unsere Wunden, um noch ein wenig länger durchzuhalten. Wir rauchen noch eine weitere Zigarette. Wir plaudern behutsam über Nichtigkeiten. Was gestern in der Sendung På spåret passiert ist.
»Lass uns reingehen«, sage ich nach einer Weile.
»Na gut«, sagt Mama.
Wir setzen uns wieder aufs Sofa. Ich frage, ob sie noch Torte möchte, sie sagt Nein.
Ein paar Stunden später verabschieden wir uns von den letzten Gästen.
»Das ist doch ganz gut gegangen«, sage ich zu Amanda, als wir das Geschirr abräumen.
Am selben Abend breche ich in ihren Armen zusammen. Ich kann nicht aufhören zu weinen. Ich bin völlig außer Gefecht gesetzt. Ich liege im Bett und konzentriere mich auf meine Atmung. So liege ich mehrere Tage lang.
Es dauert Wochen, bis ich begreife, was mit mir los ist. Dieses Grauen. Mama auf dem Sofa, wie sie einfach wegschaut, demonstrativ nicht zu Frances blickt. Irgendetwas ist da in mir zerbrochen. Ich kenne dieses Verhalten so gut von ihr. Aber bisher war ich es immer, den sie nicht sehen wollte. Das ist meine Kindheit. Und jetzt passiert dasselbe mit Frances.
Darin liegt die Katastrophe.
Es darf nicht noch einmal passieren.
Ich sehe ein, dass ich keine Wahl habe. Ich muss das hier beenden. Nicht um Mamas willen, sondern um meinetwillen.
»Noch fünfzehn Sekunden!«
Der Hausmeister des Theaters starrt mich mit großen Augen an. Er ist schockiert, mich so zu sehen. Ich liege auf der Bühne, direkt hinter dem Vorhang. Auf der Seite, einen Arm unter den Kopf geschoben. Ich kann hier nicht liegen bleiben. Ich weiß, dass ich aufstehen muss. Der Einführungsfilm läuft bereits, ich kenne ihn auswendig; Krister Henrikssons grollende Erzählerstimme.
»Steh auf jetzt, Alex!«, zischt der Hausmeister.
In wenigen Sekunden ist der Film zu Ende, und der Vorhang öffnet sich. Aber ich weiß nicht, ob ich es schaffe, ich kann nicht atmen, es ist, als bekäme ich keine Luft mehr.
»Noch fünf Sekunden!«
Ich nehme all meine Kraft zusammen. Ich erhebe mich zunächst auf alle viere, dann stehe ich auf zittrigen Beinen da. Der Vorhang öffnet sich, die Scheinwerfer sind auf mein Gesicht gerichtet, und ganz weit vorne, in der Mitte der Bühne, steht ein Hocker. Sieben Schritte sind es bis dorthin, ich habe sie genau gezählt. Während ich vorwärtswanke, zähle ich leise mit. Sieben Schritte – dann die Belohnung: Ich brauche nicht länger auf diesen schwachen Beinen zu stehen. Als ich sitze, beruhigt sich mein Puls. Jetzt kann ich einfach dem Drehbuch folgen, und wenn ich mich auf etwas konzentrieren kann, verschwindet die Panik. Es geht mir jetzt besser, aber die Gefahr ist noch nicht gebannt. Sobald ich keine Antworten habe, sobald ich der Welt wieder Zugang gewähre, jagt mein Puls in die Höhe. Dann kommt alles wieder hoch. Das Publikum lacht, und ich stehe daneben und schnappe nach Luft. Das Lachen und der Applaus des Publikums führen zu lebensgefährlichen Stopps in meiner Darbietung, in denen die Angst mich überrollt.
Nach der Vorstellung.
Ich setze mich ins Auto. Statt auf dem Karlavägen geradeaus zu fahren, biege ich rechts in die Sturegatan ein. Ich drehe eine kleine Runde. Das Auto ist zurzeit der einzige Ort, an dem ich mich sicher fühle. Das Fahren lenkt mich ab, sodass mich die Panikattacken nicht überfallen können.
Dass dieser Moment auf dem Sofa solche Auswirkungen haben würde. Ich habe so etwas noch nie erlebt. Es kommt mir vor, als existierte ich neben meinem eigentlichen Leben her, außerhalb meiner selbst. Ständig bekomme ich diese Panikattacken, und ich kann mich nur schwer beruhigen. Ich ertrage keine lauten Geräusche. In Gesellschaft von mehr als vier Personen muss ich zwischendurch immer wieder zur Toilette, und dann stehe ich da und ringe nach Luft. Ich habe Tabletten, die ich einwerfen kann, wenn mein Herz zu sehr rast. Manchmal helfen sie, manchmal nicht. Das Einzige, was zuverlässig funktioniert, ist, in diesem Auto zu sitzen. Meistens fahre ich Richtung Uppsala aus der Stadt oder runter nach Nynäshamn. Lange Autofahrten, wenn es gerade anfängt zu dämmern.
Ich überquere den Valhallavägen und komme am Stockholmer Stadion vorbei, Richtung Värtahamnen. Ich rufe Amanda an und sage ihr, dass es später wird.
»Wie geht es dir?«, fragt sie.
»Wie immer. Vielleicht ein bisschen schlechter als sonst.«
Sie sagt, sie lege sich schon mal schlafen. »Wenn du nach Hause kommst, kannst du wieder eine Vorstellung abhaken«, sagt sie.
Sie hat eine Reihe kleiner Quadrate auf ein Blatt Papier gemalt und dieses am Kühlschrank befestigt. Jedes Feld entspricht einer Vorstellung, und wenn ich alle abgehakt habe, bin ich fertig und brauche mich dem Rampenlicht nicht mehr auszusetzen.
Ich fahre auf die Lidingö-Brücke und biege anschließend links ab, Richtung Bosön. Die Fahrbahn wird schmaler, Wälder zu beiden Seiten. Über der Landstraße dämmert es. Es ist die blaue Stunde.
Autofahrten haben etwas an sich, das mich in der Zeit zurückversetzt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Geräusche immer noch dieselben sind. Dasselbe Motorgeräusch. Dasselbe Geräusch von Reifen auf dem Asphalt, dasselbe Prasseln des Regens auf den Scheiben, dasselbe Quietschen der Scheibenwischer. Und draußen eine Landstraße oder Wald wie in Värmland rund um das Sommerhaus. Ich erinnere mich, wie wir als Familie im Konvoi in unser Sommerhaus fuhren und anschließend zurück. Mama in ihrem Volvo 960 und Papa in seinem weißen Renault. Zwei Punkte auf der Straße, die zusammengehörten.
Mama und Papa teilten uns drei Kinder immer auf die beiden Wagen auf. Wir wollten alle lieber mit Mama fahren. Heute kommt mir das vollkommen absurd vor, aber es war so: Ganz früher entschieden wir uns immer eher für sie als für ihn. Jedes Mal. In Papas Auto zu sitzen, war in gewisser Weise mit Gefahren verbunden. Er schaltete schlecht und jagte den Motor hoch, und wenn er versuchte, einen Radiosender hereinzubekommen, kam es vor, dass er die Kontrolle über den Wagen verlor und auf die andere Fahrbahn hinüberglitt. Außerdem war irgendeine Sicherung durchgebrannt, sodass es wahnsinnig schnell tickerte, wenn er den Blinker betätigte. Das schuf eine geradezu hysterische Atmosphäre, als hätten wir es permanent eilig. Was sogar stimmte. Papa hatte es immer eilig. Wenn er fuhr, lagen seine Nerven stets blank. Wenn jemand anderes ein gefährliches Überholmanöver durchführte, konnte er ausrasten, dann brüllte er aus vollem Hals: »Mann, du Arschgeige!« Oft machte ihn diese Rücksichtslosigkeit so wütend, dass er dem betreffenden Idioten hinterherjagte. Er fuhr viel zu dicht auf und blendete mehrfach auf. Dann überholte er selbst, und während des Manövers starrte er den anderen an und tippte sich an die Stirn, lange, noch über seine Schulter hinweg, ich erinnere mich genau an seine großen Augen und den Zeigefinger, mit dem er sich gegen die Stirn hämmerte.
Mama fuhr einen Automatik, in dem es nach Leder und Lippenstift roch. Sie fuhr, als wäre sie eins mit dem Wagen. Ich erinnere mich an das Geräusch, wenn sie das Auto nach einer scharfen Kurve von selbst in seine Ausgangslage zurückfinden und dabei das Lenkrad durch ihre Handflächen gleiten ließ. Ich erinnere mich an ihren geübten, immer wiederkehrenden Blick in den Rückspiegel. Sie konnte Heizungsknopf, Lüftung und Radio bedienen, ohne dabei die Straße aus den Augen zu verlieren. Sie fuhr ruhig und systematisch. Wir brauchten uns nicht anzuschnallen. Wenn Mama ein gefährliches Überholmanöver startete, hielt sie eine Hand über meinen Brustkorb, um mich im Falle eines Zusammenpralls zu schützen.
Bei Papa war das anders. Er stand ständig unter Druck, es war weit bis zum Sommerhaus, und er wollte möglichst früh dort sein. Ein kurzer Halt bei der Esso-Tankstelle in Arboga, wo Mama die Autos betanken musste, während Papa hineinlief und Kaffee und Traubenzucker kaufte, und dann ging es sofort weiter. Immer schaute er auf die Uhr, wenn wir auf die Straße zurückfuhren. »Sehr gut – nur sieben Minuten verloren.«
Mama war neugieriger als Papa. Zumindest als wir noch klein waren. Auf einer der Fahrten zum Sommerhaus durfte ich als Einziger mit ihr fahren, meine Brüder waren hinter uns in Papas Wagen. Ich war neun. Wir kamen gerade durch Karlskoga, als Mama ein Maklerschild an der Straße entdeckte. Etwas weiter weg stand ein Hof zum Verkauf.
»Wollen wir uns den mal ansehen?«, fragte sie. Es war schwierig für mich, diesen Vorschlag zu deuten. Schwierig herauszufinden, ob sie es ernst meinte oder nicht, denn ich wusste ja, was dann hinter uns los war. Es würde Chaos geben. Mama bog ab. Damals gab es noch keine Handys. Papa fand jedoch andere Möglichkeiten, seine Missbilligung kundzutun. Er blinkte wie wild, es waren Signale eines Menschen in Panik. Ich drehte mich um, sah sein entsetztes Gesicht. Mama fuhr weiter, Papa begann zu hupen, erst vorsichtig, als wäre er nur versehentlich drangekommen, und dann immer länger, ein unglückliches Hupen vom Auto hinter uns, während wir tiefer und tiefer in den Wald hineinfuhren. Wir gelangten zum Hof und hielten in der Einfahrt. Papa stieg aus und war mit wenigen Schritten bei uns. Er riss Mamas Autotür auf.
»Was machst du denn, verdammt noch mal?«
»Ich wollte mir nur mal diesen Hof anschauen.«
»Aber wozu denn, verdammte Scheiße? Das war jetzt ein Umweg von einer halben Stunde!«
»Aber Allan …«
»Es wird schon bald dunkel!« Jetzt brüllte Papa. »Ich kann im Dunkeln nicht Auto fahren.«
»Du brauchst doch nicht gleich so wütend zu werden.«
Papa verstummte. Er schaute über die Wiese zum Hof. Dann stieß er zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor: »Komm, wir fahren.«
»Können wir uns den Hof nicht wenigstens kurz ansehen?«
»Auf gar keinen Fall! Wir müssen weiter, wenn wir noch rechtzeitig ankommen wollen.«
Papa ging zu seinem Auto zurück und stieg ein. Mama starrte ausdruckslos auf das Lenkrad. Dann ließ sie den Motor an.
Ich erinnere mich, wie wir aus der Einfahrt rausmanövrierten. Ich erinnere mich an jede Sekunde. Wie die Sonne durch die Birken schien, an das Geräusch der Reifen auf dem Kies. Mir war nicht bewusst, wie sehr Papa Mama gekränkt hatte, aber ich begriff, dass etwas geschehen war.
»Er war schön, der Hof«, sagte ich.
»Ich weiß, mein Schatz.«
Ihre Hand auf dem Schalthebel. Ich sah sie eine Weile an. Dann legte ich meine Hand auf ihre.
»Ach, Süßer«, sagte Mama. Sie nahm meine Hand und winkte damit wie mit einem Wimpel.
Wir bogen auf die Autobahn ein.
»Bist du traurig?«, fragte ich.
»Nein, ist schon in Ordnung«, sagte Mama.
Ihre Augen waren blank. Sie wischte sie mit dem Ärmel ab. Wir fuhren weiter.
Papa passte sein Leben und das seiner Familie in einen minutiösen Zeitplan ein. Für alles gab es feste Zeiten. Hatte Papa beschlossen, dass um sechs das Essen auf dem Tisch zu stehen hatte, war es wichtig, dass es auch tatsächlich so kam. Wurde es fünf nach sechs, konnte es passieren, dass er in die Küche trat und vorsichtig fragte: »Und?« Für Feiertage wie Mittsommer oder Heiligabend hatte er alles genau durchgetaktet; die Notizen dazu trug er in der Brusttasche mit sich herum.
Papa arbeitete als Fernsehproduzent, und in den Studios hing alles davon ab, dass man die Zeit bis auf die Sekunde genau einhielt. Jedes Mal, wenn ich ihn zur Arbeit begleiten durfte, richtete sich alles nach einem Zeitplan, den er in Händen hielt, ein Dokument mit den genauen Uhrzeiten für die unterschiedlichen Beiträge. Das war seine Bibel.
Ich erinnere mich an Fernsehabende in meiner Kindheit. Wir guckten zusammen eine Sendung namens Showmaschine. Das Jingle ertönte, und dann kam sofort eine Musiknummer. Bereits nach einer Minute rutschte er nervös hin und her. Nach zwei Minuten brüllte er vor Wut: »Zu lang!« Mama nickte sanft und stimmte ihm zu. Dieses Bild zieht sich durch meine gesamte Kindheit: Papa sitzt mit verkniffenem Gesicht auf seinem Sessel und ruft früher oder später: »Zu lang!«
Er konnte nichts dafür, er hatte diesen eingebauten Mechanismus, dieses Gefühl, wann jemand zeitlich überzog. Und das trug er ins Familienleben hinein. Wenn wir gemeinsam etwas unternahmen, merkten wir ihm diesen Stress immer an. Wir saßen im Restaurant, wir hatten gerade aufgegessen. Wir fragten unsere Eltern, ob wir noch eine Limo bekommen könnten, und Mama sagte: »Ja, natürlich.« Papa dagegen schaute nervös auf die Uhr. Er sagte nichts, aber in ihm rief eine Stimme: »Zu lang!«
In meinen ersten Erinnerungen an Streit zwischen meinen Eltern ging es nahezu ausschließlich darum. Mama fühlte sich eingesperrt in Papas Schema, und wenn sie versuchte auszubrechen, reagierte Papa mit Wut. Von diesen Ausbruchsversuchen gab es viele.
Einige Zeit später im selben Urlaub saßen meine Mutter und ich in einem der Autos auf dem Weg zurück zum Sommerhaus. Wir waren schon fast da, hörten Musik. Nur wenige Kilometer vor der Abfahrt nach Gustavsfors gab es eine Abkürzung durch den Wald. Von der Strecke her war es kürzer, aber es dauerte länger. Papa wusste das, weil er beide Strecken mit der Stoppuhr gemessen hatte. Für den Waldweg brauchte man ein paar Minuten länger, deshalb war er für ihn keine Alternative.
Als wir die Abfahrt erreichten, warf Mama einen kurzen Blick in den Rückspiegel und bog am Schild »Gustav-Adolfs-Kirche« kurzentschlossen rechts ab. So schnell konnte mein Vater nicht reagieren. Ich drehte mich um und sah sein verzerrtes Gesicht, diese Mischung aus Wut und Verzweiflung, als er auf dem gewohnten Weg zum Sommerhaus weiterfuhr. Der Ausbruchsversuch war gelungen, zumindest für den Moment. Jetzt waren wir auf Abenteuertour, nur Mama und ich, auf einem Kiesweg, der durch die värmländischen Wälder pflügte. Wir kurbelten die Fensterscheiben herunter, und der Sommer strömte mit der Zugluft zu uns herein. Jedes Mal, wenn Mama vor uns einen Hügel entdeckte, befahl sie mir, die Augen zu schließen, und dann beschleunigte sie, sodass es in meinem Bauch kribbelte.
Wir bekamen einen Steinschlag ab, doch nichts passierte. Niemand brüllte, niemand fluchte, hielt mit quietschenden Bremsen an und sprang aus dem Auto, um den Schaden zu begutachten. Mama beugte sich lediglich vor und musterte die Windschutzscheibe, und das war’s. Es war, als könnte ihr so etwas nichts anhaben. Wir fuhren tief in den Wald hinein, die Bäume wurden höher und dichter. Es war mitten am Tag, dennoch wurde es dunkel. Die Schotterpiste wurde zu einem schmalen Weg, doch dann öffnete sich plötzlich die Landschaft, ein paar kleine Häuser standen entlang der Straße, gefolgt von ein paar größeren, und am Ende türmte sich eine mächtige Holzkirche oberhalb eines Hangs vor uns auf. Mama hielt auf dem Parkplatz davor und schaltete den Motor aus. Wir schauten uns an und kicherten. Wir spürten beide den Kitzel vermischt mit Angst, es war gestundete Zeit. Irgendwo auf der anderen Seite des Waldes war Papa, auf der Jagd nach Sekunden und Minuten. Wenn er wüsste, dass wir angehalten, dass wir die Fahrt abgebrochen hatten und einfach so Zeit verplemperten, würde er ausflippen. Wir wussten auch, wie wütend er sein würde, wenn wir irgendwann nach Hause kamen.
Mama öffnete Papas Kühltasche im Kofferraum. Darin waren Butter und Milch und andere Kühlprodukte aus Stockholm, sorgfältig verpackt zwischen vergilbten Aggregaten, damit sie den ganzen Weg bis zum Sommerhaus hielten. Mama zog einen Schokoriegel heraus.
»Jetzt zeige ich dir den schönsten Ort der Welt«, sagte sie, und wir gingen den Hang hinauf zur Kirche. Frisch gemähter Rasen, gleichmäßige Gräberreihen. Hohe Gedenksteine, als ruhten ausschließlich Würdenträger an diesem Ort. Wir warfen einen raschen Blick in die Kirche. Sie war wirklich seltsam in ihrer Imposanz – mehrere Hundert Plätze für ein Dorf mit insgesamt acht Häusern. Ganz vorn über dem Altar hing eine Jesusfigur aus Holz. Auf einer Tafel die Nummern einiger Psalmen, wahrscheinlich noch vom letzten Gottesdienst.
»Komm«, sagte Mama und wandte sich zum Gehen. »Guck dir das an.« Sie zeigte nach draußen. Wir standen an einem Grashang, der zu einem See hundert Meter weiter unten abfiel. Wir setzten uns auf die Wiese.
»Ist das nicht schön?«, fragte Mama.
»Doch«, sagte ich.
Es gab nur Mama und mich. Keiner von den anderen war dabei. Die Sonne kam heraus, es sah schön aus, als der See zwischen den Bäumen anfing zu glitzern. Es rauschte in den Baumkronen.
Ich erinnere mich an alles.