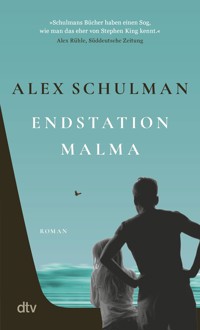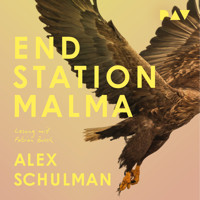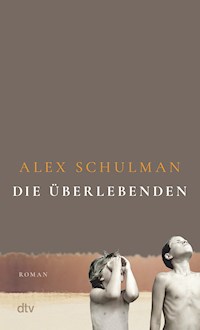
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Über Hoffnung. Über Versöhnung. Über Leben Nach zwei Jahrzehnten kehren die Brüder Benjamin, Pierre und Nils zum Ort ihrer Kindheit – ein Holzhaus am See – zurück, um die Asche ihrer Mutter zu verstreuen. Eine Reise durch die raue, unberührte Natur wie auch durch die Zeit. Im Kampf um die Liebe der Mutter, die abweisend und grob, dann wieder beinahe zärtlich war, haben die Jungen sich damals aufgerieben bis zur Erschöpfung. Heute fühlen sie sich so weit voneinander entfernt, dass es kein Aufeinanderzu mehr zu geben scheint. Und doch ist da dieser Rest Hoffnung, den Riss in der Welt zu kitten, wenn sie sich noch einmal gemeinsam in die Vergangenheit vorwagen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Alex Schulman
Die Überlebenden
Roman
Aus dem Schwedischen von Hanna Granz
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
für Calle und Niklas
TEIL 1
Das Sommerhaus
KAPITEL 1
23:59 Uhr
Ein Polizeiauto pflügt langsam durch das blaue Grün, die Traktorspur zum Hof hinunter. Da steht das Sommerhaus, einsam auf einer Landzunge, in der nie ganz schwarzen Juninacht. Es ist ein einfaches Holzhaus mit seltsamen Proportionen, etwas höher, als es sein sollte. Die Farbe an den weißen Giebeln ist abgeblättert, das rote Holz an der Südseite sonnengebleicht. Die Dachpfannen sind zusammengewachsen, ein Dach wie die Haut eines Urtiers. Windstill ist es jetzt und ein wenig kühl, die Fensterscheiben sind nach unten hin beschlagen. Ein einsamer grellgelber Lichtschein dringt aus einem der Fenster im Obergeschoss.
Da unten liegt der See, blank und still, gesäumt von Birken unmittelbar am Ufer. Und das Saunahäuschen, in dem die Jungen mit ihrem Vater an zahlreichen Sommerabenden schwitzten und von wo aus sie anschließend über scharfkantige Steine ins Wasser stolperten; sie liefen im Gänsemarsch, breiteten, wie gekreuzigt, die Arme aus. »Herrlich!«, schrie der Vater, wenn er sich hineingestürzt hatte, und der Hall sang über dem See, und dann wurde es still, wie es nur hier still sein konnte, an diesem Ort so weit weg von allem anderen, eine Stille, die Benjamin manchmal Angst machte, ihm jedoch manchmal auch das Gefühl gab, alles würde lauschen.
Ein Stück weiter das Ufer entlang steht ein Bootshaus, das Holz ist morsch geworden, und die Konstruktion neigt sich dem Wasser zu. Etwas oberhalb davon der Stall, mit Millionen Termitenlöchern in den Balken und Spuren von siebzig Jahre altem Mist auf dem Zementboden. Zwischen Stall und Haus liegt das kleine Stück Rasen, auf dem die Jungen immer Fußball spielten. Eine leichte Hanglage; wer mit dem Rücken zum See steht, spielt bergauf.
Das ist der Schauplatz, so sieht es aus, ein paar kleine Gebäude auf einer Wiese, mit dem Wald dahinter und dem Wasser davor. Ein unzugänglicher Ort, heute ebenso abgeschieden wie früher. Stand man am äußersten Ende der Landzunge und blickte sich um, war nirgends eine Spur menschlichen Lebens zu entdecken. Ganz selten einmal hörten sie Motorengeräusche vom Kiesweg auf der anderen Seite des Sees, das entfernte Brummen eines langsam fahrenden Autos. An trockenen Sommertagen konnten sie die Staubwolke sehen, die dann aus dem Wald aufstieg. Doch sie begegneten niemandem, sie waren allein an diesem Ort, den sie niemals verließen und zu dem nie jemand kam. Einmal sahen sie einen Jäger. Die Jungen spielten im Wald, und plötzlich war er einfach da. Ein grüngekleideter Mann mit weißem Haar, zwanzig Meter von ihnen entfernt, lautlos glitt er zwischen den Kiefern hindurch. Als er an ihnen vorüberging, sah er sie ausdruckslos an und legte den Zeigefinger auf die Lippen, und dann setzte er seinen Weg fort und verschwand zwischen den Bäumen. Er blieb ein Rätsel, wie ein geheimnisvoller Meteorit, der nahe herangekommen, dann aber über das Himmelsrund verschwunden war, ohne die Erde zu streifen. Die Jungen redeten später nie darüber, und manchmal fragte sich Benjamin, ob es den Jäger überhaupt gegeben hatte.
Es ist zwei Stunden nach Sonnenuntergang, das Polizeiauto kriecht langsam die Traktorspur hinunter. Der Mann am Steuer blickt besorgt über die Motorhaube, um zu sehen, was ihm auf dem Weg unter die Räder kommt, und er beugt sich vor und blickt nach oben, ohne jedoch die Spitzen der Baumkronen erkennen zu können. Die Fichten, die sich über dem Haus erheben, sind gigantisch. Schon in ihrer Kindheit waren sie riesig, aber jetzt … Dreißig, vierzig Meter ragen sie in die Höhe. Ihr Vater war immer stolz gewesen auf den fruchtbaren Boden hier, als wäre es sein Verdienst. Anfang Juni säte er Radieschen, und nur wenige Wochen später führte er die Kinder zum Gemüsegarten, um ihnen die roten Punkte zu zeigen, die sich in Reihen aus der Erde schoben. Doch auf die Fruchtbarkeit rund um das Sommerhaus war und ist kein Verlass, hier und da ist der Boden vollkommen tot. Der Apfelbaum, den der Vater ihrer Mutter zum Geburtstag geschenkt hat, steht, wo er ihn gepflanzt hat, aber er wächst nicht und er trägt keine Früchte. An manchen Stellen ist die Erde steinfrei, schwarz und schwer – an anderen liegt der Fels dicht an, unmittelbar unter der Grasnarbe. Papa, wie er den Spaten in die Erde stieß, als er einen Zaun für die Hühner errichten wollte. Mal glitt der Stahl weich und sanft durch das regenschwere Gras, mal traf er sirrend auf Stein, und Papa schrie auf, seine Hände vibrierten vom Widerstand des Fels.
Der Polizist steigt aus. Er ist groß. Mit routinierten Bewegungen regelt er die Lautstärke des Apparats an seiner Schulter herunter, der ein eigentümliches Zwitschern aussendet. Die an den Kanten abgestoßenen, mattschwarzen Gegenstände, die um seine Taille baumeln, lassen ihn irgendwie geerdet aussehen, ihr Gewicht drückt ihn nach unten, Richtung Erdkruste.
Blaulicht über den hohen Fichten.
Etwas ist mit dem Licht, den blauenden Bergen über dem See und dem Blaulicht des Polizeiautos. Man könnte es auf eine Leinwand malen.
Der Polizist geht ein paar Schritte auf das Haus zu und hält inne. Plötzlich ratlos, betrachtet er die Szene. Die drei Männer sitzen nebeneinander auf der Steintreppe vor der Haustür. Sie weinen, halten sich im Arm. Sie tragen Anzug und Krawatte. Neben ihnen im Gras steht eine Urne. Der Polizist nimmt Blickkontakt mit einem der Männer auf, der sich erhebt. Die beiden anderen bleiben sitzen, noch immer die Arme umeinander gelegt. Sie sind durchnässt und übel zugerichtet, der Mann versteht jetzt, warum sie auch einen Krankenwagen gerufen haben.
»Ich heiße Benjamin. Ich habe den Notruf abgesetzt.«
Der Polizist sucht in seinen Hosentaschen nach einem Notizblock. Er weiß nicht, dass diese Geschichte auf kein Stück Papier passen wird, dass er gerade in eine mehrere Jahrzehnte lange Erzählung einsteigt, von drei Brüdern, die einmal vor langer Zeit von hier fortgerissen wurden und jetzt gezwungen sind zurückzukehren; dass alles an diesem Ort zusammengehört, nichts steht für sich oder kann einzeln erklärt werden. Das Gewicht all dessen, was in diesem Moment passiert, ist groß, doch das meiste ist längst geschehen. Was sich hier auf der Steintreppe abspielt, das Weinen der drei Brüder, die geschwollenen Gesichter und all das Blut, ist nur der letzte Ring auf dem Wasser, der äußerste, der am weitesten vom Einschlagpunkt entfernt ist.
KAPITEL 2
Das Wettschwimmen
Jeden Abend stand Benjamin im flachen Wasser, unmittelbar unterhalb der kleinen Strandwiese, wo seine Eltern saßen. Sie folgten dem Lauf der Sonne, verschoben Tisch und Stühle um einige Meter, sobald sie sich im Schatten befanden, und so fuhren sie fort, während die Dämmerung langsam hereinbrach, bewegten sich immer weiter. Unterm Tisch saß Molly, der Hund, und wunderte sich, dass sein Dach verschwand, dann folgte er dem Gespann auf seinem Weg am Ufer entlang. Jetzt waren Benjamins Eltern an der Endstation angekommen und sahen zu, wie die Sonne über den Wipfeln am anderen Seeufer sank. Sie saßen immer nebeneinander, Schulter an Schulter, denn beide wollten aufs Wasser schauen. Die weißen Plastikstühle ins hohe Gras gebohrt, ein schiefer kleiner Holztisch, auf dem die fleckigen Biergläser in der Abendsonne glänzten. Ein Schneidebrett mit einem Zipfel ungarischer Salami, Mortadella und Radieschen. Im Gras zwischen ihnen eine Kühltasche, die den Wodka kalthielt. Jedes Mal, wenn Papa einen Schnaps kippte, sagte er »hej« und hob das Glas in Richtung Nirgendwo und trank. Er säbelte an der Wurst, sodass der Tisch wackelte, das Bier schwappte über, was Mama jedes Mal irritierte – mit einer Grimasse hob sie ihr Glas, bis er fertig war. So etwas fiel Papa gar nicht auf, Benjamin dagegen schon. Er registrierte jede Veränderung, stand immer ein klein wenig abseits, damit sie ihre Ruhe hatten, und doch nah genug, um ihren Gesprächen folgen, Stimmungen und Launen einschätzen zu können. Er hörte ihr freundliches Murmeln, Besteck auf Geschirr, das Geräusch, wenn sich einer von ihnen eine Zigarette ansteckte, ein Strom von Lauten, die darauf hindeuteten, dass zwischen ihnen alles in Ordnung war.
Mit seinem Kescher schlenderte Benjamin am Ufer entlang, spähte ins Wasser. Manchmal sah er versehentlich genau in die Spiegelung der Sonne, und dann schmerzten seine Augen, als würden sie bersten. Er balancierte über die großen Steine, suchte den Grund nach Kaulquappen ab, diesen seltsamen Tierchen, schwarz und träge, die aussahen wie schwimmende Kommas. Er zog ein paar mit dem Kescher heraus und entließ sie in die Gefangenschaft des roten Eimers. Es war ein Ritual. Mit den Eltern als Kulisse sammelte er Kaulquappen, und wenn die Sonne unterging und Mama und Papa aufstanden, um ins Haus zu gehen, kippte er die Kaulquappen in den See und wanderte mit den Eltern hangaufwärts. Und am nächsten Abend begann er wieder von vorn. Einmal vergaß er die Kaulquappen im Eimer. Als er es am Nachmittag darauf bemerkte, waren alle tot, vernichtet von der Hitze der Sonne. Die Angst, Papa könnte es bemerken. Rasch leerte er den Eimer ins Wasser, und obwohl Benjamin wusste, dass Papa oben im Haus war und sich ausruhte, war ihm, als brenne dessen Blick in seinem Nacken.
»Mama!«
Benjamin schaute zum Haus hinauf und sah, wie sein jüngerer Bruder den Hang runtergelaufen kam. Man sah ihm seine Rastlosigkeit schon von Weitem an. Das hier war kein Ort für Ungeduldige. Vor allem nicht diesen Sommer: Als sie vor einer Woche angekommen waren, hatten die Eltern beschlossen, dass es die ganzen Ferien über kein Fernsehen geben sollte. Feierlich teilten sie es den Kindern mit, und vor allem Pierre nahm es schwer, als der Vater das Kabel herauszog und den Stecker demonstrativ oben auf den Fernseher legte, wie bei einer öffentlichen Hinrichtung, bei der man die Leiche zur Abschreckung hängen lässt. Es sollte sie daran erinnern, was den Dingen blühte, die die Entscheidung der Familie bedrohten, ihren Sommer im Freien zu verbringen.
Pierre hatte seine Comics, die er sich langsam und murmelnd selbst vorlas, wenn er abends auf dem Bauch im Gras lag. Doch irgendwann verlor er die Lust, und dann lief er immer zu ihren Eltern, und Benjamin wusste, dass ihre Reaktion je nach Laune unterschiedlich ausfallen konnte; manchmal durfte man auf Mamas Schoß, und dann kraulte sie einem den Rücken. Manchmal wurde sie ärgerlich, und dann war der Tag gelaufen.
»Mir ist langweilig«, sagte Pierre.
»Geh doch mit Benjamin Kaulquappen sammeln«, schlug Mama vor.
»Nein«, sagte Pierre. Er stellte sich hinter ihren Stuhl und blinzelte in die tiefstehende Sonne.
»Was ist mit Nils, könnt ihr nicht was zusammen machen?«, fragte Mama.
»Was denn?«
Schweigen. Da saßen sie, ihre Eltern, irgendwie kraftlos und wie versunken in ihren Plastikstühlen. Schwer vom Alkohol blickten sie über den See. Es war, als überlegten sie, was sie sagen könnten, als suchten sie nach Vorschlägen, doch es fiel kein Wort.
»Hej«, murmelte Papa schließlich und kippte einen Schnaps, und dann verzog er plötzlich das Gesicht und klatschte dreimal laut in die Hände. »Also gut, alle mal herhören«, rief er. »In zwei Minuten will ich meine Jungs hier in Badehose sehen!«
Benjamin blickte auf, trat vom Wasser zurück. Ließ den Kescher ins Gras fallen.
»Na los«, rief Papa. »Kommt schon!«
Nils lag mit seinem Walkman in der Hängematte zwischen den beiden Birken oben am Haus und hörte Musik. Während Benjamin sorgfältig auf jedes Geräusch der Familie lauschte, blendete Nils alles aus. Während Benjamin sich ständig in der Nähe der Eltern aufhielt, suchte Nils Abstand zu ihnen. Er ging einfach in ein anderes Zimmer, nahm nicht teil. An manchen Abenden, wenn die Brüder im Bett lagen und nicht schlafen konnten, hörten sie ihre Eltern durch die dünnen Sperrholzwände streiten. Benjamin registrierte jedes Wort, stellte bei jedem Gespräch Schadensuntersuchungen an. Manchmal warfen sie sich unfassbare Gemeinheiten an den Kopf, sagten so schlimme Dinge, dass es sich anfühlte, als ließe es sich nie wieder reparieren. Über Stunden lag Benjamin dann wach und ging den Streit in Gedanken noch einmal durch. Nils dagegen wirkte vollkommen unbeteiligt. »Was für ein Irrenhaus«, murmelte er, wenn ein Streit eskalierte, drehte sich auf die andere Seite und schlief ein. Es kümmerte ihn nicht, er blieb tagsüber für sich und man bekam nicht viel von ihm mit, es sei denn, er bekam einen seiner Wutanfälle, die plötzlich aufloderten und ebenso plötzlich wieder vergingen. »Verdammte Scheiße!«, hörte man es dann von der Hängematte her, und Nils zappelte und wedelte hysterisch mit den Händen, um eine Wespe zu verscheuchen, die ihm zu nahegekommen war. »Verdammte Scheißidioten«, brüllte er und schlug ein paarmal in die Luft. Dann wurde es wieder still.
»Nils!«, rief Papa. »Sammeln am Ufer!«
»Er hört dich nicht«, sagte Mama. »Er hört Musik.«
Papa rief lauter. Keine Reaktion. Mama seufzte, stand auf, ging zu Nils und wedelte demonstrativ vor seinem Gesicht herum. Er nahm die Kopfhörer ab. »Papa ruft euch.«
Sammeln am Ufer. Ein Glücksmoment. Papa mit diesem besonderen Blick, den die Brüder so liebten, ein Funkeln, das Jux und Dollerei versprach, und immer dieselbe Feierlichkeit in seiner Stimme, wenn er einen neuen Wettkampf auslobte, todernst, doch mit einem Lächeln um die Mundwinkel. Zeremonienhaft und pathetisch, als stünde tatsächlich etwas auf dem Spiel.
»Die Regeln sind ganz einfach«, erklärte er und baute sich vor den drei Brüdern auf, die dünnbeinig in ihren Badehosen dastanden. »Auf mein Zeichen hin springt ihr ins Wasser, schwimmt einmal um die Boje da herum und wieder zurück. Wer zuerst wieder an Land ist, hat gewonnen.«
Die Jungen machten sich bereit.
»Habt ihr verstanden?«, fragte Papa. »Das ist der große Moment. Jetzt wird sich zeigen, wer von euch der Schnellste ist.«
Benjamin schlug sich auf die sehnigen Schenkel, wie er es bei Sportlern vor entscheidenden Wettkämpfen gesehen hatte.
»Wartet«, sagte Papa und nahm seine Armbanduhr ab. »Ich stoppe die Zeit.«
Mit seinen zu großen Daumen drückte er auf die kleinen Knöpfe der Digitaluhr und fluchte vor sich hin, als es ihm nicht sofort gelang, sie einzustellen: »Verdammtes Ding!« Dann blickte er auf.
»Auf die Plätze.«
Benjamin und Pierre schubsten einander, um eine günstigere Startposition zu ergattern.
»Hört auf«, sagte Papa. »So was macht man nicht.«
»Komm, wir lassen’s, das bringt doch so nichts«, sagte Mama, die noch immer am Tisch saß und schon wieder ihr Glas auffüllte.
Die Brüder waren sieben, neun und dreizehn Jahre alt, und wenn sie zusammen Fußball oder Karten spielten, konnte es inzwischen in so heftigem Streit enden, dass Benjamin spürte, wie etwas zwischen ihnen zerbrach. Noch höher war der Einsatz, wenn ihr Vater sie gegeneinander aufstellte, wenn er so klarmachte, dass er herausfinden wollte, wer von ihnen in irgendetwas der Beste war.
»Auf die Plätze … fertig … los!«
Benjamin rannte in den See, dicht gefolgt von seinen Brüdern. Hinter sich hörte er Mama und Papa rufen.
»Bravo!«
»Los, schneller!!«
Ein paar rasche Schritte, und der scharfe, steinige Grund verschwand unter seinen Füßen. Die Bucht war junikalt, und etwas weiter draußen warteten Strömungen noch kälteren Wassers, die kamen und gingen, als wäre der See etwas Lebendiges, das Benjamin mit verschiedenen Arten von Kälte auf die Probe stellen wollte. Die weiße Styroporboje lag still im spiegelblanken See. Ein paar Stunden zuvor hatten die Brüder sie dort platziert, als sie mit ihrem Vater das Fischnetz ausgelegt hatten. Benjamin konnte sich nicht erinnern, dass das so weit draußen gewesen war.
Die Brüder schwammen schweigend, um Kräfte zu sparen. Drei Köpfe im schwarzen Wasser, das Rufen vom Strand immer weiter entfernt. Nach einer Weile verschwand die Sonne hinter den Bäumen auf der anderen Seite des Sees und es wurde dämmrig. Plötzlich schwammen sie in einem anderen See, das Wasser kam Benjamin fremd vor. Ihm wurde bewusst, was alles unter ihm war, ihm fielen die Tiere ein, die sie vielleicht nicht hier haben wollten. Er dachte an die vielen Male, die er mit seinen Brüdern im Boot gesessen hatte, während ihr Vater die Fische aus dem Netz gepflückt und in den Fußraum des Bootes geworfen hatte. Die Brüder beugten sich dann oft vor und betrachteten die nadelspitzen kleinen Fangzähne der Hechte, die stacheligen Flossen der Barsche. Manche der Fische schlugen nach ihnen aus, und die Brüder fuhren zusammen und schrien, und Papa, den ihr plötzliches Geschrei erschreckte, schrie zurück. Dann wieder Ruhe, und Papa murmelte, während er am Netz herumzupfte: »Ihr werdet doch wohl keine Angst vor Fischen haben.« Benjamin stellte sich vor, dass eben diese Wesen jetzt genau neben oder genau unter ihm schwammen, vom dunklen Wasser verborgen. Die weiße Boje, im Abendlicht rosa schimmernd, war noch immer weit weg.
Nachdem sie eine Weile geschwommen waren, zog sich das Startfeld auseinander – Nils ein gutes Stück vor Benjamin, der wiederum Pierre hinter sich gelassen hatte. Als es jedoch dunkel wurde und die Kälte sie in die Oberschenkel zwickte, näherten sich die Brüder einander wieder an und bald schwammen sie erneut dicht an dicht. Sie dachten vielleicht nicht darüber nach, und niemals hätten sie es sich eingestanden, aber sie ließen sich dort im Wasser nicht im Stich.
Ihre Köpfe sanken tiefer Richtung Oberfläche. Die Armbewegungen wurden kürzer. Zu Beginn hatte das Wasser von ihren Schwimmzügen geschäumt, jetzt schwieg der See. An der Boje drehte Benjamin sich um. Ihr Sommerhaus ein roter Legostein in der Ferne. Erst jetzt wurde ihm klar, wie weit es zurück zum Ufer war.
Die Müdigkeit kam wie aus dem Nichts. Seine Muskeln schmerzten so sehr, dass er die Arme nicht mehr heben konnte. Er erschrak so heftig, dass er die Beinbewegungen vergaß, er wusste plötzlich nicht mehr, wie es ging. Kälte strahlte vom Nacken in den Hinterkopf aus. Er hörte seinen eigenen Atem, wie er kürzer und heftiger wurde, und eine eisige Erkenntnis füllte seine Brust: Er würde es nicht schaffen, den ganzen Weg zum Ufer zurückzuschwimmen. Er sah, wie Nils den Hals reckte, um kein Wasser in den Mund zu bekommen.
»Nils«, sagte Benjamin. Nils reagierte nicht, schwamm einfach weiter, den Blick zum Himmel gerichtet. Benjamin holte ihn ein, angestrengt atmeten sie einander ins Gesicht, und Benjamin sah Angst in den Augen seines älteren Bruders, wie er sie bisher nicht gekannt hatte.
»Was ist?«, fragte Benjamin.
»Ich weiß nicht …«, keuchte Nils. »Ich weiß nicht, ob ich das hier schaffe.«
Nils streckte beide Hände nach der Boje aus, hielt sich fest, doch sie trug sein Gewicht nicht und sank in die Dunkelheit hinab. Sein Blick suchte das Ufer.
»Es geht nicht«, murmelte Nils. »Es ist zu weit.«
Benjamin erinnerte sich, was er im Schwimmunterricht gelernt hatte, an die endlosen Vorträge des Trainers über Wassersicherheit.
»Wir müssen ruhig bleiben«, sagte er zu Nils. »Längere Schwimmbewegungen machen. Längere Atemzüge.«
Er warf einen Blick auf Pierre.
»Alles klar?«, fragte er.
»Ich habe Angst«, sagte Pierre.
»Ich auch.«
»Ich will nicht sterben!«, rief Pierre. Seine feuchten Augen knapp über der Oberfläche.
»Komm her«, sagte Benjamin. »Komm ganz dicht zu mir.«
Die drei Brüder rückten im Wasser zusammen.
»Wir helfen uns gegenseitig«, sagte Benjamin.
Seite an Seite schwammen sie Richtung Haus zurück.
»Lange Züge«, sagte Benjamin. »Wir machen alle zusammen lange Züge.«
Pierre hatte aufgehört zu weinen und schwamm jetzt entschlossen vorwärts. Nach einer Weile fanden sie einen gemeinsamen Rhythmus, eine gemeinsame Bewegung, sie atmeten aus und atmeten ein, lange Züge.
Benjamin sah Pierre an und musste lachen.
»Deine Lippen sind blau.«
»Deine auch.«
Dann konzentrierten sie sich wieder. Köpfe übers Wasser. Lange Züge.
Benjamin sah das Sommerhaus und den kleinen Fußballplatz mit dem unregelmäßigen Rasen, wo er und Pierre jeden Tag Fußball spielten. Den Erdkeller und die Beerensträucher links, wo sie nachmittags Himbeeren und schwarze Johannisbeeren pflückten und mit weißen Schrammen an den braungebrannten Beinen zurückkehrten. Und dahinter erhoben sich die Fichten, die in der Dämmerung noch finsterer erschienen.
Die Brüder näherten sich dem Ufer.
Als sie nur noch fünfzehn Meter entfernt waren, brach Nils aus und kraulte wie besessen. Benjamin fluchte, weil er damit nicht gerechnet hatte, und beeilte sich ihm zu folgen. Plötzlich war der See nicht mehr still, der Kampf der Brüder wurde zum Ufer hin wilder. Pierre war hoffnungslos abgeschlagen, Nils nicht mehr als eine Armlänge vor Benjamin, als sie das Ufer erreichten, Seite an Seite rannten sie schließlich den Hang hinauf. Benjamin packte Nils’ Arm, um an ihm vorbeizukommen, aber der riss sich mit einer Wut los, die Benjamin überraschte. Dann kamen sie am Sitzplatz der Eltern an. Sie sahen sich um.
Benjamin ging zum Haus, spähte durchs Fenster. Entdeckte die Gestalt seines Vaters in der Küche. Den breiten Rücken, wie er sich über den Abwasch beugte.
»Sie sind reingegangen«, sagte Benjamin.
Nils stützte sich mit beiden Händen auf den Knien ab und schnappte nach Luft.
Pierre kam keuchend den Hang hinauf. Sein verwirrter Blick, als er den abgeräumten Tisch sah. Unschlüssig standen sie da, die drei Brüder. Ihr ängstliches Atmen draußen im Schweigen.
KAPITEL 3
22:00 Uhr
Nils schleudert die Urne gegen die Brust seines Bruders. Pierre ist nicht darauf gefasst, an dem Geräusch erkennt Benjamin sofort, dass etwas in Pierres Körper kaputtgeht. Ein Brustbein oder eine Rippe. Schon immer hat Benjamin es vermocht, drei Schritte weiter zu sehen als die anderen. Er konnte Konflikte zwischen Familienmitgliedern vorhersagen, lange bevor sie sich tatsächlich entluden. Von der ersten Irritation an, so subtil, als wäre sie gar nicht da, wusste er genau, wie der Streit beginnen und auch wie er enden würde. Aber das hier ist anders. Von dem Moment an, in dem in Pierres Brustkorb etwas bricht, weiß er nicht mehr, wie es weitergeht. Von jetzt an ist alles unbekanntes Terrain.
Pierre liegt im Wasser und tastet seine Brust ab. Nils ist rasch bei ihm: »Alles okay?«
Er bückt sich, um seinem Bruder aufzuhelfen. Er hat Angst.
Pierre tritt Nils gegen die Waden, sodass dieser auf dem steinigen Ufer einknickt. Dann stürzt er sich auf ihn, sie rollen über die Wiese und schlagen aufeinander ein, hämmern sich die Fäuste ins Gesicht, auf Brust und Schultern. Dabei reden sie die ganze Zeit. Benjamin erscheint die Szene unwirklich, fast erfunden; dass sie miteinander reden, während sie sich gleichzeitig an die Kehle gehen.
Benjamin hebt die Urne auf, die umgekippt auf der Strandwiese liegt. Der Deckel ist heruntergefallen, ein Teil der Asche hat sich auf dem Ufersand verteilt. Die Farbe der Knochenreste ist grau, ins Blau gehend, das fällt ihm auf, als er den Deckel wieder draufsetzt; so hat er sich die Asche seiner Mutter nicht vorgestellt. Er hält die Urne mit beiden Händen, tritt ein paar Schritte zurück, erstarrt beim Anblick seiner sich immer noch schlagenden Brüder. Festgefroren außerhalb des Geschehens, wie so oft. Er sieht die linkischen Schläge, ihre Unbeholfenheit. An jedem anderen Tag wäre Pierre Nils weit überlegen. Er prügelt sich, seit er ein Teenager war. Erinnerungen an die Schulzeit, wenn Benjamin über den Pausenhof zu einer Traube von Jugendlichen hinüberging, die sich versammelt hatten, um einer Schlägerei zuzusehen, wie er zwischen den Steppjacken seinen Bruder entdeckte, über einen anderen Jungen gebeugt, und schnell weiterging, weil er nicht mitansehen wollte, wie Pierre immer weiter zuschlug, obwohl sich sein Gegner längst nicht mehr rührte, scheinbar leblos am Boden lag. Pierre kann austeilen, doch hier am Ufer und mit gebrochener Rippe sind die Chancen ausgeglichen, er vermag sich kaum aufrechtzuhalten. Die meisten Schläge der Brüder gehen ins Leere oder treffen unsauber, oder werden von Händen und Armen abgewehrt. Andere haben eine verheerende Wirkung. Pierre trifft Nils über dem Auge, und Benjamin sieht, wie ihm Blut über die Wange und den Hals hinabrinnt. Nils trifft Pierre mit dem Ellbogen, und es klingt, als breche er ihm die Nase. Er reißt Pierre an den Haaren, und als Nils endlich loslässt, hängen Büschel von Pierres Schopf zwischen seinen Fingern. Nach einer Weile werden sie müde. Für einen Moment sieht es aus, als könnten sie beide nicht mehr. Mehrere Meter voneinander entfernt sitzen sie am Wasser und sehen einander einfach nur an. Und dann beginnen sie wieder von vorn. Es ist ein zäher und langwieriger Kampf, als wollten sie einander umbringen, aber sie scheinen es nicht eilig zu haben.
Und sie reden die ganze Zeit.
Nils tritt nach seinem Bruder, verfehlt ihn jedoch und verliert das Gleichgewicht. Pierre macht ein paar Schritte zur Seite und hebt einen Stein vom Ufer auf, den er mit voller Wucht in Nils’ Richtung schleudert. Der Stein zischt vorbei, aber Pierre hebt einen weiteren auf und trifft Nils diesmal am Kinn. Noch mehr Blut. Vorsichtig geht Benjamin rückwärts, seine Brüder im Blick, die Landzunge hinauf, er hält die Urne so fest, dass seine Finger weiß werden. Dann dreht er sich um und läuft Richtung Haus. In der Küche liegt sein Handy. Er wählt die 112.
»Meine Brüder«, sagt er, »ich habe Angst, sie bringen sich um.«
»Können Sie eingreifen?«, fragt die Frau am Telefon.
»Nein.«
»Warum nicht? Sind Sie selbst verletzt?«
»Nein, nein …«
»Warum können Sie nicht eingreifen?«
Benjamin presst das Handy an sein Ohr. Warum kann er nicht eingreifen? Er blickt aus dem Fenster. Überall sieht er die Schauplätze seiner Kindheit. Hier hat irgendwann alles angefangen, und hier endete es auch. Er kann nicht eingreifen, weil er hier festgefroren ist und sich seitdem nicht mehr rühren kann. Er ist noch immer neun Jahre alt, und da unten schlagen sich erwachsene Männer, seine Brüder, die ohne ihn weitergelebt haben.
Er sieht die Umrisse der beiden, die immer noch aufeinander einschlagen. Das ist kein würdiges Ende, auch wenn es vielleicht absehbar war. Was hatten sie denn erwartet? Was hatten sie gedacht, was passiert, wenn sie schließlich an den Ort zurückkehren, dem sie ihr Leben lang zu entkommen versucht haben? Die Brüder prügeln sich jetzt im knietiefen Wasser. Von der Küche aus sieht Benjamin, wie Pierre Nils niederringt, sodass dieser unter der Wasseroberfläche verschwindet. Nils bleibt liegen, er steht nicht mehr auf, und Pierre macht keine Anstalten, ihm zu helfen.
Ein Gedanke durchzuckt Benjamin: Sie sterben da unten.
Und da lässt er das Handy fallen und rennt. Er setzt die Steintreppe hinab, nach draußen, der Weg zum See sitzt im Muskelgedächtnis, nach wie vor kann er alles parieren, auch bei dem Tempo, er weicht jeder hervorstehenden Wurzel aus, springt über jeden spitzen Stein. Er rennt durch seine Kindheit. Er kommt an der Stelle vorbei, wo seine Eltern immer in der Abendsonne gesessen haben, bis sie schließlich hinter dem See versank. Er läuft an der Wand vorüber, die der Wald im Osten bildet, passiert das Bootshaus. Er rennt. Wann hat er das zuletzt getan? Er erinnert sich nicht. Sein erwachsenes Leben hat er in einem fortlaufenden Stillstand verbracht, wie in Parenthese, und als er jetzt den Puls in seiner Brust spürt, erfüllt ihn eine seltsame Euphorie, darüber, dass er kann, oder vielleicht vor allem: darüber, dass er will. Er spürt die Kraft, die darin liegt, dass ihn endlich etwas antreibt. Und er springt über den kleinen Damm, an dem er als Kind immer Kaulquappen gefangen hat, und stürzt sich ins Wasser. Er greift nach seinen Brüdern, bereit sie zu trennen, merkt aber, dass es nicht mehr nötig ist. Sie haben aufgehört, sich zu schlagen. Sie stehen nah beieinander im hüfthohen Wasser, ein paar Meter weit im See. Sie sehen einander an. Ihr dunkles Haar ähnelt sich, ihre Augen sind identisch, haben dieselbe kastanienbraune Farbe. Sie sagen nichts. Es wird still auf dem See. Nur das Geräusch dreier Brüder, die weinen.
Auf der Steintreppe untersuchen sie ihre Verletzungen. Sie entschuldigen sich nicht, denn sie wissen nicht, wie das geht, es hat ihnen niemand beigebracht. Vorsichtig tasten sie einander ab, tupfen ihre Wunden, pressen ihre Stirnen gegeneinander. Dann umarmen sie sich.
In der dumpfen, feuchten Sommerstille hört Benjamin plötzlich Motorengeräusche im Wald über ihnen. Er blickt zum Hang hinauf. Ein Polizeiauto pflügt langsam durch das blaue Grün, die Traktorspur zum Hof hinunter. Da steht das Sommerhaus, einsam auf einer Landzunge, in der nie ganz schwarzen Juninacht.
KAPITEL 4
Die Rauchsäule
Mama und Papa standen vom Mittagessen auf der Terrasse auf. Papa sammelte die Teller ein und stellte die Gläser ineinander. Mama nahm den Weißwein mit in die Küche und verstaute ihn im Kühlschrank. Zeichen von Aktivität auf der Toilette, die Wasserpumpe quietschte ein paarmal. Papa spuckte kräftig ins Waschbecken. Anschließend schleppten sie sich hintereinander die Treppe hinauf. Benjamin hörte die Schlafzimmertür zuschlagen, dann wurde es still.
Sie nannten es »Siesta«. In Spanien mache man das ständig, hatten sie den Kindern erklärt. Eine Stunde Nickerchen nach dem Essen, um frisch und mit neuen Kräften bis zum Abend zu kommen. Für Benjamin war es eine lange Stunde Nichts, gefolgt von einer eigenartigen, weiteren halben Stunde, in der die Eltern wieder auf die Terrasse hinauswankten und schweigend und gereizt auf ihren Plastikstühlen saßen. Benjamin hielt sich in der Regel etwas abseits, um sie in Ruhe aufwachen zu lassen. Doch schon bald gesellte er sich zu ihnen, und auch seine Brüder kamen aus unterschiedlichen Richtungen herbei, denn manchmal nach der Siesta konnte es vorkommen, dass Mama ihnen etwas vorlas. Wenn das Wetter gut war, auf einer Decke im Garten, wenn es regnete, auf der Küchenbank vor dem Kamin. Schweigend lauschten sie, wenn sie ihnen aus den Klassikern vorlas, Büchern, von denen sie fand, dass sie sie kennen müssten. Es gab dann nichts anderes mehr, außer Mamas Stimme, und mit der freien Hand fuhr sie einem von ihnen durchs Haar, und je länger es dauerte, desto näher fühlten sie sich ihrer Mutter, und gegen Ende war es, als bildeten sie einen einzigen Körper, man wusste nicht, wo ein Kind aufhörte und das nächste begann. Wenn das Ende eines Kapitels erreicht war, schlug Mama das Buch mit einem Knall vor der Nase eines der Kinder zu, und alle jauchzten begeistert.
Benjamin setzte sich auf die Steintreppe. Das Warten, das vor ihm lag, war lang. Er schaute auf seine zerschrammten Sommerbeine hinunter, sah die Mückenstiche auf den Schienbeinen, roch den Duft seiner sonnengebräunten Haut und der Salubrinlösung, mit der sein Vater ihm die Füße gegen die Brennnesselstiche eingeschmiert hatte. Sein Herz schlug schneller, obwohl er sich nicht bewegte. Er spürte keinen Überdruss, sondern etwas anderes, schwer Fassbares. Er war traurig, ohne zu wissen, warum. Er schaute über den windstillen Hang zum See hinunter, die sonnenzerfressene, weiß gewordene Wiese. Und er spürte, wie alles um ihn herum nachgab. Es war, als senke sich eine Käseglocke über die Landzunge. Mit dem Blick folgte er einer Wespe, unruhig kreiste sie über einer Schüssel mit Sahnesauce, die auf dem Tisch draußen stehen geblieben war. Die Wespe war schwer und unberechenbar, es schien, als bewegten sich ihre Flügel immer langsamer, mit wachsender Mühe, bis sie der Sauce zu nahekam und klebenblieb. Benjamin sah ihr dabei zu, wie sie kämpfte, um sich zu befreien, wie ihre Bewegungen immer schwächer wurden, bis sie zum Schluss ganz aufhörten. Er lauschte dem Vogelgesang, der plötzlich etwas Seltsames bekam, als zwitscherten die Vögel langsamer, in halbem Tempo. Dann verstummten sie ganz. Benjamin spürte, wie ihn Panik ergriff. War die Zeit stehengeblieben? Er klatschte fünfmal in die Hände, wie er es immer tat, um wieder zu sich zu kommen.
»Hallo«, rief er ins Leere. Er stand auf, klatschte erneut fünfmal, so fest, dass seine Handflächen brannten.
»Was machst du da?«
Pierre stand ein Stück weiter unten Richtung See und blickte zu ihm hinauf.
»Nichts«, sagte Benjamin.
»Wollen wir angeln?«
»Okay.«
Benjamin stand auf und holte seine Gummistiefel aus dem Flur. Dann ging er außen ums Haus und nahm die Angelrute, die an der Rückwand lehnte.
»Ich weiß, wo es Regenwürmer gibt«, sagte Pierre.
Sie gingen hinter den Stall, wo die Erde feucht war. Zwei Spatenstiche und plötzlich glänzte die Erde vor Regenwürmern. Die Brüder zogen sie aus der Erde und legten sie in ein Glas, wo sie unbeteiligt liegenblieben, ohne sich darum zu scheren, dass sie gefangen waren. Pierre schüttelte das Glas und stellte es auf den Kopf, um Leben in die Würmer zu bringen, aber sie schienen alles gelassen hinzunehmen, auch den Tod, denn als Benjamin sie unten am See auf den Haken spießte, protestierten sie nicht, sondern ließen sich widerstandslos durchbohren.
Benjamin und Pierre wechselten sich dabei ab, die Angel zu halten. Der Schwimmer war rot und weiß und auf der Wasseroberfläche gut zu sehen, außer, wenn er in der Straße aus Sonnenlicht auf dem See verschwand. Am Ufer entlang kamen die Schwestern Larsson auf sie zu, die drei Hühner hier auf dem Hof, gemeinsam, und doch jedes mit seinen eigenen Angelegenheiten beschäftigt, in verschiedene Richtungen den Boden pickend, leise glucksend. Benjamin hatte es noch nie gemocht, wenn sie ihm zu nahe kamen, ihr Verhalten entbehrte jeder Logik. Er war angespannt, jetzt konnte alles geschehen, wie wenn ein Betrunkener auf dem Marktplatz einen plötzlich ansprach. Noch dazu war eines der Hühner blind, hatte Papa gesagt, und konnte ausflippen, wenn es sich bedroht fühlte, und so starrte Benjamin ihnen immer in die leeren Augen, fand aber nie heraus, welches von ihnen nichts sah. Waren sie nicht eigentlich alle blind? Wenn sie nervös über das Gelände staksten, schien es fast so. Papa hatte sie vor ein paar Sommern gekauft, um sich endlich seinen Lebenstraum von frisch gelegten Eiern zum Frühstück zu erfüllen. Er gab ihnen zu fressen, warf ihnen nachmittags Trockenfutter hin und rief »putt, putt, putt«, und abends scheuchte er sie in den Stall, das Geräusch des Kochlöffels, der gegen einen Topf schlug, hallte über den ganzen Hof. Jeden Morgen war es Pierres Aufgabe, ins Hühnerhaus der Schwestern Larsson zu gehen und die Eier zu holen, und dann kam er über den grasbewachsenen Weg zum Haus zurückgerannt, mit dem Schatz in seinen Händen, und Papa eilte in die Küche und setzte einen Topf Wasser auf. Es wurde ihr gemeinsames Ritual, Pierres und Papas, und auch für Benjamin war es ein schöner Moment, denn er beruhigte ihn, er war hell und man konnte darin verschnaufen.
Die Hühner hörten auf herumzupicken und sahen die Brüder mit ihren toten Augen an. Benjamin machte eine Bewegung in ihre Richtung, und sofort kam Leben in die Schwestern Larsson, mit langen Schritten liefen sie weiter, starrten ins Gras hinunter. Sie rannten vorbei und waren fort.
Als es am Schwimmer ruckte, hielt Pierre gerade die Angel. Erst war es nur ein leises Zittern, dann verschwand der Schwimmer ganz im schwarzen Wasser.
»Es hat einer angebissen!«, rief Pierre. »Nimm du sie!« Er reichte Benjamin die Angel.
Benjamin machte es, wie Papa es ihn gelehrt hatte, er riss den Fisch nicht sofort aus dem Wasser, sondern versuchte, ihn vorsichtig an Land zu ziehen. Benjamin zog in die eine Richtung, der Fisch in die andere, mit einer Kraft, die Benjamin überraschte. Als er die Umrisse des Fischs unmittelbar unter der Oberfläche ausmachte und sah, wie er kämpfte, um sich zu befreien, rief er: »Schnell, einen Eimer!«
Pierre blickte sich ratlos um. »Einen Eimer?«
»Nils!«, rief Benjamin. »Bring uns schnell einen Eimer! Wir haben einen Fisch gefangen.«
Er sah, wie sich die Hängematte bewegte, Nils lief zum Haus und kam dann mit einem roten Eimer zu ihnen herunter. Benjamin wollte nicht zu fest ziehen, aus Angst, die Angelschnur könnte reißen, doch er musste hart dagegenhalten, als der Fisch Richtung Seemitte zerrte. Sofort trat Nils einen Schritt ins Wasser und tauchte den Eimer in den See.
»Zieh ihn raus!«, rief er.
Der Fisch schlug gegen die Wasseroberfläche, näherte sich wieder dem Ufer. Nils machte einen weiteren Schritt ins Wasser, seine kurze Hose wurde nass, dann schöpfte er den Fisch heraus.
»Ich habe ihn!«, schrie er.
Sie versammelten sich um den Fisch und starrten ihn an.
»Was ist das für einer?«, fragte Pierre.
»Ein Barsch«, antwortete Nils. »Aber ihr müsst ihn wieder reinwerfen.«
»Warum?«, fragte Pierre überrascht.
»Er ist zu klein«, sagte Nils. »Den kann man nicht essen.«