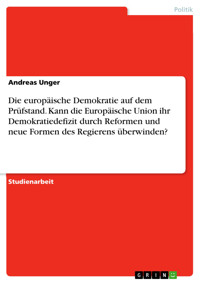Andreas Unger
Vergebung
Eine Spurensuche
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2019
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung und Umschlagmotiv: © Christoph Pittner (Pittner-Design)
Autorenfoto: © Kathrin Harms
Inhalt
Einleitung
1 Die Suche beginnt
2 »Weil die Wärme tot war in mir«
3 Warum? Warum? Warum?
4 »Ein Auto oder ein Haus kann man reparieren oder neu bauen, aber keinen Menschen«
5 »Das wichtigste Wort ist Versöhnung«
6 »Ich nehme das Leben, wie es ist« – oder: »Soll ich wirklich?«
7 »Der Satz hat mich drei Meter größer werden lassen«
8 »So lange du auch nur einem Menschen nicht verzeihst, bist du nicht frei«
9 Der Mythos vom Abschließen
10 Vergib uns unsere Schuld
11 Schluss
Über den Autor
Einleitung
Vergebung war nie ein Thema für mich. Was hat einer schon zu vergeben, der in den 70er-Jahren in eine stabile, liebende Familie hineingeboren wurde, behütet und behutsam erzogen, im Wohlstand aufgewachsen, inmitten der Freiheit, Liberalität und dem Frieden Mitteleuropas? Mir sind große menschliche Verwerfungen bisher weitgehend erspart geblieben. Mal ein mieser Chef, okay, oder Reibereien mit Kollegen, deren Ehrgeiz sich nicht mit meinem vertrug. In jungen Jahren noch die ein oder andere Beziehung, die nicht gut endete, das ist auch schon alles, was es zu nennen gibt, gleich gefolgt von der Frage: Ist das nennenswert?
Ich habe also nichts zu verzeihen, und das bedeutet: Dieses Buch hat einer geschrieben, der sich dem Thema mit leichtem Gepäck nähert. Dramaturgisch ist das natürlich schwierig. Stellen Sie sich vor, wie wuchtig dieses Buch geworden sein könnte, stammte es von einem Autor, der sich durch das Schreiben mit einem Unglück oder Verbrechen in seinem Leben auseinandersetzt, den wir gewissermaßen live beim Ringen mit seinem Schicksal begleiten dürfen, der uns tief hineinführt in seine verletzte Seele und sich schließlich, im letzten Kapitel, geläutert von seinem Sieg über die Dämonen, bereit zeigt für das Stück Leben, das vor ihm liegt.
Stattdessen jetzt das: Ein unbeschwerter Autor schreibt ein Buch darüber, wie keinesfalls so unbeschwerte Menschen mit dem umgehen, was ihnen das Leben vor die Füße knallt. Ob das gut geht? Ich hoffe, dass es nicht nur gut gegangen ist, sondern dem Buch auch gutgetan hat. Ich habe versucht, den Menschen, die ich für dieses Buch kennengelernt habe, mit der Neugier des Unwissenden zu begegnen, nicht mit dem Bestätigungs- oder Widerlegungsbedürfnis dessen, der seine eigene Geschichte in derjenigen seines Gegenübers gespiegelt finden möchte.
Ich habe keinen autobiografischen Bezug zum Thema dieses Buches. Trotzdem, oder gerade deswegen, will ich erklären, wie ich auf dieses Thema gekommen bin. Nämlich doch durch eigene Erfahrung.
Es war an einem auf feierliche Weise unspektakulären Sonntag. Ich saß in unserer hellen, freundlichen Rokoko-Kirche in München-Thalkirchen, über mir blattgoldveredelte Putten, Heilige aus Gips standen in ihren Talaren, vom Hochaltar schaute die Heilige Maria gütig auf diejenigen herab, für die sie so oft ein gutes Wort einlegen soll. Die Orgel war nicht nur zu hören, sondern auch zu spüren, in den Füßen und am Gesäß, der Weihrauch schärfte den Geruchssinn und schmälerte etwas die Sicht. Es war also während der Sonntagsroutine, die ich seit meinen frühsten Tagen kenne und liebe, als ich tat, was ich gelernt hatte: aufstehen, mitsingen, das Kreuzzeichen machen, beten, setzen, knien und genießen, dass das alles seine feste Ordnung hat und damit seine Richtigkeit. Selbst dem monotonen Leiern der Gebete kann ich etwas abgewinnen: Wohin kämen wir, wenn wir solche absoluten Hammerzeilen wie »Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund« nicht lakonisch und beinahe unbeteiligt, wie es sich gehört, vor uns hin sprechen würden, sondern mit Emphase in der Betonung? Der Gottesdienst müsste aufgrund von Ergriffenheit wiederholt unterbrochen werden.
Die Monotonie gibt mir Halt, weil sie mich in eine Reihe stellt mit Menschen rund um den Erdball, die seit Jahrhunderten diese Worte sprechen, diese Gesten machen und Gesänge hinaufschicken, und in eine Reihe mit Menschen, die das noch in Jahrhunderten tun werden. Der Rhythmus ist mir längst in Fleisch und Blut übergegangen, ich muss mich nicht auf ihn konzentrieren, und weil das so ist, passiert es mir manchmal, dass ich geistig abschweife, während ich spreche, dass ich mich zerstreue, sich mein Geist selbständig macht, herumstreunt, plötzlich kehrtmacht und mich zum Nachdenken bringt über all das, was ihm so aufgefallen ist während seines kurzen Ausflugs.
Wir waren also damals, während ich noch herumschweifte, beim Vaterunser angekommen, »und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern« beteten wir in feierlicher, monotoner Ernsthaftigkeit. Plötzlich erinnerte ich mich, wie mich dieses Vaterunser seit jeher begleitet hat, wie ich es früher betete, vorm Schlafengehen, als Kind, und welchen Reim ich mir damals, als vielleicht Sechsjähriger, auf »Vergib uns unsere Schuld« gemacht hatte: Ich habe mal einen Nachbarsjungen mit einem Taschenmesser in den Finger geschnitten. Zum Glück war es nur eine harmlose Schnittverletzung, geheilt mit Desinfektionsspray, Pflaster und gutem Zureden. Für mich aber war es eine ganz große Sache. Kleinlaut war ich zu dem Jungen gegangen, um mich zu entschuldigen. Ich hatte nichts zu vergeben, aber wollte, dass mir vergeben wurde. Ich glaube, das war der Tag meiner Kindheit, an dem ich »Schuld« kennengelernt habe und eben doch »Vergebung«. Und während ich wieder auftauche aus meiner Erinnerung, hakt er plötzlich ein, mein Geist, mit einer kleinen Frage:
Wie geht Vergebung?
Dann war die Kirche aus, ich machte mich auf den Weg zu Fuß nach Hause, vorbei am Antiquitätenladen, über die Straße, das Treppchen hoch und über die Ampel. Ich weiß nicht mehr, woran ich dachte, ans Mittagessen vielleicht, ans Wetter, an meinen neuen Fahrradhelm oder die Fenster, die mal wieder geputzt gehörten.
Mit den Fragen ist es ja so: Die schwersten kommen beiläufig daher, sie brechen nicht herein, nehmen einen nicht in Beschlag, zumindest nicht sofort. Man erkennt sie nicht daran, dass sie sich aufdrängen. Sondern daran, dass sie nicht mehr weggehen. Die riesigen, bisweilen monströsen Fragen, die sich hinter den kleinen verstecken, kommen erst nach und nach zum Vorschein.
1
Die Suche beginnt
Die großen Fragen, die hinter der kleinen stecken, kommen zum Vorschein. Am Computer in meinem Büro sitzend suche ich nach relevanten Einträgen im Internet. Zu den Suchbegriffen, die ich auf Deutsch und Englisch eingebe, zählen: vergeben, verzeihen, entschuldigen, nachtragen, Rache, Vergeltung, Einsicht, Nachsicht, Vergessen, Versöhnen, Loslassen, Täter, Opfer. Hinter jedem dieser Wörter stehen Gedankengebäude, Glaubensfragen, Geschichten, Gefühle, Lebensläufe. Schon allein die Zahl der Suchbegriffe, die mir wichtig erscheinen, lässt mich ahnen: Das Thema könnte größer sein, als ich dachte.
Fast zu groß, so sperrig und pathetisch wie das Wort daherkommt: Vergebung. Prediger sagen es. Angeklagte bitten darum, wenn sie vor Gericht stehend gesenkten Hauptes Reue zeigen. Und Schauspieler am Ende kitschiger Filme, damit auch der letzte Zuschauer kapiert: Obacht, jetzt wird’s sentimental.
Vergebung beziehungsweise die Bitte darum, das scheint den ganz Großen vorbehalten sein: Willy Brandt, wie er in Warschau auf die Knie fällt. Nelson Mandela, wie er nach über einem Vierteljahrhundert in den Gefängnissen der Buren die Aussöhnung mit ihnen einleitet. Oder Papst Franziskus, der Gott um Vergebung für die bittet, die afrikanische Flüchtlinge vor Lampedusa ertrinken lassen.
Doch so ist es nicht. Je mehr ich nach der Vergebung suche, desto mehr erscheint sie mir genau so außergewöhnlich wie alltäglich zu sein. Sie steckt im »Ego te absolvo«, mit dem der Priester den Beichtenden von seinen Sünden losspricht, und im saloppen »Schon okay« der Tochter, deren Papa sie mal wieder zu spät vom Kindergarten abholt. Sie ist im Spiel, wenn sich der gefoulte Fußballer, der sich eben noch im Gras wand, an der hingestreckten Hand seines Gegenspielers hochzieht. Verzeihen passiert beim Bier, das zwei ehemals beste Freunde nach zehn Jahren der Funkstille miteinander trinken, nachdem der eine dem anderen die Freundin ausgespannt hat. Oder unterm Weihnachtsbaum der alt gewordenen Eltern, wenn die Erinnerung an die gemeinsame Kindheit zwei Schwestern einen alten Streit vergessen lässt. Es kann in einem langen Brief geschehen, durch einen knappen Handschlag oder gar in aller Heimlichkeit, es kann das glückliche Ende eines jahrelangen Ringens bedeuten oder eher nebenbei passieren.
Im Netz finde ich platte Hinweise des Inhalts, Verzeihen sei wirklich wichtig. Ich finde fromme Schriften, Streitschriften, Bekenntnisschriften. Esoterische Bücher mit Titeln wie »Versöhnung mit den Ahnen: Mit der 7-Generationen-Aufstellung zu ungeahnter Kraft«; der Arzt-Roman Nr. 141 mit dem Titel »Wir müssen vergessen – und verzeihen«; eine Handy-Schutzhülle mit der Aufschrift »Fight Less – Forgive More«; die CD »Verlieben, verloren, vergessen, verzeihen« des Schlagerstars Wolfgang Petry mit dem Hinweis »Tanzbar!«; Stieg Larssons Roman »Vergebung«; und jede Menge Do-It-Yourself-Ratgeber-Literatur mit hundertprozentigen Problemlösungsvorschlägen, zum Beispiel: »Radical Forgiveness: A Revolutionary Five-Stage Process to Heal Relationships, Let Go of Anger and Blame, Find Peace in Any Situation«. Einmal Blanko-Vergebung bitte – danke auch.
Immerhin werden die Fragen präziser, die sich stellen: Welche Rolle spielt die Schwere der Tat? Ist es wichtig, dass der Täter bereut? Dass er sich entschuldigt? Ist es leichter, eine Fahrlässigkeit zu verzeihen als eine Affekttat oder ein vorsätzliches Verbrechen? Welche seelischen Voraussetzungen bringen Menschen mit, die vergeben?
Ist Verzeihenkönnen eine Gnade, eine Tugend, eine Errungenschaft? Aus welchem Material ist Vergebung: aus einem rationalen Beschluss, einem Kalkül, einem Gefühl? Was sind ihre Voraussetzungen, und wie schafft man sie? Was ist das Gegenteil von Vergeben? Ignorieren? Nicht vergeben? Rache nehmen? Kann auch die Genugtuung, die aus Rache stammt, Wunden heilen? Was macht das Verzeihen mit den Opfern? Was mit den Tätern? Was bedeutet das Nicht-Verzeihen? Und was ist der Unterschied zwischen Vergeben und Verzeihen?
Ich bin unzufrieden. Was im Netz steht, bringt mich kaum weiter. Ich will mich nicht über ein Phänomen informieren, will mich nicht schlau machen, will zu nichts aufgefordert, von nichts überzeugt und zu nichts bekehrt werden. Was also will ich? Ich bin ziemlich überfordert, ganz allein. Also suche ich Partner für meine Recherche. Die Fotografin Silke Wernet lässt sich auf das Thema ein. Gemeinsam ergattern wir ein Recherche-Stipendium des Fachverbands Konfessionelle Presse im Verband Deutscher Zeitschriftenverleger. Anschließend gewinnen wir das Magazinstern dafür, für eine umfangreiche Recherche ein Budget einzurichten. Redakteur Dominik Stawski betreut unser Stück redaktionell. Ihnen allen ein herzliches Dankeschön!
Ich weiß noch nicht, was ich in der Welt der Vergebung und des Verzeihens genau suche. Aber ich weiß, wie ich vorgehen will: Ich will mit Menschen reden. Auf einer Reise quer durch Deutschland, weiter nach Polen, Israel, Palästina und in die USA, auf einer Reise in die immer wiederkehrende Ratlosigkeit und wieder zurück. Ich tue nicht so, als verstünde ich alles. Dem, was einigen meiner Gesprächspartner widerfahren ist, kann man nicht mit Sätzen begegnen wie »Ich weiß, was Sie meinen.« Ich weiß es nämlich nicht, oder besser: Ich weiß es allenfalls nur bis zu der Wegmarke, ab der einen nicht mehr Analyse und Empathie, sondern nur noch eigenes Erleben weiterführen. Diese Wegmarke wollte ich gerne erreichen. So habe ich mich von Frage zu Frage gehangelt, von Ratlosigkeit zu Ratlosigkeit, Begegnung zu Begegnung. So habe ich eine Reise getan hin zu den Quellen der Vergebung. Auf diese Reise nehme ich Sie, liebe Leser, mit.
2
»Weil die Wärme tot war in mir«
A m Morgen des 12. Mai 2009 stieg ich ins Auto und fuhr nach Winnenden. Am Tag zuvor hatte Tim K. die Albertville-Realschule betreten, ein ehemaliger Schüler, in einem schwarzen Kampfanzug und mit einer Pistole bewaffnet, und dort 13 Menschen erschossen. Anschließend hatte er einen Autofahrer gekidnappt, war mit ihm nach Wendlingen gefahren, hatte zwei Männer in einem Autohaus und sich anschließend selbst erschossen. Ich sollte für die ZeitungDer Tagesspiegelaus Winnenden berichten.
Auf dem Weg vom Parkplatz herrscht auf den ersten Blick die Normalität einer südwestdeutschen Kleinstadt: Am Milchstand gibt es Thymiankäse, Menschen schauen in Schaufenster, die Müllabfuhr fährt Müll ab. Ein Junge schickt sich an, bei Rot über die Ampel zu gehen, ein alter Mann hebt mahnend den Zeigefinger, der Junge macht kehrt, lächelt, wartet. »Die Blumen verkaufen sich gut heute«, sagt der Mann am Blumenstand. Und schiebt erschrocken hinterher: »Aber man will sich ja nicht am Leid bereichern.« Ich nähere mich der Realschule. Immer mehr Menschen mit verweinten Gesichtern kommen mir entgegen. Ihre geröteten Augen starr geradeaus gerichtet, gehen sie mit eingezogenen Köpfen durch die Marktstraße, die die Altstadt in der Mitte trennt. Dort trifft sich, wie an jedem Markttag, die Seniorengruppe der Arbeiterwohlfahrt, eigentlich zum Kanastern, aber heute bleiben die Karten in der Schublade. Ein knappes Dutzend älterer Herrschaften sitzt an Resopaltischen, sie suchen nach Erklärungen. Dabei war er so ein guter Tischtennisspieler, sagt einer. Und gut im Armdrücken, ein zweiter. Und ein guter Schütze, ein dritter.
Auf dem Platz vor der Realschule parken mobile Übertragungswagen von Fernsehsendern, davor reihen sich Reporter aus der ganzen Welt auf, aus Frankreich, Australien, Großbritannien und Japan. Dazwischen stehen, gehen, schleichen Kinder, Jugendliche, Erwachsene herum, und sehr viele Polizisten. Es ist ein sehr beklemmender Tag für mich. So viel Unglück auf so kleinem Raum, so viel Taubheit, Verzweiflung, Anspannung und Schmerz. »Gott, wo warst du«, steht auf auf einem Plakat, das ein junger Mann ein paar hundert Meter von der Schule entfernt hochhält.
Ich soll aktuell berichten, spreche Menschen an. Eine junge Frau sagt, sie habe Angst, auf die Straße zu gehen. Vielleicht steckt irgendwo noch jemand, irgendein Freund des Täters. Sie wisse, dass das eigentlich nicht sein kann, aber das hilft ihr nicht, nachts hat sie kaum geschlafen. »Er hat zwei Freundinnen von mir erschossen.« Sie sagt es ganz sachlich, aber ihre Fassung reicht kaum bis zum Ende des Satzes.
Ich gehe durch die Straßen, klingle an der Haustür eines Kindergartens. Von der Leiterin möchte ich wissen, welchen Eindruck sie heute von den Kindern hat. Sie erzählt, dass viele Eltern ihre Kinder am Tag nach der Tat zu Hause gelassen hätten. Die, die da sind, stellen Fragen: Warum macht der Mann das? Warum war er so böse? Die Erzieherin sieht mich so ratlos an wie wohl auch die Kinder. Ich weiß es nicht, sagt sie.
Irgendwo in diesem Gemenge muss am Tattag auch Gisela Mayer gestanden haben. Sie wollte zu ihrer Tochter Nina, einer Referendarin an der Winnenden-Realschule. Nina verlor an dem Tag ihr Leben. Gisela Mayer wollte zu ihrem Kind, wollte es sehen, es in den Arm nehmen, doch man ließ sie nicht. Als jemand fälschlicherweise behauptete, Nina sei schon abtransportiert worden, machte sie sich auf den Weg nach Hause. Dort klingelten wenig später die ersten Reporter. »Ich war noch geistesgegenwärtig genug, sie wegzuschicken.« Tags darauf aber ließ sie jemanden von der ZeitschriftBunte in ihr Haus. »Das war ein Fehler.« In den Tagen danach verkroch sie sich mit ihrer jüngeren Tochter Ibo und ihrem Mann im Haus. Sie saßen da, taten nichts, »man verliert das Gefühl für Zeit«. Die Fenster verhängten sie mit Leintüchern, damit Fotografen und Kameraleute ihnen, die in einem Tal wohnen, nicht per Tele ins Wohnzimmer filmten.
Das alles erzählte mir Frau Mayer erst Jahre später, als wir uns zum ersten Mal begegneten. Mir war meine Arbeit in Winnenden wieder eingefallen, als ich darüber nachgedacht hatte, wer mir etwas über Vergebung erzählen könnte. Ich schreibe sie an, wir telefonieren. Sie scheint froh zu sein, einmal nicht nur über »die Tat«, »den Täter«, »die Zeit und das Leben danach« sprechen zu können. Ihr spontaner Kommentar, als ich ihr sage, dass ich übers Vergeben mit ihr sprechen möchte: »Oh, darüber habe ich noch nicht weiter nachgedacht.« Ihre Neugier auf das Thema macht mich wiederum neugierig auf sie, eine gute Voraussetzung für ein gutes Gespräch.
Ich lese ihr Buch »Die Kälte darf nicht siegen – Was Menschlichkeit gegen Gewalt bewirken kann«, erschienen etwa ein Jahr nach der Tat. Darin beschreibt sie ihre abgrundtiefe Ratlosigkeit angesichts der Sinnfrage: »Nina ist einen grundlosen Tod gestorben, einen wahllosen, willkürlichen, zufälligen. Es gibt nicht einmal den Ansatz von Erklärungen, von Begründungen, die einen Zusammenhang zwischen meiner Tochter und ihrem Mörder schaffen könnten. Der Amokläufer von Winnenden kannte Nina nicht, er hatte sie nie zuvor in seinem Leben gesehen, hatte nie ein Wort mit ihr gesprochen. Ihre Begegnung auf dem Flur der Schule war die erste – und die letzte. Der einzige Grund, warum sie sterben musste, war, dass sie helfen wollte.« Wie kann man jemandem vergeben, zu dem man überhaupt keinen persönlichen Bezug hat? Dem man die Frage nach dem »Warum« allenfalls ins Grab hinab zurufen kann?
Etwa fünf Jahre nach der Tat gehe ich dieselben Wege, die ich direkt nach dem Amoklauf gegangen bin, diesmal mit einem anderen Ziel: einem Büro in der Wallstraße. »Stiftung gegen Gewalt an Schulen – Aktionsbündnis Amoklauf Winnenden« steht am Eingang. Dorthin hat mich Gisela Mayer, die der Stiftung vorsteht, eingeladen.
Mir gegenüber, zwischen Regalen voller Fachliteratur, sitzt in sehr aufrechter Haltung eine Frau mit geradem Blick aus offenen, braunen Augen, aufgeschlossen, zugewandt, präsent. Und ein bisschen geschäftsmäßig. Ich weiß, dass ich nicht der Erste bin, mit dem sie über den Mehrfachmord von Winnenden spricht, und glaube das auch an ihrer Art mir gegenüber zu bemerken: Sie antwortet klar, aber das liegt auch daran, dass sie ein paar Fragen schon einige Male gehört hat und dass die Antworten bereits vorformuliert in ihrem Kopf vorliegen.
Gisela Mayer erzählt zuerst von einer gewaltigen Leerstelle. Sie heißt »Täter«. Das, was alle Welt an diesem Tag ganz selbstverständlich »die Tat« nennt, hat Gisela Mayer lange Zeit nicht als solche erlebt. Sondern wie eine Naturkatastrophe. Als wäre die Ursache keine menschliche, als gäbe es keine Schuld, keine Verantwortung. Zu schwer, abstrakt, entfernt, zu wenig hilfreich erschienen ihr diese Begriffe, obwohl sie, die Philosophie studiert hat, mit ihnen vertraut ist.
Es fällt mir schwer, das zu verstehen: die Tat keine Tat, der Täter außen vor, wie kann das sein? Waren nicht Zeitungen, Fernsehen und Radio voll des Rätselratens, wie es zu dem Verbrechen kommen konnte? Übertrafen sich die Journalisten nicht gegenseitig in der beliebten Disziplin des Täterdeutens, frei nach dem Motto »Eine unbeantwortete Frage lässt sich jederzeit mit Spekulationen stopfen«?
Fotos von Tim K. machten damals die Runde. Auf einem Passfoto schaut ein pubertierender Junge mit länglicher Brille und akkuraten Koteletten etwas unschlüssig und ziemlich ernst in die Kamera. Ein anderes zeigt ihn lachend, offen, einladend. Mal sieht man ihn neben zwei Mitgliedern eines Sportvereins vor einem Handballtor stehen, mal Tischtennis spielen oder einen Pokal in der Hand halten. Die Fotos erinnern mich an meine eigene Pubertät. So schaut jemand, der sich unwohl fühlt in seiner Haut, emotional vielleicht ein wenig unbehaust, mit anderen Worten: Diese Fotos erscheinen mir so vollkommen normal, dass sich die Frage aller Fragen aufdrängt: Wie konnte so einer so etwas tun? Und: Warum scheint Gisela Mayer zunächst nicht nach Antworten darauf gesucht zu haben?
Die Leerstelle namens »Täter« muss so umfassend, so riesig gewesen sein, dass Mayer von ihrer Existenz noch nicht einmal wusste. Erst nach und nach füllte sie sich. Mayer beschreibt die allmähliche, behutsame Erweiterung ihres Blickfeldes. Etwas in ihrer Psyche muss gnädig genug gewesen sein, nur jeweils das zuzulassen, was sie gerade noch ertragen konnte. Ihre Tochter ist tot – schon das war zu viel Information, schon allein damit umzugehen, war Zumutung genug in den ersten ein, zwei Jahren. Sie konnte sich nicht auch noch mit dem Täter beschäftigen. Und: Sie musste ihr Leben weiterleben, auch als Ehefrau und Mutter ihrer jüngeren Ibo.
Die war das, was wohl jeder gesunde Mensch in ihrer Situation wäre: überfordert. Ein Jahr lang besuchte sie kaum die Schule – sie hielt es nicht aus darin, obwohl es sich nicht um Ninas Schule handelte. »Staatliche Schulen sehen einander sehr ähnlich«, erklärt Gisela Mayer. Die Lehrer rieten dazu, dass sie die Jahrgangsstufe wiederhole; sie brauche Zeit, müsse zur Ruhe kommen, das Geschehene erst einmal verarbeiten. Aber die Mutter kam zu einem anderen Schluss: Ibo umgab sich lieber mit älteren Schulkameraden, sie war ernsthafter geworden seit dem Tod ihrer Schwester. »Durch das, was sie erlebt hat, ist sie gereift. Diese Reifung durch Leid und Not war für sie wichtig.« Gisela Mayer fürchtete, dass sie, wenn sie eine Klasse wiederholen und dadurch mit noch jüngeren Klassenkameraden zu tun haben würde, sich entfremden würde, und setzte sich stattdessen dafür ein, dass Ibo im bisherigen Klassenverband bleiben durfte, auch wenn sie große Teile des Unterrichts versäumt hatte. Das war der richtige Weg, Ibo schaffte die Klasse.
»In äußeren Angelegenheiten konnte ich für sie da sein«, sagt Mayer im Rückblick. Etwa wenn sie der Versuchung widerstand, ihre Tochter über die Maßen zu behüten, als es während der Pubertät darum ging, das Nachtleben zu erkunden: Zu wem steigt sie ins Auto, wie lange bleibt sie weg? »Es hat mich Überwindung gekostet, ihr den nötigen Freiraum zu geben.« Trotzdem sagt sie rückschauend: »Ich habe ihr Unrecht getan damals: Ich hätte noch mehr für sie da sein müssen, sie auffangen müssen. Aber ich war dazu nicht in der Lage. Mein Gefühlsleben war erstarrt, wie tot. Mit den Gefühlen ist es nämlich so: Sie können den Deckel drauf halten, aber dann auf allen Gefühlen: auf Trauer, Verzweiflung, Wut, Hass und was da sonst noch ist. Was nicht geht, ist ein selektives Aufarbeiten: Nina nachweinen, aber über den Täter nicht nachdenken«.
Erst Jahre später waren die beiden in der Lage, darüber zu sprechen. Ihre Tochter sagte ihr, dass sie Wärme vermisst hat und Aufmerksamkeit. »Weil die Wärme tot war in mir«, sagt Mayer heute, »nicht weil ich sie nicht geben wollte.« Im Nachhinein wurde Mayer auch klar, unter welchem Druck ihre Tochter stand. »Sie wurde von Ibo Mayer zur Schwester von Nina Mayer. Ich habe es erst spät mitgekriegt: Neben ihrem eigentlichen Verlust hat sie auch noch ein Stück ihrer eigenen Identität verloren.«
Auch das gehört zu dem Päckchen, nein, dem Packen, der zu bewältigen und zu verzeihen ist: nicht nur der Tod der Tochter, sondern auch die Verwerfungen, die dadurch erst entstehen, die Versäumnisse, die aus Überforderung erwachsen und aus der Tatsache, dass das Leben Frau Mayer keine Pause schenkt, nachdem die Tochter getötet worden ist. All das hatte sie mit sich selbst auszumachen. Sie musste damit umgehen, Verantwortung nicht gerecht zu werden, sich nicht um Kind und Mann kümmern zu können, weil sie erst einmal die Sicht auf sich selbst klar kriegen muss. Fühlte sich Frau Mayer schuldig deshalb? Sie seufzt. »Gute Frage. Ja, Manchmal. Ich habe mir manchmal Vorwürfe gemacht, weil ich ihre Lage nicht gesehen habe und selbst nicht in der Lage war, offen und aufmerksam zu sein.«