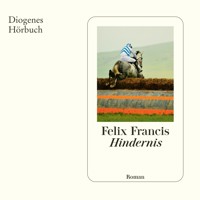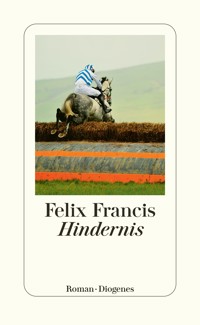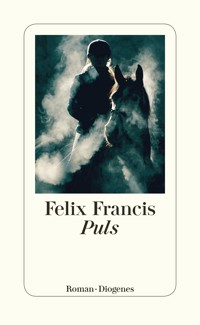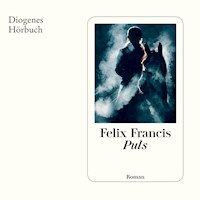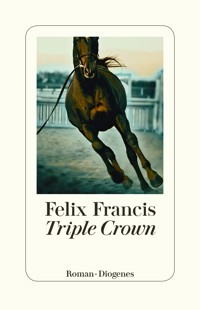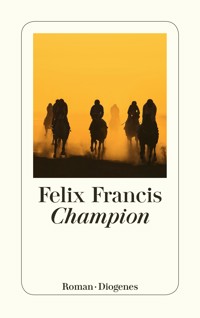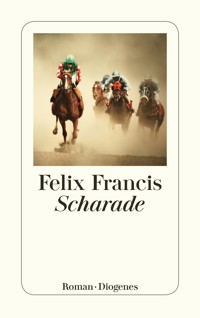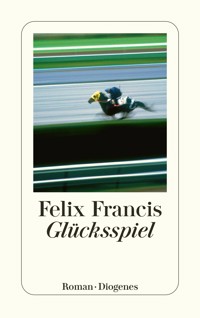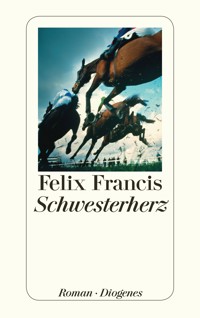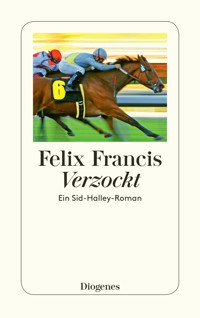
13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Sid Halley
- Sprache: Deutsch
Als Privatdetektiv hatte Sid Halley jahrelang erfolgreich Fälle im Rennbahnmilieu gelöst. Er war verfolgt, verprügelt und angeschossen worden. Er dachte, er hätte all das hinter sich. Er lag falsch. Seiner Familie zuliebe hatte Sid Halley das gefährliche und unwägbare Leben als Ermittler aufgegeben. Und nichts in der Welt würde daran etwas ändern können. Bis man ihm ein Ultimatum stellt, das er nicht ablehnen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Felix Francis
Verzockt
Ein Sid-Halley-Roman
Roman
Aus dem Englischen von Malte Krutzsch
Diogenes
{5}Für meinen Enkel Samuel Richard Francis und wie immer mit besonderem Dank an Debbie
{7}1
»Nein«, sagte ich. »Ausgeschlossen.«
»Es muss sein, Sid.«
»Warum?«
»Zum Wohl des Galopprennsports.«
Die Taktik kannte ich.
»Ich bin doch in Rente«, erwiderte ich. »So was mache ich nicht mehr.«
Sir Richard Stewart, Vorsitzender der obersten britischen Rennsportbehörde BHA, hatte sich nicht vom Regalauffüller zum Geschäftsführer der größten Supermarktkette auf der Insel hochgearbeitet, indem er »Nein« als Antwort gelten ließ.
»Ach, kommen Sie, Sid«, sagte er mit einem schlauen Lächeln. »Jeder weiß, dass Sid Halley immer noch zu den Besten gehört.« Sir Richard knuffte mich in den Arm. »Und Sie wollen es doch auch.«
Wollte ich das?
Privatdetektiv war ich seit knapp sechs Jahren nicht mehr. Inzwischen hatte ich mich als einigermaßen erfolgreicher unabhängiger Investor etabliert, hauptsächlich im Handel mit Blue Chips auf den großen Märkten, zunehmend aber auch mit der Finanzierung junger Unternehmer, die gute Ideen hatten, aber knapp bei Kasse waren.
{8}Sechs relativ stressfreie Jahre, in denen niemand darauf aus gewesen war, mich zu verprügeln oder Schlimmeres.
»Nein«, wiederholte ich entschieden. »Ich möchte wirklich nicht, weder jetzt noch überhaupt.«
Das hörte Sir Richard offensichtlich gar nicht gern.
»Sid«, und er zog den Namen ein paar Sekunden in die Länge, »darf ich Ihnen etwas im Vertrauen sagen?«
»Selbstverständlich.«
Er beugte sich zu mir vor, als hätte er Angst, belauscht zu werden, dabei saßen wir allein im Wohnzimmer meines Hauses in Oxfordshire.
»Ich befürchte ernsthaft, dass die ganze Zukunft unseres Sports auf dem Spiel steht.« Mit hochgezogenen Augenbrauen und zusammengepressten Lippen nickte er mir zu, als wollte er das Gesagte unterstreichen. »Der Rennsport lebt von seiner Integrität. Klar, natürlich kann fast jeder von verschobenen Rennen und gedopten Pferden erzählen, aber im Großen und Ganzen ist der Rennsport eine saubere Sache. Sonst wäre das Vertrauen nicht da, das die Leute zum Wetten brauchen, und wo kämen wir da hin?«
Ich schwieg.
»Deshalb investieren wir von der BHA so viel Zeit und Geld in Dopingkontrollen und ahnden Verstöße so streng. Es macht uns nicht gerade Spaß, jemandem die Lebensgrundlage zu entziehen, aber andere müssen abgeschreckt werden.«
Ich nickte. All das war mir bekannt.
»Weshalb dann die Panik?«, fragte ich.
»Ich bin überzeugt, dass jemand dabei ist, das System {9}auszuhebeln. Durch Wettmanipulation. Deshalb brauchen wir Sie.«
»Und der Sicherheitsdienst der BHA?«, fragte ich. »Können die dem nicht nachgehen?«
»Ich habe sie dazu angehalten«, seufzte er. »Es sei alles in Ordnung, und ich sei im Irrtum, hieß es. Aber ich weiß, dass ich recht habe.«
»Und woher?«
»Ich weiß es einfach.«
Schlüssig klang das nicht gerade, aber Sir Richard hatte schon oft für gewagte Überzeugungen eingestanden und sich noch selten geirrt.
»Es tut mir leid«, sagte ich im Aufstehen, »ich kann Ihnen trotzdem nicht helfen.«
Sir Richard sah mich an. »Können oder wollen Sie nicht?«
»Beides. Und wahrscheinlich wäre ich ohnehin nicht zu gebrauchen. Ich habe das Detektivspielen verlernt.«
»So ein Quatsch!« Sir Richard erhob sich ebenfalls. »Haben Sie auch das Atmen verlernt? Der Sid Halley, den ich kannte, hat mit geschlossenen Augen mehr erfasst als die ganze Londoner Polizei mit offenen.«
Ich schaute ihn aus fünfundzwanzig Zentimetern Entfernung an.
»Ich bin nicht mehr der Sid Halley, den Sie kannten.«
Er sah mir in die Augen, bis ich mich nach ein paar Sekunden abwandte.
»Das ist wirklich schade«, meinte er seufzend.
Mir war jämmerlich zumute, aber mehr konnte ich dazu nicht sagen.
{10}»Dann gehe ich wohl besser.« Sir Richard nahm seine Aktentasche vom Sofa. »Hier verschwende ich offensichtlich meine Zeit.«
Jetzt war er nicht nur enttäuscht, sondern obendrein verärgert.
»Ich finde selbst hinaus«, brummelte er mit einem Rest an Höflichkeit. Er wandte sich zum Gehen.
»Sir Richard.« Ich legte ihm die Hand auf den Arm. »Es tut mir sehr leid, aber ich mache so was nicht mehr.«
»Das hat mir der gute Admiral Roland vorige Woche auch gesagt, bloß war ich etwas skeptisch.« Er hielt inne und sah mir wieder in die Augen. »Sid, ich bin fest überzeugt, dass der Rennsport, wie wir ihn kennen und lieben, in Gefahr ist.«
Er hat Angst, dachte ich. Richtig Angst.
»Was für Beweise haben Sie?«, hörte ich mich fragen.
Verdammt. Nicht doch. Ich durfte mich da nicht reinziehen lassen.
Sir Richard klappte die Aktentasche auf und zog eine durchsichtige Plastikmappe mit einigen Bogen Papier hervor. »Ich habe eine Liste der Rennen zusammengestellt, deren Ausgang mir manipuliert worden zu sein scheint.«
»Was für faktische Beweise haben Sie denn?«, fragte ich.
»Glauben Sie mir nicht?« Sir Richard schnaubte durch die Nase und richtete sich zu voller Größe auf, so dass er mich gut und gern um einen Kopf überragte.
»Ob ich Ihnen glaube, spielt keine Rolle«, ging ich über seine Entrüstung hinweg. »Aber stichhaltige Beweise möchte ich schon gerne sehen.«
{11}»Heißt das, Sie helfen mir doch?« Er schöpfte wieder Hoffnung.
»Nein«, sagte ich. »So habe ich das nicht gemeint. Aber wenn Sie möchten, werfe ich mal einen Blick auf Ihre Liste.«
Er gab mir die Mappe. »Behalten Sie sie. Ich habe Kopien davon.«
»Mit wem haben Sie sonst noch darüber gesprochen?«, fragte ich.
»Wie meinen Sie das?«
»Mit wem außer dem BHA-Sicherheitsdienst haben Sie darüber gesprochen? Hat sonst noch jemand Ihre Liste gesehen?«
Meine Fragen schienen ihn zu überraschen. »Ja, schon.«
»Wer denn?«, hakte ich nach.
»Einige Kollegen vom BHA-Vorstand. Und meine Sekretärin natürlich. Die hat sie mir abgetippt.« Er lächelte.
»Sonst noch jemand?«
»Der eine oder andere in meinem Club. Der Admiral zum Beispiel. Ihn wollte ich überreden, sich an Sie zu wenden.«
Ich seufzte innerlich, sagte aber nichts.
»Ist das ein Problem?«, fragte er.
»Es wäre vielleicht klüger, Ihre Sorge für sich zu behalten. Wenigstens, bis etwas bewiesen ist.«
»Beweise scheint ja niemand suchen zu wollen«, entgegnete er gereizt. »Alle glauben, ich spinne mir da was zusammen.«
»Trotzdem sollten Sie Ihren Verdacht vielleicht nicht so herumtragen. Es könnte an die falschen Ohren dringen. Wenn tatsächlich was läuft, sollen die Täter ja nicht dahinterkommen, dass Sie ermitteln.«
{12}»Wo ermittle ich denn?«, gab er verärgert zurück. »Und wenn ich mit ein paar Leuten aus dem Club rede, ist das ja wohl noch kein Herumtragen.«
Ich hielt lieber den Mund, aber wenn ich aus zehn Jahren Detektivarbeit etwas gelernt hatte, dann, dass man mit Geheimhaltung und Überraschung normalerweise am besten fuhr.
Und die Zugehörigkeit zu Sir Richards Club wies nicht jeden gleich als vorbildliches Mitglied der Gesellschaft aus. Seit Jahrhunderten durchläuft ein steter Strom von Schwindlern, Hochstaplern, Dieben und Mördern die britischen Gefängnisse, und nicht wenige davon waren Mitglieder der angesehensten Londoner Herrenclubs.
»Sid, helfen Sie mir?«, fragte Sir Richard. »Zum Wohl des Rennsports.«
»Ich sehe mir Ihre Liste an.«
»Gut.«
»Aber ermitteln werde ich nicht«, schob ich schnell nach. »Das habe ich, wie gesagt, aufgegeben.«
»Ihre Einschätzung bekomme ich aber?«
»Ja. Ich sehe mir die Liste an und sage Ihnen, was ich davon halte.«
Er nickte, als genügte ihm das. »Dann gehe ich jetzt mal, sonst verpasse ich den Zug.«
»Fahren Sie nach London zurück?«, fragte ich.
Er schüttelte den Kopf. »Nein, zu meinem Haus bei Winchester. Von Banbury aus geht da jede Stunde ein Zug.«
»Soll ich Sie zum Bahnhof bringen?«
»Nein danke.« Er lächelte. »Ein Taxi wartet auf mich.«
{13}Wir traten in den Märzsonnenschein hinaus, und ich ging mit ihm zum Wagen. Als sie losfuhren, winkte ich. Bildete er sich das ein, oder stimmte wirklich etwas nicht mit dem britischen Rennsport? Und wenn nicht ging mich das noch etwas an?
Ich stand noch mit erhobenem rechten Arm auf der Straße, als Marina mit unserem Range Rover den Berg herunterkam und durchs Tor bog.
»Wer war das?«, rief sie im Aussteigen. Sie hielt eine leuchtend grüne Tragetasche in der Hand.
»Sir Richard Stewart«, sagte ich.
»Und wer soll das sein?«
»Der Vorsitzende der Britischen Rennsportbehörde.«
»Was wollte er denn?«
»Er möchte, dass ich irgendwelchen krummen Machenschaften im Rennsport nachgehe.«
Steif blieb sie vor mir auf dem Kiesweg stehen.
»Und was hast du gesagt?«
»Dass ich keine Ermittlungen mehr anstelle.«
Sie entspannte sich ein wenig, besonders in der Hals- und Schulterpartie.
»Gut.«
»Was hast du gekauft?«, wechselte ich das Thema.
Sie lächelte. »Etwas für Sassy. Ich konnte nicht widerstehen.« Sie griff in die Tasche und zog ein rosafarbenes Kinderkleid mit blauen Streifen und gelber Stickerei auf dem Leibchen hervor. »Ist das nicht süß? Und es war im Angebot.«
»Hübsch«, sagte ich.
Sassy war unsere Tochter. Saskia, genau gesagt. Kessy {14}hätte auch zu ihr gepasst. Sechs Jahre war sie alt, angehende sechzehn, und wurde schneller groß, als mir lieb war.
»Das kann sie zu Annabels Geburtstag anziehen.«
Annabel war Sassys beste Freundin in der Schule.
»Hübsch«, sagte ich noch einmal.
Wir gingen in die Küche, und Rosie, eine unserer beiden roten Setterhündinnen, kam zu uns und schmiegte sich in der Hoffnung auf ein Leckerli an mein Bein.
»Was für krumme Machenschaften?«, fragte Marina ohne Betonung.
»Ach, nichts.« Ich winkte ab. »Sir Richard spinnt sich was von manipulierten Rennergebnissen zusammen. Sein eigener Sicherheitsdienst sagt aber, da ist nichts dran, und das sind keine Hohlköpfe.«
»Und du hast ihm gesagt, es interessiert dich nicht?«
»Ja. Keine Sorge. Es liegt mir fern, irgendwelche Ermittlungen anzustellen. Er möchte, dass ich mir eine Liste von Rennen ansehe, die seiner Ansicht nach nicht ganz koscher waren.«
»Und das machst du?«
»Ich werfe nachher mal einen Blick drauf.«
Sie war nicht glücklich damit. Ich sah es ihr an.
Marina und ich waren aus London weggezogen, als sie im siebten Monat mit Saskia schwanger war. Es sollte ein Neuanfang sein – in ländlicher Ruhe.
Sie hatte mir zwar nicht direkt ein Ultimatum gestellt, aber doch ziemlich auf den Tisch gehauen. Sie liebe mich und habe versucht, meinen Beruf positiv zu sehen, aber ein Leben, bei dem sie an jeder Ecke auf Ganoven mit Schlagringen oder schallgedämpfter Pistole gefasst sein müsse, könne {15}sie nicht mehr führen. Die dauernde Angst zehre zu sehr an ihr, und mit dem Baby werde alles nur noch schlimmer.
Entweder sie oder der Beruf, hieß das.
Die Entscheidung war mir leichtgefallen.
Als Jockey hatte ich seinerzeit den Beruf über meine erste Frau gestellt, und rückblickend war das ein Fehler gewesen.
Marina konnte ich keinen Vorwurf machen. Man hatte sie angeschossen, zusammengeschlagen und immer wieder bedroht, um mich von meinen Ermittlungen abzubringen.
Denn in Verbrecherkreisen hatte sich herumgesprochen, dass es kontraproduktiv war, sich an Sid Halley selbst zu vergreifen. Der schlug dann nur umso heftiger und entschlossener zurück.
Also hatten sich die krummen Hunde, mit denen ich es berufshalber in schöner Regelmäßigkeit zu tun bekam, darauf verlegt, meine Freundin anzugreifen und sie als Druckmittel gegen mich einzusetzen.
Letztlich hatten sie damit Erfolg gehabt.
Auch das Streben nach Wahrheit und Gerechtigkeit muss im Verhältnis stehen. Ich kam zu dem Schluss, dass die Welt ohne das Eingreifen Sid Halleys ihren gerechten oder ungerechten Lauf nehmen sollte.
So wurde ich zum liebenden Ehemann und vernarrten Papa.
Aber mein früherer Beruf blieb gespenstisch präsent – schwer zu ignorieren, selten angesprochen und doch immer da.
Nur gelegentlich rückte das Gespenst so in den Vordergrund wie jetzt und ließ Marina erschauern.
{16}Ich nahm die Plastikmappe mit, als ich Sassy von der Schule abholen fuhr.
»Bring auch Annabel mit«, rief Marina mir durchs Küchenfenster zu. »Sie übernachtet heute bei uns.«
»Etwas ungewöhnlich für Mitte der Woche, oder?«
»Tim und Paula sind für heute Abend nach London gefahren. Ein formelles Essen oder so was.«
»Gut, ich denke dran.«
Meine Tochter täglich von der Schule abzuholen war mir ein echtes Vergnügen. Sie strahlte immer übers ganze Gesicht, wenn sie herauskam, und brannte so sehr darauf, mir zu erzählen, was sie alles erlebt hatte, dass sie beinah das Luftholen vergaß.
Ihre Schule lag nur anderthalb Kilometer entfernt im Nachbardorf, aber meistens kam ich zu früh hin und musste erst noch zehn Minuten auf Sassy warten. Heute war ich extra früh losgefahren, weil ich in Ruhe Sir Richards Listen durchsehen wollte.
Wie üblich parkte ich den Range Rover gegenüber dem Schuleingang, dann nahm ich die Plastikmappe vom Beifahrersitz.
Neun Rennen waren auf den beiden Seiten verzeichnet, aber wie sie zu der Ehre kamen, ging nicht daraus hervor. Auf den ersten Blick war nichts Auffälliges an ihnen und nichts, was sie unmittelbar verband.
Drei Hürdenrennen, sechs Jagdrennen. Alle hatten in den vergangenen sechs Monaten stattgefunden, zur Hauptzeit der Hindernissaison, immer an den wichtigen Renntagen, aber keines der neun war ein Hauptrennen gewesen. Nur zwei hatte der Favorit oder der zweite Favorit {17}gewonnen, und alle hatten Siegquoten von mindestens 6:1 erzielt.
Dennoch fiel mir nichts Merkwürdiges oder Ungewöhnliches an ihnen auf.
Warum standen sie also auf der Liste?
Sir Richard Stewart hatte bei seinem Verdacht vielleicht etwas zu viel Phantasie entfaltet, aber er war nicht dumm. Er musste einen Grund für das Zusammenstellen der Liste gehabt haben und hatte offensichtlich erwartet, dass der sich mir erschloss. Bis jetzt war das allerdings nicht der Fall. Vielleicht musste ich mir erst die Videos von den Rennen anschauen.
»Guten Tag, Mr. Halley«, rief jemand.
Ich sah nach rechts zum Schultor hinüber.
»Tag, Mrs. Squire«, grüßte ich durchs offene Fenster zurück.
Mrs. Squire war die Rektorin und hatte die Angewohnheit, sich ans Tor zu stellen, wenn die Schule aus war.
»Sie sollen heute auch Annabel Gaucin mitnehmen, glaube ich.«
»Stimmt.«
Mrs. Squire nickte mir zu und widmete sich dann einer Gruppe von Müttern, die am Tor wartete, zum Teil mit Kinderwagen, in denen die Lernbegierigen der Zukunft saßen.
Die Kinder stürzten aus dem Gebäude und jagten wie üblich holterdiepolter über den Schulhof. Ich stieg aus dem Range Rover und ging über die Straße. Sassy war immer als eine der Ersten am Tor – sie hatte ja den Rennsport im Blut –, aber die offenbar damenhaftere Annabel ließ {18}anderen den Vortritt, so dass Sassy und ich ein paar Augenblicke warten mussten, bis sie bei uns war.
»Hallo, Papa«, rief Sassy und winkte wild.
Von diesem Papa konnte ich nicht genug bekommen.
»Hallo, Schätzchen«, rief ich zurück.
Mrs. Squire ließ sie durchs Tor, und sie kam zu mir gerannt und griff nach meiner Hand, nach der rechten, der echten Hand, nicht nach dem Gegenstück aus Plastik und Stahl an meinem linken Arm.
Kurz darauf ließ Mrs. Squire auch Annabel durch, und sie kam zu uns.
»Nimm Saskias linke Hand«, sagte ich ihr, und indem wir ständig nach beiden Seiten schauten, überquerten wir nebeneinander die Straße. Von den Autos der anderen Eltern abgesehen, herrschte zwar kaum Verkehr, aber man konnte nicht vorsichtig genug sein.
Saskia, mein ganzer Stolz, war auf den Tag genau neun Monate nach meiner Heirat mit Marina zur Welt gekommen.
»Ein Hochzeitsnachtbaby«, hatte ein Freund mal mit einem Augenzwinkern zu mir gesagt. »Gut, dass sie nicht früher gekommen ist.«
Ich hatte zurückgegrinst und bei mir gedacht, gut, dass sie mit Verspätung gekommen ist. Marina war definitiv schon in anderen Umständen gewesen, als sie vor dem Altar »Ja« sagte.
Es schien alles so einfach. Wir hatten die Verhütung sein lassen, und Marina war im Handumdrehen schwanger geworden. Umso frustrierender war es dann, dass sie seit Saskias Geburt nicht mehr hatte empfangen können. Wir hatten sämtliche anerkannten Spezialisten aufgesucht, und {19}alle meinten, medizinische Gründe lägen nicht vor. Wir sollten uns entspannen, dann ginge es schon. Tja, wir hatten uns entspannt, aber in sechs Jahren war nichts passiert, und allmählich fanden wir uns damit ab, dass Sassy wohl unser einziges Kind bleiben würde.
Allerdings war Marina noch jung, und wir versuchten es mit Freuden weiter.
Während Marina mit den beiden Mädchen und den Hunden einen Spaziergang durchs Dorf machte, sah ich mir im Arbeitszimmer die Videos von den neun Rennen auf der Website der Racing Post an.
Den schriftlichen Details hatte ich nicht entnehmen können, dass keines dieser Rennen knapp entschieden worden war. Der Sieger hatte jeweils klar in Front gelegen, kaum bedrängt von den anderen.
Das war an sich noch nicht ungewöhnlich. Viele Jagdrennen werden durch gutes Springen über die ganze Strecke gewonnen, nicht durch einen Sprint auf den letzten zweihundert Metern.
War Sir Richard also misstrauisch, weil er dachte, die anderen hätten sich nicht bemüht?
Ich ging die einzelnen Jockeys durch.
Viele von ihnen waren in mehr als einem der fraglichen Rennen gestartet. Aber ein durchgehendes Muster – etwa, dass jedes Mal derselbe Jockey gesiegt hätte – war nicht zu erkennen.
Ich sah mir erneut die Liste an. Zu den Daten der einzelnen Rennen gab es Anmerkungen und Kommentare, die vermutlich von Sir Richard stammten.
{20}Zu einem Rennen in Sandown hatte er notiert: »Eventualquote 8:1, am Toto nur £ 5,60 für den Sieg.« Und zu einem in Newbury: »Sieger 10:1, am Toto nur £ 7,20.«
Die meisten anderen Kommentare lauteten ähnlich. Das Toto zahlte in allen Fällen weniger, als man es bei den Eventualquoten hätte erwarten können.
Der Totalisator setzt Quoten anders fest als die Buchmacher.
Bietet ein Buchmacher einen Kurs von 8:1 an und das Pferd siegt, zahlt der Buchmacher für jedes gesetzte Pfund acht Pfund aus, unabhängig davon, wie viele Leute die Wette eingegangen sind. Und die Eventualquote ist ein aus den Buchmacherquoten beim Start errechneter Durchschnittswert.
Das Toto hingegen geht vom Wettumsatz aus, das heißt, der gesamte auf die Teilnehmer eines Rennens gesetzte Betrag wird schlicht durch die Anzahl der Gewinnscheine geteilt, und daraus ergibt sich der Gewinn. Die Totoquote entspricht daher selten der Eventualquote, mal liegt sie drüber, mal drunter, aber dass sie so viel niedriger ausfällt wie bei den Rennen auf der Liste, ist sehr ungewöhnlich.
Dieser niedrige Totogewinn ließ sich nur damit erklären, dass am Totalisator ungleich höhere Beträge auf die Siegpferde gesetzt worden waren als bei den Buchmachern.
Vielleicht war das der Grund für Sir Richards Argwohn.
Einen solchen Wirbel brauchte man darum aber eigentlich auch nicht zu machen.
Jeder im Rennsport weiß, dass hohe Wetteinsätze am Totalisator kontraproduktiv sein können, da sie auf die Gewinnquote drücken. Man gewinnt lediglich das Geld {21}zurück, das man gesetzt hat, abzüglich der vierundzwanzig Prozent, die der Totalisator einbehält, um seine Unkosten zu decken und etwas zu verdienen.
Was hatte man davon? Es war verrückt. Erst recht, wenn man bei den Buchmachern bessere Quoten bekam.
Totowetten sind allerdings viel anonymer als Wetten beim Buchmacher, der einen Stammkunden mit dicker Brieftasche leicht wiedererkennt. Und Buchmacher sind die Ersten, die Betrug wittern, wenn ein hoch gewetteter Außenseiter mit Weile gewinnt, denn dann zahlen sie drauf. Dem Toto jedoch ist egal, welches Pferd gewinnt. Es kassiert seine vierundzwanzig Prozent und schaut nur danach, wie viel Geld insgesamt auf die Starter gesetzt wurde. Je höher der Einsatz, desto mehr Kasse. Über unverhältnismäßig hohe Wetten auf den Sieger könnten sich höchstens die anderen Gewinnscheininhaber beklagen, aber sie werden es als Pech abtun, wenn ihr Totogewinn bescheidener als erwartet ausfällt. Wer hadert auch schon, wenn er gerade auf einen Sieger gesetzt und bares Geld gewonnen hat? Da feiert man doch lieber.
Bei den großen Meetings sind buchstäblich Hunderte Wettschalter geöffnet, und das gestresste Personal achtet wenig bis gar nicht darauf, von wem das Geld kommt. Wer es darauf anlegt, kann im Laufe eines Nachmittags viele tausend, wenn nicht zigtausend Pfund auf ein bestimmtes Pferd setzen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen.
Ich sah mir die Liste nochmals an.
Alle neun Rennen hatten in der zweiten Hälfte des Tagesprogramms stattgefunden, und sieben waren entweder das letzte oder vorletzte Rennen des Tages gewesen.
{22}Reichlich Zeit, das Geld zu setzen.
Und an einem gutbesuchten, wichtigen Renntag ist der Gewinnpool im Allgemeinen so groß, dass einer massiven Wette kein »Verdünnungseffekt« zukommt; eine Quote von 5:1 oder 6:1 kann man nicht direkt schlecht nennen.
Schon gar nicht, wenn, wie Sir Richard angedeutet hatte, jemand den Ausgang der Rennen im Vorhinein kennt.
{23}2
»Papa, Papa, komm, spiel mit uns.«
Sassy und Annabel kamen in mein Büro gelaufen.
»Wo ist denn Mami?«, fragte ich.
»Die bügelt«, antwortete Sassy ironisch. »Sie sagte, wir sollten dich fragen.«
Ich schmunzelte. Marina bügelte sehr ungern.
»Bitte«, quengelte Sassy.
»Okay«, sagte ich. »Was wollt ihr spielen?«
»Fangen«, rief Annabel, aufgeregt auf der Stelle hüpfend.
Nein, dachte ich, nicht Fangen. Nicht mit nur einer richtigen Hand.
»Was haltet ihr von Pingpong?«
»Au ja«, riefen die Mädchen begeistert.
Also gingen wir in die Garage, wo die Tischtennisplatte stand, und ich spielte eine halbe Stunde lang gegen die beiden, wenn der Ball auch meistens am Boden oder unterm Tisch landete.
»Wollt ihr ein Eis?«, fragte ich.
Schon waren die Tischtennisschläger passé, und wir labten uns in der Küche an Vanille-Erdbeer-Eis mit bunten Zuckerstreuseln.
»Onkel Sid«, sagte Annabel auf einmal.
»Ja, Annabel?«
{24}»Was ist mit deiner linken Hand?« Sie wies mit dem Löffel darauf.
Die Unschuld sechsjähriger Kinder, dachte ich.
»Er hat keine«, antwortete ihr Sassy schlicht. »Die ist aus Plastik.«
Ich blickte besorgt zu Annabel, weil ich dachte, sie sei über die Auskunft vielleicht bestürzt, aber sie schien nicht im mindesten beunruhigt.
»Darf ich sie mir mal ansehen?«, fragte sie.
Widerstrebend legte ich meine Linke auf den Küchentisch.
Sassy knöpfte meine Manschette auf und schob den Hemdsärmel bis über meinen Ellbogen zurück. Mit großem Vergnügen weihte sie Annabel in das myoelektrische Wunderwerk ein.
»Das ist die Batterie.« Sie wies auf einen rechteckigen Block von siebeneinhalb mal zweieinhalb Zentimetern in dem Unterarm aus Fiberglas. »Damit funktioniert die Hand.«
»Wie denn?«, fragte Annabel.
»Los, Papa«, befahl Sassy, »mach auf.«
Ich konzentrierte mich, und mit einem kaum hörbaren Surren glitten die künstlichen Finger- und Daumenglieder auseinander, und die Plastikhand öffnete sich.
»Wow«, sagte Annabel. »Cool.«
Als cool hätte ich das nicht bezeichnet.
Sensoren im Plastikarm fingen die Nervenimpulse meiner Haut auf und setzten winzige verborgene Motoren in Gang, die die latexverkleideten Stahlfinger bewegten.
So raffiniert das war, cool war es nicht.
{25}Im Gegenteil, ich fand das Ding eher lästig, und es ging mir zunehmend auf die Nerven. An manchen Tagen legte ich es gar nicht an, aber Marina hielt es für besser, wenn Saskia einen Vater hatte, der »normal« aussah.
Inzwischen benutzte ich fast nur noch die rechte Hand.
Das war nicht immer so gewesen. Früher hatte ich zwei Hände gehabt und mit ihrer Hilfe viermal den Titel als bester Jagdrennreiter gewonnen. Dann hatte ein Rennunfall meiner Karriere ein Ende gesetzt und meine linke Hand unbrauchbar gemacht. Ein Sadist mit einem Schürhaken hatte die versehrte Hand dann endgültig zerstört. Das war jetzt rund vierzehn Jahre her, aber ich hatte mich nie ganz daran gewöhnt.
Im Traum hatte ich immer noch zwei Hände.
»Jetzt mach sie wieder zu«, sagte Sassy.
Erneut konzentrierte ich mich, und die Finger schlossen sich. Das sah vielleicht ganz echt aus, aber ich spürte es nicht. Ich merkte nicht, ob sich die Hand um etwas schloss, oder wie fest. Ein Weinglas konnte mir aus der Hand fallen oder unter meinem Griff zerbrechen, ohne dass ich es mitbekam.
»Darf ich auch mal?«, fragte Annabel.
»Du spinnst wohl«, meinte Sassy zu ihr. »Dafür muss doch erst dein Arm ab sein.« Sie ließ die rechte Hand wie ein Hackebeil auf ihren linken Unterarm niedersausen.
Annabel schwieg, aber ihrem enttäuschten Gesicht nach überlegte sie, ob sich für so eine Plastikhand das Abhacken nicht lohnte.
»Jetzt raus mit euch beiden«, sagte ich, zog mir den Ärmel wieder übers Handgelenk und knöpfte mit den flinken {26}Fingern meiner rechten Hand die Manschette zu. »Spielt im Garten. Ich habe zu tun.«
Von der Spüle aus sah ich ihnen eine Weile durchs Fenster zu. Sie warfen sich auf dem Rasen einen Tennisball zu, und die Hunde flitzten von einer zur anderen in der Hoffnung, dass der Ball runterfiel, was auch oft genug passierte.
Ich grinste.
Kinder machen so viel Freude.
Gegen fünf rief ich Sir Richard zu Hause an.
»Ich habe mir Ihre Liste angesehen«, sagte ich.
»Das ging ja schnell«, erwiderte er. »Und was halten Sie davon?«
»Wie Sie auf Unregelmäßigkeiten bei den Wetten kommen, vielleicht mit hohen Wetteinsätzen am Totalisator, das verstehe ich zwar, aber nicht, warum Sie daraus schließen, dass die Rennen abgesprochen worden sind. Dafür können ja andere hohe Totowetten geplatzt sein.«
»Es sind aber doch Muster zu erkennen«, beharrte er. »Immer die großen Renntage.«
»An denen wird nun mal am meisten gewettet«, sagte ich. »Unser Toto-Vielsetzer hat vielleicht eine Vorliebe dafür. Und wie sollen die Rennen denn abgesprochen worden sein?«
»Das weiß ich nicht«, antwortete er.
»Die Pferde wurden getestet, nehme ich an.«
»Ja, alle platzierten Pferde wurden routinemäßig einem Dopingtest unterzogen, und alle waren negativ.«
»Und die anderen?«, fragte ich.
{27}»Bei nichtplatzierten Startern werden ja Stichproben gemacht, darüber weiß ich hier aber nichts Genaues. Allerdings weiß ich, dass dieses Jahr noch überhaupt kein Springer positiv getestet worden ist.«
»Haben Sie die Jockeys befragt?«
»Der Chef des Sicherheitsdienstes hat auf meinen Verdacht hin mit einem oder zweien geredet, aber ohne Ergebnis. Mir wurde vorgehalten, ich hätte Wahnvorstellungen und mir das Ganze ausgedacht.«
»Jetzt übertreiben Sie aber«, sagte ich.
»Nein«, widersprach er, und sein Unmut war nicht zu überhören. »Ich weiß, dass sich das ganze Amt über mich lustig macht und meint, ich sei zu alt für den Posten und nicht mehr ganz richtig im Kopf, aber glauben Sie mir, die irren sich.«
Er hielt inne, und ich schwieg.
»Deshalb sollen Sie untersuchen, was da vorgeht, Sid, und dem ein Ende bereiten, ehe der Rennsport irreparablen Schaden nimmt.«
»Ich führe wie gesagt keine Ermittlungen mehr durch, Sir Richard. Wenn Ihr eigener Sicherheitsdienst Ihnen sagt, dass da nichts läuft, sollten Sie vielleicht auf ihn hören. Peter Medicos ist nicht dumm, und wenn er auch nur den leisesten Hauch von Betrug wittert, bleibt er mit der Nase dran.«
Peter Medicos leitete den Sicherheitsdienst der BHA, seit er vor sieben Jahren als Chef der Kripo Lancashire aus dem Dienst geschieden war.
»Hm«, schnaubte Sir Richard laut durch die Leitung. Offensichtlich teilte er meine Zuversicht nicht. »Ich bin {28}doch sehr enttäuscht von Ihnen, Sid. Wieso erkennt bloß niemand, was da vorgeht?« Viel Frust, aber auch eine ganze Portion Angst klang aus der Frage. »Na, ich gedenke jedenfalls herauszufinden, was da gespielt wird. Und ich finde es heraus, ob Sie mir dabei helfen oder nicht.«
Er legte unvermittelt auf, und es piepte aus dem Hörer.
War da etwas im Gang, oder bildete er es sich nur ein?
Interessierte es mich überhaupt?
Ja, vielleicht schon.
Ich suchte Marina und fand sie im Wohnzimmer, wo sie sich mit Sassy und Annabel einen Disney-Trickfilm im Fernsehen anschaute.
»Ich fahre zu Charles«, sagte ich. »Nur kurz. Zum Abendessen bin ich wieder hier.«
Marina sah mich vom Sofa aus an und war sichtlich nicht erfreut. Sie wusste genau, warum ich mit Charles sprechen wollte.
»Papa, Papa, du musst uns nachher bitte noch was vorlesen«, flötete Sassy.
»Gut«, sagte ich. »Um halb acht bin ich wieder hier und lese euch eine Geschichte vor. Aber dann müsst ihr im Bett sein.«
Plötzlich war sie gar nicht mehr so wild darauf. »Annabel übernachtet doch bei uns. Darf ich da nicht länger aufbleiben?« Sie sah mich traurig an.
»Nein«, sagte ich entschieden. »Das ist erst recht ein Grund, früh ins Bett zu gehen. Dann habt ihr Zeit, euch vor dem Einschlafen zu unterhalten.«
Das munterte sie ein kleines bisschen auf. Sassy ins Bett {29}zu kriegen war ein täglich wiederkehrender Kampf, und sie besaß einen starken Willen.
»Ich nehm das Fahrrad«, sagte ich zu Marina. »Und bin schnell wieder da. Versprochen.«
Marina und ich hatten uns hauptsächlich nach einem Haus im westlichen Oxfordshire umgesehen, um in der Nähe von Charles zu sein, und wunderbarerweise hatten wir das Gewünschte in einem Dorf gefunden, das nur drei Kilometer von Charles’ Wohnort Aynsford entfernt lag.
Admiral a.D. Charles Roland hatte ein väterliches Verhältnis zu Marina und mir, obwohl wir beide nicht mit ihm verwandt waren. Er war vielmehr mein Exschwiegervater, aber das »Ex« kümmerte mich wenig, und unsere Freundschaft hatte das stürmische Ende meiner Ehe mit seiner Tochter nicht nur überdauert, sondern sich von Jahr zu Jahr gefestigt. Er hatte Marina auf Anhieb gemocht und genoss es, Saskias Opa h.c. zu sein, da seine beiden Töchter ihm keine eigenen Enkel geschenkt hatten.
Inzwischen war er weit über achtzig, doch das sah man ihm nicht an. Eins dreiundachtzig groß, volles schwarzes Haar und der Rücken noch genauso gerade wie bei seinem Eintritt in die Offiziersschule Dartmouth vor fünfundsechzig Jahren.
Er erwartete mich im Wohnzimmer. In seiner weinroten Lieblingshausjacke aus Samt und Seide stand er vor dem Kamin, zwei großzügig mit bestem Scotch gefüllte Gläser in Bereitschaft.
»Ich dachte, das könntest du vielleicht gebrauchen«, sagte er und gab mir eins.
{30}»Wie kommst du darauf?«
»Du warst schon lange nicht mehr ohne Marina oder Saskia hier.« Er nippte an dem bernsteinfarbenen Getränk. »Und ich kenne dich, Sid, ich kenne dich sehr gut. Wo liegt denn das Problem?«
Er kannte mich wirklich gut.
Charles’ Haus in Aynsford war seit jeher meine Zuflucht, mein Unterschlupf. Hier kam ich her, wenn etwas schieflief oder ich einen kompetenten Rat brauchte. So wie jetzt.
»Sir Richard Stewart«, sagte ich.
»A-ha!«, rief er und warf mit einem Lachen den Kopf zurück. »Dacht ich’s mir doch. Er hat mich vorige Woche auf dich angesprochen.«
»Ja, das hat er mir gesagt.«
»Dann hat er dir vermutlich seine Theorie von den manipulierten Rennen unterbreitet.«
»Allerdings«, sagte ich. »Glaubst du ihm?«
Charles ließ sich in seinen tiefen, chintzbezogenen Sessel sinken. »Ich glaube, dass er es glaubt.«
»Das bezweifle ich nicht.« Ich nahm den Sessel gegenüber. »Aber Sir Richard zufolge hält Peter Medicos ihn für verrückt.«
»Ich kenne Sir Richard seit über zwanzig Jahren, und mir kam er noch nie verrückt vor.«
»Aber man wird älter«, sagte ich, »und das Alter macht komische Sachen mit einem.«
»Gut, was glaubst du denn selbst?«, fragte Charles. »Peter Medicos’ Meinung kannst du nicht so ganz teilen, sonst wärst du nicht hier.«
{31}»Ich habe mir Sir Richards Liste angesehen und stimme ihm zu, dass die Totoauszahlungen zu Misstrauen Anlass geben könnten, aber er hat weder Beweise, noch auch nur eine Vorstellung, wie die Rennergebnisse manipuliert worden sein sollen. Entweder irrt er sich, oder da ist eine Riesenverschwörung im Gang.«
»Verschwörung von wem?«, fragte Charles.
»Ich weiß es nicht«, sagte ich. »Aber die Jockeys müssten beteiligt sein.«
»Gehst du der Sache nach?«
»Nein«, wehrte ich ab. »Sicher nicht. Damit habe ich nichts mehr zu tun.«
»Warum bist du dann hier?«
Vielleicht kannte er mich zu gut.
Ich schwieg einen Moment und trank einen Schluck Whisky.
»Nur mal angenommen, er hat recht«, sagte ich. »Da kann ich doch nicht die Hände in den Schoß legen. Vor einer Stunde habe ich ihm gesagt, er müsse sich irren, aber er hörte sich richtig wütend an und auch etwas beunruhigt. Und ich habe großen Respekt vor Sir Richard.«
»Dann sprich doch mal mit Peter Medicos. Hör, was er sagt, statt nach dem zu gehen, was er laut Richard gesagt haben soll.«
»Wieso bin ich darauf nicht selbst gekommen?« Ich lachte. »Gleich morgen früh rufe ich ihn an.«
Wir tranken friedlich unseren Whisky und unterhielten uns über die jüngsten Neuigkeiten und Ergebnisse aus dem Rennsport.
Er begleitete mich zur verglasten Veranda.
{32}»Wieso bist du kein Sir?«, fragte ich. »Ich dachte, alle Admirale werden in den Ritterstand erhoben.«
»Ich war ja nur Konteradmiral«, antwortete Charles. »Das reicht nicht.«
»Der Konteradmiral steht hinten?«
»Ganz hinten.« Er grinste breit. »Im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert kommandierte der Konteradmiral die Flottenreserve, den Teil des Verbands, der sich im Hintergrund hielt, bis er gebraucht wurde. Aber heutzutage haben alle Admirale ihr Büro an Land. Der letzte Admiral, der auf See kommandiert hat, war Sandy Woodward im Falklandkrieg. Da hatten wir noch eine richtige Marine. Verdammte Politiker. Die haben derart den Etat gekürzt, dass jetzt bald auf jedes Schiff ein Admiral kommt.«
Offensichtlich hielt er von den Politikern so wenig wie von den Kürzungen.
Das wusste ich. Ich hatte es schon öfter gehört.
Obwohl ich heftig in die Pedale trat, war es ein paar Minuten nach halb acht, als ich mein Rad in der Garage abstellte, das Licht abschaltete und ins Haus eilte.
»Da bin ich wieder«, rief ich auf der Treppe nach oben. »Kann’s losgehen mit der Geschichte?«
Zum Glück lag auch Marina etwas hinter dem Zeitplan, und die Mädchen plantschten noch im Bad und bewarfen sich gegenseitig mit Schaum. Ohne Gnade!
»Los, ihr beiden«, rief Marina durch das Geschrei. »Raus jetzt!«
Schon waren sie in flauschige weiße Handtücher gehüllt, {33}und in kunterbunten Schlafanzügen hüpften sie dann in die beiden Betten in Sassys Zimmer.
»Erzähl uns was, Papa«, quiekte Sassy aufgeregt. Sie saß kerzengerade im Bett. »Was vom Pferderennen.«
Sassy war erst lange nach meiner Jockeyzeit zur Welt gekommen, wollte aber immer wieder davon hören.
Ich setzte mich an ihr Bettende.
»Es war einmal eine Zeit«, sagte ich, »da ritt ich im Grand National.«
»Hast du gewonnen? Hast du gewonnen?«, rief Annabel.
»Warte doch mal ab«, sagte ich. »Wo war ich stehngeblieben? Ah ja, ich ritt also im Grand National. Das Pferd hieß Noss Boy und war ein großer, starker Schimmel, der sprang, als hätte er Sprungfedern unter den Hufen.«
Ich schilderte, wie ich in Aintree das erste Mal um die Bahn gegangen war, und wippte dabei wie im Galopp auf der Bettkante.
»Hör mal, Sid«, sagte Marina, die aus dem Bad hereinkam, »die beiden sollten jetzt schlafen.«
»Mami, sei doch nicht so ein Spielverderber«, protestierte Saskia. »Das Rennen ist noch nicht vorbei.«
»Dann beeilt euch.« Marina las ein paar Kleidungsstücke vom Boden auf und ging hinaus.
Ich wippte schneller und bewältigte Becher’s Brook und den Canal Turn mit einem einzigen Sprung.
»Ach, es ist so weit vom letzten Hindernis zum Ziel«, sagte ich keuchend. »Komm, alter Junge, du schaffst das. Die paar Meter. Los, Junge, mach!«
Meine rechte Hand ging auf und ab wie bei einem scharfgerittenen Endspurt.
{34}»Gesiegt!«, rief ich, und die Mädchen hüpften begeistert auf den Betten herum. »Jetzt aber ab in die Heia«, sagte ich, damit die beiden zur Ruhe kamen, »sonst seid ihr morgen früh zu müde für die Schule.«
Ich deckte sie zu und gab jeder einen Kuss auf die Stirn. »Gutnacht, gutnacht.« Ich schaltete das Licht aus und ließ die Tür angelehnt, damit es nicht ganz dunkel war.
Marina war schon nach unten gegangen, und ich fand sie in der Küche.
»Was hast du?«, fragte ich.
»Wieso?«
»Du bist unleidlich.«
»Überhaupt nicht«, fuhr sie mich an.
Ich trat zu ihr und nahm sie in die Arme. »Was ist los?«
»Nichts.« Sie stieß mich weg.
»Ich ermittle nicht«, sagte ich. »Das habe ich dir versprochen, und ich tu’s auch nicht.«
»Warum warst du denn dann bei Charles?«
»Ich wollte ihn um Rat fragen.«
»Weswegen?«
»Ich habe ihn gefragt, was ich wegen des Rennmanipulationsverdachts unternehmen sollte, von dem mir der Mann heute Nachmittag erzählt hat.« Ich schwieg. »Ermitteln werde ich da nicht, aber ich kann auch nicht einfach stillhalten, oder?«
Sie sagte nichts, doch ich nahm an, genau das erwartete sie von mir.
»Charles empfahl mir, mit dem Chef der Rennsport-Sicherheit zu reden und alles Weitere ihm zu überlassen. Den rufe ich morgen an. Und damit hat es sich.«
{35}Sie beruhigte sich ein wenig, doch es blieb den ganzen Abend etwas angespannt zwischen uns. Allen Beschwichtigungsversuchen zum Trotz war Marina offenbar entsetzt über die Aussicht, ich könnte wieder zu ermitteln anfangen. Das war zum Schreckgespenst für sie geworden, in ihrer Vorstellung viel beängstigender als in Wirklichkeit.
Zumindest dachte ich das damals.
Ich rief Peter Medicos auf seinem Handy an, sobald ich die Mädchen am nächsten Morgen zur Schule gebracht hatte.
»Hallo, Sid«, sagte er im breiten Lancashire-Dialekt.
»Haben Sie einen Augenblick Zeit?«, fragte ich.
»Nur kurz. Ich habe wirklich zu tun, aber schießen Sie los.«
»Es geht um Sir Richard Stewart.«
»Ja, ich weiß«, sagte er. »Schrecklich, nicht?«
»Wie bitte?«
»Das mit Sir Richard«, wiederholte er. »Schrecklich.«
Ich fragte mich, ob ich in eine Parallelwelt geraten war.
»Peter«, sagte ich langsam. »Was ist schrecklich in Bezug auf Sir Richard?«
»Dass er tot aufgefunden wurde«, antwortete er ebenso langsam. »Rufen Sie nicht deswegen an?«
»Tot!«, rief ich aus. »Wann denn?«
»Heute Morgen«, sagte er. »Vor ein paar Stunden. In einem seiner alten Wagen. Möglicherweise hat er sich umgebracht.«
{36}3
Am späten Vormittag war Sir Richards mutmaßlicher Selbstmord die Topmeldung im Radio, doch dem, was Peter Medicos mir schon erzählt hatte, fügten die Berichte wenig hinzu.
Anscheinend hatte sein Gärtner ihn in einer verschlossenen Garage bei laufendem Motor auf dem Vordersitz seines klassischen Jaguars Mark IV aufgefunden. Der Aussage seines erschütterten Sohns nach hatte sich Sir Richard allein im Haus der Familie in Hampshire aufgehalten, während Lady Stewart zu Besuch bei ihrer Schwester in London war. Er konnte sich nicht erklären, warum sein Vater aus dem Leben geschieden sein sollte.
Ich auch nicht.
Sir Richard hatte sich Lichtjahre von einem Selbstmord entfernt angehört, als er am Nachmittag zuvor einfach aufgelegt hatte.
Na, ich gedenke jedenfalls herauszufinden, was da gespielt wird. Und ich finde es heraus, ob Sie mir dabei helfen oder nicht.
Das klang mir nicht nach jemandem, der sich wenige Stunden später umbringt.
Wenn es also kein Selbstmord war, was war es dann?
Wenn in geschlossenen Räumen Fahrzeuge gestartet {37}werden, kommt es immer wieder einmal zu tödlichen Unfällen, weil die schnelle und verheerende Wirkung des freigesetzten Kohlenmonoxids nicht bedacht wird. Eine Konzentration von weniger als einem halben Prozent bringt einen erwachsenen Menschen um, und das ohne Vorwarnung.
Aber so gut wie jeder kennt die Risiken, und Sir Richard als Oldtimer-Sammler hatte sie mit Sicherheit auch gekannt.
War es weder Selbstmord noch ein Unfall, sondern Mord?
Vielleicht lag es an meinem vorherigen Beruf, aber ein Tod mit unklarer Ursache erschien mir bis zum Beweis des Gegenteils immer verdächtig.
Sir Richard Stewart lässt verlauten, dass er glaubt, jemand manipuliert den Ausgang von Pferderennen, und dass er demjenigen auf die Spur kommen will, und am nächsten Morgen wird er in einer Situation, die auf Selbstmord hindeutet, tot aufgefunden.
Wunderte nur mich dieser Zufall?
Ich rief Peter Medicos noch einmal an.
»Ja, Sid?« Der Anruf kam wohl etwas ungelegen. »Was gibt’s noch?«
»Es tut mir leid, Sie noch mal zu stören, Peter, Sie haben’s ja bestimmt nicht leicht heute, aber ich kam vorhin gar nicht dazu, Ihnen zu sagen, worum es mir ging.«
»In Bezug auf Sir Richard?«, fragte er.
»Ja. Er war gestern Nachmittag bei mir und sagte, er befürchte, dass jemand Rennen manipuliert.«
»Ach, das«, meinte er hörbar ungehalten. »Damit ging er schon seit Cheltenham hausieren.«
{38}»Stimmt es denn?«
»Nicht dass ich wüsste.«
»Sind Sie seinen Behauptungen nachgegangen?«
»Ich habe mich mit ein paar älteren Jockeys unterhalten, und sie fanden, das sei völliger Blödsinn.«
Das war natürlich zu erwarten, besonders, wenn sie selbst die Finger drin hatten.
»Meinen Sie, sein Tod könnte etwas damit zu tun haben?«, fragte ich.
Es war still in der Leitung. »Inwiefern?«, sagte er. »Wollen Sie damit andeuten, dass er sich umgebracht hat, weil ich seine Vorwürfe nicht ernst genommen habe?« Er war offensichtlich nicht erfreut.
»Steht denn fest, dass er sich umgebracht hat?«, fragte ich. »Gibt es einen Abschiedsbrief?«
»Sid, ich schlage vor, Sie überlassen alle Ermittlungen den Profis von der Polizei und dem BHA-Sicherheitsdienst. Wir sähen es nicht gern, wenn sich ein Amateur da einmischt.«
Ich verzichtete darauf, ihm zu sagen, dass ich in Ermittlungsfragen keineswegs ein Amateur war und dass seinerzeit der Sicherheitsdienst des BHA regelmäßig bei mir angeklopft und mich um Unterstützung gebeten hatte.
»Ich versichere Ihnen, jede Einmischung liegt mir fern«, sagte ich. »Ich denke aber, die Frage muss gestellt werden. Sir Richard war fest überzeugt, dass etwas im Argen liegt, und nachdem er jetzt plötzlich unter ungeklärten Umständen ums Leben gekommen ist, sollte jemand seinem Verdacht nachgehen.«
»Natürlich«, sagte Peter. »Dafür sorge ich auch.«
{39}»Sie verständigen also die Polizei?«, fasste ich nach.
»Ja«, sagte er knapp.
Wieso glaubte ich ihm nicht recht?
Den Donnerstagmorgen verbrachte ich weitgehend am Schreibtisch und versuchte, mich auf Börsentrends und Rentenerträge zu konzentrieren, kehrte aber immer wieder zu Sir Richard und seinem Jaguar Mark IV zurück.
Mein Telefon klingelte. Es war Charles.
»Das kommt mir alles sehr spanisch vor«, sagte er ohne Umschweife. »Ich hätte Sir Richard nie als Selbstmörder eingestuft. Er hatte viel zu viel Mut.«
»Gehört denn kein Mut dazu, sich umzubringen?«
»Natürlich nicht«, erwiderte er scharf. »In Bedrängnis gehört Mut dazu, am Leben zu bleiben.«
Und mit Mut in bedrängter Lage kannte Charles sich aus. Mit neunzehn war er als Fähnrich auf der HMS Amethyst unter Beschuss der chinesischen Kommunisten den Jangtse hinuntergefahren und hatte einunddreißig seiner Kameraden sterben sehen.
»Was heißt das für dich?«, fragte ich.
»Mord«, antwortete er rundheraus. »Ganz sicher.«
»Du siehst zu viel fern«, sagte ich lachend, aber irgendwie gab ich ihm auch recht.
»Es liegt auf der Hand«, erwiderte Charles. »Einen Selbstmord halte ich für ausgeschlossen, und wer sich mit Autos so auskennt wie Richard, stirbt nicht durch das versehentliche Einatmen von Abgasen. Es muss also Mord sein.«
»Wir kennen noch nicht alle Umstände«, sagte ich. »Und {40}Kohlenmonoxid als Todesursache ist ja nur eine Vermutung. Es könnten auch andere natürliche Ursachen vorliegen.«
»Vorige Woche kam er mir kerngesund vor.«
Mir am vorangegangenen Nachmittag ebenso, aber ein Herzanfall kann auch jemanden niederstrecken, der wie das blühende Leben aussieht.
»Weißt du, ob er herzkrank war?«
»Sid«, sagte er in herablassendem Ton, »wir wissen doch beide, dass es Mord war, also kümmere dich drum.«
Das hörte sich so einfach an.
»Die Polizei wird sich drum kümmern«, sagte ich.
Sein Seufzer klang durch die Leitung. »Vor langer Zeit, als du mit dem Rennreiten aufhörtest, musste dir jemand einen ordentlichen Tritt in den Allerwertesten geben, damit du wieder in Gang kamst. Vielleicht ist es mal wieder so weit.«
»Charles!«, protestierte ich gequält.
»Tut mir leid«, sagte er obenhin. »Aber es stimmt.«
»Nein«, verteidigte ich mich. »Ich habe mich ganz bewusst entschieden, die Detektivarbeit aufzugeben, und bin mit dem, was ich jetzt mache, sehr zufrieden.«
»Und was war das noch mal?«
»Du weißt ganz genau, was ich mache.«
»Geld schiebst du hin und her.« Er schnaubte. »Das ist doch kein richtiger Beruf.«
Ich wollte nicht mit ihm diskutieren, das hätte doch nichts genützt. Der Admiral war von seinen Ansichten und Meinungen so schwer abzubringen wie die Flugzeugträger, die er befehligt hatte, von ihrem Kurs.
{41}»Ich gebe deine Überlegungen an die Polizei weiter«, sagte ich ruhig. »Und Peter Medicos will Sir Richards Verdacht nachgehen.«
»Ist das nicht der Mann, der ihn für verrückt gehalten hat?«
»Doch.«
»Dann erwarte ich davon nicht viel.«
Das ging mir auch so.
Ich wandte mich wieder meinen Geldgeschäften zu und fragte mich, ob Charles recht hatte.
War das ein richtiger Beruf?
Eine einträgliche Beschäftigung auf jeden Fall. In den vergangenen sechs Jahren hatte ich vom Schreibtisch aus wesentlich mehr Geld verdient als mit der Hatz durch nasse Gräben und dem Stöbern in fremden Mülleimern. Aber getan oder geschaffen hatte ich eigentlich nichts. Ich hatte einfach richtig vorhergesehen, wann bestimmte Aktien und Obligationen im Wert stiegen oder fielen, und sie entsprechend gekauft oder verkauft.
Ähnlich, wie man beim Pferderennen auf Pferde setzt und anderen dann die Arbeit überlässt, sie zum Sieg zu führen.
Wieder unterbrach das Telefon meine Gedanken.
»Hallo«, meldete ich mich.
»Ist da Mr. Halley?«, fragte jemand mit ausgeprägtem nordirischen Akzent, »Mr. Sid Halley?« Er betonte das »Ha« im Namen.
»Ja«, sagte ich.
»Mr. Halley«, wiederholte er, »Sie müssen etwas für mich tun.«
{42}»Wer spricht da?«, fragte ich.
»Das lassen wir mal«, sagte er mit einem drohenden Unterton. »Sie sollen etwas für mich ermitteln, okay?«
»Tut mir leid. Ich stelle keine Ermittlungen mehr an.«
Ich legte auf.
Sofort klingelte das Telefon wieder.
»Mr. Halley«, sagte dieselbe Stimme. »Das ist keine Bitte, sondern eine Aufforderung. Sie ermitteln für mich. Habe ich mich klar ausgedrückt?« Der Ton war wirklich bedrohlich.
»Wer spricht denn da?«, fragte ich verärgert noch einmal. »Was fällt Ihnen ein, so mit mir zu reden?«
»Was mir einfällt?« Er lachte beinah. »Mr. Halley, mir fallen noch ganz andere Sachen ein. Und Sie tun, was ich sage, verlassen Sie sich drauf.«
»Nein«, sagte ich kurz und legte wieder auf.
Ich wählte umgehend die 1471, um die Nummer des Anrufers zu erfahren, doch er hatte sie unterdrückt. Das überraschte mich nicht.
Ich schaute auf das Telefon und wartete auf das nächste Klingeln, aber es kam keins mehr.
Die Anrufe hatten mich ziemlich irritiert.
Es war längst nicht das erste Mal, dass mir jemand telefonisch mitteilte, ich hätte nach seiner Pfeife zu tanzen, aber zum ersten Mal verlangte jetzt jemand, dass ich Ermittlungen anstellte. Bisher war es immer darum gegangen, sie einzustellen.
Ich wollte mich wieder meiner Arbeit widmen, konnte mich aber nicht konzentrieren. Stattdessen ging ich zu Marina.
{43}Marina von der Meer, so ihr Mädchenname, war Biologin. Ihre Arbeit bei der Britischen Krebsgesellschaft hatte sie aufgegeben, als wir einen Monat vor Saskias Geburt aus London weggezogen waren, aber jetzt, wo unsere Kleine in der Schule war, arbeitete Marina in Teilzeit von zu Hause aus als Redakteurin und Sachverständige für wissenschaftliche Veröffentlichungen.
Wie üblich saß sie umringt von dicken Wälzern über Zellbiologie am Küchentisch und tippte auf ihrem Computer.
»Kennst du das zentrale Dogma?«, fragte sie, als ich hereinkam.
»Ist das was Theologisches?«
»Nein. Das zentrale Dogma der Molekularbiologie.«
»Ich habe keinen Schimmer«, sagte ich.
»Der Autor dieses unnützen Papiers anscheinend auch nicht.« Sie seufzte und reckte die Arme in die Luft.
»Was ist denn damit?«, fragte ich. »Mit dem Dogma?«
»Das ist ein Prinzip des Lebens. Es besagt, dass genetische Information in einer Nukleinsäure gespeichert und übertragen werden kann, dass aber der Informationstransfer in ein Protein unumkehrbar ist.«
Ich wünschte, ich hätte nicht gefragt, und hielt den Mund.
»Wer hat denn angerufen?«, wechselte Marina das Thema, nach wie vor auf ihren Bildschirm konzentriert.
»Erst Charles und dann jemand, den ich nicht kenne.«
»Was wollte Charles?«
»Es ging um meinen Besuch von gestern.«
»Den Mann von der Rennsportbehörde?«
{44}»Ja«, sagte ich. »Er ist heute Morgen tot aufgefunden worden.«
Sie fuhr auf ihrem Stuhl herum und sah mich mit tiefen Sorgenfalten auf der Stirn an.
»Hatte das mit dem zu tun, weshalb er bei dir war?«
»Ich weiß es nicht«, antwortete ich, »Aber ich bezweifle es. Er hat offenbar Selbstmord begangen.«
»Ach, wie furchtbar.«
»Er war ein Freund von Charles. Sie gehörten demselben Club an.«
»Armer Charles«, sagte Marina.
Armer Sir Richard, dachte ich.
»Und was wollte Charles von dir?«, fragte Marina.
»Gar nichts«, log ich. »Er wollte nur mit jemandem darüber reden.«
»Die Polizei sollte vielleicht erfahren, dass der Mann gestern hier war, und auch, worüber ihr gesprochen habt.«
»M-hm, da magst du recht haben. Vielleicht rufe ich sie an.«
Sollte ich ihr dann auch von dem Nordiren erzählen, der mir am Telefon gedroht hatte?
»Was gibt’s zu Mittag?«, fragte ich.
»Worauf hast du denn Lust? Ich habe noch Thaisuppe mit Huhn und Curry im Kühlschrank.«
»Prima.«
Wir setzten uns an den Tisch und aßen die Suppe mit frisch aufgebackenem Baguette.
»Ach, du hast Post bekommen«, sagte Marina und hielt mir einen Brief hin.
{45}Absender war das Queen-Mary-Krankenhaus in Roehampton.
»Wahrscheinlich eine Erinnerung an meinen Kontrolltermin nächsten Dienstag«, sagte ich. »Wie jedes Jahr.« Ich hielt meine Handprothese hoch.
Marina kehrte zu ihrem Lektorat am Computer zurück, und ich ging in mein Büro und riss den Brief auf.
Es war tatsächlich die Terminerinnerung, aber nicht nur. Ein Brief von einem gewissen Harold Bryant lag bei.
Sehr geehrter Mr. Halley,
mir ist bekannt, dass Sie vor geraumer Zeit durch einen Unfall beim Pferderennen und ein weiteres Trauma die linke Hand verloren haben, und mir wurde mitgeteilt, dass Sie seit vierzehn Jahren mit einer myoelektrischen Prothese leben, die Mr. Alan Stephenson vom Reha-Zentrum Roehampton für Sie angefertigt hat.
Wie Sie vielleicht aus der Presse wissen, hat die Queen-Mary-Klinik sich im Rahmen eines Forschungsprogramms auf komplette Hand- und Handgelenktransplantationen spezialisiert, und meiner Überzeugung nach sind Sie ein geeigneter Kandidat für eine solche Maßnahme.
Sollten Sie sich näher darüber informieren wollen, bin ich anlässlich Ihres Kontrolltermins in der Klinik gern zu einem Gespräch mit Ihnen bereit.
Mit freundlichen Grüßen,
Harold Bryant, FRCS, Leiter des Transplantationsteams
{46}Ich schaute auf den Brief und las die Worte immer wieder: komplette Hand- und Handgelenktransplantationen.
Ich suchte »Handverpflanzung« im Internet und verbrachte die nächsten beiden Stunden damit, mir Videos von Leuten mit verpflanzten Händen anzusehen. Es waren erstaunliche Aufnahmen dabei und sogar ein Film von einem Mann, der mit seinen zwei neuen Händen Klavier spielte, wenn auch nur mit je einem oder zwei Fingern.
Was wollte ich?
Ich hatte mich zwar daran gewöhnt, fast alles einhändig zu erledigen, doch es gab auch Dinge, die ich einfach nicht hinbekam. Schnürsenkel hatte ich längst aufgegeben, ich trug nur Slipper, aber Socken, die ich nicht anziehen, Krawatten, die ich nicht binden, und Hosen, die ich nicht zuknöpfen konnte, machten mir das Leben sauer. Wollte ich wirklich die Tortur einer solchen Operation auf mich nehmen, nur um mich leichter anziehen zu können?
Und die Immunsuppressiva, die ich mein Leben lang einnehmen müsste, damit mein Organismus die Hand nicht abstieß? War ich dazu bereit?
Vielleicht schon.
Ich hasste meine Prothese, das »Wunder« aus Stahl und Plastik, das meinen linken Unterarm ergänzte. Sie war zwar erstklassig, die beste künstliche Hand auf dem Markt, aber eben künstlich, kalt und empfindungslos in jeder Hinsicht. Ich konnte kein Geldstück damit aufheben und keine Gabel halten.
Die Verpflanzungsrecherche nahm mich so gefangen, dass ich darüber die Zeit vergaß.
{47}»Holst du Sassy ab oder ich?«, fragte Marina an meiner Bürotür und schaute demonstrativ auf die Uhr.
»Ach Gott, entschuldige«, sagte ich. »Bin schon unterwegs.«
Ich eilte hinaus zum Range Rover, ließ die Räder auf der Kieseinfahrt rotieren und kam bei der Schule an, als die Kinder gerade herausströmten.
»Tag, Mr. Halley«, sagte Mrs. Squire, die Rektorin, als ich zum Tor gelaufen kam. »Was tun Sie denn hier?«
Ich sah sie verwirrt an. »Ich wollte Saskia abholen.«
»Aber Saskia ist doch schon weg.« Mrs. Squire machte eine betretene Miene.
»Weg?« Mir schwante nichts Gutes. »Wohin denn?«
»Ihre Schwester und Ihr Schwager haben sie vor einer halben Stunde abgeholt.«
Jetzt ging mein Puls nach oben, und Adrenalin schoss mir durch die Adern.
Ich hatte weder eine Schwester noch einen Schwager.
{48}4
»E