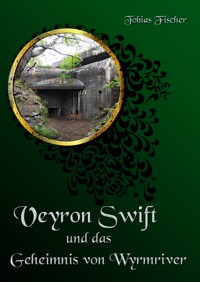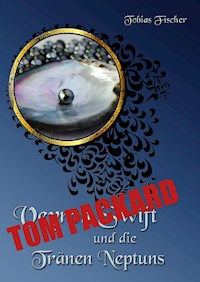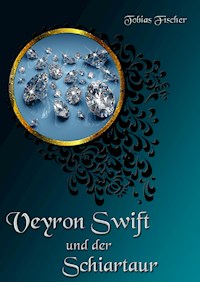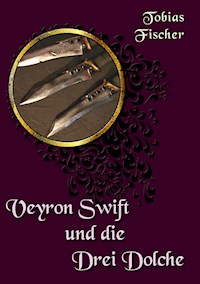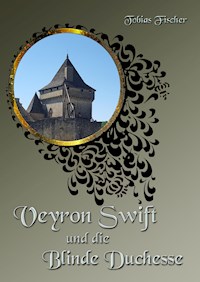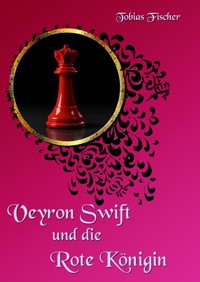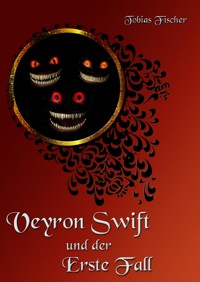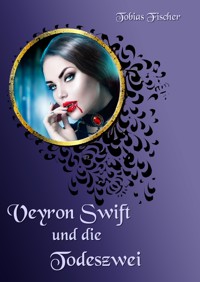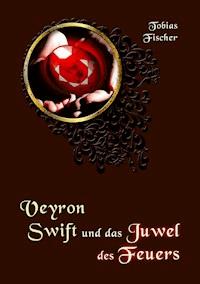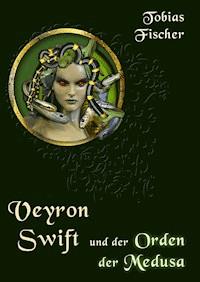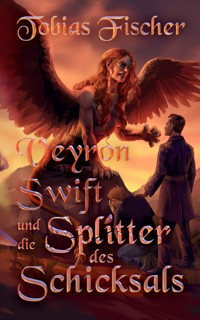
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Veyron Swift
- Sprache: Deutsch
Jahre nach seinem letzten Abenteuer, kehrt Tom Packard zu Veyron Swift zurück und wird gleich in einen neuen Fall hineingezogen. Das unerwartete Auftauchen des Splitters eines mächtigen Zaubersteins, der unvorstellbares Wissen verleiht, bringt den Dunklen Meister auf den Plan. Veyron, Tom und ihre Freunde müssen sich ein weiteres Mal auf die Spur Elderwelts begeben, um die übrigen Splitter zu finden. Die Häscher des Dunklen Meisters sitzen ihnen dabei im Nacken und lassen nichts unversucht, um als Erste ans Ziel zu gelangen. Denn wer die Splitter besitzt, hält das Schicksal der ganzen Welt in den Händen. Zudem muss Veyron das Rätsel um den Alchemisten Gilford Crave lösen, der mit seinen Zaubermaschinen das Gleichgewichte der Kräfte zu verschieben droht. Und was hat es mit Veyrons neuer geheimnisvoller Assistentin Nio auf sich? Ein tödliches Wettrennen beginnt, das bis in die entlegensten Winkel Elderwelts führt, verfolgt von den gefährlichsten denkbaren Geschöpfen, mit denen es Veyron Swift je zu tun hatte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 923
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Tobias Fischer
Veyron Swift und die Splitter des Schicksals
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Prolog: Die Werke der Alten Meister
1. Kapitel: Die neue Assistentin
2. Kapitel: Das Wild ist auf
3. Kapitel: Das Labor
4. Kapitel: Der Elder-Club
5. Kapitel: Schattenfalle
6. Kapitel: Versperrte Wege
7. Kapitel: Mount Suswa
8. Kapitel: Der Turm der Hoffnung
9. Kapitel: Die Karawane von Pamoja
10. Kapitel: Die Eine, die tot sein sollte
11. Kapitel: Der Herr von Cal-Oriel
12. Kapitel: Haferbier und Hummelhonig
13. Kapitel: Korallenmeer
14. Kapitel: Die Fäden kreuzen sich
15. Kapitel: Kurskorrektur
16. Kapitel: Gäste in der Finsternis
17. Kapitel: Tränen des Meeres
18. Kapitel: Har-Imgrul
19. Kapitel: Schutt und Asche
20. Kapitel: Kein Schatten kommt vorbei
21. Kapitel: Tempus fugit
22. Kapitel: Ein paar letzte Rätsel
Impressum neobooks
Prolog: Die Werke der Alten Meister
Tobias Fischer
Veyron Swift
und die Splitter des Schicksals
Es herrschte Krieg.
Feuer hagelte aus dem Himmel, steckte Dächer in Brand, löste Explosionen auf den Marktplätzen aus. Flüssiges Feuer rann über dunkelrote Dachziegel, tropfte auf Scheunen und setzte sie sofort in Brand. In den Gärten standen lodernde Fackeln, die zuvor noch Büsche und Bäume waren. Menschen schrien verzweifelt durcheinander nach Hilfe, nach Verstärkung, nach Wasser, suchten nach Verwandten und Freunden. Klagelaute durchzogen die Straßen von Cal-Illion, der einst schönsten Stadt Elderwelts.
Gilford Crave, Alchemist der Stadt, kamen die Tränen, wenn er aus dem Fenster seines Studierzimmers blickte, hinunter auf die brennenden Häuser. Von überall stiegen schwarze Rauchsäulen auf. Wie Kometen zischten immer neue Brandgeschosse über die Zinnen der hohen Stadtmauern.
Es herrschte Krieg – und er als der Stadtalchemist konnte nichts dagegen tun.
Cal-Illion lag am Fuße eines hohen, steilen Berges, der eine einzigartige, nahezu perfekt konische Form besaß, wie ein von den alten Göttern vergessener Zuckerhut. Üppige Wälder rankten sich an seinen steilen Flanken empor, umkränzten die Mauern der Stadt wie ein grüner Zaubermantel, der sie aus der Ferne vor vielen Blicken verbarg.
Die Stadt mit ihren glatten, strahlendweißen Mauern umgaben dutzende von Garten- und Feldterrassen, durchzogen von künstlichen Bachläufen und Wassergräben, die das ganze Jahr über für eine üppige Orangenernte sorgten. Cal-Illion war ein Paradies, die südlichste und letzte Kolonie des großartigen Königreichs von Caralantion, tausende von Meilen entfernt, eine Insel im riesigen Binnenmeer Elderwelts.
Jetzt aber glich die Stadt einem Trümmerhaufen, die Wände geschwärzt von Feuer und Zerstörung, die Hälfte aller Häuser in Flammen. Doch die Stadtmauer hielt. Noch war es den Feinden nicht gelungen, sie zu überwinden. Selbst wenn sie es schaffen sollten, gab es zwei weitere Mauerringe auf den höheren Ebenen. Die Alchemisten der Vergangenheit hatten darüber hinaus für ein paar weitere Überraschungen gesorgt, technische Wunder zur Verteidigung der Einwohner, die alles übertrafen, was Menschen je ersonnen hatten. Die Werke der Alten Meister wurden diese Technologien genannt. Einfache Gesellen mochten sie glatt für Zauberei halten, doch Crave, als Stadtalchemist, kannte natürlich ihre Geheimnisse.
Trotz all der innovativen Einfälle gab es nur eines nicht in Cal-Illion: einen Fluchtweg!
Cal-Illion war die einzige Stadt auf der gleichnamigen Insel, wo es sonst nur noch ein paar Gehöfte draußen auf den Terrassen und das Fischerdorf unten am Hafen gab. Den Weg dorthin hatte das Imperium jedoch längst abgeschnitten, die Flotte Cal-Illions restlos niedergebrannt. Einzig eine Flucht in die steilen Berge im Norden der Insel wäre möglich, wenngleich dies einem Marsch ins Verderben glich. Dort gab es keine Häuser, keine Höhlen und keine Nahrung. Die Menschen würden verhungern, sollten sie es wagen. Für die Bewohner der Stadt hieß es deshalb: ausharren und überleben – bis dem Feind Soldaten und Material ausgingen, um Cal-Illion über den Winter weiter zu belagern.
Crave kannte die Geschichte Elderwelts, hatte von den Heeren des Dunklen Meisters gelesen, die vor Jahrhunderten Angst und Schrecken verbreitet hatten. Jetzt waren es jedoch keine Horden blutrünstiger Schrate, sondern Menschen, welche die Stadt belagerten. Das Imperium Maresium war gekommen.
In seiner grenzenlosen Gier, alle Länder an den Küsten des Binnenmeers zu beherrschen, hatte das Imperium einen langen, furchtbaren Feldzug gegen das Seefahrer-Reich Elissa geführt. Wie immer, wenn in Elderwelt Krieg tobte, erklärte Cal-Illion seine Neutralität, stets darauf vertrauend, dass die Herren Caralantions ihre schützende Hand über das kleine Inselreich mit seiner paradiesischen Stadt hielten.
Doch der machtversessene Senat der Maresier ließ es darauf ankommen. Seit zweihundert Jahren hatte man in diesem Teil der Welt keinen der Weißen Ritter Caralantions mehr gesehen, zu lange keines ihrer großen, dreimastigen, schnellen Segelschiffe. Sehr bald war dem Imperium bewusst: Cal-Illion stand allein. Unter einem politischen Vorwand, der freilich erfunden war, erklärte der Senat den Krieg gegen Cal-Illion und begann seinen blutigen Feldzug.
Der Stadtrat von Cal-Illion suchte nach Frieden, versuchte es mit Verhandlungen. Die Senatoren in Gloria Maresia forderten jedoch unerfüllbare Zugeständnisse, als Friedenspreis die Unterwerfung.
Vor rund drei Wochen war sie dann erschienen: die maresische Flotte. Hunderte Schiffe stark, besetzt mit abertausenden Soldaten. Zuerst hatten sie bei Nacht und Nebel den Hafen überfallen und die Flotte Cal-Illions in Brand gesteckt. Danach begannen die Landungen an den Küsten – an drei unterschiedlichen Stellen. Zu drei Seiten besaß die Insel flache, weiße Sandstrände, die es den Truppen des Imperiums einfach machten anzulanden – mit nur geringer Gegenwehr. Erst in den Wäldern rings um das Hochplateau, auf dem die Stadt lag, brachen schließlich Kämpfe aus. Die Soldaten Cal-Illions wehrten sich erbittert, doch die ausgefeilte Militärmaschinerie des Imperiums, und ihre speziellen Nahkampftaktiken, ließen keinen Sieg der tapferen Ritter zu. Zwar konnte man die feindlichen Legionen in den Wäldern aufhalten, doch jene, die über den Hafen heranmarschierten, durchbrachen bald die Reihen der Abwehr. Die Schlacht verlief für beide Seiten furchtbar und verlustreich, doch letztlich bezwang das Imperium die furchtlosen Verteidiger, trieb sie zurück hinter die Mauern der Stadt.
Anstatt einen neuen Großangriff zu wagen, errichteten die Maresier erst einmal eine Reihe von Lagern, holzten die Wälder ab und erbauten hunderte von Belagerungsmaschinen. Ganze Berge aus Steinen und Gusseisengeschossen brachten sie über den Seeweg herbei.
Seitdem bombardierten nun die Kriegsmaschinen des Imperiums täglich die Stadt, verwandelten sie in einen Trümmerhaufen. Vorbei war es mit fröhlichen Gesängen auf den Marktplätzen, in allen Straßen herrschten nur noch Tränen und Geweine. Es gab kein Haus, das nicht von Bombentreffern gezeichnet war, dessen obere Stockwerke nicht eingestürzt waren, ihre morschen Mauerreste wie Zacken in den Himmel ragend. Stille statt Kindergelächter lag über den Spielplätzen – war man doch gezwungen, sie in Friedhöfe umzuwandeln.
Diese Stadt stirbt, wusste Gilford Crave. Er als Stadtalchemist konnte das nicht verhindern, nicht einmal hinauszögern. Was er brauchte, war eine neue Waffe. Eine, die so mächtig war, dass sie die Truppen des Imperiums schlagartig vernichtete, sie mit einem Fingerschnippen von dieser Insel fegte.
Er wusste, wo es eine solche Waffe gab und sogar, wie er an sie herankommen könnte. Er hatte es gesehen. Seit Wochen dauerten seine Vorbereitungen, dieses Wunder möglich zu machen, nun schon an. Jetzt zerrann ihm die Zeit zwischen den Fingern. Er musste es wagen. Er musste es sogar noch heute wagen oder alles wäre aus.
Gerade als Crave diese dunklen Gedanken rekapitulierte, flog die Tür zu seinem Arbeitszimmer auf. Ein junger Mann stolperte herein, seine beige Tunika an mehreren Stellen verkohlt. Er blutete aus einem Kratzer an der rechten Schläfe, weitere kleine Splitterwunden übersäten seinen muskulösen Körper. Adron, sein Sekretär, kehrte gerade von der Front zurück. Es stand schlecht, so wie er aussah und wie schwer er schnaufte.
»Meister«, rief Adron aufgeregt. »Soeben hat der Feind im Osten die Mauer zum Einsturz gebracht. Das Imperium ist durchgebrochen!«
Crave zog die Augen skeptisch zusammen, eilte zum östlichen Fenster seines Büros, nahm sein Fernrohr – wohlweislich immer griffbereit – zur Hand. Sein Zimmer lag im obersten Stockwerk eines Turms, der zu den höchsten Gebäuden Cal-Illions gehörte. Im Stadtzentrum gab es viele Türme, denn sie zeugten nicht nur von Reichtum und Prestige, sondern waren obendrein praktisch, um möglichst viel Raum auf möglichst wenig Platz unterzubringen.
Tatsächlich! Legionäre in dunklen Kettenhemden und bronzenen Helmen, kletterten über die Trümmer eines Stücks eingestürzter Mauer. In diesem Sektor war bislang nicht gekämpft worden und Crave fragte sich, wie es den Belagerern überhaupt gelungen war, das Bollwerk hier zum Einsturz zu bringen. Die gesamten Mauern der Stadt ruhten nicht auf ebenem Boden, ihre Fundamente lagen vier Meter tief unter der Erde. Sie konnten nicht so einfach untertunnelt und zum Einsturz gebracht werden.
»Egal«, knurrte Crave und schüttelte den Gedanken aus seinem Kopf. Er reichte sein Fernrohr an Adron. »Schau es dir an! Die Werke der Alten Meister wirken.«
Interessiert nahm Adron das Fernrohr zur Hand und staunte nicht schlecht.
Die Legionäre erreichten die ersten Straßen der Wohnsiedlung Cal-Illions. Sie zogen ihre Gladii, die tödlichen Kurzschwerter des Imperiums. Mit Gebrüll gingen die Maresier auf die kreischenden und schreienden Menschen los. Schild an Schild rückten sie vor, eine rote Wand mit gelben Adlerschwingen als Verzierung – nur um im nächsten Moment in die Luft katapultiert zu werden. Dort, wo eben noch Legionäre standen, hatte sich eine neue Mauer aus dem Boden geschoben, versperrte meterhoch den Zugang zur Straße. Es wurde sogar noch erstaunlicher, denn nun bewegte sich das Haus zur Linken der Legionäre, ebenso das zur Rechten, walzten mit einem unheilvollen Grollen langsam aufeinander zu. Die Soldaten, in Panik versetzt, versuchten, in die Richtung zu fliehen, aus der sie gekommen waren. Eine weitere Mauer, die urplötzlich aus dem Boden fuhr, schnitt ihnen den Fluchtweg ab, die beiden Häuser malmten weiter aufeinander zu, bis sich ihre Außenwände berührten. Das panische Geschrei der Legionäre verstummte augenblicklich.
Plötzlich hörte Crave es laut krachen. Ein Blitz fuhr aus dem Himmel nieder, traf eine Schar feindlicher Krieger, die einen anderen Weg in die Stadt suchten. Der Einschlag sprengte die Legionäre auseinander, ließ sie wie Strohpuppen durch die Luft wirbeln, verbrannte viele von ihnen zu Asche. Ein weiterer Blitzschlag folgte, dann noch einer und noch einer. Die Maresier hatten genug.
»Sie fliehen«, rief Adron aufgeregt, hüpfte auf der Stelle. »Sie rennen wie die Kaninchen!«
Crave brauchte es nicht zu sehen, um zu wissen, welche Furcht die Maresier übermannt haben musste. Für sie mussten die Werke der Alten Meister wahrhaft göttliche Kräfte sein. Da ergriff man lieber die Flucht. Völlig verständlich.
Er eilte zum Nordfenster, schaute hinauf zum höchsten Turm der Stadt, schlanker als die anderen, mehr ein überdimensionaler Mast. Er überragte alle anderen Gebäude in der Stadt, seine silbern schimmernde metallische Spitze war eingerahmt von zwölf mehrere Meter langen, stählernen Dornen, die in den Himmel ragten. Sie qualmten noch.
»Gut so, der Mechanismus funktioniert«, seufzte Crave erleichtert. Die Werke der Meister konnten nicht nur mechanische Mauern nach Belieben verschieben, sondern auch elektrische Entladungen von ungeheurer Macht auf ihre Feinde schleudern.
Adron gab seinem Meister beeindruckt das Fernrohr zurück. Seine Frage, wie das alles möglich sei, konnte Crave ihm nicht beantworten. Es war zu kompliziert, die Maschinen der Alten Meister zu erklären, besonders die Tatsache, dass diese völlig autonom und ohne menschliches Zutun agierten und sogar die Intelligenz besaßen, Bewohner von Feinden zu unterscheiden und immer an der richtigen Stelle einzugreifen.
»Ob uns das wirklich retten wird?«, jammerte Adron. »Mit schweren Steinen und gusseisernen Kugeln schießen die Imperialen unsere Mauern zusammen. Die Werke der Alten Meister, sie werden uns nicht ewig schützen. Wir brauchen eine andere Strategie, Meister. Eine, die diesen Krieg beenden kann.«
Crave nickte stumm. Leider musste er da seinem Sekretär recht geben. Nur noch einen Monat, dachte er. Wenn wir noch einen Monat durchhalten, kommt der Winter. Dann muss das Imperium seine Belagerung abbrechen und nach Hause zurückkehren. Es lag an ihm als Stadtalchemist, Cal-Illion diesen einen Monat irgendwie zu erkaufen, zugleich wusste er, dass es diesen Zeitraum nicht gab. Cal-Illion blieben allerhöchstens noch Tage.
»Komm, Adron! Verlieren wir keine weitere Zeit! Der Apparat ist zwar nicht endgültig getestet, aber wir können nicht länger warten. Die Mauer im Osten ist durchbrochen«, sagte Crave streng. Er nahm eine Ledertasche, stopfte so schnell er konnte mehrere Papierrollen hinein, ebenso ein paar wissenschaftliche Instrumente, von denen er sich Hilfe versprach: einen Kompass, einen Sextanten, ein kleines Fernrohr und einen Beutel mit Golddukaten. Gold konnte man immer brauchen, egal wohin es ging.
Er schulterte die Tasche, eilte hinaus, Adron hinterdrein. Über eine Wendeltreppe ging es hinunter in die Räume der Laboratorien.
»Wollt Ihr verreisen, Meister? Fliehen? Es gibt keinen Weg mehr aus der Stadt. Keiner unserer Boten ist zurückgekehrt. Wir bezweifeln inzwischen, dass überhaupt einer davon Caralantion erreicht hat.«
»Ja, ja«, grummelte Crave. Er kannte die taktische Situation. Selbst wenn es einem der Boten gelungen wäre, die Küste im Norden zu erreichen, Tewensiniel zu durchwandern, über das Meer zu fahren und nach Caralantion zu gelangen, so blieb es fraglich, ob von dort überhaupt Hilfe käme. Fern im Westen lag die Insel Cal-Oriel verlassen. Die Festungsstädte Gilion Illone und Gilion Riane an der Splitterküste, hunderte von Meilen nördlich, befanden sich schon lange in der Gewalt feindlicher Mächte. Von Caralantion würde keine Hilfe mehr kommen. Niemand würde die Weißen Ritter jemals wieder sehen. Nur er, Gilford Crave, konnte das Blatt noch wenden.
Der Weg führte sie hinaus auf die Straßen, wo die letzten Soldaten der Stadt mit gezogenen Schwertern, Speeren und Pfeil und Bogen nach Osten eilten.
Links und rechts ragten die hohen Türme auf, schneeweiß und von allen Kämpfen unbefleckt. Der Beschuss der Maresier konzentrierte sich vorwiegend auf die Außenbezirke der Stadt und die Mauern. Zum Glück! Das verschaffte Craves Plan wertvolle Zeit. Schließlich erreichten sie den Palast des Gouverneurs, ein im Vergleich zu den hohen Türmen mickrig anmutendes Herrenhaus aus zwei Stockwerken, dass sich hufeisenförmig um einen großen Brunnen bog.
Die Soldaten, die dort Wache hielten, salutierten zackig, als sie Crave und seinen Sekretär heraneilen sahen, öffneten ihm die Tore und ließen ihn eintreten. Immer wieder sah Crave, wie sie dabei zusammenzuckten, wenn der Boden unter einem neuen Bombardement erzitterte. Der Anblick ihrer brennenden Stadt setzte den Männern schwer zu. Sie fragten sich, wann auch sie dem Tod ins Gesicht blicken mussten.
Das Innere des Regierungspalastes von Cal-Illion wirkte chaotisch. Viele Vasen und Säulen waren umgestürzt, lagen zerbrochen am Boden. Die beiden Männer fanden Gouverneur Lord Reclarn in seinem Büro hinter seinem breiten Schreibtisch sitzen, seinen feisten Körper in seine teuerste Tunika gezwängt, dunkelblau und je nach Lichteinfall verschieden schillernd. Crave wirkte dagegen selbst in seiner roten Robe über schwarzen Hosen regelrecht einfach.
»Gouverneur, die Zeit ist gekommen. Wir müssen nun meinen Plan umsetzen, so wie ich ihn Euch vor drei Monaten schon vorgestellt habe. Alle Arbeiten sind abgeschlossen, es kann sofort losgehen«, begrüßte er den Landesherren.
Lord Reclarn nickte kurz, stand auf und ging ein paar Schritte auf und ab. »Ich will zuerst noch abwarten, ob Nachrichten vom König eintreffen. Caralantion muss inzwischen Bescheid wissen. Man wird uns Hilfe schicken.«
Crave konnte es nicht fassen. Jeden Augenblick konnten maresische Legionäre die Stadt stürmen und der alte Narr glaubte noch an Wunder. »Reclarn, öffnet Eure Augen«, forderte Crave den Gouverneur auf. »Es ist vorbei. Es wird keine Hilfe aus Caralantion kommen, seit zweihundert Jahren kommt von dort nichts mehr zu uns. Wir wissen nicht einmal, ob es überhaupt noch einen König gibt. Wir müssen uns selbst helfen, oder alles ist verloren.«
»Euer Plan«, begann Reclarn, hielt inne und dachte kurz nach. »Euer Plan gleicht purem Wahnwitz. Ich kann es nicht erlauben.«
»Ich habe an alles gedacht, ich habe alle Variablen genau berechnet. Ich weiß, dass ich es durchführen kann.« Ich habe es gesehen, wollte er anfügen, doch er verkniff es sich. Der Gouverneur würde toben, wenn er davon wüsste.
»Die übrigen Alchemisten sind anderer Meinung«, konterte Reclarn. »Sie stellen Eurem Vorhaben kein gutes Zeugnis aus. Ich kann es nicht erlauben.«
»Die anderen sind Idioten!«, fauchte Crave wütend. »Ich werde es Euch beweisen!«
Lord Reclarn musterte den Stadtalchemisten einen Moment, dann deutete er zur Tür. »Kehrt in Euren Turm zurück, Alchemist! Die Werke der Alten Meister werden uns bis zum Einbruch der Nacht schützen, dann unterhalten wir uns weiter. Es gibt noch andere Ideen, die vielleicht einen Ausweg bieten.«
Es wird keine Nacht mehr geben, wusste Crave. Dennoch rang er sich ein höfliches Nicken ab, wirbelte auf den Absätzen herum und stürmte aus dem Büro, gefolgt von einem völlig verdatterten Adron.
Die Einschläge der Brandgeschosse des Imperiums kamen immer näher, sprengten Wohnhäuser in Trümmer, rasierten die oberen Stockwerke von Türmen ab, schlugen wie Bomben ein und ließen ganze Mauern augenblicklich in sich zusammenstürzen. Hoch über ihnen zuckten gleißende Blitze aus den Antennen des großen Verteidigungsturms.
Nur mit Mühe gelangten Crave und Adron zu ihrem Haus, zwängten sich durch die schwere Eingangstür. Sie eilten hinunter in den Keller, einem riesigen Gewölbe, metertief unter der Stadt. Sie erreichten die alten Laboratorien der Stadtalchemisten. Hier hatten sie einst ihre Zauberwerke entwickelt. Nur Crave wusste, wie er in die Maschinenräume der Werke der Alten Meister gelangen konnte. Doch die waren nicht sein Ziel. Er trat in sein Labor, wartete, bis Adron ihm gefolgt war. Sein Sekretär, dem er nur selten den Zutritt gestattete, blickte auf einen riesigen, golden schimmernden Ring, der einen gehörigen Teil der Bodenfläche des Labors einnahm. Er maß im Durchmesser knapp das Doppelte eines Menschen. Es war eine Maschine ganz besonderer Art. Drei Jahre hatte ihre Konstruktion gedauert und viele Nächte Forschung waren im metallurgischem Labor notwendig gewesen, tonnenweise Gold, Silber und weitere seltene Metalle, die Crave alle nach Cal-Illion importiert hatte.
»Ich bin nicht sicher, was Ihr mit diesem Ring erreichen wollt, Meister. Ihr sagtet selbst, dass er keine Waffe sei«, meinte Adron skeptisch.
»Ich weiß«, zischte Crave ungeduldig. Er eilte zu seinem Labortisch, wo er eine große Konsole aus verschiedensten Hebeln angefertigt hatte. Die Steuerung für seinen Zauberring. Er zog und drückte die Schalter und Hebel in verschiedene Positionen, bis der goldene Ring am Boden plötzlich zu brummen und zu vibrieren begann.
»Es ist ein Teleporter«, verkündete Crave seinem staunenden Sekretär stolz. »Er wird mich auf Reisen schicken, zu fremden Orten, die noch kein Mensch gesehen hat. Denn die Waffe, die ich suche, sie findet sich nicht in dieser Welt. Sie existiert allein in Fernwelt! Dort ist man unserer Zeit um Jahrhunderte voraus. Fernwelt ist voller Wunder, die man sich selbst in den kühnsten Träumen nicht vorstellen kann.«
Einen Moment lang starrten sich Meister und Sekretär wortlos an.
»Ihr wollt nach Fernwelt reisen? Wie ist das möglich?«
Crave öffnete den Kragenverschluss seiner roten Tunika, griff in die Brustinnentasche und brachte einen kleinen, kantigen Gegenstand zum Vorschein. Es war das Bruchstück eines milchig-weißen Kristalls, kaum größer als der Reißzahn eines Wolfes und von ganz ähnlicher Form, zudem schartig an den Rändern.
»Das … Ding? Ihr habt wahrhaftig das Ding benutzt? Meister, das ist sehr riskant.« Erschrocken wich Adron zurück.
»Laurnin-Estra«, sagte Crave und nickte ernst. »Es zu benutzen, obliegt allein den Stadtalchemisten von Cal-Illion. Es hat mir die Baupläne für meinen Teleporter gezeigt und mich in den letzten drei Jahren angeleitet. Er hat mir auch die geheimnisvolle Waffe beschrieben, und wo und wann sie in Fernwelt zu finden ist.«
Adron schüttelte den Kopf. »Meister, Ihr seid verrückt! Laurnin-Estra darf nicht benutzt werden! Die Alten Meister haben es genau aufgeschrieben, ihre Warnungen sind heilig! Nur zu siebt soll man den Geist in diesem Stein anrufen, nur zu siebt vermag man dem Wahnsinn zu trotzen, dem man durch ihn ausgesetzt ist.«
Crave kannte die Regeln. Die sieben Alten Meister, die ersten Alchemisten Cal-Illions, hatten sie aufgestellt. Dabei hatten sie das geheime Wissen dieses Zaubersteins doch selbst genutzt, um ihre Werke zu erschaffen. Sie hatten durch das magische Wissen in diesem Stein sogar eine künstliche Energiequelle geschaffen, die niemals erlischt. Warum also sollte er, als Nachfolger der sieben Meister, den Laurnin-Estra nicht auch nutzen? Befand sich Cal-Illion nicht in existenzieller Not?
»Ich habe den Verstand nicht verloren, Adron«, versicherte Crave seinem jungen Sekretär – einem Mann, der ihm wegen seines beschränkten Denkvermögens kaum als Alchemist nachfolgen würde. Crave war sehr enttäuscht von ihm. »Schau nur, meine Maschine funktioniert! Ist dies etwa das Werk eines Wahnsinnigen!«, schimpfte er. »Ich sage dir, ich werde nach Fernwelt reisen und dann hierher zurückkehren, mit einer Waffe, um das Imperium zu besiegen.«
Was ihm der Stein sonst noch gezeigt hatte, die vielen unverständlichen, verrückten Details, davon konnte Crave Adron nichts erzählen. Der junge Mann würde es nichts verstehen. Wie sollte er auch erklären, dass er die Zerstörung Cal-Illions gesehen hatte, reduziert zu Ruinen, verlassen von allem menschlichen Leben. Wie sollte er verdeutlichen, dass er das Versagen der Werke der Alten Meister gesehen hatte; aber auch den Ausweg! Diese eine Waffe, die alle Armeen der Welt zu vernichten mochte. Diese eine Waffe, welche die Rettung für die Stadt und seine Bewohner bedeutete.
»Wohin nach Fernwelt wollt Ihr reisen, Meister?« Adron wirkte nun regelrecht verzweifelt. »Wollt Ihr diese Reise etwa allein antreten? Ihr braucht doch sicher einen Sekretär.«
Mit einem dankbaren Lächeln fasste Crave Adron an der Schulter, schüttelte den Kopf. Beschränkt im Verstand, aber treu im Herzen, dachte Crave. »Es wird eine weite Reise, Adron, eine gefährliche Reise. Deshalb muss ich allein gehen. Ich habe die benötigte Energie exakt berechnet. Sie reicht nur für eine Person von durchschnittlicher Größe und Gewicht. Sie neu zu berechnen, dafür reicht die Zeit nicht mehr.«
»Fernwelt«, murmelte Adron skeptisch. Seine Augen musterten Crave mit neuer Skepsis. Er hält mich für völlig verrückt, war sich der Stadtalchemist sicher, lächelte aber nur darüber. Er hatte all das gesehen, der magische Stein hatte es ihm gezeigt. Er konnte nur nichts beweisen, doch er wusste, es war die Wahrheit.
»Fernwelt kennt niemand, kein Weg dorthin ist bekannt, es gibt nur Gerüchte. An den Akademien in Elissa und in den Hallen der Philosophen Timaretes hält man Fernwelt sogar für einen Mythos, eine Sage aus alter Zeit.«
»Fernwelt existiert! Ich werde es dir beweisen, wenn ich zurückkehre.«
Mehr konnte Crave nicht dazu sagen, als hinter ihnen die Tür des Labors geöffnet wurde. Eine junge Frau steckte schüchtern ihren Kopf herein.
»Meister?«, rief sie weinend. Lindira gehörte zum Dienerzirkel des Stadtalchemisten, eine sehr intelligente junge Frau, der Crave durchaus zutraute, selbst Alchemistin zu werden. Vor drei Jahren war sie ohne ihre Eltern nach Cal-Illion gekommen, eine Geflüchtete aus dem Norden des Imperiums, wie sie erzählte. Crave kannte kein Mädchen, dem er mehr Klugheit und zugleich Warmherzigkeit zuschrieb.
»Meister, die Werke der Alten Meister schweigen. Der Feind rückt vor. Die Wachen sagen, die Marktstraße und der Gartenweg seien bereits in der Hand des Imperiums. Sie werden bald die Enge Gasse heraufkommen, direkt hierher. Lord Reclarn erbittet Eure Weisheit«, berichtete sie und wischte sich Tränen aus dem Gesicht.
Crave nickte ihr dankbar zu. Er wandte sich an Adron und schaute diesem ernst in die Augen. »Ihr wisst, was zu tun ist«, sagte er finster. »Der Zugang zu den Werken der Alten Meister muss geheim bleiben. Ihr müsst dafür Sorge tragen!«
Die Selbstzerstörung, dachte Crave. Er hatte den Turm mit Sprengfallen aus explodierendem Pulver versehen, die per Hebelzug ausgelöst werden konnten. Eine elektrische Ladung würde sie entzünden und den Turm in sich kollabieren lassen. Sein Labor, sein Studierzimmer und der einzige Zugang zu den Werken der Alten Meister wären dann für immer verschüttet.
»Dann sitzt Ihr in der Falle«, meinte Adron. »Ohne den Teleporter könnt Ihr nicht zurückkehren.«
»Ich werde in Fernwelt einfach einen neuen bauen«, versicherte Crave lachend. Natürlich würde er das, denn niemals würde er Laurnin-Estra zurücklassen. Der magische Stein begleitete ihn auf dieser Reise.
»Meister«, sagte Lindira nun, kam näher und fasste Crave am Ärmel: »Meister, Ihr müsst das nicht tun, ihr dürft das nicht tun! Es gibt einen anderen Weg, Laurnin-Estras Wissen zu nutzen, um die Menschen dieser Stadt zu retten. Schaltet Eure Maschine ab, damit die Werke der Meister wieder wirken. Ich weiß, sie werden uns verteidigen – selbst jetzt noch.«
Erstaunt blickte er auf die junge Frau hinunter. Ihr Bitten wirkte so verzweifelt, dass er tatsächlich für einen Moment darüber nachdachte, sein Vorhaben aufzuschieben. Woher konnte sie überhaupt wissen, dass sein Teleporter der Grund dafür war, dass die Werke der Meister schwiegen? Wie konnte sie auch nur erahnen, wie viel Energie seine Maschine benötigte, die ganze Ladung eines Blitzschlags … Wild schüttelte er den Kopf. Nein! Er musste es tun, es gab keinen anderen Weg.
Er nahm Lindira in die Arme, drückte sie an sich. Sie war ihm in den letzten drei Jahren wie eine Tochter geworden, so schlau und gebildet. Sie wird eine hervorragende Alchemistin werden, wusste er. »Es gibt keinen anderen Weg. Ihr versteht das nicht, aber ich weiß es«, sagte er ihr, küsste sie auf die Stirn. »Vertraut mir einfach, so wie immer.«
Dann wandte er sich Adron zu, der fassungslos den Kopf schüttelte. »Ihr habt die Werke abgeschaltet, damit Euer Teleporter mit Energie versorgt werden kann? Stimmt das?«, rief er zornig.
Verärgert, dass er in der Stunde der größten Not so ungerecht angeklagt wurde, schritt Crave an Adron vorbei, kontrollierte die Einstellungen an der Steuerkonsole und trat in die Mitte des goldenen Rings.
»Es ist der einzige Weg«, versicherte er Adron und Lindira noch einmal.
»Es verändert Euch bereits«, glaubte sein Sekretär zu erkennen, deutete auf den magischen Stein in Craves Faust. »Ihr habt Euch in die Irre leiten lassen von diesem Ding.«
»Es ist möglich«, zischte Crave nun voller Zorn. Es gefiel ihm gar nicht, dass Adron den Laurnin-Estra abfällig als Ding bezeichnete. Noch weniger gefiel ihm die andauernde Skepsis. Er hatte es gesehen, verdammt nochmal. Der Stein hatte ihm die grausame Zukunft gezeigt.
Von oben wurden Rufe laut, die vor Soldaten warnten. Getrampel erklang, wildes Geschrei, das Klirren von Schwertern, die aufeinandertrafen.
»Sie kommen«, jammerte Lindira, flüchtete in die Arme Adrons, der sie festhielt. Der Weg nach oben war abgeschnitten. In den heiligen Hallen der Alchemisten ging es bereits um Leben und Tod.
»Dann lasst uns keine Zeit mehr verlieren. Zieht den roten Hebel an der Wand und eilt zum Fluchtausgang! Ihr habt fünf Minuten, danach bricht über uns alles zusammen.«, wies Crave sie an. »Erwartet meine Rückkehr in drei Tagen!«
Lindira schüttelte energisch den Kopf: »Ihr werdet nicht zurückkehren, Gilford Crave. Ihr könnt nicht zurückkehren, es ist schlichtweg unmöglich. Ihr habt Laurnin-Estra falsch verstanden. Er ist nur der Splitter eines weitaus mächtigeren Juwels und zeigt Euch keinen vollständigen Einblick. Brecht jetzt ab und flieht mit uns! Alles andere führt ins Verderben. Meister, ich flehe Euch an … lasst es sein!«
Tränen standen in ihrem hübschen, verzweifelten Gesicht. Sie fiel vor ihm auf die Knie, bat noch einmal darum, aufzuhören. Crave konnte darüber nur lächeln. Was wusste dieses junge Ding schon von temporalen Gleichungen? Er, Gilford Crave, hatte in den magischen Stein geblickt und die Zukunft gesehen. Es gab keine Alternative, nur er wusste das. Das Brummen des Teleporters wurde lauter und dröhnender. Er schloss die Augen, spürte die Energien, die sich rund um ihn aufbauten, versorgt von der geheimen Energiequelle der Alten Meister. Adron und Lindira verschwammen hinter einer Wand aus gleißendem Licht. Er hörte das Gebrüll von Soldaten im Keller, dann ein mehrfaches Krachen wie von Explosionen. Adron oder Lindira mussten die Selbstzerstörung aktiviert haben. Er wunderte sich nur, dass sie sofort auslöste, hatte er sie doch anders konstruiert.
Weiter kamen seine Gedanken nicht. Er sah noch, wie die Welt um ihn herum zu verschwimmen begann, sich auflöste in gleißend grelle Energie, wie eine Macht an ihm zog und zerrte, ihn zu Boden zwang, seinen Körper auseinanderzog, als hätte man ihn zwischen flüchtende Elefanten gekettet. Er wollte schreien, doch kein Laut verließ seinen Mund.
Dann war er fort.
Lindira sollte recht behalten:
Gilford Crave kam nicht wieder zurück.
1. Kapitel: Die neue Assistentin
Tom Packard schlenderte die Wisteria Road entlang, den Kragen seines Mantels hochgeschlagen und die Fäuste tief in die Taschen gesteckt. Der kalte Herbstwind strich ihm durch sein rotes Haar, das Laub raschelte und vereinzelte Blätter tänzelten durch die Luft. Es war bereits Anfang November und der Nebel hing an diesem Morgen tief über Harrow. Beinahe geisterhaft und finster ragten die alten Backsteinbauten rechts von ihm auf. Die Häuser und Bäume auf der anderen Straßenseite konnte er kaum ausmachen.
Schnell kam Tom nicht voran, ein nachdenkliches Zögern bremste seine Schritte, ließ ihn mehr schleichen als gehen. In den letzten Jahren war er kaum hier gewesen. Fünf Jahre lang hatte er hier mit Veyron Swift unter einem Dach gelebt und die unglaublichsten Abenteuer erlebt.
Gut und gerne drei Jahre lag Toms Auszug aus der 111 Wisteria Road zurück, Veyron Swift war aus seinem Leben verschwunden.
Na, gut: nicht ganz. Immerhin hatten sie per Messenger noch gelegentlichen Kontakt, und viermal im Jahr tauschten sie Glückwünsche aus. Zu Ostern, zu Weihnachten, zu Neujahr und an ihren Geburtstagen. Wenngleich es ein Kuriosum war, dass Veyron ihm stets sofort im Anschluss an die eigene erhaltene Gratulation zurückgratulierte.
Im Voraus oder im Nachhinein – je nachdem, was näher am Datum liegt – auch für deinen Geburtstag, lieber Tom, alles erdenklich Gute.
Tom seufzte, während seine Blicke über die dunkelrote Hausfassade glitten, über die alte schwere Holztür mit ihrer dunkelgrünen Farbe.
Ein Interview für den Wilton Morning Star hatte ihn heute zurück nach Harrow geführt. Seit dem Ende seines Studiums vor einem Jahr arbeitete Tom für den Willton Morning Star, einem Newsblog, der seine Leser mit Nachrichten aus allen Teilen der Welt versorgte. Mrs und Mr Willton, die beiden Gründer der Seite, legten höchste Ansprüche an die journalistische Qualität der geposteten Beiträge. Keine reißerischen Headlines, nur fundierte und vollständige Artikel, die keine Fakten unterschlugen. Manchen galten die Willtons als Feinde der Nation, da sie schonungslos die Unzulänglichkeiten von Politikern und Großkonzernen gleichermaßen aufdeckten, wie auch journalistische Fehler und Inkompetenzen der Konkurrenz.
Die Arbeit für WMS hatte Tom schon von Schottland über Deutschland und Russland nach China geführt, und von dort wieder zurück, über die Unabhängigkeitsbewegung in Schottland und über die furchtbar langweilige politische Landschaft in Zentraleuropa. Viele seiner Reisen waren aufregend. Er war bei den Studentenprotesten in diktatorischen Nationen dabei gewesen, hatte Interviews mit Oppositionellen geführt – oft unter Lebensgefahr. Eine aufregende Zeit – aber ohne Albträume.
Sein neuer Auftrag erschien dagegen völlig belanglos: Ein Interview mit dem Selfmade-Milliardär James Havelock. Warum ausgerechnet in Harrow, verstand Tom zwar nicht. Aber es war eine gute Gelegenheit, mal wieder bei Veyron vorbeizuschauen.
Den Fußweg vom Parkplatz am Headstone Drive über die Harrow-View-Straße in die Wisteria Road kannte er wie seine Westentasche, und tatsächlich hatte sich fast nichts verändert. Viele der Nachbarn waren noch die Gleichen, – wenngleich zahlreiche Häuser zum Verkauf standen, wie Tom auffiel. Die Situation war nicht gut in diesem Teil Harrows; eigentlich war sie nirgendwo im Land wirklich gut. Doch die Menschen verdrängten das, schrieben das allen möglichen Gründen zu und nicht den aus Toms Sicht fatalen politischen Entscheidungen der letzten Jahre. Er hatte noch gut Veyrons Worte von damals in Erinnerung: ›Seit wann in der Geschichte der Menschheit wäre man allein besser zurechtgekommen als in einem Bündnis? Wer aus der Geschichte nichts lernt, ist gezwungen sie zu wiederholen! Das ist der Grund, warum die Menschheit so oft auf der Stelle tritt.‹
Eben als er an Veyron Swift denken musste, erschien auch schon 111 Wisteria Road vor ihm aus dem Nebel. Das große, zweistöckige Haus mit seinem spitz zulaufenden Dach, der dunkelroten Backsteinfassade, dem weitläufigen, mit Bäumen und Sträuchern zugewucherten Garten. Und von der Straße führten noch immer die gleichen, leicht schräg liegenden Steinstufen hinauf zur Haustür. Nur ein paar Schritte, dann wäre er oben an der Klingel und würde seinen alten Freund, Mentor und Vormund wiedersehen.
Auch wenn es nun drei Jahre zurücklag und er sich noch sehr lebendig an einige der Albträume erinnerte, wollte er die Zeit mit Veyron unter einem Dach nicht missen. Nie war sein Leben aufregender gewesen – und wie es aussah, würde es das auch nie wieder sein. Diese Zeit war vorbei. Und doch lockte ihn das unausgesprochene Versprechen nach neuen Abenteuern, wenn er an Veyron dachte.
»Ach was«, sagte er sich schließlich. »Wahrscheinlich ist er gar nicht daheim.« Das Bedürfnis, die Treppen hinaufzusteigen und zu läuten, verging wie Rauch. Er war mit dreiundzwanzig Jahren noch viel zu jung für Nostalgie! Abenteuer hin oder her, er hatte jetzt einen wirklichen Job, verdiente sein eigenes Geld und lebte nicht schlecht – zumindest konnte er sich eine Wohnung in Winchester leisten – wo er nur selten schlief, meistens übernachtete er in Hotelzimmern.
Tom drehte sich um, wollte eben fortgehen, als ihm plötzlich zugerufen wurde: »Hey, Tom Packard! Willst du noch länger auf der Straße herumstehen und zusehen, wie das Laub von den Bäumen fällt?«
Das war nicht die Stimme von Veyron Swift. Sie klang hell und melodisch und außerdem rotzfrech.
Überrascht wandte er sich um, sah oben vor der Haustür eine ausgesprochen junge, blondhaarige Frau stehen. Sie war kurzgewachsen und sehr schlank, ihr rundes Gesicht mit den großen, kristallblauen Augen strahlte vor jugendlicher Unschuld. Das Mädchen schien einige Jahre jünger als Tom zu sein. Der violett/weiß-gestreifte Strickpullover, in dem sie regelrecht versank, war ihr um mindestens zwei Nummern zu groß, fiel ihr über die Hände und die Knie. Eine zerrissene Jeans und ein völlig unpassendes, mintgrünes Stirnband, das sie über ihren blonden Rastalocken trug, komplettierten ihre ungewöhnliche Aufmachung.
»Wer um alles in der Welt bist jetzt du?«, fragte Tom, nachdem er einen Moment gebraucht hatte, seine Worte wiederzufinden.
»Na, Nio natürlich«, erwiderte sie. »Veyron sagt, du sollst gefälligst reinkommen, sonst holst du dir noch einen Schnupfen und kriegst Fieber. Es weht ein eisiger Ostwind. Der verheißt nichts Gutes.«
Ohne auf Tom zu warten, drehte diese Nio sich um und verschwand durch die Tür. Tom schüttelte lachend den Kopf und stieg schließlich die Treppen nach oben. Erst jetzt fielen ihm die Blumenrabatten auf, die jemand im Garten angelegt hatte. Herbstastern in den verschiedensten Farben, Chrysanthemen, Dahlien und Anemonen lieferten sich dicht gedrängt einen Wettkampf um Sonnenlicht und Aufmerksamkeit. Tom staunte. Blumen hatte es bei Veyron noch nie gegeben. Für die Gartenpflege hatte sich stets ihre Nachbarin, Mrs Fuller, eingesetzt. Aber das war nie über das Zurechtschneiden der Büsche und Bäume hinausgegangen (wofür Mrs Fuller zweimal im Jahr ihren Neffen gegen ein kleines Taschengeld engagiert hatte). Noch erstaunlicher schien ihm, dass um diese Jahreszeit eine derartige Blütenpracht anzutreffen war.
Tom trat ins Haus und schloss die Tür. Nio stand direkt vor ihm und er bemerkte jetzt erst, wie klein sie war. Wie groß mochte sie sein? Vielleicht ein Meter fünfzig? Sie reichte ihm gerade mal bis zur Brust. »Bist du eine Klientin von Veyron?«, wollte Tom wissen, während er seinen Mantel an die Garderobe hing.
»Was? Nein, natürlich nicht. Ich arbeite für Veyron. Nebenverdienst, verstehst du?«
»Aha, du studierst also«, stellte er fest.
»Jap. Philologie und Geschichte.«
»Und du bist was? Seine Vorzimmerdame?«
»Seine Assistentin, Mr Packard«, rief ihm die wohlvertraute, dunkle Stimme von Veyron Swift aus Richtung des Wohnzimmers zu. »Sie ist dein Ersatz.«
Tom grinste, huschte an Nio vorbei und betrat das große Wohnzimmer am Ende des Flurs. Auch hier hatte sich nichts verändert. Das Bücherregal bog sich noch immer unter der Last hunderter dicker Wälzer, Büchertürme ragten zu allen Seiten auf. Die alte Couch stand an der Wand, gegenüber der große Ohrensessel, in dem Veyron lümmelte, seinen schweren, dunkelroten Morgenmantel um die schlaksige Gestalt gewickelt. Das Haar an den Seiten deutlich silbergrau, aber der Schopf noch immer tiefschwarz, die Falten in seinem hageren Gesicht tiefer und die Falkennase präsent wie eh und je, die Beine überschlagen und die Finger aneinandergelegt, die Augen geschlossen.
»Sie haben sich nach meinem Fortgang eine Assistentin geholt? Wohnt sie bei Ihnen?«, fragte Tom.
Veyron deutete ihm auf der Couch Platz zu nehmen: »Seit den letzten Semesterferien. Njörun ist eine großartige Hilfe. Sie dokumentiert meine Fälle, sortiert meine Akten und hilft mir, die Dinge klarer zu sehen. Ihr differenzierter Blickwinkel ist mir eine willkommene Unterstützung.«
»Njörun«, murmelte Tom. »Ein ungewöhnlicher Name, oder?«
»Nicht, wenn man aus Island kommt«, grummelte die junge Frau, lehnte sich an den Türrahmen und verschränkte die Arme – wobei ihr die viel zu langen Ärmel des Pullovers ein wenig im Weg waren. »Meine Freunde nennen mich Nio. Das ist leichter auszusprechen.«
»Du bist also seit ungefähr einem halben Jahr hier und hast bereits den Garten umgestaltet?«
Sie nickte: »Jap. Schön geworden, nicht wahr?«
Tom schaute überrascht zu Veyron, der kurz lächelte. »Sie hatte zuvor in einer Gärtnerei gearbeitet, die liebe Nio«, sagte er.
»Ich dachte immer, Sie machen sich nichts aus Blumen«, konterte Tom.
»Ich nicht, Nio schon. Übrigens: Nio, würdest du bitte eine Kanne Tee für uns aufsetzen? Das kalte Wetter ist ein guter Anlass für eine schöne Tasse Earl Grey und Toms Besuche sind selten geworden.«
»Stimmt, weil er seitdem auf dem Mars lebt und keine Gelegenheit mehr hatte, hier vorbeizukommen. Aber okay, mir solls recht sein«, maulte sie, wandte sich um und verschwand im Flur.
Diese Aussage hatte ihm doch glatt einen Stich versetzt. Tom ballte unweigerlich die Fäuste und sein schlechtes Gewissen verstärkte sich gleich noch einmal. Beschämt senkte er den Kopf und bemühte sich, in eine andere Richtung zu blicken.
»Hören Sie, Veyron. Ich … also, ich …«, rang Tom um eine Rechtfertigung, aber Veyron hob die Hand und schüttelte den Kopf. »Es gibt keinen Grund, sich zu entschuldigen, mein lieber Tom«, hielt Veyron dagegen. »Die Zeit war reif für dich, dieses Haus zu verlassen und deinen eigenen Weg zu beschreiten. Meine Aufgabe, als dein testamentarischer Vormund und Beschützer, war abgeschlossen. Somit erlosch jegliches Recht meinerseits, dich für meine Abenteuer weiter in Anspruch zu nehmen. Und schau dich an: Du bist erwachsen geworden, trägst jetzt Bart und Anzug. Was Nio betrifft: Die hat ihre eigenen Ansichten zu allen Dingen. Das sollte dich nicht bekümmern.«
Tom strich sich kurz über seinen roten Vollbart. Ihm wurde bewusst, wie sehr er sich in den letzten vier Jahren verändert hatte. »Ich bin beruflich gerade in dieser Gegend, eine einfache Recherche, nichts Weltbewegendes. Da dachte ich, ich schau mal bei Ihnen vorbei, ob Sie zuhause sind und wie’s Ihnen so geht«, versuchte Tom das Thema zu wechseln.
»Eine hervorragende Idee! Und gerade rechtzeitig, wo du doch einen Blogbeitrag über Mister James Havelock schreiben möchtest; seines Zeichens Selfmade-Milliardär. Er besitzt übrigens eine beeindruckende Sammlung an Edelsteinen, eine der größten Privatsammlungen dieses Kontinents«, meinte Veyron und lächelte spitzbübisch, als er Toms verblüfften Gesichtsausdruck bemerkte.
»Woher, um alles in der Welt, wissen Sie das denn schon wieder?«, rief Tom, engte die Augen zu Schlitzen zusammen. »Spionieren Sie mir immer noch nach?«
Nun musste Veyron lachen: »Mitnichten, Tom! Alles ist sehr viel banaler. Die Wahrheit ist so unspektakulär, dass du nie darauf kommen wirst.«
Nun war Tom gespannt. Eigentlich war es unmöglich, dass Veyron von dem geplanten Treffen mit Havelock wissen konnte. Sie hatten seit drei Jahren kaum Kontakt und wenn Veyron ihm nicht hinterherspionierte, wie konnte er dann so etwas wissen?
»Havelocks Assistentin hat es erzählt«, sagte Nio, als sie mit dem Tee hereinkam. Sie stellte ein Tablett mit der Kanne und zwei Tassen auf dem kleinen Beistelltisch ab. »Sie hat heute Morgen angerufen und um einen kurzfristigen Termin gebeten. Und dabei erwähnt, dass sich Havelock eigentlich wegen eines Interviews mit dir treffen wollte. Veyron hat ihr gesagt, dass das warten kann. Vielleicht checkst du besser deine Nachrichten, du scheinst nicht auf dem Stand der Dinge zu sein.«
Nie in seinem Leben war Tom sprachloser. Da stand dieses unverschämte kleine Weibsbild vor ihm und schaute ihn aus ihren großen, blauen Augen unschuldig an. Veyron hingegen lächelte nur, dankte Nio und wies sie an, Havelock zu empfangen, wenn er hier ankäme.
»Sie ist ganz schön schnippisch, die liebe Nio«, meinte Tom, kaum dass sie wieder verschwunden war. Er griff in die Tasche seines Sakkos und fischte sein Telefon heraus. Tatsächlich! Eine kurze Textnachricht mit der Nummer aus Havelocks Sekretariat: Termin abgesagt. Sorry. Wir melden uns. Seltsam, dass er den Nachrichtenton nicht gehört hatte. Diese Technik, dachte er abfällig. Mit einem Achselzucken steckte er das Smartphone zurück in die Tasche. Lachend wandte er sich wieder an Veyron: »Wie sind Sie nur an die gekommen?«
Veyron setzte sich in seinen Sessel, zuckte mit den Schultern. »Nach deinem Fortgang versuchte ich mich allein durch ein paar kleinere Fälle zu schlagen, so wie früher eben. Aber ich stellte fest, dass mich das nicht so erfüllte, wie jene Abenteuer, die wir beide bestritten haben, Tom. Ich nahm mir eine Auszeit, ging für ein Jahr in ein Kloster nach Schottland, verbrachte einige Zeit bei Mönchen in Tibet, reiste um die Welt und studierte Mythen und Legenden, denen ich bisher noch nicht mein volles Interesse gewidmet hatte«, erzählte er. Tom schaute seinen früheren Vormund, den er immer als seinen Patenonkel bezeichnet hatte – was nie ganz zutreffend war – erwartungsvoll an: »Und der Dunkle Meister? Sind Sie ihm auf der Spur geblieben?«
Veyron lächelte schief, dann seufzte er: »Der Dunkle Meister … Ja, da gibt es einiges zu erzählen, doch dazu später mehr. Ich muss zugeben, Tom, dass ich mich wahrhaftig in einer Sinnkrise befand. Eine Reihe von Rückschlägen ließ mich zweifeln, mir fehlte schlichtweg die Kraft, diesen Kampf fortzuführen. Frieden, Erholung, Zerstreuung, danach verlangte es mich. Tatsächlich spielte ich sogar mit der Überlegung, aufzugeben und mich zur Ruhe zu setzen, vielleicht um Bienen zu züchten – wie eines meiner großen Vorbilder. Jedoch gelangte ich bald zu der Erkenntnis, dass die Zeit hierfür noch nicht reif war. Wie könnte ich herumsitzen und mich dem Müßiggang hingeben, während der Dunkle Meister die Welt quälte? So entschloss ich mich, nach London zurückzukehren und meine alten Tätigkeiten wieder aufzunehmen. Doch das ging nicht ohne Unterstützung und Hilfe. Ich habe mich sehr an unsere Zusammenarbeit gewöhnt, Tom, wusste aber auch, dass ich dich nicht mehr einfach so aus deinem Alltag reißen konnte. Also brauchte ich einen neuen Partner, einen Assistenten. Deshalb habe ich entsprechende Inserate aufgegeben. Eine Reihe verschiedener Leute hat sich beworben. Alles langweilige Menschen, Streber, Besserwisser und Idioten. Manche zweifellos intelligent, aber so sehr von den geistigen Normen eingeengt, dass es völlig unmöglich wäre, das Unlogische und Unwirkliche mit ihnen zu ergründen. Bis eines Tages Njörun Ögmundsdottir vor der Tür stand. Als ich sie fragte, wie sie sich ihre Aufgaben vorstellte, sagte sie: ›Blumen. Es fehlt bei Ihnen an Blumen. Um Zwerge und Schrate können wir uns später kümmern, aber lassen Sie uns zuerst ein paar Blumen pflanzen! Das war so unkonventionell und verrückt, dass mich das sofort überzeugte.«
Tom machte große Augen: »Das ist alles? Sie haben Nio engagiert, weil sie einen Blumentick hat?«
Veyron stieß ein kurzes Lachen aus, nahm sich eine Tasse Tee und nippte daran. »Selbstverständlich spricht sie obendrein sämtliche nordischen Sprachen fließend, ebenso Gotisch, Alt-Germanisch, Alt-Englisch, Alt-Hochdeutsch, Latein, Griechisch und einige keltische Dialekte sowie einige Sprachen aus Südostasien, die ich nicht im Ansatz beherrsche. Für meine Arbeit sind dies wertvolle Ergänzungen.«
Tom nickte. »Wenigstens ist Ihr Verstand noch immer pragmatisch veranlagt. Also schön, Sie haben mich neugierig gemacht. Was hat es mit Havelock auf sich, warum braucht er Ihre Hilfe?«
»Das werden wir, so hoffe ich, gleich erfahren«, sagte Veyron und legte die Fingerspitzen aneinander.
Kurz darauf klingelte es an der Tür. Tom hörte, wie Nio öffnete und mit einem Mann redete. Nach einem kurzen Augenblick erschienen die beiden im Wohnzimmer.
»Werte Herren: Mr James Havelock bequemt sich zu Ihnen«, stellte Nio mit gespielt nasaler Stimme den Besucher vor. Havelock war ein großer Mann von beeindruckender Statur, mit breiten Schultern und muskulösem Nacken. Unter seinem offen getragenen, dunkelblauen Seidensakko trug er einen grauen Rollkragenpullover teuerster Marke. An jedem Finger saßen dicke Ringe mit großen Edelsteinen; Selbst Könige oder der Papst wirkten dagegen fast bescheiden. Havelocks Alter war schwierig einzuschätzen, Tom tippte ihn auf Mitte fünfzig und entdeckte deutliche Anzeichen von Botox-Behandlungen an Stirn und Wangen.
»Wer von euch ist Veyron Swift?«, fragte Havelock mit nuschelnder Stimme. Er schmatzte laut, kaute pausenlos auf einem Kaugummi herum.
Veyron erhob sich und trat dem Selfmade-Milliardär entgegen. Soweit Tom wusste, hatte Havelock sein Vermögen mit irgendeiner Software-App gemacht, die heutzutage schon wieder nahezu vergessen war. Aber es reichte, um sich einen Hangar voller Privatjets zu leisten sowie eine Garage mit Oldtimern und einmaligen Rennwagen, die in ihrem Umfang einem Museum gleichkamen. Ebenso wie seine berühmte Edelsteinsammlung.
»Ich bin Veyron Swift. Willkommen, Mr Havelock! Bitte, setzen Sie sich«, sagte Veyron und deutete auf die Couch. Tom stand extra auf, um Havelock Platz zu machen. Doch der schüttelte nur den Kopf.
»Ich stehe lieber. Und du bist wer, Rotschopf?«
»Tom Packard; wir hätten uns eigentlich heut getroffen, Mr Havelock. Leider kam Ihnen etwas dazwischen.«
Einen Moment schien der Milliardär ratlos. Er zuckte schließlich mit den Schultern: »Echt? Keine Ahnung, müsste erst meine Assistentin fragen. Weswegen wollten wir uns eigentlich treffen?«
»Wegen Ihrer Edelsteinsammlung, ich will darüber einen Blogbeitrag für WMS verfassen«, erklärte Tom. Im Hintergrund sah er Nio stehen, die sich mit Mühe ein Lachen verkneifen musste. Sie schien sich gerade zu fragen, wer von ihnen der größere Idiot war – Tom oder Havelock.
»Meine Edelsteinsammlung … Gut, dass du das erwähnst, Tim … ich darf doch Tim sagen, oder? Genau deswegen bin ich hier. Veyron – ich darf doch Veyron sagen, oder? Also, bei mir wurde heute Nacht eingebrochen und der Dieb hat mir einen Edelstein gestohlen!«
Veyron ließ sich in seinen Sessel fallen, drückte sich mit Daumen und Zeigefinger die Augen zu. »Mr Havelock«, setzte er an, wurde jedoch von diesem sofort unterbrochen.
»James, nenn mich James«, sagte Havelock grinsend und schmatzte weiter auf seinem Kaugummi herum.
Veyron war sichtlich bemüht nicht zu seufzen oder den Gast entnervt abzuwinken. »Mr Havelock, ich verstehe Ihren Wunsch um absolute Diskretion, doch bei Diebstählen rate ich Ihnen, sich an die örtliche Polizei zu wenden.«
»Natürlich, das werde ich auch. Aber später, denn der Diebstahl ist so ungewöhnlich, ich kann mir keinerlei Reim darauf machen. Tatsächlich wurde nichts von Wert gestohlen. Aus meiner Werkstatt hat der Dieb einen zerbrochenen Edelstein entwendet. Ich hatte ihn zusammen mit einer Sammlung weitaus kostbarerer Steine ersteigern lassen. Eigentlich ist er Abfall, kaum mehr als zwei oder drei Pfund wert. Trödel, wenn du verstehst.«
Veyrons Körper spannte sich an. Er legte die Fingerspitzen aneinander: »Nur Trödel, sagen Sie? Sicherlich war er einzigartig, etwa in Form oder Farbgebung?«
»Nein, nein. Es war nur einer von vielen kleineren Steinen, kaum mehr als ein einfacher, leicht milchig-weißer Bergkristall, eine Absplitterung eines größeren Steins. Wirklich keine Seltenheit, in meiner Edelsteinwerkstatt finden sich viele solcher Reste. Ich behalte Sie, um bei Bedarf daraus Steine für Ringe, Türgriffe und Hemdknöpfe schleifen zu lassen. Nobel geht die Welt zugrunde, wenn du verstehst«, sagte Havelock und musste über seinen eigenen Scherz lauthals lachen.
Veyron schien hingegen gar nicht nach Humor. Mit tiefem Ernst versank er kurz in Nachdenklichkeit: »Wann geschah der Überfall?«
»Heute Nacht, gegen drei Uhr. Ehrlich, Veyron, ich komme nicht wegen des Diebstahls zu dir. Das interessiert mich nicht, auch nicht die Tatsache, dass es noch nie jemand geschafft hat, in mein Anwesen einzubrechen. Ich meine, die Fenster sind aus Panzerglas, alles ist mit Alarmanlagen und Laserbarrieren gesichert. Nein, nein. Ich bin wegen der Natur des Einbrechers hier.« Havelock hielt einen Moment inne, blickte wieder zu Tom. »Kann man Tim vertrauen?«
»Mr Havelock«, erwiderte Veyron finster. »Tom Packard ist absolut vertrauenswürdig. Wir beide haben schon viele Fälle gemeinsam gemeistert. Wenn Ihr Einbrecher in einer Weise ungewöhnlich war, dann sind Sie bei ihm in ebenso guten Händen wie bei mir.«
Veyron deutete in Richtung Tür, wo Nio noch immer am Rahmen lehnte, und alles interessiert beobachtete. »Nicht weniger vertrauenswürdig ist meine Assistentin, Njörun. Diskretion ist unser Berufscredo«, versicherte Veyron. Demonstrativ verschränkte Nio ihre Arme und nickte ernst. Tom hingegen gefiel es nicht ganz, dass Veyron seiner neuen Assistentin das gleiche Vertrauen schenkte wie ihm. Immerhin war sie erst seit ein paar Wochen hier und hatte noch nie etwas von Elderwelt gesehen.
»Also, Mr Havelock«, begann Veyron von neuem – die Aufforderung seinen Klienten ihn beim Vornamen zu nennen, geflissentlich ignorierend – »Sie haben all Ihre Termine kurzerhand verworfen, um mich aufzusuchen, und dabei hatten sie es verdammt eilig. Schnell in die nächstbesten Schuhe, das erstbeste Sakko aus dem Schrank – seit einiger Zeit nicht mehr gerade Ihr Lieblingsstück – und ab in den Wagen. So eilig hatten Sie es, denn nicht nur wollten sie zu mir gelangen und erzählen, was so einzigartig, so außerweltlich an dem Überfall war, sondern hatten obendrein noch etwas in Hounslow zu erledigen, dass keinen Aufschub duldete.«
Havelock nickte zögernd: »Okay, einverstanden. Also gut …« Er musste Luft holen und in seiner Lässigkeit begann er plötzlich herzlich zu lachen. Er klatschte in die Hände und schüttelte den Kopf. »Unglaublich! Woher weißt du das alles? Ich meine, ich habe doch noch gar nichts erzählt. Und verdammt ja, ich habe dieses Sakko schon lang nicht mehr getragen, aber es musste schnell gehen. Ich stand wirklich unter Zeitdruck; wegen dieser anderen Sache in Hounslow. Es ging um ein paar wirkliche seltene Edelsteine. Da musste ich heute noch zuschlagen, sonst wären sie weg gewesen. Also, raus damit! Woher weiß du das alles?«, rief Havelock begeistert.
Mit einem Auflachen sprang Veyron aus seinem Sessel und begann im Wohnzimmer auf und abzumarschieren. »Alles keine Magie, Mr Havelock. Verschiedene Streifen auf Ihren Lackschuhen glänzen, andere hingegen nicht. Ihr Personal war mit dem Poliermittel entweder schlampig, oder – was wahrscheinlicher sein dürfte – schlichtweg noch nicht fertig. Wäre Ihr Aufbruch nicht in höchster Eile erfolgt, wäre es Ihnen gar nicht erst in den Sinn gekommen, in dieses Paar Schuhe zu schlüpfen. Ihr Sakko ist am Revers leicht angestaubt, weil es die meiste Zeit nur im Schrank hängt, daher die Schlussfolgerung, dass er nur selten getragen wird, folglich nicht mehr zu Ihren Lieblingsstücken gehört. Auch hier schließt die Wahl des Sakkos auf den Mangel an Zeit für eine aus Ihrer Sicht ästhetischere Entscheidung. Zuletzt kurz zum Fakt, dass Sie sich noch vor einer halben Stunde in Hounslow aufgehalten haben: Der Stoff an Ihren Schultern ist feucht. Heute Morgen hat es in einem dünnen Streifen über Hounslow kurz geregnet, während der Rest Londons trocken blieb«, ratterte Veyron seine Analyse herunter. Schließlich wirbelte er zu seinem Klienten herum. »Jetzt fehlt nur noch der Grund für die Eile. Wenn Sie so weit sind, erzählen Sie mir bitte alles! Vergessen Sie nicht das kleinste Detail!«
Havelock klatschte in die Hände, strahle vor Begeisterung. »Fantastisch«, rief er aus, »wirklich großartig! Ich hatte schon befürchtet, du wärst ein Spinner. Aber jetzt sehe ich, dass ich bei dir an der richtigen Adresse bin. Okay, ich denke, ich kanns euch dreien erzählen. Wenn einer was an die Presse weitergibt, verklag ich euch auf einen Millionenbetrag. Außerdem ist es so absurd, dass es eh keiner glauben wird.«
Früher wäre Tom jetzt aufgesprungen und hätte gegen diese Drohung protestiert, aber zu seinem eigenen Erstaunen blieb er einfach sitzen. In der Tat: Die letzten Jahre hatten ihn verändert. Veyron blieb sowieso unbeeindruckt und Nio zuckte auch nur mit den Schultern. Tom erwischte sich dabei, wie er innerlich schmunzelte, als er die Enttäuschung in Havelocks Gesicht erkannte, dass er niemanden einzuschüchtern vermochte. Er schien keine Ahnung zu haben, mit wem er es zu tun hatte und was Tom und Veyron schon alles erlebt hatten.
»Der Einbrecher«, begann Havelock. »Also, der war kein Mensch. Und ich weiß es, denn ich selbst bin diesem Kerl, oder was auch immer, gegenübergestanden.« Erwartungsvoll schaute er abwechselnd zu Veyron und Tom, drehte sich dann zu Nio um, als hoffte er zumindest von ihr eine überraschte Reaktion. An der Verblüffung in Havelocks Gesicht erkannte Tom, dass er sich irgendetwas anderes, als drei stille Zuhörer erhoffte.
»Bitte beschreiben Sie den Einbrecher«, forderte ihn Veyron ungerührt auf.
»Mitten in der Nacht habe ich es rumpeln und klirren gehört und bin vom Schlafzimmer runter in die Ausstellungsräume meiner Sammlung. Natürlich mit meiner Pistole. Ich hab’ in jedem Raum eine Waffe, genau für solche Fälle – dass sich jemand ungebeten Zutritt in meine Räumlichkeiten verschafft. Dann sah ich ihn: ein großer Kerl, breite Schultern, grobschlächtige Gestalt, fettiges, schwarzes Haar, ein dicker, dunkler Mantel, schmutzige Schuhe. Zuerst hielt ich ihn für einen Penner von der Straße, doch dann drehte er sich um. Was soll ich sagen … sein Gesicht … Also sein Gesicht, das war eine Ruine von einem Gesicht, die Nase mehrfach gebrochen und platt, die Augen gelb. Und ich meine richtig gelb, brennend und hasserfüllt. Die Haut schmutzig, aschgrau in der Farbe, und fleckig. Dazu furchtbar vernarbt, als wäre sie aus altem Leder gemacht.«
»Ein Schrat«, schlussfolgerte Tom und schnippte mit den Fingern. »Ein Schrat mitten in London. Das hatten wir auch noch nicht oft.«
»Nicht so voreilig, Tom«, bat Veyron. »Was ist weiter geschehen?«
»Er hat mich angegriffen«, sagte Havelock und musste lachen. »Hat mir eins in die Fresse gegeben … tja, und danach weiß ich nichts mehr. Bin wohl bewusstlos zu Boden gegangen. Dreimal in der Woche kommt der Fitnesstrainer, und dann haut mich so ein Kerl einfach um. Ist mir fast peinlich. Freilich hätte ich ihn erschießen können, aber ich war so erschrocken, dass ich meine Waffe ganz vergessen habe.«
»In der Tat können Sie froh sein, dass Sie mit dem Leben davongekommen sind«, meinte Veyron ungerührt. »Fahren Sie bitte fort!«
»Er ist abgehauen«, sagte Havelock. »Wie erwähnt, hat er nichts weiter mitgehen lassen als diesen einen vollkommen wertlosen Kristallsplitter. Also was ist nun? Kannst du das Rätsel lösen, Veyron? Mit wem und was hatte ich es letzte Nacht zu tun?«
Veyron stand auf und begann in seinem Wohnzimmer auf und abzumarschieren. Tom wusste, wie intensiv sein früherer Vormund gerade nachdachte, wie er Theorien entwarf, verschiedene Szenarien durchspielte und auf ihre Tauglichkeit überprüfte.
»Ich muss dorthin«, sagte er schließlich. »Mr Havelock, ich fürchte, es ist unabdingbar, den Tatort zu besichtigen. Ansonsten vermag ich keinen Zusammenhang zu erkennen, der irgendeinen Sinn ergibt.«
Mit einem breiten Grinsen war Havelock sofort damit einverstanden.
Havelock-Manor befand sich östlich von Eastcote Village, nordöstlich von Harrow gelegen, mitten im Ruislip-Wald, unweit des als Ruislip-Lido bezeichneten Sees, weit von aller Nachbarschaft entfernt. Nur eine einzige Straße führte dorthin, schnurgerade durch den Wald, bis man auf das großzügige Areal rund um das alte Landgut kam. Das dreistöckige Manor ragte gespenstisch aus dem morgendlichen Nebel auf, als sie mit Havelocks Wagen vorfuhren – einem monströs anmutenden Geländewagen, der dank eines Elektromotors nahezu geräuschlos auf den gekiesten Hof fuhr. Sofort eilte eine ganze Dienerschar heran, die Havelock und seinen Gästen die Türen öffneten. Eine gertenschlanke, mindestens etwa dreißig Jahre jüngere Frau mit langem, dunklem Haar hieß Havelock willkommen und plapperte wild drauflos. Tom bekam nur mit, dass es um Anwälte und Versicherungen ging. Wahrscheinlich wegen des Überfalls in der Nacht. Irgendjemand versicherte dies, ein anderer das und der Tenor war, dass es eigentlich nicht möglich hätte sein dürfen, dass die Alarmanlage ausgefallen war.
»Merk dir das, Tom«, murmelte Veyron an Toms Seite. »Es gab keinen Stromausfall, weder in Eastcote Village noch drüben in Ruislip Common.«
»Vielleicht hat der Schrat die Leitungen durchtrennt«, mutmaßte Tom.
»Und woher weiß ein Schrat, was eine Alarmanlage sein soll? Also echt, Tom Packard! Die Leitungen sind alle im Haus verlegt und die Alarmanlage computergesteuert. Er hätte den Strom abstellen müssen und das wäre sicher aufgefallen«, gab Nio zum Besten. Verärgert drehte sich Tom zu ihr um. Nio hatte die Hände in die Taschen ihres Pullovers gestopft und wippte auf den Fußspitzen vor und zurück.
»Das wäre gar nicht möglich. Das Haus ist ein Selbstversorger und nicht an das städtische Stromnetz angeschlossen. Seht ihr die Solarplatten auf dem Dach? Das Modernste vom Modernen, ich scheue keine Kosten«, warf Havelock dazwischen.
Nio grinste Tom unschuldig zu und zuckte mit den Schultern. »Was es alles gibt, was? Da kommt ja wirklich keiner mehr mit.«
Tom verkniff sich seine Antwort und wandte sich stattdessen an Veyron, der amüsiert lächelte. »Mitdenken, Tom«, ermahnte er ihn und zwinkerte Nio zu. Danach beeilten sie sich, Havelock und seine noch immer plappernde Assistentin einzuholen. Jetzt ging es darum, wen man alles verklagen könnte, vornehmlich den Hersteller der Alarmanlage.
Sie marschierten über den Hof, eine hohe Steintreppe hinauf und dann hinein in das imposante Manor, wo sich ihnen wie auf Kommando die Türen öffneten. Tom hörte leise Elektromotoren surren und nahm an, dass alles in diesem Gebäude vollautomatisiert war.
»Willkommen, willkommen, ein dreifaches Willkommen«, rief Havelock. »Ich würde euch ja zu gern das ganze Anwesen zeigen – vielleicht später. Jetzt aber zuerst einmal meine Edelsteinsammlung. Kommt! Sie nimmt den ganzen zweiten Stock ein. Insgesamt sind rund fünftausend Exponate aus aller Welt ausgestellt, von Diamanten über Rubine und Smaragde zu Bergkristallen und Quarziten in allen Größen und Formen. Ich habe ein Zimmer, das ist eine einzige Geode, gefunden im Jahr 1877, irgendwo in Südafrika. Es gibt aber auch wimpernkleine Splitter, für die man fast eine Lupe braucht, um sie zu erkennen. Es ist eine eigene, faszinierende Welt.«
Über ein breites Treppenhaus ging es nach oben. Voller Stolz öffnete Havelock die Flügeltüren zu seiner Sammlung. Die Wände waren dunkel, ebenso der Boden und nur wenige Lampen erhellten die Räumlichkeiten, so dass eigentlich nur die vielen Schaukästen und Vitrinen bewundert werden konnten, in denen die Unmengen an Edelsteine und Minerale zu sehen waren. Havelock erklärte ihnen eine Menge über Silikate und welche Formen sie annehmen konnten, wie sich Paragenesen zusammensetzten und warum einige Mineralien vollkommen perfekte geometrische Formen annahmen, als wären sie von einer Gottheit mit Lineal vermessen und präzise aus einer Form ausgeschnitten worden. Es gab Steine, die hielten Tom und Nio für Gold, nur um von Havelock verbessert zu werden, dass es sich dabei um Chalkopyrit handelte, sogenannten Kupferkies. Besonders gut gefielen Nio einige blaue Steine, Kyanit, worauf immerhin Veyron zum Besten zu geben wusste, dass diese chemisch mit Aluminium verwandt waren. Tom hingegen konnte sich für die fantastisch perfekte Geometrie der schwarzen Pyroxene und den sternartigen Gebilden aus Muskovit begeistern.
»Das ist sicher alles sehr fantastisch. Leider haben wir nicht die Zeit, die Schönheit und Perfektion zu bestaunen, zu der die Erde imstande ist und die uns Menschen zurecht auf unseren Platz verweist. Wir sind doch nur rasch vergängliche Wesen im Vergleich zu diesen Kostbarkeiten. Zeigen Sie uns nun bitte Ihre Werkstatt, Mr Havelock«, unterbrach Veyron die viel zu kurze Führung durch die Schatzwelten.
Der Milliardär führte sie durch Korridore und Hallen weiterer glänzender, funkelnder, schillernder Schätze, bis sie einen kleinen, relativ schmucklosen Raum erreichten, der ebenso von Vitrinen voller Edelsteine und Mineralien eingerahmt war. Im Zentrum standen ein Tisch samt Mikroskop und ein Werkzeugkasten mit mehreren kleinen Schubladen.
»Die meisten meiner Schätze werden so wie ihr sie gesehen habt aus dem Felsen gebrochen oder gefunden, sauber gemacht und direkt ausgestellt. Aber es findet sich auch immer wieder viel Bruch und dieser wird hier nachbearbeitet, um daraus Schmuck herzustellen«, ergänzte Havelock. Stolz zeigte er ihnen eine Reihe runder, schwarzer Perlen und erklärte, dass sie aus einem zerbrochenen Amphibol geschliffen wurden und zu einer Halskette für seine Freundin verarbeitet werden sollen. Havelock nahm eine der Perlen in die Hand und drehte sie zwischen seinen Fingern. Er seufzte. »Veneta ... was für eine fantastische Frau! Ich wünschte, ihr könntet sie kennenlernen, aber sie kehrt erst heute Abend von einem Auftrag zurück. Ich habe vor sie zu heiraten – was einige der anderen Ladys tief enttäuschen dürfte. Aber wer weiß schon, wie lange die Ehe halten wird?« Er brach in lautes Lachen aus.
Veyron begutachtete inzwischen einen kleinen Beistelltisch, auf dem eine ganze Reihe zerbrochener Kristalle herumlagen, manche komplett durchsichtig, andere in einem durchscheinenden Weiß, als wären sie aus Milchglas gemacht. Einige waren so groß wie ein Ei, andere hingegen kaum größer als die Spitze von Toms kleinem Finger.
»Sie sagten, es wurde nur ein einziger Stein entwendet, der Splitter eines Bergkristalls. Einer wie dieser hier?«
»So ist es. Ich habe alles unverändert gelassen, falls es nötig wäre, die Polizei zu holen. Der Einbrecher, dieser – wie nanntest du ihn? Schrat? Also ein Schrat – er hat den vierten Stein der dritten Reihe mitgenommen. Und nur den. Schon seltsam, nicht? Ich habe ihn zusammen mit den anderen Stücken vor etwa drei Monaten ersteigern lassen.«
»Interessant«, meine Veyron lediglich, hob einen der zerbrochenen Bergkristalle auf, inspizierte ihn von allen Seiten. Tom fiel nur auf, dass sie ähnlich geformt waren, rundlich auf der Außenseite und flach auf der Innenseite, teilweise recht scharfkantig. Es waren erkennbar die Splitter eines einst größeren Steins.
»Waren die auch für einen besonderen Zweck gedacht?«, wollte er von Havelock wissen, der den Kopf schüttelte.
»Nein, nein. Die sollen zu Knöpfen umgearbeitet werden – für das Hochzeitskleid meiner geliebten Veneta. Was für eine Frau! Ich arbeite daran, ihr einen BH aus Diamanten anfertigen zu lassen, aber das wird selbst für meine Verhältnisse verdammt teuer.«
Veyron legte den Kristall ab und untersuchte den nächsten: »Der verschwundene Splitter hatte also kein einziges eigentümliches Merkmal? Er war nicht kleiner oder größer als die anderen Reste, keine spezielle Form?«