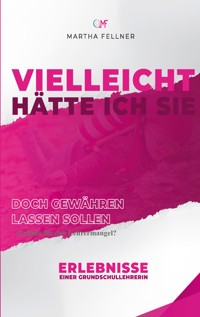
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Die Welt der Schulen, besonders die der Grundschulen und hier die Welt der Eltern ist in vielen Bereichen in Aufruhr geraten. Sie möchten ihr Kind unterstützen, wissen aber nicht genau, wie. Es beginnt bereits in der Zeit vor der Einschulung. Die Erziehung eines Kindes ist oft nicht leicht. Man erhält ja bei der Geburt des eigenen Kindes keine Gebrauchsanweisung dazu. Außerdem bringt jeder Elternteil ein Päckchen an eigener Erziehungserfahrung mit. Dann kommen noch neue Methoden hinzu. Man hört dies und das. Kurz: Viele Eltern sind verunsichert. Was ja auch kein Wunder ist. Ein Kind kommt gut durch die Schulzeit und durch sein Leben, wenn es von den Eltern ein individuelles Gerüst bekommen hat. Mit dem Buch möchte ich Ihnen, neben meinen Erlebnissen, auch einen kleinen Erziehungsratgeber mit an die Hand geben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
VORWORT
1.
WIE ICH WURDE, WAS ICH BIN
2.
DAS SCHLÜSSELERLEBNIS
3.
AUF DER SUCHE NACH URSACHEN FÜR DAS VERHALTEN DER ELTERN
4.
DIE ELTERN
5.
WAS PASSIERT, WENN KINDER KEINE GRENZEN UND KEIN VERANTWORTUNGSGEFÜHL MEHR KENNEN?
6.
DIE HEUTIGE ERZIEHUNG
7.
DIE SCHULLAUFBAHN DES KINDES
8.
DIE LEHRKRÄFTE UND DIE SCHULLEITUNG
9.
DAS ELTERNGETRATSCHE
10.
DIE UNTERSCHIEDLICHKEIT DER KINDER
11.
DIE WURZELN DER GEWALT
12.
FAZIT
Vorwort
„Vielleicht hätte ich Sie doch gewähren lassen sollen …“ war der letzte Satz einer Mutter, bevor ich das Schulsystem verließ. Diese Worte waren der Anstoß für das vorliegende Buch, das ich geschrieben habe.
Eine herausfordernde Zeit lag hinter mir, geprägt von Enttäuschungen und Frustrationen – Erfahrungen, die ich mir in meinen schlimmsten Träumen nicht hätte vorstellen können. Auf den folgenden Seiten habe ich nichts beschönigt; meine erlebten Gefühle sind in meinen Sätzen deutlich spürbar.
Als gut gelaunter Mensch trat ich im Jahr 2003 in das Schulsystem von Nordrhein-Westfalen ein, wohl wissend, dass das Schulleben nicht immer einfach ist. Doch das, was mir hier widerfahren ist, übertraf all meine Erwartungen.
Viele Jahre nach meinem aktiven Schuldienst wollte ich nun herausfinden, warum sich das Schulleben so verändert hat.
1. Wie ich wurde, was ich bin
Ich habe in Bayern Lehramt für die Grundschule studiert – ein Beruf, der schon immer mein Traum war. Als ich schließlich einen Studienplatz erhielt, war ich überglücklich. Die Studienzeit stellte sich als die bewussteste und intensivste Phase meines Lebens heraus.
Die anschließende Referendariats Zeit war jedoch eine große Herausforderung. In Bayern ist die Anspruchsmesslatte sehr hoch, und es war eine intensive Zeit des Lernens und Wachsens. Nach meinem Referendariat unterrichtete ich an einer Grundschule mit angeschlossener Hauptschule, die als Brennpunktschule bekannt war. Viele der Schüler hatten einen Migrationshintergrund, und in jeder Schulstufe gab es Übergangsklassen für Kinder mit geringen Deutschkenntnissen oder sogar ohne diese. Ich unterrichtete sowohl in diesen Übergangsklassen als auch in den regulären Grundschulklassen. Das Unterrichten war in beiden Kontexten nicht einfach, da auch in den „normalen“ Klassen viele Schüler aus schwierigen familiären Verhältnissen waren.
Auf dem Pausenhof standen drei Bürocontainer, in denen Sozialarbeiter untergebracht waren, die uns Lehrkräften im Notfall zur Seite standen. Wir konnten sie sowohl in die Klassen holen als auch Kinder und Jugendliche zu ihnen bringen, wenn es nötig war.
Zusätzlich hatten wir das Glück, einen Rektor zu haben, der uns Lehrkräfte stets unterstützte, wo er nur konnte.
Wenn bei der Einschulungsuntersuchung schulische Schwierigkeiten bei einem Kind festgestellt wurden, zogen wir direkt nach der Einschulung Fachleute hinzu und führten gezielte Tests in den entsprechenden Bereichen durch. Zwei Kolleginnen der Schule hatten sich speziell in diesem Bereich fortgebildet. Zeigte sich hierbei ein Förderbedarf, erhielten die Kinder von der Förderlehrerin eine individuell auf sie abgestimmte Unterstützung.
Für einige Kinder reichte diese Förderung jedoch nicht aus. In diesen Fällen verfassten die Lehrkräfte einen kurzen Bericht über die beobachteten Auffälligkeiten und besprachen diesen mit den Fachkolleginnen und -kollegen der Förderschule. Die Fachkräfte der Förderschule kamen daraufhin in die Grundschule und führten mit den Kindern einen speziell auf die festgestellten Auffälligkeiten abgestimmten Test durch. Sollte sich dabei herausstellen, dass die Grundschule für ein Kind nicht der passende Lernort war, wurde ein Antrag auf Aufnahme in die Förderschule gestellt.
Alle Schritte wurden selbstverständlich im Vorfeld mit den Eltern besprochen. Zu jedem einzelnen Schritt fand ein Gespräch statt, und sämtliche Testergebnisse wurden den Eltern im Anschluss vorgelegt. Gemeinsam suchten wir nach den besten Lösungen für das Kind.
Im Rückblick kann ich feststellen, dass die Eltern unsere Einschätzungen respektierten und unsere Entscheidungen selten infrage stellten. Unsere fachliche Kompetenz und Erfahrung wurden anerkannt, und ich fühlte mich sehr wohl in diesem Schulsystem.
Doch als gebürtige Westfälin zog es mich schließlich zurück in die Heimat – zusammen mit meinem bayerischen Mann, der sich auf das Abenteuer Nordrhein-Westfalen einließ, und meinem damals 22-jährigen Sohn.
Wir kehrten Bayern nach 16 Jahren den Rücken und ich begann meine Arbeit an einer Dorfschule. Der Ort hatte etwa 19.000 Einwohner und fünf kleine Grundschulen.
Meine Erwartungen waren positiv: freundliche, liebe Kinder aus geordneten Verhältnissen, die ihre Schulmaterialien mitbringen und vielleicht sogar ihre Hausaufgaben erledigen.
An besondere Probleme mit den Eltern dachte ich nicht – warum auch? In meinem bisherigen Lehrerleben waren Eltern meist verständige Gesprächspartner gewesen. Doch diese Erwartung sollte sich leider nicht erfüllen.
Vor meinem ersten Schultag bat mich die Rektorin zu einem Gespräch, das sich bald als regelrechte Fragestunde entpuppte. Sie wollte alles über mein bisheriges Leben wissen – warum, weshalb, wieso. Das machte mich schon sehr stutzig. Doch nicht nur mein Leben interessierte sie; auch gezielte Fragen zu meinem Mann und meinem Sohn kamen auf: Ausbildung, Beruf, Einstellung und mehr. Es fühlte sich für mich weniger wie Anteilnahme an, sondern eher wie eine gezielte Untersuchung, als wolle sie nach Schwachstellen suchen. So etwas war mir bisher noch nie passiert.
In Bayern war ich am ersten Tag einfach zur Lehrerkonferenz gegangen und dort in den Stundenplan eingeteilt worden. Niemand fragte nach meinem persönlichen Hintergrund – nur die Fächerkombination und Stundenanzahl interessierten. Das war angenehm, denn wenn man neu in einem Ort ist, möchte man schließlich nicht sofort sein ganzes Leben preisgeben, oder?
Im ersten Jahr an der neuen Schule in Nordrhein-Westfalen wurde ich als „Springer“ eingeteilt. Ich sollte im zweiten Jahr eine vierte Klasse übernehmen, da die Kollegin dann in den Ruhestand ging. Als Springer war ich jedoch in fast jeder Stunde in einer anderen Klassenstufe, in einem anderen Raum, mit einem anderen Fach und ständig wechselnden Kindern. Ein „bewegtes Leben“ im wahrsten Sinne des Wortes! Ich dachte mir: Gut, ein Jahr ist absehbar, und so lerne ich viele Kinder kennen. In diesem Jahr unterrichtete ich Kunst, Musik, Religion und Mathematik sowie Förderunterricht.
Und dann begannen die Probleme.
Sie endeten erst, als ich die Schule nach vier Jahren völlig frustriert verließ und mich an eine andere Grundschule in Nordrhein-Westfalen versetzen ließ. Endlich kehrte der mir vertraute Zustand aus Bayern zurück – mit einem freundlichen Rektor an der Spitze. Doch leider ging dieser in Pension, nachdem ich ein Jahr dort an der Schule gewesen war, und die alten Probleme wie an der ersten Grundschule in Nordrhein-Westfalen kamen erneut zum Vorschein.
Aber zunächst möchte ich schildern, wie alles anfing.
2. Das Schlüsselerlebnis
An der ersten nordrhein-westfälischen Grundschule, an der ich als Lehrerin tätig war, stand eines Tages eine Mutter vor der Tür des Klassenzimmers, aus dem ich gerade herauskam. Sie beschuldigte mich, ihren Sohn während des Unterrichts mit bestimmten Worten beleidigt zu haben. Ich war völlig überrumpelt.
Stellen Sie sich das vor: Sie kommen gerade aus einer Stunde und sind auf dem Weg zur nächsten, mitten im Wechsel der Gedanken von einem Unterricht zum anderen, als plötzlich eine Mutter Sie aufhält. Ohne einen Termin zu vereinbaren oder höflich zu fragen, ob Sie kurz Zeit hätten, überfällt sie Sie mit einem Vorwurf. Der Kopf noch halb bei der vergangenen Stunde oder beim Start der nächsten, wird man abrupt in die Defensive gedrängt, und der Adrenalinspiegel steigt. Was will diese Mutter eigentlich?
Ich wies sie auf die wartenden Kinder hin und schlug vor, das Gespräch nach der Schule fortzusetzen. Doch sie bestand darauf, ihr Anliegen sofort loszuwerden. Rückblickend frage ich mich, wie sie überhaupt wusste, wo ich mich als Springer gerade aufhalten würde. Wurde sie unterstützt? Damals kam ich nicht dazu, darüber nachzudenken, doch inzwischen bin ich mir sicher, dass dies der Fall war – und das leider nicht zum letzten Mal, wie ich enttäuscht feststellen musste.
Also stand ich da im Flur, während Kollegen vorbeiliefen und Kinder lärmten. Einige Klassen wechselten gerade zum Sportunterricht, und mittendrin debattierte ich mit dieser Mutter. Ein paar Tage später kam es zur gleichen Situation mit derselben Mutter. Beim dritten Mal erwischte sie mich direkt nach einer Religionsstunde.
Die Stunde war sehr angenehm gewesen; wir hatten eine Kerzenmeditation gemacht, um zur Ruhe zu kommen und über ein Gebet nachzudenken. Ich war noch ganz entspannt, hielt die warmen Teelichter in der Hand, als wieder dieselbe Mutter vor mir stand – mit einem weiteren Vorwurf.
Dieses Mal ging ich kurzerhand mit ihr direkt ins Büro der Rektorin, riss die Tür auf, legte die Teelichter auf den Tisch und sagte laut und deutlich, dass es nun wirklich genug sei. Ich schilderte die Vorfälle und erwartete Unterstützung von der Rektorin. Doch leider wurde ich enttäuscht. Es wurde lediglich ein Gesprächstermin mit der Mutter vereinbart und später ein weiterer Termin mit mir.
Im Gespräch zu dritt stellte sich heraus, dass die Mutter drei Söhne hatte. Der älteste war bereits durch unsere Schule gegangen und so verhaltensauffällig gewesen, dass er für mehrere Wochen in stationärer Therapie war, da die Eltern allein nicht mehr weiterwussten. Die beiden jüngeren, zweieiigen Zwillinge mit sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten, fielen ebenfalls auf: Der eine prügelte sich regelmäßig mit Mitschülern und formte mit anderen eine kleine „Gang“. Es wurden Verhaltensverträge mit ihm geschlossen, die jedoch kaum Wirkung zeigten. Der andere Sohn wiederum beschritt einen anderen Weg: Er erzählte der Mutter erfundene Geschichten über Vorfälle in der Schule, die sie dann – wie auch hier – veranlassten, sich bei mir zu beschweren. So stand die Mutter in einem ständigen Verteidigungsmodus.
Dieses Mal hatte ich noch die Kraft, aus der Haut zu fahren. Nach dem Gespräch mit der Rektorin jedoch nicht mehr. Sie machte mir deutlich, dass sie die Anliegen der Eltern sehr ernst nahm. Was bedeutete das? Im Gespräch lief alles darauf hinaus, dass ich als Lehrerin die Bedürfnisse der Eltern bedingungslos zu erfüllen habe – ihre Zufriedenheit war die oberste Priorität.
Ob ich anderer Meinung war oder ihre Wünsche als nicht umsetzbar ansah, spielte keine Rolle. Die Eltern mussten zufriedengestellt werden, ohne Rücksicht auf mögliche Belastungen für das Lehrpersonal oder die Kinder.
Ich sollte erwähnen, dass direkt neben unserer Schule, nur durch den Schulhof getrennt, eine weitere Grundschule lag. Zwischen den beiden Schulen – oder besser gesagt zwischen den beiden Rektorinnen – herrschte ständige Konkurrenz. Die Nachbarschule war ein Altbau, während unsere ein teilweise renovierter, heller und freundlicher Teil-Neubau war. Das wichtigste Ereignis jedes Jahr waren die Schulanmeldungen. Es fühlte sich jedes Mal wie ein Sieg oder eine Niederlage an, wenn unsere Schule eine Klasse mehr oder weniger Anmeldungen verzeichnete. Da wir oft mehr Neuzugänge hatten, sah die Rektorin ihr Vorgehen bestätigt.
Aber wie kommt es dazu, dass Eltern sich über Lehrkräfte beschweren? Welche Gründe könnten dahinterstecken?
Im oben beschriebenen Fall war die Mutter überfordert und suchte die Schuld für ihre Probleme ausschließlich bei anderen, nicht bei sich oder ihren Kindern. In ihren Augen waren die Kinder Opfer der Umstände, die sie ständig versuchte, zu ändern. Doch wie entsteht solch ein Verhalten? Welches „Handwerkszeug“ fehlte der Mutter?
Jedes Kind wird auf irgendeine Weise erzogen. Deshalb werde ich nach Ursachen für das Beschwerdeverhalten der Eltern als Erstes bei der Erziehung suchen.
3. Auf der Suche nach Ursachen für das Verhalten der Eltern
3.1 Was bedeutet Erziehung?
Meines Erachtens ist Erziehung der Weg, ein Kind lebensfähig zu machen. Sie mögen sagen: „Mein Kind ist doch lebensfähig! Es kann allein essen und trinken, sich anziehen, sprechen, laufen, seine Bedürfnisse äußern.“ Doch für mich bedeutet Lebensfähigkeit vor allem auch Sozialfähigkeit, und das bringt viele Anforderungen mit sich.
Zunächst muss ein Kind begreifen, dass es nicht allein auf der Welt ist – und noch wichtiger, dass es nicht der wichtigste Mensch auf der Erde ist. Viele Eltern sehen das jedoch anders: Für sie ist ihr Kind der wichtigste Mensch. Das gilt natürlich im Leben der Eltern, aber außerhalb dieser familiären Gemeinschaft existieren viele weitere Lebensgemeinschaften. Eine davon ist die Schule. Hier ist das Kind, anders als vielleicht noch im Kindergarten, nur eines von etwa 27 Schülern. Es ist weder das wichtigste noch das einzige Kind.
In der Schule haben alle Kinder Anspruch auf ihren Platz – und doch keiner mehr als die anderen. Hier sind alle gleichwertig. In der Familie mag das Kind sich Gehör verschaffen, indem alle sofort auf seine Worte achten, doch in der Schule muss es sich an allgemeine Regeln halten: Es meldet sich, indem es die Hand hebt, und spricht erst, wenn es dazu aufgefordert wird. Da auch die Eltern einmal zur Schule gegangen sind, kennen sie diese grundlegende Regel und wissen um ihre Bedeutung.
Dennoch ignorieren einige Eltern diese Regeln und fragen empört nach, warum ihr Kind im Unterricht kein Gehör findet. Auch der Hinweis darauf, dass ihr Kind ständig an die Regel erinnert werden muss, jedoch ohne Erfolg, scheint sie nicht zu berühren. Stattdessen müssen die Vorteile dieser Regel lang und breit erläutert werden: Was wäre, wenn bei 27 Kindern alle gleichzeitig sprechen würden?
Selbst der Versuch, eine Verhaltensstrategie für zu Hause mit den Eltern zu vereinbaren, stößt oft auf Widerstand. Das Kind werde zu Hause schließlich richtig erzogen; das Problem bestehe nur in der Schule.
Natürlich kommen diese Mütter oder Väter mit ihren Beschwerden gerne kurz vor Unterrichtsbeginn, in der Pause oder irgendwann dazwischen. Dabei bedenken sie leider nicht, dass nicht nur die Kinder eine Pause brauchen – auch das Lehrpersonal benötigt dringend Erholung. Denn die Arbeit mit den Schülern ist oft sehr fordernd.
Erziehung erfordert Konsequenz. Was genau bedeutet das? Wenn ich in einer bestimmten Situation einmal „Nein“ sage, bleibt es bei diesem „Nein“ – heute, morgen und auch in einer Woche, selbst wenn das Kind 10-, 15- oder 100-mal nachfragt. Die Antwort bleibt stets die gleiche. Warum? Ich höre immer wieder, ein Kind teste seine Grenzen. Doch welche Grenzen? Soll das Kind nicht so leben dürfen, wie es ihm gefällt, um seine eigenen Erfahrungen zu machen? Natürlich, jeder muss seine Erfahrungen machen – doch es geht darum, dass Kinder die grundlegenden Regeln des Zusammenlebens schon zu Hause lernen. Dann könnten wir in der Schule direkt mit dem Lehrstoff beginnen, ohne vor jeder Stunde erst eine Viertelstunde erzieherische Arbeit leisten zu müssen.
Diese Grundregeln des Zusammenlebens sind jedoch vielen Eltern heute nicht mehr bekannt, da sie sie selbst nie richtig gelernt haben. Ich sage bewusst „nicht mehr“, denn die Großeltern der heutigen Eltern beherrschten diese Regeln noch. Doch leider wurden sie nicht weitergegeben. Die Gründe dafür werde ich später erläutern.
3.2 Die Grundregeln des Zusammenlebens
3.2.1 Respekt im Umgang miteinander
Eine grundlegende Regel für das Zusammenleben ist der Respekt gegenüber anderen Menschen. Doch was genau bedeutet „Respekt“? Wörtlich übersetzt umfasst er Achtung und Anerkennung. Wer Respekt zeigt, drückt damit seine Wertschätzung seinem Gegenüber als eigenständige Person mit eigenem Lebensweg aus – ein Mensch mit eigenen Erfahrungen, Ansichten und Empfindungen, dem man auf Augenhöhe begegnet. Respekt bedeutet also, das Gegenüber als Persönlichkeit anzuerkennen.
Leider erleben Lehrkräfte häufig, dass einige Eltern ihnen diesen Respekt nicht entgegenbringen. Und so überrascht es nicht, dass Eltern, die in ihrer eigenen Erziehung den Wert von Respekt nicht erfahren haben, ihren Kindern ebenfalls kein respektvolles Verhalten gegenüber Lehrkräften vermitteln können.
Anders lässt es sich kaum erklären, dass einige Eltern einen angemessenen Umgangston gegenüber Lehrkräften völlig vermissen lassen. Sie behandeln die Lehrkraft nicht wie eine gleichberechtigte Person, sondern herabsetzend – als wüssten sie als Eltern stets besser, was ihrem Kind guttut. Dieser herablassende Ton trägt zu einer aggressiven Atmosphäre bei. Wie kann ein Kind Respekt vor der Lehrkraft entwickeln, wenn es zu Hause erlebt, wie Eltern die Lehrkraft beschimpfen oder sich in ihrem Beisein beschweren – ohne dass ihnen von der Schulleitung Einhalt geboten wird? Dieser Eindruck prägt das Kind nachhaltig und ist kaum zu korrigieren. Aussagen wie „Du hast mir gar nichts zu sagen! Mama sagt auch, dass dieses Fach sch… ist!“ sind die Folgen.
Wenn Eltern in Anwesenheit des Kindes derartige Äußerungen tätigen, verliert das Kind das Interesse am Unterricht, schließlich hat es ja von den eigenen Eltern – den wichtigsten Personen in seinem Leben – gehört, dass deren Meinung Vorrang hat. Kinder orientieren sich an den Einstellungen der Eltern und übernehmen deren Werturteile. Wenn Eltern die Hausaufgaben als wichtig erachten, nachfragen und diese kontrollieren, werden auch dem Kind die Hausaufgaben wichtiger sein. Doch fehlt diese elterliche Unterstützung, werden die Anweisungen der Lehrkraft bezüglich Verhalten und Pflichten ignoriert – ein Teufelskreis entsteht.
Im Laufe seiner frühen Jahre hat das Kind gelernt: „Wenn ich nur frech genug bin, bekomme ich meinen Willen.“ Kinder lernen einen Großteil durch Nachahmung und üben dies zuerst bei den eigenen Eltern. Zunächst empfinden die Eltern ein selbstbewusstes Auftreten des Kindes vielleicht als witzig oder sogar als Grund zum Stolz: „Oh, mein Kind kann sich behaupten!“ Dabei erkennen sie oft nicht, dass das Verhalten des Kindes sich bereits in die falsche Richtung entwickelt.
Erst später, wenn sie das Verhalten als störend empfinden, reagieren Eltern zunehmend frustriert. Manche resignieren schließlich und überlassen das Kind sich selbst. Denn nachzugeben ist oft der einfachste Weg, Erziehung zu vermeiden.
Dieses „Gewährenlassen“ wird dann positiv verpackt, als würden die Eltern das Kind bewusst seine eigenen Erfahrungen machen lassen. So können sie nach außen hin erklären, dass sie ihrem Kind Freiraum zur Entfaltung geben. Und vor sich selbst rechtfertigen sie, dass ihr Ansatz richtig sei – ohne zu hinterfragen, ob das Kind durch diese „Entfaltung“ auch das Rüstzeug für ein selbstständiges und verantwortungsvolles Leben erhält.
Damit zurück zur Frage des Respekts. Respekt bedeutet nicht, Angst zu haben. Er umfasst vielmehr die Achtung vor jedem anderen Menschen, sei es ein anderes Kind, ältere Menschen wie die Großeltern, der Busfahrer – und nicht zuletzt auch Tiere, und seien diese noch so klein. Respekt bedeutet, andere Lebewesen als gleichwertig neben sich selbst wahrzunehmen. Ohne Respekt und Achtung fehlt dieses Bewusstsein komplett.
Eltern können oft nicht nachvollziehen, warum ihr Kind Probleme hat, mit anderen Kindern zurechtzukommen. Doch hier fehlt dem Kind das Bewusstsein, dass andere Lebewesen ihm gleichwertig sind. Dieses Bewusstsein kann ein kleines Kind jedoch nicht allein entwickeln. Für ein Kleinkind steht es selbst im Mittelpunkt der Welt, und der Prozess, sich in andere hineinzuversetzen, ist langwierig – ein Prozess, den leider auch viele Erwachsene nicht vollständig durchlaufen haben.
Hier stehen die Eltern in der Verantwortung, ihrem Kind früh und bei passenden Gelegenheiten zu vermitteln, dass alle Menschen gleichwertige Lebewesen sind. Wenn Eltern diesen Schritt versäumen, lernt das Kind erst durch schmerzliche Erfahrungen, dass es nicht über allen anderen steht. Solange das Kind die Auffassung beibehält, dass seine Bedürfnisse immer zuerst erfüllt werden müssen, kommt es unweigerlich zu Konflikten – besonders, wenn auch andere Kinder ähnlich erzogen wurden und ebenfalls ihre Ansprüche durchsetzen wollen.
Im häuslichen Umfeld hat das Kind vielleicht erfahren, dass lautes Fordern genügt, um seinen Willen durchzusetzen. Vielleicht haben die Eltern bereits kapituliert und reagieren sofort, um Ruhe zu haben. Diese Erwartungshaltung überträgt das Kind jedoch auch auf andere Lebensbereiche und ist dann überrascht, wenn es bei Gleichaltrigen auf Widerstand stößt. Auseinandersetzungen, im schlimmsten Fall Schlägereien oder beleidigende Wortwechsel, sind die Folge.
Eltern sollten ihrem Kind zudem vermitteln, dass andere Menschen womöglich andere Bedürfnisse, Ansichten oder Meinungen haben. Dies wird jedoch oft übersehen, vielleicht unbewusst, mit dem Gedanken: „Mein Kind ist das Wichtigste auf der Welt.“ Diese Haltung führt dazu, dass das Kind lernt, sich ohne Rücksicht durchzusetzen, als sei die eigene Meinung die einzig richtige. Es versteht nicht, dass etwa das Ärgern anderer Kinder diesen nicht ebenfalls Freude bereitet.
Ohne Einfühlungsvermögen fehlt dem Kind die Fähigkeit, zu verstehen, wie sein Verhalten auf andere wirkt. Ein Gewissen, das als moralische Orientierung dienen könnte, wird weder entwickelt noch angeregt.
3.2.2 Das Erlernen von Umgangsformen
Eine weitere Grundregel ist das Erlernen von Umgangsformen. Natürlich sind diese bei der Einschulung noch nicht perfekt ausgeprägt, weshalb ich von dem „Erlernen“ der Umgangsformen spreche.
Dennoch sollten sie bereits angebahnt sein. Man erkennt sofort, ob bei einem Kind dieser Prozess in Gang gesetzt wurde oder nicht.
Gute Umgangsformen werden allgemein geschätzt, da sie das Zusammenleben wesentlich erleichtern, vielleicht sogar erst ermöglichen. Umgangsformen können nur weitergegeben werden, wenn sie selbst erlernt wurden und der Nutzen im eigenen Leben erkannt und geschätzt wurde.
Unsere Eltern – also die Großeltern der heutigen Schulkinder – legten großen Wert auf Umgangsformen, und sie wurden konsequent eingehalten. Konsequent! Für ein Kind mögen Umgangsformen zunächst lästig und schwer nachvollziehbar sein; das war in der Vergangenheit nicht anders. Doch wenn Umgangsformen von klein auf vorgelebt werden, kennt das Kind es nicht anders und übernimmt diese automatisch. Für ein Kind, dem diese Regeln vertraut sind, werden sie selbstverständlich, und es wird die Missachtung solcher Regeln durch andere eher befremdlich finden.
Umgangsformen bieten ein unsichtbares Gerüst für das Miteinander – eine stabile Konstruktion, die im täglichen Verhalten zum Vorschein kommt. Noch vor einigen Jahren war das den meisten Menschen bewusst. Jetzt erleben wir jedoch eine Veränderung. Viele Menschen spüren, dass etwas nicht harmonisch ist, dass im Umgang miteinander etwas nicht mehr so „rund“ läuft. Sie bemerken eine wachsende Unsicherheit in sozialen Interaktionen, und diese Unsicherheit führt nicht selten zu Aggressivität.
Könnte das ein Grund sein, warum manche Eltern heute so aggressiv auftreten? Sind sie vielleicht unsicher und lassen dies an der Lehrkraft aus? Und wie ist das mit der zunehmenden Gewaltbereitschaft, den Amokläufen?
Während meiner Schulzeit kann ich mich an solche Vorfälle nicht erinnern. Warum gibt es sie heute?
Vielleicht fehlt den Jugendlichen eine klare Orientierung – eine Linie, die ihnen einen Weg aufzeigt, den sie verfolgen könnten. Unsichere Eltern, die bereits resigniert haben und wahllos unterschiedliche Wege einschlagen, ohne einen davon konsequent zu verfolgen, können auch ihren Kindern keine Sicherheit bieten. Kinder, die ohne dieses Gerüst aufwachsen, entwickeln oft keine eigene Stabilität und reagieren gereizt, sind häufig schlecht gelaunt und unzufrieden. Diese Unzufriedenheit kann zu Aggressivität führen, was die Eltern dazu verleitet, Konflikten aus dem Weg zu gehen und den Kindern schließlich alles zu gewähren, nur um Ruhe zu haben. So wird das laute Fordern, Toben oder sogar das Schlagen der eigenen Eltern nicht hinterfragt, sondern erstaunt passiv geduldet. Sie denken: „Was ist passiert? Ich verstehe mein eigenes Kind nicht mehr. Ich habe doch alles für es getan.“
3.2.2.1 Erste Umgangsform: Das Grüßen
Eine grundlegende Umgangsform ist das Grüßen. Doch oft kommt ein Kind morgens in die Klasse, sagt weder „Hallo“ noch beachtet es die Lehrkraft, die bereits anwesend ist. Der Blick geht zu Boden, das Kind steuert wortlos den Platz an. Wenn ein weiteres Kind den Raum betritt, gibt es ebenfalls keinen Gruß – auch nicht untereinander. Beim Gong nach der letzten Stunde ist die Situation ähnlich: Die Kinder packen schnell zusammen, und ein „Auf Wiedersehen, alle miteinander“ der Lehrkraft erreicht sie schon gar nicht mehr. In der Regel braucht es mehrere Wochen, bis diese beiden kleinen Gesten – das Begrüßen und Verabschieden – den Kindern bewusst und zur Gewohnheit werden.
Das Grüßen ist mehr als eine bloße Formalität. Es zeigt, dass ich mein Gegenüber wahrgenommen habe und ihn wertschätze. Ein Gruß signalisiert Gleichwertigkeit und Anerkennung. Wenn ich jemandem „Guten Morgen“ wünsche, erhoffe ich mir im Gegenzug, dass er mir dasselbe zurückgibt – ein respektvoller Austausch, der den Alltag menschlicher gestaltet.
Ein schönes Beispiel ist mir aus einer ersten Klasse in Erinnerung geblieben: Ein kleines Mädchen kam jeden Tag nach der Schule zu mir, reichte mir die Hand und sagte: „Tschüss, Frau …, die anderen rennen einfach raus, aber ich möchte mich von dir verabschieden.“ Solche Momente zeigen, wie liebenswürdig und bedeutend kleine Gesten sein können.
3.2.2.2 Weitere Umgangsformen: Rücksichtnahme und Verantwortung
Zum respektvollen Umgang zählt auch, auf andere Rücksicht zu nehmen – etwa, indem ein Kind seinen Platz ordentlich hält und seine Dinge nicht so ausbreitet, dass der Nachbar in seiner Arbeitsfreiheit eingeschränkt wird. Vielen Kindern ist dieses Prinzip fremd. Die Frage „Wieso darf ich meine Sachen hier nicht liegen lassen?“ oder „Warum muss ich das jetzt einpacken?“ zeugt von Unverständnis und Einsichtslosigkeit. Oft wandern Materialien sogar einfach auf den Tisch des Nachbarn, der schon fertig gepackt hat.
Diese Haltung entspringt oft einer Nachlässigkeit, die Kinder von ihren Eltern übernommen haben. Die Erziehung zur Verantwortung für die eigenen Dinge hat nicht stattgefunden. Eltern geben häufig nach der dritten Ermahnung, das Spielzeug wegzuräumen, auf und übernehmen diese Aufgabe schließlich selbst. Dabei lernt das Kind nicht, dass es für seine eigenen Sachen verantwortlich ist. Respekt für das Umfeld und für den persönlichen Raum anderer bleibt ihm unbekannt. Wenn ein Kind den Nachbarn als gleichwertige Person anerkennt und verinnerlicht hat, dass es nur ein Teil der Gruppe ist, dann wird es auch darauf achten, die eigene Tischfläche nicht zu überschreiten.





























