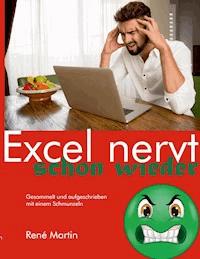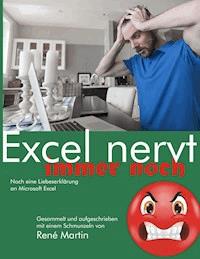Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Edition Gesellschaft und Verantwortung
- Sprache: Deutsch
René Märtin lädt zu einer intensiven Spurensuche ein: von der Pandemie als Spiegel unserer Endlichkeit über die Einsamkeit von Verantwortungsträgern und den Zugriff moderner Organisationen bis hin zur Sehnsucht nach »Ferien vom Ich«. Seine Essays bleiben nicht bei Schlagworten stehen. Sie stellen die drängenden Fragen nach Tod, Freiheit, Schuld und Sinn - und eröffnen Räume für Selbstprüfung, Klarheit und neue Orientierung. Texte, die zum Innehalten anregen, die eigene Haltung herausfordern und dazu ermutigen, das Menschsein im Heute bewusster zu leben. Mit einem Vorwort von Helmut Dorra.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 106
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Jenseits von Eden
Führung und Einsamkeit
Der totale Zugriff der Organisation auf den Menschen
Ferien vom Ich
Editorische Notiz
Vorwort
Wahrheit im Gegenüber
Von Helmut Dorra
Es gibt Stunden, in denen die Welt uns nicht mehr als Bühne erscheint, sondern als Anspruch. Nicht wir befragen das Leben – das Leben befragt uns. René Märtins Essays stellen solche Fragen ins Zentrum. Sie kommen der Gegenwart nahe, an der Schnittstelle von Freiheit und Verantwortung, Nähe und Distanz, Person und System, Endlichkeit und Hoffnung. Sie sind nicht Kommentare zum Zeitgeschehen, sondern Markierungen im Gelände unserer Existenz.
Jenseits von Eden erinnert an eine einfache, harte Wahrheit: Wir leben nicht im Schutzraum der Unverletzlichkeit. Die Pandemie hat das Unverfügbare wieder in unsere Häuser getragen: Angst, Verlust, Schuldanteile. Wer das verdrängt, verliert die innere Beweglichkeit. Wer es annimmt, gewinnt Richtung. Sinn ist dann nicht das bequeme Bild, das ich mir von mir selbst mache, sondern das Echo einer Wirklichkeit, die mir entgegenkommt. Es gibt Entscheidungen, in denen wir – wissend um den Preis – dennoch Ja sagen müssen. Verantwortung beginnt im Angesicht der Begrenzung. Wer seine Endlichkeit ernst nimmt, verstrickt sich weniger in Selbstbehauptung viel mehr aber in Treue: zu Menschen, zu Aufgaben, zu einem Wort, das gilt. Der Augenblick – der Kairos – kommt nicht zweimal. Manchmal ist er leise: ein kurzer Blick, ein Anruf, ein erster Schritt. Manchmal ist er radikal: ein Abschied, ein Verzicht, ein Bekenntnis. Immer aber verlangt er Gegenwärtigkeit.
In Führung und Einsamkeit wird sichtbar, was Macht und Einfluss selten offenbaren: die Kälte des freien Raums. Wer führt, steht ausgesetzt – zwischen Ansprüchen und Projektionen. Dort nützt kein Rollenspiel. Tragfähig wird, wer den eigenen inneren Ort kennt und ihn nicht gegen Beifall tauscht. Einsamkeit ist dann nicht Mangel, sondern Brennpunkt der Person. Sie prüft, ob wir noch »Ich« sagen können, ohne den anderen aus dem Blick zu verlieren. Die Person darf nie zur Funktion schrumpfen – auch nicht die eigene. Barlachs Der Einsame ist deshalb keine Pose, keine Glätte, nur das Gewicht der Wirklichkeit. Diese Figur kennt die Schwere – und steht dennoch. So kann Einsamkeit zur Schule der Unterscheidung werden: Welche Erwartungen tragen? Welche verführen? Was dient dem Auftrag – und was nur der Eitelkeit des Augenblicks? Wer sich hier klärt, wird verlässlicher für andere.
Der totale Zugriff der Organisation auf den Menschen – der Titel trifft einen Nerv. Wir leben in Systemen, die ohne Personen nicht können, aber bisweilen so tun, alswären Personen austauschbare Ressourcen. Aus Verfügbarkeit wird Tugend, aus Transparenz Kontrolle, aus Zugehörigkeit Kolonisierung. Beschleunigung verheißt Effizienz – und erzeugt doch jenen »rasenden Stillstand« (Paul Virilio), der uns innerlich entleert. Der Widerspruch ist offenkundig: Organisationen sollen halten, wofür Menschen stehen. Sie dürfen aber nicht absaugen, wovon Menschen leben. Darum braucht es Grenzen – gesetzte, nicht nur gefühlte. Ein »Nein« aus Gewissen ist kein Affront, sondern Beitrag zur Kultur. Wer nur optimiert, verliert Maß. Wer nur maximiert, verliert Sinn. Verantwortung ist mehr als Regelkonformität; sie ist vorausschauende Treue: gegenüber dem Mitmenschen, den Zukünftigen, der verletzlichen Welt. Systeme werden menschlich, wo sie die Person schützen und vertraute Räume bieten. Dazu bedarf es fehlerfreundliche Prozesse, Rhythmen, die nicht nur leistbar, sondern menschenwürdig sind. Menschlichkeit ist kein Kostenfaktor – sie ist Geschäftsgrundlage.
In Ferien vom Ich klingt etwas Heiteres an, doch der Ernst bleibt. Es ist die Einladung zur Selbstdistanz – nicht zur Selbstverleugnung. Wer sich aus dem Spiegelblick löst, sieht besser. Narzissmus ist die Versuchung der Gegenwart: viel Oberfläche, wenig Halt. Ferien vom Ich heißt nicht Flucht, sondern Befreiung von der Tyrannei des Eigenen. Humor hilft – er nimmt nichts Leichtes leicht, aber das Schwere nicht schwerer, als es ist. Freundschaft hilft – sie widerspricht, ohne zu zerstören. Arbeit hilft – dort, wo sie nicht nur Leistung abfragt, sondern Würde stiftet. Und das Staunen hilft – über das, was größer ist als wir: Natur, Kunst, Gnade. Wer sich nicht absolut setzt, wird frei für Begegnung.
Alles zusammengeführt wird hier ein Vierklang des Daseins sichtbar: »Umwelt«, »Mitwelt«, »Eigenwelt«, »Überwelt«. Unsere Gegenwart zerreißt ihn oft: Wir verlieren Maß in der Umwelt, veröden in der Mitwelt, verfangen uns in der Eigenwelt, vergessen die Überwelt. Die Essays stellen den Klang wieder her. Sie nehmen die Welt ernst – konkret, widersprüchlich, begrenzt. Sie schützen die Mitwelt – nicht romantisch, sondern dialogisch: Ich sehe dich, du siehst mich; wir schulden uns Wahrheit, nicht Bequemlichkeit. Sie stärken die Eigenwelt – Gewissen, Urteil, Mut. Und sie öffnen die Überwelt – jenes Vertrauen, das nicht machbar ist und doch trägt. Wer so lebt, lebt »wahr im Werden«: ohne endgültige Sicherheiten, aber mit verlässlicher Haltung.
So finden wir in diesen Essays Themen wieder, die existenzielle Bedeutung gewinnen. Erstens: Endlichkeit. Sie ist keine Drohung, sondern Maßstab. »Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir ein weises Herz gewinnen.« (Psalm 90,12). Weisheit ist nicht Wissen plus Zeit – sie ist Liebe zum Wesentlichen. Zweitens: Begegnung. Wirkliches Leben geschieht zwischen »Ich« und »Du«. Dort wird Wahrheit nicht besessen, sondern bezeugt. Drittens: Freiheit. Sie ist nicht Willkür, sondern Antwortfähigkeit; nicht Flucht vor Bindungen, sondern die Fähigkeit, ein Wort zu halten. Viertens: Verantwortung. Sie reicht über den Moment hinaus: in Strukturen, in Zukünfte, in die stillen Folgen unseres Tuns. Fünftens: Maß. Ohne Maß frisst das Gute sein Bestes. Rituale, Grenzen, Pausen – sie sind keine Relikte, sondern Ressourcen. Sechstens: Hoffnung. Nicht als Wunschdenken, sondern als geerdete Erwartung: dass Treue trägt, dass Wahrheit sich zeigt, dass Güte einen langen Atem hat.
Und schließlich: Gewissen als leiser Hörsinn für Wirklichkeit. Nicht Moral, sondern Wahrnehmung: Wo werde ich gerufen, wo verschleiere ich? Gewissen unterscheidet Angst vor Konsequenzen von Verantwortung für Folgen. Es weiß um Schuld – nicht als Selbstabwertung, sondern als Ruf zur Versöhnung: mit mir, mit anderen, mit dem, was war. Ohne die Möglichkeit der Vergebung erstarrt Verantwortung zur Selbstinszenierung. Deshalb gehört zur Freiheit das Maß: die selbstgesetzte Grenze, die Beziehung schützt; der Rhythmus, der Arbeit zu Werk und das Ich zur Person werden lässt. Führung wird so zum Dienst an der Würde – nicht an Stimmungen. Organisationen werden menschlich, wenn sie Räume der Treue ermöglichen: zu einem Wort, zu einem Auftrag, zueinander. Und im Persönlichen braucht es jene kleine Selbstdistanz, die den Spiegel absenkt und den Blick öffnet: für ein Du, für das Gemeinsame, für den Kairos, der uns heute zufällt. Hoffnung schließlich ist keine Fluchtnach vorn, sondern die geerdete Erwartung, dass Wahrheit trägt, wenn wir ihr entsprechen. So entsteht Handlungsfähigkeit: still, entschieden, verantwortlich – mitten im Unfertigen.
Wer diese Linien zusammenzieht, merkt: Das Eigentliche ist nicht spektakulär. Es ist unscheinbar, konkret, wiederholbar: ein Gespräch, das ernst nimmt; ein Beschluss, der standhält; eine Entschuldigung, die heilt; ein freier Samstag; eine klare Zusage; eine beharrlich gesetzte Grenze. In einer Kultur des dauernden »Mehr« mag es heute als subversiv empfunden werden. Und vielleicht ist es genau das, was heute an der Zeit ist.
Darum sei dieser Band als Begleitung empfohlen – nicht als Rezeptbuch.Er misstraut der schnellen Machbarkeit und vertraut auf das Gewordene, das gilt. Er scheut die großen Worte, um die großen Dinge zu schützen: Würde, Wahrheit, Treue, Barmherzigkeit. Und er lädt ein, das je Eigene nicht zu verlieren – mitten in Rollen, in Krisen, in Systemen.
Mögen diese Seiten etwas von jener Gegenwart wecken, die wir alle brauchen: still, aufmerksam, verlässlich. Mögen sie helfen, in einer lauten Welt die leisen Stimmen nicht zu überhören. Und mögen sie uns ermutigen, im richtigen Augenblick zu tun, was dran ist – im Bewusstsein: Wahrheit geschieht im Gegenüber, Freiheit bewährt sich im Grenzen-Setzen, Verantwortung trägt durch die Zeit. Jenseits von Eden, mitten im Leben.
Helmut Dorra ist Theologe, Autor und Existenzanalytiker. Seit vielen Jahren begleitet er Menschen in Fragen von Leben, Glauben und Sinn. Sein besonderes Anliegen ist die existenzielle Deutung des Alltags: das Heute im Horizont von Zeit, Endlichkeit und Freiheit wahrzunehmen und daraus Wege zu einem verantworteten, erfüllten Leben zu eröffnen. Er veröffentlicht regelmäßig Essays und Beiträge zu existenziellen Themen und ist Mitbegründer der Akademie für Existenzanalyse und Logotherapie.
Jenseits von Eden
In der durch die Pandemie ausgelösten Krise zeigt sich der Mensch von seiner verletzlichen Seite. Sie wird deutlich durch das Leid der vielen Erkrankten und dem Tod, der durch erschreckende Zahlen und die damit verbundenen Bilder aus der gesamten Welt präsent ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob wir das aus dem eigenen Erleben wissen (z. B. durch die Erkrankung von Angehörigen oder die Erfahrungen vom Arbeitsplatz z. B. in der Pflege), denn wir bekommen all diese Fragen explizit auch medial übermittelt. Sie prägen derzeit unser Bewusstsein und die Frage, wie wir darüber denken und damit ganz persönlich umgehen wollen.
Eine existenzielle Sicht auf die Pandemie
Die Pandemie konfrontiert uns mit fünf wesentlichen, existenziellen Themen: Tod, Freiheit, Isolation, Sinnlosigkeit und Schuld. Diese Themen werden uns Menschen vom Leben an uns herangetragen; sie sind unvermeidlich – und somit kann man der Auseinandersetzung mit ihnen nicht aus dem Weg gehen. Neben aller Freiheit, Selbstbestimmtheit und Gestaltungskraft, die wir als Menschen haben, können wir uns niemals vor dem Unvermeidlichen schützen. Alle fünf Kategorien geraten in der Pandemie gewissermaßen unter das existenzielle Brennglas, wir sehen deutlich, wie jedes Leben durch diese Fragen herausgefordert ist. Welchen Sinn hat das menschliche Leben eigentlich, wenn der Mensch doch sterben muss? Wie soll der Mensch mit der Sinnlosigkeit seiner eigenen Existenz umgehen? Wie kann er mit dem ständig möglichen Tod leben? Die aus diesen Fragen entstehende Angst wird vor dem Hintergrund der Pandemie zur ständigen Begleiterin des Menschen und treibt ihn zum Handeln an.
Dabei hat er zwei Möglichkeiten: sich (an)treiben zu lassen zu Ersatzhandlungen, die kurzfristige Befriedigung und damit Ablenkung versprechen. Oder er stellt sich der Gewissheit des Todes und übernimmt für die Gestaltung seines Lebens Verantwortung. Denn nur so hat der Mensch die Möglichkeit, aus freier Entscheidung heraus seinem Leben Sinn zu geben. Dafür braucht es Zustimmung und Erkenntnis, wie es der Psalmist ausdrückt: »Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden« (Ps. 90,12). Die Pandemie stellt uns genau vor diese Herausforderung. Zustimmung ist zur Wirklichkeit zu geben: dass wir sterben müssen, ist allegorisch gleichzusetzen mit der Tatsache, dass wir nicht im Paradies weilen. Es gibt kein ewiges Leben, weder endlosen Frieden noch dauerhafte Gesundheit oder absolute materielle Sicherheit. Darüber hinaus gibt es keine andere Form Sicherheit, nirgends. Unser Leben ist vom Grundsatz her immer gefährdet.
Doch die Idee vom Paradies ist stark im Menschen verwurzelt; niemand setzt sich gern mit der eigenen Endlichkeit auseinander. Deshalb sei daran erinnert: So wort- und sinnlos, wie in der alten biblischen Geschichte vom Brudermord Kain seinen Bruder Abel auf dem Feld erschlägt, so unerwartet und absurd kommt die Katastrophe über uns. In diesem Sinne ist es klug, einzusehen, dass wir uns bereits, um im Bilde zu bleiben, »jenseits von Eden« (Gen. 4,17) befinden.
Aus existenzieller Sicht bedeutet das, die Begrenzung als Ansporn zu nehmen, in dem und mit dem, was wir tatsächlich haben, Verantwortung zu übernehmen – nicht im Traum unerreichbarer Vollkommenheit, sondern im mutigen Gestalten des Wirklichen, in Eigentreue, der gemeinsamen Endlichkeit bewusst.
Tod: »bedenke, dass du sterben wirst«
Im Alltag sind wir zwar immer wieder, aber im Grunde recht selten, konkret mit dem Tod konfrontiert. Die Pandemie führt uns allerdings hundertausendfach, ja, millionenfach unsere eigene Endlichkeit vor Augen. Wie bereits beim katastrophalen epidemischen Auftreten der Pest in Europa ab Mitte des 14. Jahrhunderts wird dabei ein zentraler existenzieller Gedanke verstärkt – insgeheim ist jeder Bericht, jede Erzählung, jedes Erleben ein geflüstertes »Memento mori« (bedenke, dass du sterben wirst). Jenes altrömische Ritual des Sklaven, der beim Triumphzug hinter dem umjubelten Feldherrn stand oder ging, einen Gold- oder Lorbeerkranz über den Kopf des Siegreichen hielt und mit diesen Worten ununterbrochen mahnte – jenes Ritual können wir als Ostinato der Pandemie verstehen. Die Menschen der Antike haben dabei die existenzielle Dimension verstanden: der Tod ist der »ewige Gleichmacher«, uns allen ist ein Ende unserer Existenz bestimmt. Dass dies unbedingt zu unserem Dasein dazugehört, drückt sich im zweiten Geflüster des Sklaven aus: »memento te hominem esse« (bedenke, dass du ein Mensch bist). Menschsein und Sterben, Dasein und Tod sind unwiderruflich miteinander verknüpfte Grundfesten des Lebens. Je ferner wir uns dieser Tatsache wähnen, desto leichter rutscht das aus unserem Bewusstsein. Verstärkt wird dies durch eine zunehmende Individualisierung, einhergehend mit einer geradezu infantilen Egozentrierung, deren äußerste Zuspitzung sich durch die permanente narzisstische Zurschaustellung in den sozialen Netzwerken zeigt.
Diese »Angst vor der Bedeutungslosigkeit« (Carlo Strenger) gaukelt auf der Verhaltensebene vor, auf der einen Seite gewissermaßen unsterblich zu sein, während sich auf der anderen Seite die eigene Einzigartigkeit manifestiert. Umso wichtiger wird hier das dritte Geflüster des Sklaven: »respice post te, hominem te esse memento« (sieh dich um und bedenke, dass auch du