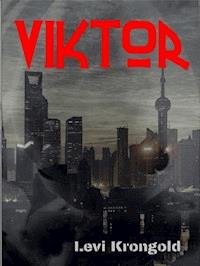
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Levi Krongold, ein Psychiater und Mitarbeiter einer staatlichen Personenkontrollbehörde, dessen Aufgabe es ist, Abweichler auf ihre geistige Zurechnungsfähigkeit zu überprüfen, findet sich über eine attraktive Patientin plötzlich mit einem geheimen Netz von Dissidenten konfrontiert, in dem ein mysteriöser VIKTOR das Sagen hat. Mehr und mehr gerät er in den Bann dieser Gruppe, was ihn schließlich selbst zum Gejagten macht im tödlichen Kampf der Ideologien. Eine düster, optimistische Extrapolation unserer heutigen gesellschaftlichen Entwicklungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 561
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Levi Krongold
Viktor
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Das Buch:
Danksagung:
Die Dissidenten
2.*
3.*
4.*
5.*
6.*
7.*
8.*
9*
10.*
11.*
12.*
13. *
14.*
15.*
16.*
Die Infiltration
17.*
18.*
19.*
20.*
21.*
22. *
23.*
24.*
25.*
26. *
27.*
28.*
29.*
30.*
31.*
Lion
32.*
33.*
34.*
Weitere Romane von Levi Krongold
Impressum neobooks
Das Buch:
Levi Krongold
Viktor
Science-Fiction-Roman
Levi Krongold, Psychiater und medizinischer Gutachter eine. »Überwachungsbehörde für Personenschutz« wird mit einem dubiosen Fall betraut. Er soll die offenbar schizophrene Klientin »Suzanne Montenièr« auf ihre geistige Zurechnungsfähigkeit und Konformität mit gesellschaftlich erwünschten Gedankengut überprüfen. Merkwürdigerweise interessiert sich jedoch auch die Sicherheitsabteilung des Geheimdienstes für diese Dame. Als er den Kontakt mit der Klientin aufnehmen will, gerät er durch eine Intrige unversehens in die Hände einer Gruppe, die die herrschende autoritäre Staatsmacht stürzen möchte, die Dissidenten. Dort hat ein mysteriöser »Viktor« das Sagen und dann ist da noch diese hübsche Montenièr!
Danksagung:
Für ihre freundliche und hilfreiche Unterstützung danke ich Frau Klaudia Jacobs, Dr. Frank Weinreich, Frau Angela Volknant und Herrn Peter Lankes, die mir hilfreiche Anregungen zur Fertigstellung dieses Romans gaben.
Widmung:
Dieses Buch widme ich auf dessen ausdrücklichen Wunsch Raskovnik, der mich bereits durch alle meine früheren Romane begleitet hat.
Die Dissidenten
1. Buch
Ich weiß auch nicht, welcher Teufel mich reitet!
Ich schreie die Frau an, die neben mir auf der kleinen Steinmauer vor der Tankstelle sitzt, um den Verkehrslärm der Hauptstraße zu übertönen.
»Ich würde gerne zu Ihnen sagen, dass Sie mir als Frau durchaus sexuell sehr reizvoll erscheinen. Ich könnte mir sogar vorstellen, mit Ihnen drei oder vier Kinder zu zeugen. ...... Leider fürchte ich, dass Sie diese mit ihrer Macke so neurotisieren würden, dass ich von vornherein Bedenken hätte, sie könnten sich niemals zu gesunden, stabilen Menschen entwickeln. Deshalb sage ich es nicht!«
Sie lächelt ein feines unsicheres Lächeln, während sie sich bemüht, die Bedeutung der Satzfetzen zu entschlüsseln, die rumpelnde Lastwagen, wütend hupende Pkws und lautstarke Werbeansagen der allgegenwärtigen überdimensionalen Infotafeln zu ihr durchlassen. Ich rücke den »Applikator«, ein ringförmiges, an einen Heiligenschein erinnerndes Gerät, das auf einer Art Kopfhörer montiert ist, wieder gerade, da er mir bei der jähen Kopfwendung zur Seite in die Stirn zu rutschen droht. Auch sie trägt diese Spule über der Stirn, doch ihr steht sie deutlich besser als mir, finde ich.
Sie sitzt neben mir, ein wenig in sich zusammengesunken in ihrer unförmigen Armeejacke, die jede Körperform retuschiert. Ihre Augen suchen die Worte von meinen Lippen zu lesen, um einen Sinn in der Kakophonie von Lärm und Sprache zu finden. Ihr schlankes Gesicht mit den kurzen mittelbraunen Haaren wirkt fast unscheinbar, doch es sind die Bögen ihrer Augenbrauen und die weibliche Wangenpartie, der Ausdruck ihrer großen verwirrten Augen, die mich gefangen nehmen.
Als sie mich anlächelt und dabei eine Reihe hübscher weißer Zähne entblößt, weiß ich, dass sie kein Wort verstanden hat oder so tut, als ob sie nichts verstanden hätte. Immerhin wird sie nicht böse und springt nicht mit einem Fluch auf den Lippen auf.
»Können wir das jetzt wieder abnehmen?«, schreie ich und weise auf die Apparatur auf meinem Kopf. Sie winkt entschieden, fast panisch ab.
Es ist immerhin erstaunlich, dass uns noch niemand aufgespürt hat, das muss ich zugeben. Sitzen wir doch nun schon mindestens eine halbe Ewigkeit an dieser exponierten Stelle. Wenigstens einer der versteckten Sensoren in der Umgebung hätte Alarm schlagen müssen, weil wir uns nicht ordnungsgemäß weiterbewegen. Sie hätten die Ordnungskräfte in unsere Richtung lenken müssen, um uns zum Weitergehen aufzufordern oder uns einer intensivierten Personenkontrolle zuzuführen.
Aber nichts dergleichen geschieht. Statt dessen sind Gefühle in mir erwacht, die ich von früher kannte, als das hier alles noch nicht so war, wie es jetzt ist. Angenehme Gefühle, unerwünschte Gefühle, sozial geächtete Gefühle.
Sie schaut mich erwartungsvoll an, ein Blick den ich nicht deuten kann. Denkt sie über meine Worte doch nach, hat sie die Botschaft empfangen? Sie öffnet den Mund und muss wohl etwas gesagt haben, was ich nicht verstehe. Ich lehne mich zu ihr hinüber, um sie besser hören zu können, dabei rutscht de. »Applikator« von meinem Kopf. Erschrocken springt sie auf und bekommt ihn zu fassen, bevor er zu Boden rutscht und Gefahr läuft, beschädigt zu werden. Schnell setzt sie ihn mir wieder auf die Stirn. Dabei kommt mir ihr Gesicht so nah, dass ich meine, ihre Lippen auf meinen Wangen zu spüren. Einen kleinen Moment halten wir beide erschrocken inne.
»Kommen Sie, schnell, wir müssen jetzt hier weg!«, sagt sie entschieden und zieht mich am Ärmel hinter sich her.
Die Wohnung, die wir wenig später im soundsovielten Stockwerk eines verlassenen Bürogebäudes betreten, ist nahezu unmöbliert. Kabel mit blanken, kupferglänzenden Enden hängen wie in den Raum greifende Fangarme nutzlos aus den Wänden und der Decke. Eine große Fensterfront nüchterner staubiger Bürofenster ohne jeglichen Zierrat erhellt mit diffusem Licht den Raum und neutralisiert nahezu jeden Schatten.
In einer Zimmerecke entdecke ich eine abgenutzte Kunstledercouch, über die sie einige abgelegte Kleidungsstücke geworfen hat, direkt daneben Kartons mit zusammengewürfeltem Hausrat und weiteren Kleidungsstücken. Den Blick fesselt jedoch eine große Spule, eine fast armbreite Metallschlinge von über einem Meter Durchmesser, die aus einem unförmigen metallisch schwarzen Kasten ragt, von dem ein Kabel zu einer der am Boden befindlichen Steckdosen führt. Eine kleine rotblinkende LED weist darauf hin, dass dieser offenbar in Betrieb ist. Daneben steht eine alte Autobatterie, an die noch die großen roten und schwarzen Metallklemmen eines Starthilfekabels angeschlossen sind, das nun nutzlos auf dem zerschrammten und an einigen Stellen aufgerissenen Linolium des Fußbodens endet.
»Sie können jetzt die Spule abnehmen«, fordert sie mich auf, während sie die ihre bereits vorsichtig auf das freie Ende des Sofas ablegt.
»Hier wohnen Sie?«, frage ich erstaunt.
»Vorerst.«
»Allein?«
Statt auf meine Frage zu antworten, entledigt sie sich schweigend ihrer graugrünen Armeejacke, die sie achtlos über eine der Kisten wirft.
Ich verbiete mir den Gedanken, dass ich ihren schlanken, fast kindlich wirkenden Körper und ihre fließenden Bewegungen anregend finde und frage. »Gibt es noch Strom hier?«
»Glücklicherweise, wer weiß wie lange noch...«
»Und dann?«, forsche ich weiter.
Sie zuckt mit den Schultern und schaut mich prüfend an.
Verlegen und allein mit meinen unterdrückten Fantasien versuche ich mir einen Eindruck von der Perspektive zu machen, die sich von hier oben bietet.
»Gehen sie nicht zu nah ans Fenster. Sie könnten gesehen werden.«
»Ich dürfte gar nicht hier sein«, bemerke ich lakonisch.. »Nein«, antwortet sie knapp.
»Sie auch nicht!«, ergänze ich, ohne in ihre Richtung zu schauen.
»Doch, ich muss hier sein«, entgegnet sie leise. Draußen, soweit man etwas durch die schmierigen Fenster erkennen kann, verschwimmen mattgraue Wohntürme mit schemenhaften Silhouetten entfernter Hochhäuser. Ganz unten, wir sind mindestens im 20. Stockwerk, fließt nur durch schalldichte Fenster von seinem Lärm befreiter endloser Straßenverkehr dahin.
Ich nicke, gedankenverloren, während ich unbeweglich aus dem Fenster auf eine stumm gewordene Welt blicke, die zu einem mysteriösen Trugbild zu entarten scheint, bis mir etwas schwindelt.
Abrupt drehe ich mich zu ihr um. Sie steht noch immer neben dem Sofa und blickt mich ausdruckslos an.
»Und«, fragt sie nach einer ganzen Weile. »glauben Sie mir jetzt?«
Unwillkürlich muss ich einen tiefen Atemzug nehmen. Ich will mich um eine Antwort drücken, weil ich sie nicht verletzen will... oder mich selbst.
»Hmm«, murmel ich etwas unschlüssig und beginne die merkwürdige Apparatur in der Mitte des Raumes zu taxieren. Irgendetwas stört mich an diesem Gerät. Es ist zu groß, zu mächtig, es passt nicht hierher und es passt nicht zu ihr.
»Meinen Sie, es hilft?«
»Sicher!«
»Wodurch?«
»Es gibt ein Störsignal ab, so dass sie mich nicht orten können, soweit ich weiß«, erklärt sie. »Sie können nicht durchdringen zu mir, nicht bis in mich hinein vordringen!«
»Sie?«, frage ich etwas zu spitz.
Sie wendet sich abrupt ab und ballt zornig die Hände. »Sie haben überhaupt nichts verstanden, gehen Sie, gehen Sie jetzt!«
Erschrocken fahre ich zurück. »Oh, Verzeihung, ich wollte Sie ganz bestimmt nicht verärgern!«
Mir ist klar, dass ich sie jetzt nicht allein lassen möchte. Ich schelte mich selbst wegen meiner Überheblichkeit und meiner dummen Bemerkung. Wenn sie bloß nicht darauf besteht, dass ich gehen soll.
»Entschuldigen Sie bitte, wirklich, ich versuche doch, Sie zu verstehen.«
»Nein, Sie lügen! Sie wollten nur sich selbst bestätigen! Sie sind ein eitler Fatzke. Gehen Sie!«
»Bitte, es war nicht böse gemeint, wirklich«, versuche ich es nochmals, doch sie hat sich zornig umgedreht und die Arme über der Brust verschränkt. Unentschlossen nehme ich meine Jacke auf, die ich abgelegt hatte, werfe sie mir über die Schulter und nähere mich ihr einige Schritte, doch als sie immer noch nicht reagiert, gehe ich langsam auf den Ausgang zu.
Ich höre ihr leises Schluchzen, ihr Kopf ist, mir noch immer abgewandt, etwas auf ihre Brust gesunken.
Etwas in mir fasst neuen Mut, ich lasse die Jacke einfach fallen, nähere mich ihr behutsam und lege ihr die Hand sachte auf die Schulter. Sie dreht sich plötzlich zu mir um und verbirgt ihr Gesicht an meiner Schulter, während ihr Körper von Weinkrämpfen geschüttelt wird. Ich ertappe mich dabei, wie ich ihr vorsichtig über das Haar streichele, sie wie ein kleines Kind leicht wiege und dazu »okay, okay« brumme.
Sie hat so einen zierlichen, fast zerbrechlich wirkenden Körper. Sie tut mir unendlich leid und ich fühle mich schuldig, verlogen und verkommen. Sie hat ja recht, sie hat ja recht!
Eigentlich ist es nicht meine Aufgabe, sie zu verstehen. Es ist meine Aufgabe, sie zu kontrollieren. Ich bin ein Kontrolleur von Amts wegen.
Aber da ist etwas Neues hier im Raum und auch vorher an der Tankstelle. Es ist ein angenehmes Gefühl, wie eine süße Erinnerung an etwas früher Gekanntes, aber lange Vergessenes. Eine Art Kindheitserinnerung, flüchtig wie ein Geruch und doch nicht verloren und es hat mir ihr zu tun. Es ist diese Sehnsucht nach ihrer Zuneigung, dem Kontakt zu ihr und ihrem Körper.
Ich schüttele unwillig den Kopf. Was, wenn sie recht haben sollte? Was, wenn ihre Psychose gar keine, ihr Wahn Wahrheit ist?
Sie hat sich etwas beruhigt und löst sich fast schon etwas zu heftig aus meiner sanften Umarmung.
Ich stehe nur da. Der Raum, den sie gerade noch eingenommen hat, erscheint mir plötzlich endlos kalt, leer und öde. Ich lasse die Arme hängen, die mir unendlich schwer vorkommen.
Sie steht in der Nähe des Fensters, eine schlanke Silhouette, und hält sich die Schultern, als wenn sie friere. »Warum verstehen Sie denn nicht? Warum verstehen sie denn alle nicht?«
Ich antworte nicht. Es fehlen mir einfach die Worte und ich will sie nicht noch einmal provozieren.
Es ist nicht mein Job, sie zu provozieren. Aber was ist eigentlich mein Job? Ich weiß es plötzlich irgendwie nicht mehr. Versuche mich zu erinnern. Warum zum Teufel bin ich ihr eigentlich hierher gefolgt?
2.*
Sie war aufgefallen.
Sicher, sie sollte kontrolliert werden, weil sie aufgefallen war. Eine psychische Anomalie, eine Störung, vielleicht eine Psychose. Ein atypisches Denkmuster. Nichts Ernstes wahrscheinlich, nur eine Routinekontrolle.
Ihre Akte, Suzanne Montenier, die ich neulich bei Dienstbeginn im Amt für Gesundheit und Soziales, Refera. »Medizinische Begutachtung und Rehabilitation«, auf meinem Schreibtisch entdeckte und die den Stapel auf der Ablage für unbearbeitete Fälle auf meiner Linken noch um einige Zentimeter erhöhte, trug allerdings den Vermerk. »Eilt, diskret!«, mit dem dafür üblichen blauen Aufkleber und der roten Diagonalen über der grauen Aktenfolie.
Merkwürdigerweise war sie offenbar auf meinem Schreibtisch von jemanden abgelegt worden und nicht über den zentralen Server eingetaktet, wie die anderen Akten. Denn am Tag zuvor war sie sicher noch nicht dabei gewesen. Außerdem unterschied sie sich schon farblich von den mattroten Folien der übrigen Akten.
Ich blätterte sie seufzend kurz durch, notierte routinemäßig das Eingangsdatum in der Bearbeitungsmaske im PC, der mir daraufhin das Abgabedatum des Berichtes diktierte.
8 Wochen, wie neuerdings üblich.
Aufgrund einer Beschwerde der übergeordneten Personenschutzbehörde waren nun aus der früher üblichen Bearbeitungszeit von 3 Monaten unlängst 8 Wochen geworden, bei gleichzeitiger Reduzierung des Personals. Dennoch betrug die Verfahrensdauer meist mehr als dreimal soviel, was auch irgendwie niemanden wirklich störte.
Nur, wenn mal wieder ein perfider Terroranschlag die Gazetten füllte, wie neulich, als die soundsovielte Bombe mehrere Opfer in einem der neuen Einkaufscenter zur Folge hatte und der oder die Täter nicht geortet werden konnten, weil sie sich mit einer neuen Technik vor den Sonden und Kameras unsichtbar gemacht hatten, dann wirbelte alles in den oberen Etagen der betreffenden Behörde durcheinander, rollten einige Köpfe untergebener Abteilungen, wurden neue Verfahrensweisen oktroyiert, Urlaubstage gestrichen, Versetzungen veranlasst und Bearbeitungsprogramme umgeschrieben, bis alles nach einiger Zeit wieder im alten Trott weiterlief. So auch jetzt.
Ich strich über meine müden Augenlider, setzte mich seufzend zurück, schaute die absolvierten PC-Zeiten auf meinem Arbeitszeitkonto an, die mir sagten, dass ich mein Monatssoll noch nicht erfüllt hätte und beschloss, trotzdem einen Kaffee trinken zu gehen.
Die Cafeteria des Amtes für Personenüberwachung befindet sich im Eingangsbereich im Erdgeschoss. Sie ist der einzige Vorwand, wenn einem danach ist, für kurze Zeit einmal den PC-Arbeitsplatz zu verlassen und sich Bewegung zu verschaffen. Ansonsten ist wenig Grund geblieben, sich von seinem Computersessel zu erheben. Naja, manchmal fällt eine Aktenfolie vom Stapel und verschwindet unter dem Schreibtisch oder rutscht unter den Aktenschrank. Warum rutschen die Aktenfolien eigentlich immer wieder gerade in die verdammte Ritze unter diesem altertümlichen Schrank? Vielleicht liegt es am Material, diesen dokumentenechten, glatten, unzerstörbaren, reiß- und knautschfesten Folienchips? Immer wieder bin ich gezwungen, den letzten noch gerade mit der Fingerspitze erreichbaren unter der Stoßleiste vorlukenden Zipfel vorsichtig zu fassen und hervorzuziehen, um sie nicht versehentlich und auf alle Zeiten ganz unter den Aktenschrank zu schieben. Dann wünschte ich mir, dass alle Akten noch von der gleichen soliden Substanz wären, wie diejenigen im Schrank, die wohl schon einhundert Jahre darauf warten, endlich digitalisiert zu werden. Aber der Fortschritt lässt sich nicht aufhalten.
Aus meinem Referat führen zwei altertümliche Aufzüge nach unten, von denen einer, der linke, immer noch nicht repariert und außer Betrieb ist. Er ist genauso alt wie die muffigen Flure der Abteilung und genauso heruntergekommen. Die Gelder für die Sanierung scheinen immer wieder in den anderen vorrangigen Abteilungen zu verschwinden. Auf diese Weise nimmt die hochmütige Missachtung, die unserer Abteilung durch die anderen Referate entgegengebracht wird über bröckelnden Putz und der durch Jahrzehnte ausgeblichenen Verputz der Wände greifbare Gestalt an. Wir gelten im Amt als Sonderlinge, da wir noch persönlichen Kontakt mit Klienten ode. »Kunden« pflegen, wie wir beschönigend sagen, anstatt uns in vornehmer digitaler Distanz zu ihnen zu halten. So gleicht das Gedränge, dass morgens bei Dienstbeginn und abends bei Dienstende vor dem rechten Aufzug entsteht, einem Spießrutenlauf, bei dem die Blicke der anderen Mitarbeiter um so deutlicher ausdrücken, was die Lippen sorgsam verschweigen.
Zur frühen Nachmittagszeit hingegen war der Aufzug meist leerer. So auch jetzt.
Ich versuchte, die beiden Mitarbeiterinnen aus der Abteilun. »Hygiene und Seuchen«, eine ärztliche Kollegin und deren Vorzimmertippse, die sich angeregt über einen Impfverweigerer unterhielten, höflich zu ignorieren, da ich von ihnen auf meinem Arm-Pad nicht angepingt worden war, was deren Bereitschaft zur Kommunikation signalisiert hätte. Ihrem geflüsterten Gespräch war jedoch zu entnehmen, dass der betreffend. »Kunde« zwangsweise zum Impftermin vorgeführt worden war und wohl viel Geschrei veranstaltet hatte. Eine nicht alltägliche Abwechslung im üblichen Büroalltagseinerlei.
Beim Verlassen des Aufzuges nickte ich der ärztlichen Kollegin verständnisvoll zu, was mir einen verwunderten, jedoch nicht unfreundlichen Blick eintrug.
Die Cafeteria war wie immer um diese Zeit fast leer. Drei oder vier Gestalten saßen vor den Monitoren oder warteten vor den Serviereinheiten auf die Ausfertigung ihrer Bestellung.
Ich ließ mich auf einen freien Sessel sinken, legte meinen Codering an das Terminal und wartete die üblichen vier Sekunden auf das Ende des unvermeidlichen Werbetextes, bei dem diesmal eine neue Kaffeesorte, aus garantiert gentechnisch optimierten Kaffeebohnen, mit de. »gewissen Geschmacks-plus« angepriesen wurde. Dann nickte ich der virtuellen Bedienung, deren Konterfei heute ein asiatisches Aussehen hatte, bejahend zu, als sie mich lächelnd fragte, ob es wieder dasselbe sein dürfte wie vor 2 Stunden.
Vor zwei Stunden? Solange hatte ich es schon durchgehalten? Entspannt ließ ich mich zurücksinken und die Simulation auf mich wirken, die die neuesten Fortschritte bei der Umsetzung der Beschlüsse des 85. Kongresses der Regierung seit der Übernahme der Geschäfte durch ChemChi ins Bild setzte, schaltete jedoch bald auf das Konzertprogramm um, auf der Suche nach Vivaldis Frühling, meinem Lieblingssatz, inszeniert durch FengLang mit dem synthetischen Symphonieorchester Schanghai.
Ich ließ mir gerade mit geschlossenen Augen den wohltuenden Duft des vanillierten Kaffeegetränks in die Nase steigen, als ich angeplingt wurde.
»Krongold, bitte begeben Sie sich umgehend mit der Akte Montenièr zu Herrn Dr. Dr. habil Eschner.« Ich zuckte zusammen. Bereits der Name dieses Herrn fühlt sich für mich an wie Zahnschmerzen der übelsten Sorte.
Er ist der Typ, den man ums Verrecken nicht los wird in seinem Leben. Schon in meiner Assistentenzeit in der Psychiatrischen Landesklinik, kurz vor meiner Facharztprüfung zum Psychiater, nervte dieser Hornochse alle Kollegen auf der Station mit seiner überragende. »Intelligenz«, die sich aus dem Nachplappern gerade gelesener Fachartikel und einem ansonsten völliges Dummschwätz zusammensetzte, aber enormen Eindruck bei den Professoren und Chefärzten der Stationen machte. Schon damals duckmäuserte er hinter den Vorgesetzten her, intrigierte nach Leibeskräften, bis er es zum Stellvertreter des Chefarztes geschafft hatte, nicht ohne alle, die ihm im Weg gewesen waren, kaltblütig abserviert zu haben. Ich war einer derjenigen, die seinem Wirken zum Opfer fielen, was zur Folge hatte, dass ich mich unversehens in dieser Behörde wiederfand, im hintersten Winkel des Gebäudes auf die Erlösung durch Berentung wartend. Was leider noch lange hin ist.
Als ich dann vor anderthalb Jahren aus der Tür meines Büros trat und beim Gang zur Cafeteria zufällig einen anderen Weg durch einen sanierten Gebäudetrakt nahm, traf mich fast der Schlag, als ich vor dem Zimmer des Amtsleiters beinahe mit ihm zusammenstieß. Er verließ gerade mit den für ihn üblichen arrogant hochgezogenen Augenbrauen das Chefzimmer, stolperte ärgerlich fast in mich hinein, stutzte und zog die Mundwinkel nach unten.
»Ah, Krongold, im Weg wie immer!« Ich blieb verdutzt stehen.
»Was machen Sie hier?«, entfuhr es mir verblüfft.
Er starrte mich an, wie eine lästige Fliege, die man gerne mit dem Daumen genüsslich zerdrücken möchte. »Arbeiten. Arbeiten mein Lieber. Eine für Sie ungewohnte Beschäftigung, nehme ich an.« Und ohne meine Reaktion abzuwarten, fuhr er fort. »Dadurch lieber Krongold bringt man es eben auch zu was. Sollten Sie vielleicht auch mal versuchen!« Damit wandte er sich ab und schwebte davon.
Ich traf ihn später noch häufiger. Er hatte es wohl innerhalb weniger Monate zum stellvertretenden Leiter des Amtes Gesundheit und Soziales geschafft, dem neben meinem Refera. »Medizinische Begutachtung und Rehabilitation« unter anderem auch das Referat Hygiene und Seuchen untergeordnet ist.
Jedesmal wenn ich ihm begegnete, hatte er gerad. »etwas ganz Wichtiges zu tun und leider gar keine Zeit für mich«. Einmal kam er gerade aus dem Refera. »Gefährdung und Sicherheit«, schwebte mit in die Luft gehobener Nase und einem dicken Ordner in der Hand gewichtig schreitend und sich nach allen Seiten absichernd, ob er denn auch bemerkt werde, an der Cafeteria und an mir vorbei, plingte mich an, nur um mir mitzuteilen, dass er gerade mi. »ganz oben« über mich gesprochen hätte. Natürlich nur mit den besten Empfehlungen. Man müsse ja denen von der Sicherheit nicht immer alles auf die Nase binden. Schließlich kenne man sich ja bereits seit Jahren und er würde auch gerne Kräfte unterstützen, die es selbst nicht nach oben geschafft hätten.
Ich versuchte, den Druck in der Magengegend zu ignorieren, der mich bei seinem Anblick immer wieder quält, und wunderte mich nur. Was hatte ich mit de. »Oberen« des Referat. »Gefährdung und Sicherheit« zu schaffen?
Dieses Referat ist ohnehin ein wenig merkwürdig. Seltsame Geschichten ranken sich um dessen Existenz. Niemand scheint so richtig durchzublicken, was dessen Aufgabengebiet eigentlich ist. Nicht einmal die Mitarbeiter des Referates sind namentlich im Adressverzeichnis des Amtes auf den Mail-Servern aufgeführt. Anstelle des Namens findet sich dort nur ein graues Feld. Weshalb sie im Amt auch al. »die Grauen« bezeichnet werden. Es wird immerhin gemunkelt, dass sie einen direkten Draht zu hohen Regierungskreisen haben sollen, und dass man sich lieber nicht mit diesen Leuten einlassen sollte.
Es soll vorgekommen sein, dass das Arbeitszeitkonto plötzlich auf null gestellt war oder die angehäuften Überstunden plötzlich gegen minus unendlich tendierten, wenn man einem von ihnen irgendwie auf die Füße getreten war, sagt man.
Seufzend erhob ich mich aus meinem Sessel, nachdem die Meldung, ich solle bei Eschner vorstellig werden, inzwischen ungeduldig blinkte und auf Kenntnisnahme bestand, ließ den Kaffee-Vanilla allein weiterduften und begab mich mürrisch an meinen Schreibtisch.
Dort fischte ich die Aktenfolie vom Stapel und hielt sie vor den Scanner.
Suzanne Montenièr, 26 Jahre, ledig, keine Kinder, Studentin der Bioinformatik und Historik, las ich da.
Dem zugehörigen Bild aus der zentralen Meldebehörde, inklusive Genmuster-Code und Fingerabdruck zufolge, insgesamt ein smartes Persönchen.
Diagnose. »Verdacht auf paranoide Schizophrenie, Wahnvorstellungen von Fremdbeeinflussung.« Studium geschmissen, Nachbarn mit ihren Vorstellungen, sie würde von fremden Mächten bestrahlt, belästigt, auffälliges Sozialverhalten und zunehmende soziale Isolierung. Das übliche. Schade eigentlich!
Ich blätterte die restliche Akte lustlos durch und fragte mich, warum da so ein Bohei drum gemacht wird? Derartige Fälle sind relativ häufig geworden und kommen direkt nach den Angsterkrankungen von Leuten, die sich nicht mehr aus dem Haus trauen, weil sie befürchten, an der nächsten U-Bahnstation oder im Kaufhaus von einer heimtückisch im Mülleimer hinterlegten Bombe irgendeiner Terrorgruppe zerrissen zu werden. Letztere Erkrankung entbehrte leider nicht einer gewissen Berechtigung, führte aber bei den meisten Menschen nur dazu, dass sie sich in der Öffentlichkeit vorsichtiger bewegten, nicht jedoch das Haus gar nicht mehr verließen.
Außerdem, wer musste außer Post- und Paktetzustellern noch groß das Haus verlassen? Wer dennoch raus ging, etwa um seinen Robohund Gassi zu führen, der hatte schließlich die Security-App, die mögliche Gefährdungsstellen auf dem geplanten Fußweg in Form kleiner Bombensymbole darstellte. Außerdem gab es inzwischen kaum eine größere Straßenkreuzung, keinen Eingangsvorplatz öffentlicher Gebäude, keine Bahnstation mehr ohne die üblichen Videokameras, die deutlich die Präsenz der Polizeigewalt demonstrierten. Und schließlich schleppte jeder irgend ein technisches Gerät mit sich herum, das die Bewegungsdaten kontinuierlich, offen oder versteckt, wie man munkelt, weitermeldete.
Dennoch passierten mitunter diese mysteriösen Anschläge, bei denen es einzelnen Terroristen immer wieder gelang, unerkannt zu verschwinden, nachdem sie unschuldige Passanten ins Jenseits gebombt hatten.
Manchmal bis zu zwei oder drei Anschläge im Monat mit gleichbleibender Tendenz. Auch dazu gab es die passende Terror-App.
Was ich bei diesen diversen Terror- und Gegenterrorgruppen bis heute nicht verstanden habe, war, warum sie es meist auf die Oma von nebenan, die Schulkinder einer Grundschule, die Besucher von Kaufhäusern oder Theaterveranstaltungen, also unschuldige, unbeteiligte Menschen abgesehen hatten, jedoch nie Parlamentarier oder Chefetagen von großen Konzernen ins Visier ihres Zorns nahmen, die, wenn überhaupt jemand, für das ganze gesellschaftliche Durcheinander eher verantwortlich waren.
Sei's drum.
Ich nahm mir die Akte nochmals vor, die ich schon lustlos auf de. »Akteneingang« zurückgeworfen hatte, und ließ mir die letzte, die gelbe Auftragsseite anzeigen, wo genauere Angaben zur Art der Kontaktaufnahme ausgeführt waren und der Untersuchungsauftrag präzisiert wurde.
Das Kreuzchen war vo. »Kontaktaufnahme vor Ort, da Einladung mehrmals erfolglos« gesetzt, gefolgt von mehreren Daten derartiger vergeblicher Einladungsversuche.
Ich frage mich immer wieder, weshalb es immer noch Handakten gibt, wo doch letztlich alles im PC bearbeitet werden muss? Aber derartige Fragen stellt man in einer Bundesbehörde besser nicht, um sich nicht die Aufstiegschancen zu vermasseln.
Vorgehensweise, Doppelpunkt, 4a, rot unterstrichen, mehrere dick gemalte Ausrufezeichen, Unterschrift, i.V. Dr. med., Dr. phil., habil. Eschner!
Ich schaute erschüttert nochmals auf die Unterschrift, aber es war kein Zweifel möglich, da stand Eschner! Vor meinen geistigen Ohren erschallte ein dämonisches, boshaftes nachhallendes Gelächter aus einem zahnlosen nach Schwefeldampf stinkenden Mund.
Ich spürte das dringende Bedürfnis, fünf Liter Wasser auf einmal zu trinken, um genug Saft in der Blase zu haben, um ihm an die Bürotür zu pinkeln, wenn ich nun zu ihm ging,.
Der Code: 4a bedeutet nämlich nichts anderes, als. »Nähere Anweisungen vom Abteilungsleiter entgegen nehmen, vertraulich.«
Dies hieß, aus meiner Bürotür zu treten, zu der feindlichen Tür des Dr. Dr. Eschner zu gehen und zu klopfen. Zu warten, weil durch die schalldichten Türen keine Antwort zu vernehmen ist, nochmals zu klopfen, wieder zu warten, dann die Türklinke vorsichtig herunter zu drücken, in devoter Haltung vorsichtig den Kopf zum Zimmer hinein zu stecken, um sich darauf gefasst zu machen, unwirsch nach draußen gewinkt zu werden, weil der feine Herr gerade etwas höchst Wichtiges zu erledigen hat, etwa sich die Fingernägel zu feilen, ein Telefongespräch mit jemand sehr, sehr Hohem zu erledigen oder sonst was.
Ich spürte, wie sich mein schlecht verheiltes chronisches Magenleiden wieder bei mir meldete.
Üblicherweise ist es so, dass man einen Klienten, den man zu begutachten hat, einfach einlädt, ins Amt zu kommen. Dieser erscheint entweder allein, wenn die seelische Erkrankung es zulässt, oder in Begleitung eines Angehörigen oder Betreuers, wenn die Erkrankung schwerer zu sein scheint.Sinn der Überprüfung ist es, das Ausmaß der seelischen Störung zu beurteilen und zu entscheiden, ob der- oder diejenige soweit keine Gefahr für die Allgemeinheit oder sich selbst darstellt, ob alle therapeutischen Maßnahmen ergriffen wurden, derer man heute mächtig ist, und ob eine vertiefte rehabilitative Maßnahme notwendig sein wird, um das gewünschte Ergebnis, nämlich die aktive Teilnahme an der digitalen Interaktion, dem sozialen Leben und dessen Verpflichtungen oder gar dem Berufsleben zu ermöglichen.
Nur in wenigen Ausnahmefällen bewegt man seinen Amtsarsch aus dem Sessel und sucht den Klienten in seinem Wohnumfeld auf. Dies tut niemand gerne, wird auch nicht besonders honoriert, kostet Zeit und Nerven, insbesondere wenn man sich in die Niederungen des unteren sozialen Milieus begeben muss. Noch seltener wird ein Klient gar mit polizeilichen Mitteln gesucht und vorgeführt, so dass ein Weg in die Verwahrungspsychiatrie notwendig wird. Dort geht es zumindest etwas manierlicher zu, jedenfalls für den Gutachter.
Seit der Einführung der allgemeinen Impfpflicht und insbesondere den zunehmenden Terroranschlägen wurden die Definitionen, ab wann jemand zu begutachten sei, etwas erweitert und das Berufsbild des medizinisch-psychiatrischen Gutachters zum ‚Sozialpsychiatrischen Gesundheitsberater‘ umdefiniert. Ein eigener Weiterbildungsberuf mit all dem üblichen Pipapo, wie Seminaren, Weiterbildungszeiten in akkreditierten Bereichen und Prüfungen. In dieser Mühle befand ich mich seit anderthalb Jahren.
Die Aufgaben umfassten nun zusätzlich das einfühlsame Zugehen auf Menschen, denen man nicht eindeutig eine anerkannte psychiatrische Erkrankung unterstellen konnte, sondern eine gewichtige oder vermutete Feststellung einer sozial schädlichen Gedankenwelt.
Dazu bedurfte es natürlich neuer Befragungsmethoden, damit die betreffenden Personen sich nicht stigmatisiert fühlten und sich lauthals protestierend an die Medien wendeten. Nicht, dass diese begierig darauf gewesen wären, derartige Protestschreiben abzudrucken, aber um die allgemeine Lage, die bereits durch die andauernde Terrorgefahr belastet war, nicht noch mehr zu eskalieren, kehrte man derartige Dinge lieber unter den Teppich.
Es wurde daher in den letzten Jahren zunehmend notwendig, Menschen aufzusuchen, die glaubten, sich wider besseres Wissen der notwendigen Massenimpfung gegen die seit einigen Jahren grassierende Zoga-Virusepidemie entziehen zu müssen, und deren geistigen Zustand festzustellen, wie auch Menschen, die sich aggressiv in Blogs oder Kommentaren im Netz zu Wort gemeldet hatten. Das machte wenig Spaß, da man als Gutachter ode. »Controller«, wie man verächtlich im Volksmund betitelt wird, weniger soziale Anerkennung erhielt, als vielmehr auf unverhohlene Ablehnung stieß und schlecht unterdrückte Aggressionen aushalten und seelisch wegstecken musste. Man musste sich also ein dickes Fell anschaffen.
Ganz anders verhielt es sich jedoch in diesem Fall, bei dieser Suzanne Montenièr. Hier lag offensichtlich ein deutliches Missverhältnis vor im Vorgehen zwischen der offensichtlichen psychiatrischen Erkrankung, die eine Wahnerkrankung nun einmal ist, und der Art und Weise, wie dieser Fall eingetaktet worden war.
Noch mysteriöser wurde es, als von ihm, kaum war ich wenige Minuten vor meinem PC, eine dringliche Anfrage mi. »höchster Priorität«, rotes Ausrufezeichen, per Netz kam, in der er sich tatsächlich herabließ, mich zu duzen.
»Lieber Kollege Levi, komm doch mal bitte kurz zu einer Besprechung der Sonderakte Montenièr zu mir rüber. Die Sache eilt etwas!«
Ich gebe zu, dass ich es langsam angehen ließ. Mit einem Mal entdeckte ich den Reiz alter, verstaubter Aktendeckel aus dem letzten Jahrhundert in meinem antiken Aktenschrank wieder. Auch schienen mir die Aktenordner in meinen Regalen ungebührend unordentlich aufgereiht zu sein. Dies korrigierte ich, indem ich die Fronten millimetergenau zueinander ausrichtete, bis ein einheitliches Bild der Oberflächen entstand. Auch fand ich hinter den Akten größere Staubschichten, die ich wegen fehlender Arbeitsmittel mittels eines Papiertaschentuches beseitigte. Ich habe viele Aktenschränke! Hier und da entdeckte ich sogar jahrelang verschollen geglaubte Vorgänge wieder oder welche, die von der alphabetischen Ordnung so sehr abwichen, dass sie erst zurücksortiert werden mussten.
Erst als die dritte Eilmeldung im PC mit eine. »Pling« ihre Anwesenheit bekannt gab, schlenderte ich langsam zu Eschners Büro rüber, klopfte flüchtig und trat sofort mit einem vor meinem Spiegel sorgfältig einstudierten kameradschaftlichen Lächeln ein.
»Was gibt's altes Haus?«
Immerhin hatte sic. »mein lieber Kollege Konrad Eschner«, nachdem ihm zuerst kurz die Gesichtszüge entgleist waren, als hätte ihm ein Schlaganfall das Kleinhirn ausgeschaltet, relativ schnell wieder im Griff und wies mir mit säuerlicher Miene einen Platz auf seinem Besucherstuhl zu.
Was er darauf folgend eröffnete, gab mir noch einige Stunden später reichlich Stoff zum Nachdenken. Erst einmal stellte er fest, dass es keinen geeigneteren Menschen im ganzen Amt gebe als mich, diese Begutachtung durchzuführen. Da hätten bei mir schon alle Alarmglocken klingeln sollen! Ich stand allerdings zu sehr unter Anspannung, als dass ich entspannt hätte nachdenken können.
Die Art und Weise, wie er mir Honig ums Maul strich, strafte er allerdings durch seinen das genaue Gegenteil ausdrückenden Gesichtsausdruck wiederum Lügen.
»Wie kommt denn diese Akte auf meinen Schreibtisch?«, fragte ich nach. »Sie ist offenbar nicht auf dem normalen Dienstweg bei mir abgelegt worden.«
Eschner lehnte sich gewichtig zurück, betrachtete eine Weile seine Fingernägel und erhob sich dann.
»Sie kommt eigentlich aus dem Referat Sicherheit«, hob er an. Auf meinen verwunderten Blick hin fügte er schnell hinzu. »Das bleibt natürlich alles unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Ich hoffe, dass ich auf deine Diskretion vertrauen kann?!«
»Diskretion, weshalb?«
»Die Dame steht unter Beobachtung und man fragte mich, wen ich für geeignet hielte, Kontakt mit ihr aufzunehmen.«
Er machte eine bedeutungsvolle Pause. »Und da fielst du mir natürlich ein!«
»Aus alter Verbundenheit!«, setzte ich ironisch hinzu.
Er lächelte ein malignes Lächeln. »Aus alter Verbundenheit, selbstverständlich!«
Ich spürte, wie bei mir alle Wahnlämpchen anfingen zu leuchten.
Noch merkwürdiger erschien mir die Herangehensweise an den Fall. Es wurde Wert darauf gelegt, dass die Annäherung an die Klientin in mehreren Phasen verlaufen sollte. So eine Art zufälliges Zusammentreffen, das von mal zu mal vertieft werden sollte, damit die Dame nicht misstrauisch wurde.
»Wozu soll das gut sein?«, fragte ich ihn verblüfft. »Es ist eine Schizophrene, da muss man doch nicht mit geheimdienstlicher Beflissenheit vorgehen!«
Er gab zu, dass ihn das auch ein wenig gewundert habe, allerdings habe er Andeutungen vo. »ganz oben« erhalten, dass nicht die Frau selber, sondern ihr Umfeld Probleme bereiten könnte.
Wer das sein soll. »ganz oben?«, fragte ich. »Ich verstehe nicht, was diese Andeutungen sollen? Was heißt das Umfeld könnte Probleme machen? Sind das Rocker, Terroristen, Radikale oder Pestkranke?«
Er verzog seine Miene derart gekünstelt in Richtung Mitgefühl, dass ich ihm hätte spontan auf die hochglanzpolierten Schuhe kotzen können.
»Wenn ich nicht an völlige Geheimhaltung gebunden wäre, würde ich dir liebend gerne Auskunft darüber geben, aber leider ....« Er vollendete den Satz nicht, sondern setze sich wieder bequem in seinen Chefsessel. »Zum dortigen Referat haben nur wenige Zutritt, musst du wissen.«
»So wie du!«, ergänzte ich, bemüht ruhig zu klingen.
Er unterdrückte ein selbstgefälliges Grinsen, lehnte sich verschwörerisch nach vorne und flüsterte mit gesenkter Stimme. »Also hör zu. Es scheint, dass einige Abteilungen sehr beunruhigt sind, weil die Klientin nicht nur schizophren sein soll, sondern sich auch auf eine eigenartige Art und Weise der Überwachung entzieht.«
»Überwachung?«, fragte ich verwundert nach.
»Naja, du weißt schon. Eigentlich sollte sie irgendwo wohnen. Offiziell tut sie das auch, aber dort ist sie nie anzutreffen. Daraufhin wurde man aufmerksam auf diese Person und begann sie zu überwachen, Terrorgefahr, du verstehst?«
»Eine Verrückte?«, gab ich ungläubig zurück.
»Warum nicht, meinst du, die Terroristen wären alle ganz klar im Oberstübchen?«, konterte er.
Das deckte sich auch mit meiner Einschätzung. »Und weiter?«, forschte ich.
»Es stellte sich heraus, dass auch die im öffentlichen Raum zulässigen Mittel und auch die weniger offiziellen Mittel, wie Arm-Pad-Überwachung, nicht dazu führten, lückenlos heraus zu bekommen, wo sich diese Person aufhält. Sie scheint sich immer wieder in Luft aufzulösen.«
»Echt?«, fragte ich erstaunt. Es war mir natürlich bereits klar, dass die inoffizielle Überwachung entgegen aller offiziellen Versionen breite Anwendung findet, insbesondere als ich durch einen Zufall herausbekam, dass jedes Handy zwei Leitungen gleichzeitig benutzen kann, eine offizielle Gesprächsleitung und eben eine weitere, die ohne Wissen des Teilnehmers funktioniert.
»Und?«, regte ich ihn zu einer weiteren Erklärung an, da er mich abwartend anschaute.
»Es scheint in ihrem Umfeld Leute zu geben, die eine Technik anwenden, die sie vor Überwachung wirksam schützt. Das ist natürlich für die Abwehr von potentiellen Gefährdern ein großes Problem.«
Das verstand ich.
»Aber was habe ich damit zu tun?«, versuchte ich, nun langsam Licht in die Angelegenheit zu bringen.
»Man war der Ansicht, es wäre am unauffälligsten den üblichen Routineweg zu gehen. Einen Gutachter erwartet man ja in solchen Fällen und daher erregt dieser bei einem eventuell gefährlichen Umfeld am wenigsten Verdacht.«
Mir wurde ein wenig mulmig. Was aber, wenn das möglicherweise gefährliche Umfeld nun auf die Idee kam, mich einfach wegzubomben?
»Dafür bin ich zu deinem Schutzpatron ernannt worden«, gab er grinsend von sich.
»Ich kann dir auch nur versichern,« nickte er. »dass ich dich so gut wie möglich mit Rat und Tat unterstützen werde, wenn du nicht zurechtkommen solltest.«
»Firma dankt!«, erwiderte ich frostig.
Im Rausgehen rief er mir noch nach. »Ich kann mich auf dich verlassen, ja? Denk dran, die Sache eilt!«
Ich kann nicht behaupten, dass ich mich an Einzelheiten bezüglich des Rückweges zu meinem Zimmer wirklich erinnern kann. Ich war damit beschäftigt, über die vielen Ungereimtheiten nachzudenken, als mein Arm-Pad angeplingt wurde. Raskovnik, einer meiner wenigen Bekannten im Amt, lud mich ein, kurz einmal in der Cafeteria vorbeizuschauen. Erfreut drehte ich auf dem Absatz um und erlaubte mir den kleinen Umweg durch das Erdgeschoss.
Raskovnik ist ein merkwürdiger Mitmensch. Er passt so gar nicht ins Amt. Offenbar ist er jedoch genauso hier gestrandet wie ich. Sein Vater soll ein hohes Tier bei der Uno gewesen sein. Das war, bevor die Eurasische Union zwischen Russland und China, Tuanti Sojus, kurz TUS, die militärische und wirtschaftliche Schwäche der USA nach deren strategischer Niederlage im Nahen Osten ausnutzte und die Hebel der Macht an sich riss. Zurück blieb eine ausgebombte, radioaktiv verseuchte und unbewohnbare vorderasiatische Region, mit der wirklich niemand mehr etwas anfangen kann und eine durch innere Konflikte auseinanderfallende Rest-USA, die Western Union, die im Weltgeschehen praktisch bedeutungslos geworden ist.
In diesem Verlauf wurde die UNO als nutzlos und zu kostspielig aufgelöst. Raskovnik's Vater floh offensichtlich in die TUS, wo er jedoch keine wesentliche Funktion mehr innehatte und sein Sohn, Vladic Raskovnik, versumpfte hier im Amt ohne Aussicht auf eine nennenswerte Karriere. Dennoch hatte er bei der besagten Abteilung für Gefährdung und Sicherheit eine unbedeutende, jedoch gesicherte Tätigkeit als Dolmetscher erstreiten können, auch wenn er unter ihrer Leitung nicht ganz glücklich zu sein schien.
Er wirkt ein wenig phlegmatisch, trotz des Stiernackens und seines fast quadratischen Körperbaus, was einem Ringer mehr entspräche als einem Sesselpfurzer. Allein die senkrechte Falte über seiner Nasenwurzel und sein verschlossenes, wortkarges Auftreten lassen den geschulten Psychiater die mühsam beherrschte Wut ahnen, die diese Seele peinigen muss. Dennoch, Raskovnik sprach gleich von Anfang an eine Seite in mir an, die ihm meine Zuneigung sicherte. Ihn traf ich häufiger in der Cafeteria. Auch wenn es nie zu einem tiefer gehenden Gespräch kam, so plingte er mich des Öfteren an, nur um mir ein paar belanglose Worte zu simsen.
Hinzu kam, dass auch Raskovnik als Mitarbeiter der Sicherheit ei. »Grauer« ist und dass er mir gegenüber im Laufe der Monate seinen Klarnamen erwähnte, was einen eklatanten Verstoß gegen die Sicherheitsbestimmungen darstellt, zeigte mir, dass unsere Sympathien wechselseitig sein müssen. Kurz und gut, ich freute mich nach dem Gespräch mit Eschner vielleicht ein paar Hintergrundinformationen von ihm zu erhalten. Umso mehr wunderte es mich, dass er sich, wie ich mich erinnere, nur auf wenige Sätze beschränkte, nachdem ich ihm kurz die Zusammenhänge erläutert hatte.
»Levi, sei auf der Hut vor Eschner! Da scheint eine riesige Sauerei im Amt zu laufen. Ich versuche heraus zu bekommen, woher der Wind weht. Ich melde mich bei dir!« Damit verließ er die Cafeteria eilig, ohne sich noch einmal nach mir umzuschauen.
Ich verbrachte den Rest des Tages vergeblich damit, meinen Bearbeitungsrückstand bezüglich der offenen Fälle zu verringern. Schließlich gab ich es trotz blinkender Warnhinweise wegen der Bearbeitungsdauer längst überfälliger Akten und tiefrot im Minus verweilender PC- Zeiten auf und beschloss, für heute Schluss zu machen, zumal auch keine Termine zur persönlichen Begutachtung mehr eingetragen waren. Ich bestellte per App ein AuTaX, eine automatische Fahrkabine, die die Funktion früherer Taxis übernommen hat, zum Amt.
Nachdem ich am Ausgangsterminal meinen Daumenabdruck und meine Iris gescannt hatte und ich erfolgreich ausgeloggt war, umfing mich feuchtkühler Nachmittagsnebel. Das AuTaX wartete bereits in der Haltebucht, so dass ich es mit dem Chip am Fingerring aktivieren konnte.
Ich zögerte kurz, wählte dann aber nicht meine Wohnadresse, sondern das italienische Bistro im benachbarten Park am See und legte mich entspannt zurück, als das AuTaX lautlos seine Fahrt aufnahm. An mir floss der dichte Personenverkehr mit viel Lärm und Gestank vorbei, während ich auf meiner AuTaX-Spur problemlos das Chaos neben mir zurückließ.
Ich fragte mich, wann es wohl gelingen werde, das vor 20 Jahren begonnene AVS-System endlich zu realisieren. AVS ist die Abkürzung für ‚Automatisiertes Verkehrssystem‘. Die Idee war ja nicht schlecht, alle innerstädtischen Fahrzeuge automatisiert und vor allem elektrisiert und auf Mietbasis zu betreiben. Keine lästige Parkplatzsuche mehr, keine verstopften Straßen, keine Staus. Leider stehen zwischen einer Idee und deren Verwirklichung die Dämonen der Verwaltung und auch des Besitzstanddenkens. Nicht nur die Autoindustrie zeigte sich eher schwerfällig, denn es sollten ja letztendlich keine privaten Pkw mehr auf die Straße, sondern statt dessen automatisierte Fahrkabinen, die auf Anforderung das gewünschte Fahrziel ansteuern. Auch die Verkehrsbehörde hatte massive Bedenken und torpedierte das Projekt, wo sie konnte. Übrig blieb vorerst nur die AuTaX-Fahrspur für automatisierte Taxikabinen, die in allen größeren Straßen realisiert worden war, immerhin. So fließt denn der führerlose Taxiverkehr weitgehend ungestört neben intelligenten Autos, die dennoch ständig irgendwelche Unfälle verursachen, und dem herkömmlichen Personenverkehr dahin, mit dem Ergebnis größtmöglicher Ineffektivität. Ich verzichte gerne auf den Besitz eines prestigeträchtigen Pkws, wenn ich so für die Überbrückung einer normalen Fahrstrecke nur ein Drittel der sonst üblichen Zeit benötige. Ganz zu schweigen von den öffentlichen Verkehrsmitteln, die inzwischen zu reinen Sicherheitsrisiken geworden sind und nur noch vo. »Mobb« benutzt werden.
Als der Verkehr ruhiger wurde, in dem Maße wie ich mich dem westlichen Außenbezirk näherte, entspannte sich auch mein strapaziertes Gehirn etwas. Für mich gibt es immer noch nichts Erfreulicheres als in dem kleinen Bistro am See zu sitzen und meine Gedanken schweifen zu lassen. Heute am frühen Nachmittag war hier noch nicht viel los. Ich checkte mittels Chip ein und ließ mir vom Getränke-Bot einen altertümliche. »Cafe Latte« servieren, setzte mich bequem in den Liegesessel vor die Monitorwand und schaltete das sommerliche Seeambiente dazu, denn der reale See lag derzeit im vorwinterlichen Graubraun. Sogleich erblühten die kahlen Bäume in virtueller Blätterpracht, zwitscherten längst ausgestorbene Vogelarten und wehte ein angenehmer, nach frischem Grün riechender Duft heran.
Was für ein Tag!
Mit einem Seufzer setzte ich das Kaffeeglas ab und schaute mich nach den wenigen Anwesenden um. Einige saßen mit ihren Virtual-Reality-Brillen ruhig in ihren Sesseln, andere machten es wie ich und benutzten nur den Monitor. Der in die Sessellehne eingebaute Screen zeigte nur eine Person an, die gesprächsbereit gewesen wäre, aber ich beachtete diesen Hinweis nicht, sondern schaltete mich auf offline.
In Gedanken ließ ich die heutigen Ereignisse Revue passieren. Alles, aber auch alles war bislang an diesem Tag merkwürdig. Ich schien plötzlich in höchst beunruhigende Ereignisse verwickelt, die eine unangenehme Vorahnung in mir hinterlassen hatten, ein unbestimmtes Gefühl der Unruhe in mir erzeugten, ohne dass ich hätte sagen können, wovor ich Angst bekommen hätte. Einerseits drängte es mich, den Fall Montenièr lieber zurückzugeben, andererseits spürte ich auch eine zunehmende Neugierde, geradezu eine Abenteuerlust, mich in dies Unternehmen zu stürzen. Denn abenteuerlich ließ es sich ja bereits an. Ich musste mit jemandem sprechen, nur leider war in meinem Privatleben auf fast allen Kanälen Sendepause. Meine Frau Iris hatte sich in ihren Beruf verabschiedet und dort eine neue Beziehung angefangen. Meine Tochter Clarissa schied ebenfalls aus, ich wollte sie nicht in die Probleme der Erwachsenenwelt hineinziehen. Sie saß derzeit zwischen allen Stühlen und zog es vor, tagsüber lieber in Ruhe ihr Telestudium zu absolvieren. Ohnehin wusste sie derzeit nicht, ob sie Fisch oder Fleisch sein sollte, da sowohl die Pubertät als auch die Trennung von meiner Frau sie in eine schwierige Situation gebracht hatten. Sie meldete sich so gut wie überhaupt nicht mehr bei mir, und wenn, dann nur um Forderungen an mich zu stellen. Das schmerzte.
Die Kyperbekanntschaften waren erwiesenermaßen genauso fleischlos wie unverbindlich, mein psychiatrischer Supervisor schied momentan aus, weil... weil... Er schied eben aus. Ein Psychobot tat es auch manchmal, wenn man die Erwartungen, die man an ein Gespräch mit einem Computerprogramm hatte, nicht zu hoch ansetzte. Ich schaltete die Musik ein, Vivaldi, das beruhigte mich sonst immer. Aber anstatt ruhiger zu werden, wurde ich immer nervöser, bis ich mich schließlich dabei ertappte, dass ich wie ein Maschinengewehr mit den Fingern auf das Terminal tackerte. Auf dem Screen öffnete sich ein Fenster, in dem das Gesicht einer hübschen Frau zu sehen war, die freundlich nach meinem Befinden fragte. »Kann ich irgendetwas für Sie tun?«, lächelte sie ein professionelles Lächeln. Leider weiß man nie, ob das Gesicht eine Computersimulation ist oder ein reales Abbild. Ich tat so, als wäre mir das im Moment egal. »Nicht dass ich wüsste, danke.«
»Sind Sie mit irgendetwas unzufrieden, Sie wirken angespannt?«
»Oh, wirklich?«
»Ja, wir dachten, vielleicht gefällt Ihnen unsere Simulation nicht.«
»Oh, doch, doch vielen Dank, sie ist wirklich gut. Wirklich gut. Danke.«
»Wie schön, wenn wir irgendetwas tun können, um Ihren Aufenthalt hier so angenehm wie möglich zu machen, dann lassen Sie es mich bitte wissen. Für nur 24 Quian können wir Ihnen zum Beispiel eine Wohlfühl-App anbieten, entstressen auf höchstem Niveau, oder eine Harmoniser-XXL-App, neuestes Update, für nur 34 Quians. Gegebenenfalls könnten sie auch eine Libidoseur-Applikation erhalten, im günstigen Jahresabonnement um zehn Prozent günstiger, die erste Rate wird erst nach einer unverbindlichen Probewoche abgebucht.«
»Oh, danke, ich weiß nicht so genau.«
Die Dame lächelte ein entzückendes Lächeln. »Na, dann melden Sie sich einfach, wenn Sie möchten. Einen weiterhin schönen Aufenthalt wünsche ich Ihnen.«
Ich ließ mich ermattet zurücksinken und blickte auf das abstrakte Bildschirmmuster, welches auf dem Screen erschienen war und sich im Rhythmus von Vivaldi. »Vier Jahreszeiten« bewegte. Seltsamerweise wurde ich etwas ruhiger. Ich blickte wie im Traum auf die bizarren Figuren, die sich bildeten und wieder vergingen. Auch wenn sie zufällig entstanden, so waren sie doch auch faszinierend. Obwohl es keine ausgeprägte geistige Tätigkeit verlangte, sie anzusehen, brachten sie doch einige Free-bits ein, die ich zu einem kleinen Prozentsatz in mein Arbeitskonto einbuchen konnte und die zum Teil auch mein Payback-Quians-Konto vermehrten. Nach einer geraumen Weile, es war inzwischen schon dunkel geworden, beschloss ich, doch in die häuslichen Gefilde zurückzukehren. Ich schüttelte ein paarmal den Kopf, um die Müdigkeit loszuwerden, rieb mir kräftig über das Gesicht und bestellte ein Abendessen im Nutri-Shop nach Hause, danach ein AuTaX zum Café. Ich blickte nochmals auf den Bildschirm, der nun zwei potentielle Gesprächspartner anzeigte. Einer Frau im Alter meiner Exfrau simste ich eine Offerte für später und checkte mich aus. 50 Quians von meinem Konto für den hiesigen Aufenthalt waren nicht wenig, aber seis drum. Das Ausgangsterminal fragte diesmal nicht nach einem Trinkgeld, der Service gehe aufs Haus. Seit das Bargeld nun endgültig abgeschafft worden war, hätte zwar nur ein Druck auf die Trinkgeldtaste genügt, andererseits wüsste ich nicht, wem ich es in einem automatisierten Café hätte zuweisen sollen. Ich war eben noch ein wenig altmodisch in dieser Beziehung.
Auf dem Rückweg flimmerten die Lichter der abendlichen Stadt an mir vorbei. Überdimensionale Leuchtreklamen lenkten die Aufmerksamkeit von den Niederungen dieser Welt in eine virtuelle bessere Welt. Die Kabine nahm einige merkwürdige Umwege, wahrscheinlich weil ihr auf der berechneten Route Hindernisse gemeldet worden waren. Tatsächlich stauten sich auf der Hauptstraße die individuell gesteuerten Autos bereits, was zu dieser Tageszeit in Richtung Zentrum normal war. Einige hatten sich sogar auf die Fahrspur der Automatischen gewagt, was üblicherweise mit empfindlichen Geldbußen oder monatelangem Führerscheinentzug geahndet wird.
Der Himmel über der Stadt, der rötlich leuchtend die von den Wolken reflektierten Lichter zurückwarf, zeigte noch einige schwache Versuche der untergegangenen Sonne, sich mit einem letzten fernen Leuchten zu verabschieden. Jetzt waren wieder mehr Menschen auf den Straßen, obwohl dies eigentlich die riskanteste Zeit ist, das Haus zu verlassen und sich in die Öffentlichkeit zu wagen. Über 80 Prozent aller Anschläge werden nach Einbruch der Dämmerung verübt! Wir passierten die gelblich blinkenden Lichter eines Polizeifahrzeuges und eines wartenden Sanitätswagens. Aber da kein olivgrünes Fahrzeug des Terrorschutzes zu sehen war, handelte es sich wohl nur um einen Unfall. Ich zählte die Anzahl der Videokameras, die auf dem Weg zu entdecken waren, in Abwandlung eines alten Kinderspieles, bei dem wir früher die Autos einer bestimmten Automarke abgezählt hatten.
Die Welt hat sich in den letzten 20 Jahren sehr verändert. Ich frage mich, ob das Leben leichter geworden ist, seit die neue Regierungsform notwendig wurde? Ich weiß es nicht. Andererseits konnte es so auch nicht weitergehen. Die diversen demokratischen Parteien und Splitterparteien hatten sich im Parlament nicht zu einer konstruktiven Lösung zusammen tun können, sondern sich nur gegenseitig blockiert. Bis auf das gemeinsame Interesse, bei jeder Kleinigkeit die Steuern oder Staatsschulden zu erhöhen, gab es keine erkennbare Gemeinsamkeit. Jeder gut gemeinte Reformansatz wurde daher im Mahlwerk der eigennützigen Interessen bis zur Unkenntlichkeit deformiert, durch eine Heerschar eifriger Juristen und Bürokraten ins glatte Gegenteil gekehrt und schließlich als neue Zumutung der Bevölkerung auferlegt. Wen wundert es, wenn die Netzmedien überwiegend von Hassbotschaften dominiert wurden? Bis zur Wahlreform, die lediglich die Möglichkeit einer einzigen Regierungspartei zuließ, versank das Land im Chaos sich gegenseitig bekämpfender Parteien, revoltierender Bürgerinitiativen, litt unter Terroranschlägen verschiedenster Gruppierungen und Wirtschaftskriminalität, so dass es ein Glück war, als ein chinesischer Konzern seine Wirtschaftsmacht ausnutzend, das Ruder herumriss und die dortigen zentralistischen Strukturen auch bei uns einführte. Nicht, dass dies auf allgemeine Zustimmung gestoßen wäre, aber unleugbar ging es seitdem auch bei uns wieder langsam bergauf.
Aber war das Leben auch leichter geworden? Es war geordneter, das wohl. Die persönlichen Probleme blieben einem allerdings treu, wie ehedem.
Mein persönliches Problem bestand aus der Ereignislosigkeit, aus der ermüdenden Routine des Alltags und der privaten Perspektivlosigkeit. Meine Familie hatte wenigstens die Illusion der Notwendigkeit eines derartigen Zustandes erzeugt, aber seit der Trennung wurde dieses Gefühl zunehmend zur Last.
Vor dem Wohnblock, in dem ich mein neues Zuhause gefunden hatte, checkte ich mich aus der Kabine aus, die sofort zum nächsten Einsatz fuhr, sog die kühle Abendluft noch einmal kräftig ein und wollte mich gerade mittels Daumenabdrucks an der Pforte identifizieren, als mein Arm-Pad sich meldete. »Bitte Rückruf, dringend. Raskovnik«.
Ich stutzte. Raskovnik rief mich privat an? Woher hatte der meine Privatnummer? Soweit ich mich erinnern konnte, hatten wir nie unsere privaten Nummern ausgetauscht.
Ich tippte die Antworttaste. Der kleine Bildschirm flammte auf. »Entschuldige, dass ich dich in deiner Freizeit störe...«
»Woher hast du meine Nummer?«
»Ist die nicht im System hinterlegt...?«, fragte er zurück.
»Nicht das ich wüsste...«, überlegte ich.
»Hör mal, es gibt eine geringe Chance. Es wäre wichtig, dass u diese Montenièr schnellstmöglich aufsuchst. Sie weiß dir einiges zu berichten, was ich dir hier nicht am Pad mitteilen kann. Es gibt eine Chance, dass du sie heute Abend in der Nähe vom ,Fleur' antriffst. Ich habe ein wenig recherchiert und herausgefunden, dass sie sich dort aufhält.«
»Weshalb?«
»Kann ich dir nicht sagen, gerade. Aber du weißt schon. Es könnte wichtig sein für dich!«
Merkwürdig!
»In welchem Bezirk liegt das ‚Fleur‘?«
»Im 14.«
»Willst du mich etwa in diesen Abgrund schicken?«
»Es ist nun mal dort, tut mir leid.«
Das gefiel mir gar nicht, da ich es nicht gewohnt war, aus meinem Bezirk herauszugehen.
»Aber ich habe keinen Dienst jetzt.«
»Ich weiß, ich weiß. Nur das Problem liegt darin, dass es sonst schwer werden wird, sie überhaupt irgendwo anzutreffen.«
»Ich hab gar keine Akte dabei.«
»Levi, es geht um dich. Vertrau mir! Es ist von größter Wichtigkeit. Vielleicht ergibt sich eine Kontaktmöglichkeit. Mach dir mal ein Bild vom Zustand dieser Frau.«
»Randaliert sie?«
»Nicht, dass ich wüsste.«
»Hör mal, das schmeckt mir überhaupt nicht. Wenn die Sicherheit ohnehin weiß, wo sie ist, warum schickt sie dann nicht einen ihrer Leute hin.«!«
Er räusperte sich. »Ist sozusagen eine private Angelegenheit... verstehst du?«
»Wieso?«
»Ich erklär es dir später. Ich schicke dir nochmals ein Bild von ihr, damit du sie erkennst. Gehst du?«
Was war nur mit Raskovnik los? Irgendwie passte die Art, wie er mir dies mitteilte, nicht zu dem Bild, das ich mir von ihm gemacht hatte. Ob er etwas wusste, was mit Eschner und dessen obskuren Rolle in dieser Sache zu tun hatte?
Offenbar konnte er nicht offen reden am Pad. Andererseits, überlegte ich, hatte ich ohnehin nichts mehr vor heute und vielleicht entwickelte sich ja daraus die Perspektive, die mir gegenwärtig so dringend fehlte.
»Okay. Aber nur kurz.«
»Gut! Das AuTaX ist informiert.«
Kurz danach öffnete sich ein Anhang, in dem das Bild der schizophrenen Klientin angezeigt wurde. Missmutig schaltete ich das Teil aus.
Was ging hier eigentlich vor und warum um alles in der Welt ließ ich mich auf diese merkwürdig. »Begutachtung« ein? Ich hatte einige Zeit im AuTaX darüber nachzugrübeln, insbesondere da dort Fahrziel und Einbuchung schon vorgenommen worden waren. Die Antwort lag wohl im Konterfei dieser Suzanne Montenièr. Sie war mir nämlich irgendwie sympathisch. Genaugenommen konnte ich mir nicht vorstellen, dass sie an dieser Wahnerkrankung leiden sollte, zumindest wünschte ich es ihr nicht. Obwohl das biometrisch korrekt erstellte Foto eher wie ein Auszug aus einer Verbrecherkartei wirkte, beeindruckten mich in dem schlanken Gesicht die großen Augen und markanten Augenbrauen, die dem Gesichtsausdruck etwas Sanftes verliehen. Aber man soll sich nicht täuschen! Schizophrene sind nicht grundsätzlich dumm oder geistig minderbemittelt. Im Gegenteil. Ich habe in meiner Laufbahn als Psychiater viele äußerst intelligente, phantasievolle Patienten erlebt, die erst durch die lange Einwirkung von Medikamenten oder den chronischen Krankheitsverlauf geistig abgebaut hatten. Mit anderen Worten, ich war neugierig auf die Frau. Andererseits war die amtliche Herangehensweise an diesen Fall mehr als seltsam.
Bis zu dem Punkt, wo die Klientin vor Ort aufgesucht werden sollte, konnte ich noch routinemäßig mitgehen. Aber diese merkwürdige Annäherung, ohne dass die betreffende Person von ihrer Ausforschung erfahren sollte, schmeckte mir nicht. Ich bin zwar nicht scharf darauf, gleich mit eine. »Verpiss dich« abgefertigt zu werden, andererseits billige ich meinem Gegenüber noch so viel Menschenwürde zu, dass es wissen sollte, worum es geht.
Stellen wir uns nur einmal vor, Suzanne Montenièr könnte die Geheimleute wirklich zu einem Terroristennetzwerk führen, dann würde ich annehmen, dass die sich Tag und Nacht an ihre Fersen heften und schauen, wo sie sich aufhält. Aber statt dessen eine psychiatrische Begutachtung zu veranlassen erschien mir wenig zielführend. – Es sei denn, dass dies nur ein Vorwand für etwas anderes war – oder dass die Beobachtung durch mich genauso wirkungsvoll wäre, nur andere aus der Schusslinie brächte. An diesem Punkt begann eine gewisse Verärgerung in mir aufzukeimen. Ich beschloss, ihr, sollte ich ihr begegnen, gleich reinen Wein einzuschenken. Andererseits... Eschner eins auswischen, indem ich Schleimipunkte irgendwo ganz oben einsammelte, war auch nicht schlecht.
Der Platz vor de. »Fleur«, ein in die Jahre gekommenes kleines französisches Restaurant, war genauso runtergekommen wie alle anderen Gebäude auch. Ich befand mich im Botanikerviertel, einer Promeniermeile aus besseren Zeiten, ganz in der Nähe des Botanischen Gartens und des kleinen Kanals, der die Metropole im Norden teilt. Einige imposante restaurierte Jugendstilbrücken führen zur anderen Seite des Viertels. Dahinter liegt heute das ehemalige Studentenviertel, aufgrund der Nähe der Universität so benannt und der Tatsache, dass dort wegen der damals schon heruntergekommenen Bausubstanz billige Wohnungen zu haben waren. Inzwischen wohnten dort in enger Nachbarschaft mit imposanten Büroneubauten vor allem Sozialhilfeempfänger in städtischen Sozialwohnungen, die ihnen zugewiesen worden waren. Die ganze Gegend weist eine mindestens doppelte Dichte an Überwachungskameras aus, wie der restliche Teil der Stadt zusammengenommen. Allerdings gibt es auch hier die höchste Kriminalitätsrate der gesamten Stadt. Hier und da kreisen plötzlich Polizeidrohnen über den Plätzen, scannen alles mit Infrarotkameras, um kurz darauf blitzartig wieder zu verschwinden. Nicht gerade ein Ort, wo man gerne nachts alleine rumsteht, so wie ich jetzt. Ich hatte kaum eine Minute unschlüssig auf dem Platz gestanden, als schon eine dieser Drohnen über mir kreiste. Ich setzte mit meinem Arm-Pad meinen Code ab, worauf sie sich entfernte. Wie sollte ich Frau Montenièr hier finden? Ich schaute mich um, ob irgendwo eine ausgeflippte Person die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich zog oder in einer Ecke oder am Fuß einer Brücke eine zusammengekauerte Gestalt hockte. Fehlanzeige. Zweimal verfolgte ich eine Person, die die Gesuchte hätte sein können, sich jedoch als Prostituierte herausstellte. Die hätte aber ebensowenig hier sein dürfen. Immerhin wies diese Tatsache darauf hin, dass die staatliche Überwachung der Plätze doch nicht so lückenlos sein konnte, wie allgemein angenommen. Eine Überlegung, die die ganze Angelegenheit in ein anderes Licht rückte. Vielleicht war gar nichts Geheimnisvolles am Verschwinden der Frau, sondern die Überwachung war nur einfach lückenhaft. Dieser Gedanke beruhigte mich insofern, als die Wahrscheinlichkeit, unliebsamen Kontakt mit einer Terrorgruppe zu bekommen, etwas geringer erschien. Ein leichter Nieselregen hatte eingesetzt. Ich hatte die Nase voll, war frustriert und müde und hungrig, deshalb beschloss ich, in. »Fleur« zu gehen, um dort etwas zu mir zu nehmen.
Trotz des antiquierten Eindrucks, den das kleine Restaurant machte, öffnete sich die Tür erst, nachdem Chip und Iris gescannt waren. Drinnen umfing mich gedämpftes Lampenlicht, in dem einige wenige Holztische zu sehen waren, die in kleinen mit riesigen Tonvasen und künstlichen kalkweißen Mauern dekorierten Nischen untergebracht waren. Überall hingen Sträuße getrockneten Lavendels an den Wänden und von der Decke allerlei antikes landwirtschaftliches Gerät, welches zweckentfremdet dort angeschraubt war.
Es dauerte eine Weile bis ein runtergekommener Wirt mit Baskenmütze und schmierigem Hemd nach meinen Wünschen fragte.
»Was Kleines, bitte!«, forderte ich müde. Er stieß einen kurzen Lacher aus.
»Das findest du eher draußen!« Es dauerte eine Weile, bis ich begriff, dass er die Nutten auf dem Platz meinte. Ich lächelte verlegen.
»Ich möchte speisen, was Kleines.«
»Mon dieu, Sie befinden sich in einem französischen Restaurant, da ist alles klein, wissen Sie?«
Ich lächelte zurück. »Lassen Sie mich raten, nur die Preise sind groß?«
Er lachte kurz auf, wobei sich sein fast zahnloser Mund unter einem kleinen Schnäuzer öffnete, aus dem ein so derartig pestilenzartiger Tabakgeruch entströmte, dass ich kurz den Atem anhalten musste. Dann klopfte er mir herzhaft auf die Schulter, drehte sich um, um eine Karaffe mit einer roten Flüssigkeit auf einer Anrichte hinter sich zu ergreifen und mir wortlos auf den Tisch zu stellen.
Ich schaute ihn fragend an. »Was ist das?«
»Rotwein!«, gab er wie selbstverständlich zurück, wobei sein Blick einen stillen Triumpf ausdrückte, als er meine Überraschung bemerkte. Alkoholhaltige Getränke sind seit Langem nicht mehr legal zu bekommen!
Danach reichte er mir das Pad mit der Speisekarte. »Wenn ich etwas empfehlen dürfte, das Lamm muss noch weg«, lachte er, um danach wieder mit enthusiastischem Blick beide Hände an die Lippen zu führen. »Es ist süperb. Aber diese Trottel hier können das nicht richtig schätzen, deshalb hebe ich es für Gäste wie Sie auf.«
»Richtiges Fleisch?«, fragte ich überrascht.
Er verzog beleidigt das Gesicht. »Aber natürlich, was halten Sie von mir?«
Ich war erstaunt. Richtiges Fleisch hatte ich schon lange nicht mehr gegessen.
»Sie sind nicht von hier?«, fragte er beiläufig.
»Nicht aus diesem Viertel.«
Er nickte. »Also das Lamm?«
Ich gab mich geschlagen, weil ich mich viel zu erschöpft fühlte, es noch in einem anderen Lokal zu versuchen.
Nachdem ich die Lippenstiftspuren an dem Glas auf meinem Tisch mittels einer Ecke des Tischtuches beseitigt hatte und mich bediente, stellte ich fest, dass der Wein ausgezeichnet schmeckte.
Es dauerte allerdings gut zwei komplette Baguettebrote, die der Wirt mir reichte, um mir die Wartezeit zu verkürzen und über 30 Minuten, bis er mit einer kleinen Steingutschale zurückkehrte, in der eine winzige Portion würzig duftenden Lammfleisches neben einigen winzigen Bratkartoffelwürfeln und Bohnen ‚übersichtlich‘ dekoriert war. Darüber lag ein Rosmarinzweig, dessen Ende in einer Knoblauch-Kräuter- Paste unterging.
Ich schaute ihn fassungslos an, als er diese in der Geste eines Fünfsterne-Chefkochs vor mir plazierte.
»Fehlt etwas?«, fragte er mit gespieltem Erstaunen.
Ich zögerte. »Die Lupe?«
Er brach in ein wieherndes Gelächter aus, schlug mir wiederum mehrfach auf die Schulter und entfernte sich dann kopfschüttelnd und laut lachend.
Wider Erwarten schmeckte das Lamm köstlich, ich möchte sogar sagen, es war wohl das beste, was ich jemals gegessen hatte. Dies und die Tatsache, dass der Wein ein Übriges dazugab, verbesserte meine Stimmung erheblich. Einer plötzlichen Eingebung folgend, beschloss ich, den Wirt ins Vertrauen zu ziehen und nach Frau Montenièr zu fragen. Vielleicht kannte er sie ja zufällig?
Als er mir das Terminal reichte, um abzurechnen und ich mich überschwänglich einschließlich eines reichlichen Trinkgeldes bedankte, zeigte ich ihm das Bild von Frau Montenièr.
»Kennen Sie diese Frau vielleicht? Ich sollte mich mit ihr hier treffen.«
Er stutzte einen Moment, schaute erst das Bild, dann mich an, während sich seine Miene schlagartig verdüsterte. Dann kratze er sich geräuschvoll am Hinterkopf, wobei er seine Baskenmütze bis nach vorne in die Stirn schob. »Ne, nie gesehen!«, antwortete er schroff. »Sind Sie 'nen Bulle?«
»Nein, ein Bekannter«, log ich. Er schaute mich grimmig an und schnaubte scharf durch die Nase aus. »Ein Bekannter«, echote er, dann rief er in Richtung Küche. »Claude, hilf dem Herrn doch mal in den Mantel, der Herr möchte gehen!«
Verblüfft schaute ich zur Küchentür hinüber, aus der ein Bulle von einem Koch trat. Dessen Kittel war noch schmutziger als der Fußboden, doch sein kantiges Gesicht ließ erkennen, dass er sich nicht nur als Hilfskoch betätigte, sondern mindestens eine langjährige Karriere als Boxchampion hinter sich haben musste.
Auf ein Kopfnicken in meine Richtung durch den Chef des Hauses setzte sich dieser wortlos in meine Richtung in Bewegung.
»Entschuldigen Sie, vielleicht ist das ein Missverständnis?«, versuchte ich es.
»Hau ab!«, brummte der Riese.
»Aber, ich bitte Sie...«, weiter kam ich nicht, dann gingen bei mir die Lichter aus.
Ich wachte einige Zeit später durchnässt vom Regen mit teuflisch schmerzendem Kopf auf dem Straßenpflaster einer Seitenstraße liegend auf.
Ich brauchte einige Zeit, bis ich mich erheben konnte, weil mir schwindelte und höllisch übel war.
Als ich es schließlich geschafft hatte, mich an einer Hauswand aufzurichten, musste ich mich übergeben. Benommen blieb ich stehen, mich mit dem Arm an der Wand abstützend, bis ich wieder einigermaßen klar sehen konnte. Ich muss hier weg! Wo sind diese verdammten Polizeidrohnen, wenn man sie braucht? Benommen torkelte ich einige Schritte weit. Ich musste ein AuTaX rufen! Allerdings stellte ich fest, dass mein Arm-Pad und mein Touch-Phone fehlten und auch mein Chip verschwunden war.
Wie sollte ich jetzt mit jemandem Kontakt aufnehmen? Verzweifelt hielt ich mich an einer Laterne fest, um nicht wieder umzufallen.
Verdammte Scheiße!
Was danach kam, ist nur noch bruchstückhaft in meiner Erinnerung. Irgendwann fragte ein Frauengesicht. »Was ist mit ihm?«
»Komm da weg, Suzanne, komm da weg«, hörte ich wie aus weiter Ferne eine schroffe Männerstimme befehlen. Dann vernahm ich ein Dröhnen, später meinte ich, blinkende Lichter wahrzunehmen, bis ich schließlich in einem mäßig verdunkelten Raum aufwachte.
Dieser stellte sich als Krankenzimmer in einer Überwachungseinheit heraus. Ein Infusionsschlauch schien zu meinem linken Handgelenk zu führen, ich konnte ihn allerdings nur aus einem Auge sehen, dass linke war monströs zugeschwollen. Neben meinem Bett flimmerte ein Monitor, der jedoch stumm geschaltet war und irgendeine Soap Opera im Programm hatte.





























