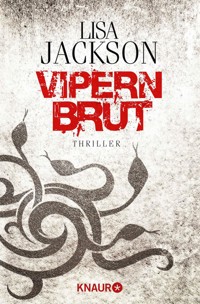
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Alvarez und Pescoli
- Sprache: Deutsch
Der neueste Fall für Detective Selena Alvarez und Regan Pescoli: In der Kleinstadt Grizzly Falls, Montana, werden mehrere Frauen vermisst. Eine der Vermissten taucht schließlich auf bizarre Weise wieder auf: nackt eingefroren in einen kunstvoll bearbeiteten Eisblock, integriert in ein Weihnachtskrippenensemble. Schon wenig später stoßen die Detectives auf die nächste Frauenleiche – positioniert als eisige Skulptur in einem Vorgarten. Schauerliches Detail: Die Tote trägt ein Schmuckstück von Selena Alvarez. Der »Eismumien-Mörder« macht Schlagzeilen. Steht die Polizistin im Visier dieses Psychopathen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 558
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Lisa Jackson
Vipernbrut
Thriller
Aus dem Amerikanischenvon Kristina Lake-Zapp
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Der neueste Fall für Detective Selena Alvarez und Regan Pescoli: In der Kleinstadt Grizzly Falls, Montana, werden mehrere Frauen vermisst. Eine der Vermissten taucht schließlich auf bizarre Weise wieder auf: nackt eingefroren in einen kunstvoll bearbeiteten Eisblock, integriert in ein Weihnachtskrippenensemble. Schon wenig später stoßen die Detectives auf die nächste Frauenleiche – positioniert als eisige Skulptur in einem Vorgarten. Schauerliches Detail: die Tote trägt ein Schmuckstück von Selena Alvarez. Der »Eismumien-Mörder« macht Schlagzeilen. Steht die Polizistin im Visier dieses Psychopathen?
Inhaltsübersicht
Prolog
Kapitel eins
Kapitel zwei
Kapitel drei
Kapitel vier
Kapitel fünf
Kapitel sechs
Kapitel sieben
Kapitel acht
Kapitel neun
Kapitel zehn
Kapitel elf
Kapitel zwölf
Kapitel dreizehn
Kapitel vierzehn
Kapitel fünfzehn
Kapitel sechzehn
Kapitel siebzehn
Kapitel achtzehn
Kapitel neunzehn
Kapitel zwanzig
Kapitel einundzwanzig
Kapitel zweiundzwanzig
Kapitel dreiundzwanzig
Kapitel vierundzwanzig
Kapitel fünfundzwanzig
Kapitel sechsundzwanzig
Kapitel siebenundzwanzig
Kapitel achtundzwanzig
Kapitel neunundzwanzig
Kapitel dreißig
Kapitel einunddreißig
Kapitel zweiunddreißig
Kapitel dreiunddreißig
Kapitel vierunddreißig
Epilog
Prolog
San Bernardino CountySechs Jahre zuvor
Was zum Teufel hat sie hier zu suchen?
Angestrengt spähte Dylan O’Keefe aus seinem ramponierten Zivilfahrzeug hinaus in die Nacht, die zusammengekniffenen Augen auf eine Gestalt geheftet, die im Schutz der Dunkelheit über das unbebaute Grundstück auf der anderen Straßenseite huschte. Wässriges, bläuliches Licht einer einzelnen Laterne an der Straßenecke erhellte eine grasüberwucherte Stelle, an der mehrere stillgelegte Fahrzeuge vor sich hin rosteten. Die Luft war dick, roch nach Abgasen und Holzfeuern, obwohl weder Verkehr herrschte noch Feuer brannten.
Doch es waren Fahrzeuge unterwegs gewesen in dieser kleinen Stadt am Fuße der Berge, und noch vor kurzem hatten hier in der Nähe des De-Maestro-Verstecks mehrere Allradwagen geparkt, wie sich unschwer an den Reifenspuren erkennen ließ.
Der Boden war trocken und staubig, obwohl es Dezember war, ertragsarm, unbedeutend für die Landwirtschaft, die Stadt eine Geisterstadt, zum Großteil verlassen, nachdem das Gold in den umliegenden Hügeln im vergangenen Jahrhundert abgebaut worden war. Lediglich eine Handvoll Bewohner nannten diese Gegend noch ihr Zuhause. Doch es war offensichtlich, dass jemand in dem heruntergekommenen Bungalow mit dem durchhängenden Dach und dem schmutzigen Putz wohnte. Die verrottete Veranda war repariert worden, der Krempel im Garten – Kinderspielzeug und Weihnachtsdekoration – diente zweifelsohne als Fassade, damit das Haus zur Nachbarschaft passte und es so aussah, als würde eine Familie darin leben.
Doch das war nichts als Tarnung.
Die gleich auffliegen würde.
Nur dass jetzt, mitten während der Observierung – die sicherstellen sollte, dass sich tatsächlich Alberto De Maestro in diesen schmuddeligen vier Wänden befand –, eine Gestalt durch die Dunkelheit schlich, eine Gestalt, die, so erkannte er jetzt, niemand anders war als Detective Selena Alvarez. Plötzlich drohte die gesamte Operation, mit der er seit über sechzehn Monaten befasst war, aus dem Ruder zu laufen.
Verdammt!
»Siehst du sie?«, flüsterte er seinem Partner zu.
»Hmmhmm.« Rico, wie immer eher verhalten, nickte langsam, ohne den Blick von dem unbebauten Grundstück zu wenden. Im Licht der Taschenlampe bemerkte O’Keefe einen glänzenden Schweißfilm auf seinem Gesicht.
»Das darf doch nicht wahr sein!«
»Bleib ruhig.« Doch auch Ricos Nerven waren zum Zerreißen gespannt, als Selena über den durchhängenden Zaun zwischen den beiden Grundstücken kletterte. Jetzt war sie schon drüben bei De Maestro und schlich auf den heruntergekommenen Bungalow zu. Die Weihnachtsbeleuchtung im Garten spendete nicht viel Licht, da der Großteil der Lämpchen durchgebrannt war, genau wie bei der Lichterkette, die um den Stamm einer einzelnen Palme geschlungen war.
O’Keefe griff nach oben, stellte die Innenbeleuchtung des Zivilfahrzeugs an und öffnete die Beifahrertür.
»Warte! Was tust du da?«, fragte Rico, doch O’Keefe kümmerte sich nicht um seine Einwände. Eilig stieg er aus und blieb mit gezogener Dienstwaffe auf dem rissigen Asphalt stehen. Er musste zu ihr, musste sie zurückpfeifen.
Das Ganze lief aus dem Ruder, ging völlig daneben.
Wenn De Maestro Wind davon bekam, dass sie da draußen war …
Lautlos überquerte er die Straße, nahm den Wind wahr, der über den Asphalt strich und trockene Blätter und Plastikmüll an den wenigen Autos vorbeitrieb, die hier parkten. Ein Hund, in einem der dunklen Höfe angekettet, fing plötzlich an, wie verrückt zu bellen.
Alvarez blieb trotzdem nicht stehen.
Geh nicht weiter!, flehte er stumm und spürte, wie Panik in ihm aufstieg. Was dachte sie sich nur dabei? Warum war sie hier? Der Hund begann zu heulen. Dreh um! Das ist doch Wahnsinn …
Wumm! Eine Seitentür flog auf.
»Schnauze!«, brüllte ein Mann, die dunklen Umrisse seines Körpers hoben sich gegen den Lichtschein aus dem Innern des Bungalows ab. O’Keefe sah, dass er eine Waffe in der Hand hielt. Alberto De Maestro. Ziel der Undercoveroperation. Dreh- und Angelpunkt des De-Maestro-Drogenkartells. Da stand er, leibhaftig!
Nein!
O’Keefes Herzschlag dröhnte in seinen Ohren.
Ein weiterer Mann erschien in der Tür; anscheinend versuchte er, De Maestro zur Vernunft zu bringen, ihn zurück ins Haus zu zerren, doch De Maestro war größer, kräftiger und rührte sich nicht vom Fleck. Der Hund beruhigte sich. Irgendwo in der Ferne heulte eine Sirene. Er drehte sich um und blickte direkt in Alvarez’ Gesicht.
Ein Lächeln, finster wie die Hölle, trat auf seine Lippen, weiße Zähne blitzten in der Dunkelheit auf. De Maestro hob die Waffe. »Perra«, sagte er und zielte.
Alvarez erstarrte.
Zu spät.
Mit erhobener Pistole stürmte O’Keefe los und schrie: »Waffe fallen lassen! Polizei! Policía! Alberto De Maestro, lassen Sie die Waffe fallen!«
»Du kannst mich mal!« Blitzschnell wirbelte De Maestro herum und richtete die Waffe auf O’Keefe. Sein bösartiges Grinsen wurde noch breiter. Der Teufel höchstpersönlich. »Feliz Navidad, bastardo! – Frohe Weihnachten!«
Und mit diesen Worten drückte er ab.
Kapitel eins
Ihre Haut nahm eine bläuliche Färbung an.
Ihr Fleisch wurde starr – was perfekt war.
Ihre Augen blickten durch das Eis nach oben, obwohl sie nichts mehr sahen, leider, denn so würde sie nicht zu würdigen wissen, wie viel Liebe, Hingabe und Überlegung er in sein Werk steckte.
Ihr Atem brachte das Eis über ihrer Nase nicht länger zum Schmelzen, auch ihr Mund blieb zum Glück geschlossen, die perfekten Lippen, nunmehr von einem dunkleren Blau … wie Schneewittchen, dachte er, nur nicht in einem gläsernen Sarg, sondern in einem Sarg aus Eis. Sorgfältig verteilte er einen weiteren Eimer Wasser über die gefrorene Schicht.
Eiskristalle bildeten sich über ihrem nackten, jugendlichen Körper, glitzerten und funkelten im gedämpften Licht seiner Höhle.
Es sah schön aus.
Wunderschön.
Perfekt.
Tot.
Summend fing er an zu meißeln. Aus dem batteriebetriebenen Radio ertönte Weihnachtsmusik und erfüllte sein ganz privates, geheimes Refugium. Er arbeitete sorgfältig, genau bis ins kleinste Detail. Perfektion, das war sein Ziel. Absolute Perfektion würde er erreichen.
Die Temperatur in seiner unterirdischen »Werkstatt« lag konstant bei minus 1,1 Grad Celsius, knapp unter dem Gefrierpunkt; sein Atem bildete bei der Arbeit weiße Wölkchen. Obwohl gerade ein Schneesturm über diesen Teil der Bitterroot Mountains hinwegfegte, war die Luft hier unten, tief in den Höhlen, unbewegt; nicht der kleinste Luftzug war zu spüren.
Er trug einen Neoprenanzug, Handschuhe, Stiefel und eine Skimaske, auch wenn er sich insgeheim wünschte, nackt zu arbeiten. Es wäre herrlich zu spüren, wie ihm die Kälte ins Fleisch schnitt, sich lebendiger zu fühlen, doch das würde warten müssen. Er durfte nicht leichtsinnig werden, durfte nicht zulassen, dass ein winziger Hautpartikel, ein Haar oder auch nur ein Schweißtropfen sein Werk beeinträchtigte.
Doch es ging nicht nur um die perfekte Schönheit, es gab auch noch das Problem mit der DNA, sobald die Polizei sich einschaltete. Lange würde das nicht mehr dauern, denn sein Kunstwerk war beinahe fertig. Hier noch ein bisschen schnitzen, dort noch ein bisschen schleifen.
»Oh, the weather outside is frightful«, sang er zur Musik mit. Seine Stimme hallte durch die durch Gänge miteinander verbundenen Höhlen, die tief unten in den Gebirgsausläufern der Bitterroot Mountains versteckt lagen. Eine natürliche Quelle lieferte ihm das Wasser, das er für seine Arbeit brauchte, batteriebetriebene Lampen spendeten bläuliches Licht. Wenn er es heller haben wollte, schaltete er zusätzliche Scheinwerfer an.
Weiter hinten in der riesigen Höhle ertönte ein jämmerliches Wimmern. Er runzelte die Stirn. Warum starb diese Frau nicht endlich? Er hatte ihr eine Dosis Beruhigungsmittel verabreicht, die einen Elefanten umgehauen hätte, und trotzdem schwankte sie noch immer zwischen Leben und Tod. Stöhnte. Mit gefurchten Augenbrauen schlug er den Hammer auf den Meißel, der rutschte ab und schnitt durch den Handschuh in den Finger. »Verdammt!« Ein einzelner Blutstropfen rollte über das Eis und gefror. Anstatt ihn wegzuwischen, meißelte er die Stelle aus, um sicherzugehen, dass sein perfektes Kunstwerk nicht ruiniert wurde.
Als er damit fertig war, schwitzte er. »Hab Geduld«, schärfte er sich ein, als er die Kerbe vorsichtig, nach und nach, mit klarem Wasser aus der Quelle füllte, um den Makel unsichtbar zu machen.
»Perfekt«, murmelte er, endlich zufrieden.
Er blickte auf sein Kunstwerk hinab, betrachtete die nackte Frau, umschlossen von Eis, dann beugte er sich vor, gerade so weit, um ihr über eine eisige Brustwarze zu lecken. Seine Zunge kribbelte, die Kälte im Mund bereitete ihm pure, heiße Lust, und er malte sich aus, wie er seinen Körper an ihrem eiskalten Fleisch reiben würde. Sein Schwanz zuckte.
Er glitt mit der Zunge über das Eis, stellte sich ihren salzigen Geschmack vor, nahm ihre harte Brustwarze in den Mund. Er wollte seine Zähne darin versenken, nur ein wenig, bis sich Lust und Schmerz vermischten. Seine Phantasie entlockte ihm ein leises Stöhnen.
Vor seinem inneren Auge sah er eine weitere schöne Frau, deren Haar ungebändigt hinter ihr herwehte, während sie lief, lachend, ihre Stimme hallte durch den Winterwald. Die schuppigen Stämme der Kiefern waren voller Schnee, zwischen den langen Nadeln hingen dünne Eiszapfen.
Er rannte durch den dicken Pulverschnee, jagte ihr hinterher, sah erregt zu, wie sie ihre Kleidung abwarf, Stück für Stück, Mantel, Bluse, Rock, Schal, bis sie in BH und Höschen dastand und wieder vor ihm davonlief.
Bald schloss er zu ihr auf und fing an, seine eigene Kleidung abzustreifen, Stiefel, Jacke, Jeans, dann fummelte er mit klammen Fingern an den Knöpfen seines Hemds, die sich nur schwer öffnen ließen. Der Abstand zu ihr wurde größer, und er musste angestrengt rennen, um sie einzuholen.
Er malte sich aus, was er mit ihr anstellen würde, wie er in sie stoßen, den vom Himmel rieselnden Schnee auf ihrer nackten Haut zum Schmelzen bringen würde.
Doch er hielt sein Messer in der Hand. Das Messer mit dem Griff, der aus dem Geweih des Hirsches gefertigt war, den er vor drei Jahren getötet hatte. Er erinnerte sich genau daran, wie er das Tier erlegt hatte, mit einem einzigen Pfeil …
Jetzt hatte er sie fast eingeholt … sein Herz pochte, seine Finger schlossen sich um den Griff des Messers.
Sie wirbelte herum, als er nur noch einen halben Schritt hinter ihr war, ihre Augen glänzten wie zwei Eiskristalle, die Wangen leuchteten gerötet von der frostigen Winterluft. Ein neckisches Lächeln umspielte ihre perfekten Lippen. Lippen wie die eines Engels.
Dann sah sie das Messer.
Ihr Lächeln verblasste. In ihrem schönen Gesicht spiegelte sich Erschrecken, dann Entsetzen wider. Sie stolperte, stürzte beinahe, dann lief sie weiter, schneller als zuvor, wobei sie noch mehr Schnee aufwirbelte. Jetzt hatte ihre Flucht nichts Spielerisches mehr, jetzt rannte sie aus nackter Angst.
Mit geblähten Nasenflügeln nahm er die Verfolgung auf, war mit ein paar Schritten bei ihr, bekam mit der freien Hand ihr offenes Haar zu fassen und dann …
Verschwommen.
Alles, woran er sich erinnerte, war die Wunde, aus der warmes rotes Blut auf den blendend weißen Schnee spritzte.
Nein! Abrupt kehrte er in die Gegenwart zurück. Er durfte es nicht zulassen, dass ihn derlei Gedanken von der Arbeit ablenkten.
Das Eis um die Brustwarze schmolz in seinem Mund. Seine Erektion war nun steinhart und drückte gegen den engen Neoprenanzug. Er richtete sich auf und verspürte einen Anflug von Abscheu wegen seiner Schwäche. Mit aller Kraft zwang er seinen stets bereiten Schwanz, wieder abzuschwellen.
Was war nur in ihn gefahren?
Er blickte auf die nackte Frau hinab und betrachtete die Stelle, an der sein Mund das Eis geschmolzen und jede Menge DNA-Spuren hinterlassen hatte. Das war nicht klug, ganz und gar nicht, und bestimmt nicht das, was man von einem Menschen mit dem IQ eines Genies erwartete.
Rasch fing er an, auch diesen Fleck aus dem Eis zu meißeln.
Im hinteren Teil der Höhle fing die Schlampe erneut an zu stöhnen. Er biss die Zähne zusammen. Sie würde noch früh genug sterben, und ihr makelloser Körper würde keinerlei Anzeichen von Gewaltanwendung aufweisen, kein Hämatom, keine Schnittwunde, nichts. Dann würde er auch sie in einen eisigen Sarg stecken und ein weiteres perfektes Kunstwerk erschaffen.
Ein Blick auf die Armbanduhr sagte ihm, dass ihm noch genug Zeit blieb, um die begonnene Arbeit zu Ende zu bringen. Seine Frau erwartete ihn nicht vor einer Stunde zurück. Jede Menge Zeit.
Er holte Wasser aus der Quelle und goss es über sein Werk. Es ist noch nicht ganz fertig, dachte er, als er in die weit aufgerissenen Augen der eingefrorenen Frau blickte.
Doch es würde nicht mehr lange dauern.
Dankbar, dass das Stöhnen aus dem hinteren Teil der Höhle endlich verstummt war und er sich wieder konzentrieren konnte, schöpfte er wieder und wieder Wasser, wobei er leise das Lied im Radio mitsang: »Let it snow, let it snow …«
»… let it …« Klick!
Selena Alvarez drückte auf die Schlummertaste ihres Radioweckers, dann stellte sie ihn, ohne zu überlegen, ganz aus und rollte sich aus dem Bett. Mein Gott, sie hasste das Lied. Überhaupt hatte sie mit Weihnachten rein gar nichts am Hut.
Und das hatte seine Gründe.
Nicht, dass sie jetzt wieder darüber nachdenken wollte.
Das wollte sie nie.
Obwohl es draußen noch stockdunkel war, teilte ihr die leuchtend rote Digitalanzeige mit, dass es halb fünf war, die Zeit, zu der sie für gewöhnlich aufstand und langsam in Fahrt kam. Die meiste Zeit des Jahres nahm sie jeden einzelnen Tag in Angriff, als stellte er eine besondere Herausforderung dar, doch sobald sich der Herbst dem Ende näherte und der November in den Dezember überging, verspürte sie den ewig gleichen Überdruss, der die Vorweihnachtszeit begleitete, die mangelnde Begeisterung, die ihr die Kraft raubte und ihre Stimmung trübte. Im Winter schwand ihre übliche Ich-stelle-mich-dem-Leben-Haltung, und sie musste sich doppelt zusammenreißen, um sich nicht hängen zu lassen.
»Dummkopf«, murmelte sie und streckte sich.
Sie kannte natürlich den Grund für diesen alljährlichen Stimmungswechsel, doch sie sprach nie darüber, nicht einmal mit ihrer Partnerin. Schon gar nicht mit ihrer Partnerin. Pescoli würde sie doch nicht verstehen.
Und Alvarez würde jetzt ganz bestimmt nicht darüber nachdenken.
Der Welpe, den sie vor kurzem zu sich genommen hatte, eine Mischung aus Schäferhund und entweder Boxer oder Labrador, regte sich in seinem verschließbaren Hundekorb, streckte sich und bellte, um herausgelassen zu werden, während ihre Katze, Mrs. Smith, die stets auf dem zweiten Kopfkissen in Selenas Bett schlief, den Kopf hob und blinzelte.
Der Hund bellte und winselte lauter, dann jaulte er aufgeregt, als wollte er sagen: »Nun lass mich endlich raus, ich habe ein dringendes Geschäft zu erledigen!« Der Kleine zeigte genau die Begeisterung, die Alvarez gerade fehlte.
»He, du weißt, dass du das nicht darfst«, tadelte sie den Welpen, dann öffnete sie das Gitter seines Hundekorbs und ließ ihn heraus. Sofort fing er an, bellend um sie herumzuspringen, trotz ihrer Bemühungen, ihn im Zaum zu halten. »Nein, Roscoe! Aus! Sitz!« Er stürmte die Treppe hinunter ins Wohnzimmer ihres Reihenhauses, dicht gefolgt von seiner Herrin und der Katze. Unten angekommen, umkreiste er Couch und Couchtisch, dann rannte er schwanzwedelnd zur Terrassentür.
Alvarez sah zu Mrs. Smith hinüber, die unterdessen auf ein Regal gesprungen war und die ganze Szene mit katzenhafter Verachtung beobachtete. »Ja, ich weiß. Du musst mir das nicht extra unter die Nase reiben!« Sekunden später ließ sie den Hund in ihren kleinen, umzäunten Garten, wo er sofort in den dunkelsten Ecken verschwand, um zweifelsohne das Bein an jedem Baum, Busch und Pfosten zu heben, den er finden konnte. Es schneite immer noch, stellte sie fest, als sie rasch die Schiebetür schloss, um die Kälte draußen zu lassen, die unangenehm durch ihren Flanellschlafanzug zog. Durch die Scheibe sah sie, dass die Töpfe mit den größeren Pflanzen, die sie auf der Terrasse stehen gelassen hatte, mit einer zehn Zentimeter hohen Schneeschicht bedeckt waren, auch auf dem Rasen lag eine unberührte weiße Decke – ein friedlicher Anblick, bis Roscoe hineinsprang und alles zerwühlte.
Doch Schnee brachte ihr ohnehin weder Ruhe noch Frieden.
Roscoe aufzunehmen war eine überstürzte Entscheidung gewesen, zumal sie das Reihenhaus gerade erst gekauft hatte, doch jetzt war es zu spät – der lebenslustige Welpe hatte längst einen ganz besonderen Platz in ihrem Herzen erobert.
Trotz seiner Schwächen.
»Zum Heulen!«, murmelte sie.
Roscoe sprang zurück auf die kleine Betonfläche ihrer Terrasse und kratzte an der Scheibe. Sie öffnete die Schiebetür ein Stückchen, und er versuchte, sich durch den Spalt ins Wohnzimmer zu zwängen, doch sie erwischte ihn am Halsband. »Kommt gar nicht in Frage, Kumpel«, brummte sie, schnappte sich das Handtuch, das sie zu diesem Zweck an den Fenstergriff gehängt hatte, und putzte ihm die mächtigen Pfoten ab, bevor sie ihn hineinließ.
Momentan ging sie nur selten ins Fitnessstudio; stattdessen joggte sie mit dem Hund, um ihn auszupowern, dann nahm sie eine Dusche, zog sich an und ließ ihn so lange im Hauswirtschaftsraum. Das war keine optimale Lösung, doch sobald er ganz stubenrein wäre, würde sie eine Hundeklappe einbauen lassen und die Nachbarin bitten, am Nachmittag mit ihm Gassi zu gehen. In letzter Zeit blieb sie abends nicht mehr lange im Department, nahm die Arbeit lieber mit nach Hause.
Was an und für sich eine gute Sache war.
Leider führte es ihr nur noch deutlicher vor Augen, dass sie außer ihren Haustieren niemanden hatte, der zu Hause auf sie wartete.
Nicht dass sie es während des vergangenen Jahres nicht versucht hätte, sie hatte sich sogar ein paarmal verabredet, war mit Kevin Miller ausgegangen, einem Pharmavertreter, der in seiner Freizeit häufig ins Fitnessstudio ging und ständig über seine Arbeit redete. Er hatte sie zu Tode gelangweilt. Auch mit Terry Longstrom hatte sie sich getroffen. Terry war Psychologe und arbeitete mit jugendlichen Straftätern; er hatte sie ein paarmal ausgeführt, doch obwohl er sehr nett war, fühlte sie sich einfach nicht zu ihm hingezogen, und so tun, als ob es anders wäre, wollte sie auch nicht. Am schlimmsten war es mit Grover Pankretz gewesen. Er hatte früher im ortsansässigen DNA-Labor gearbeitet, doch als die Firma schrumpfte, war seine Stelle gestrichen worden. Grover war ein geistreicher Mann, doch von Anfang an für ihren Geschmack viel zu besitzergreifend. Schon beim zweiten Date wollte er etwas Festes, deshalb hatte sie das Ganze beendet, noch bevor es richtig beginnen konnte. Zum Glück waren all diese Männer weitergezogen, entweder in eine andere Gegend oder zu anderen Frauen. Terry und Grover, so war ihr zu Ohren gekommen, hatten geheiratet.
Die Wahrheit war simpel: Sie war einfach nicht bereit für eine ernsthafte Beziehung, wie ihre alberne Schwärmerei für den älteren, unerreichbaren Dan Grayson bewiesen hatte, der rein zufällig ihr Boss war. Typisch.
»Gib’s zu«, sagte sie zu sich selbst, »im Grunde willst du gar keinen Mann in deinem Leben.«
Nachdem sie ihre morgendliche Routine hinter sich gebracht hatte, machte sie sich auf den Weg zum Büro des Sheriffs auf dem Boxer Bluff. Grizzly Falls war im Grunde zweigeteilt: Eine Hälfte des städtischen Lebens spielte sich oben auf dem steilen Hügel ab, an dessen Hängen die besser Betuchten ihre großzügigen Anwesen errichtet hatten, die andere unten, entlang des Flusses. Die spektakulären Wasserfälle, die der Stadt ihren Namen gaben, stürzten sich tosend vom Boxer Bluff in die Tiefe.
Der Verkehr hügelaufwärts staute sich an den üblichen Stellen und wurde zusätzlich durch einen querstehenden Wagen kurz vor dem Bahnübergang behindert. Die ganze Zeit über schneite es, und sie musste die Scheibenwischer auf Stufe zwei schalten, um die Windschutzscheibe frei zu halten.
Mein Gott, wie sie diese Jahreszeit hasste!
Es hatte den Anschein, als ginge die Vorweihnachtszeit hier in Grizzly Falls stets mit irgendwelchen Katastrophen einher. Trotz der Weihnachtskränze an den Türen, der festlich geschmückten Tannen und Fenster, ganz zu schweigen von der Dauerberieselung mit Weihnachtsliedern, die sämtliche Radiosender rund um die Uhr zu spielen schienen, lauerte Unheil im Schatten dieser lichterglänzenden Fröhlichkeit. Die Fälle von häuslicher Gewalt nahmen rapide zu, und in den letzten Jahren waren einige durchgeknallte Serienkiller dazugekommen, welche die Einheimischen in Angst und Schrecken versetzt hatten.
Nicht gerade eine Zeit des Friedens und der Freude.
Abschnittweise war es ziemlich glatt, doch Alvarez’ zehn Jahre alter Subaru Outback schraubte sich mühelos die vereisten Straßen hinauf. Auch der Wagen, sie hatte ihn gebraucht günstig bekommen, war neu in ihrem Leben. Dennoch wusste sie natürlich, dass selbst alle Autos und Reihenhäuser der Welt nicht die Leere in ihrem Innern würden füllen können. Die Haustiere waren ein Schritt in die richtige Richtung, dachte sie, als sie auf den Parkplatz des Departments einbog. Die Katze, deren Besitzerin einem teuflischen Mörder zum Opfer gefallen war, hatte sie vergangenes Jahr im Zuge der Ermittlungen zu sich genommen, doch der Welpe war eine spontane, unüberlegte Entscheidung gewesen.
Was hatte sie sich bloß dabei gedacht?
Vielmehr: Was hatte sie nicht bedacht?
Sie hatte ganz bestimmt nicht damit gerechnet, dass Roscoe auf den Teppich pinkeln oder ihre Möbel anknabbern würde, ganz zu schweigen von den Tierarztrechnungen. Nein, sie hatte nur ein warmes, kuscheliges Knäuel gesehen, mit glänzenden Augen, einer feuchten Nase und einem Schwanz, der nicht aufhörte zu wedeln, als sie dem örtlichen Tierheim einen Besuch abstattete.
»Albern«, murmelte sie und hielt vor dem Büro des Sheriffs an, doch sie konnte ein Grinsen nicht unterdrücken. Sie hatte gedacht, Roscoe würde sie schützen, Einbrecher verjagen.
Ach ja? Und warum hast du dann das Gefühl, jemand wäre letzte Woche in deinem Haus gewesen, auch wenn du nicht genau beschreiben kannst, warum? Wo war Roscoe, der Wachhund, da?
Vermutlich täuschte sie sich, spielten ihre Nerven verrückt, weil sie Neil Freeman vernommen hatte, einen Psychopathen, der seine Augen während des gesamten Verhörs unablässig über ihren Körper hatte gleiten lassen, dabei hatte sie ihn zum Tod seiner Mutter befragt … Es stellte sich heraus, dass diese eines natürlichen Todes gestorben war, doch sein Gehabe und die Art, wie er jede Antwort in schlüpfrige Anspielungen verwandelt hatte, wie er sich mit der Zunge über die Lippen gefahren war, war ihr ziemlich an die Nieren gegangen. Was er vermutlich beabsichtigt hatte. Perverser Fiesling!
Sie redete sich ein, dass Freeman nicht in ihrem Haus gewesen war, und wenn doch, dann hätte Roscoe ihr das schon irgendwie mitgeteilt.
Und wie sollte er das, bitte schön, tun? Mach dir doch nichts vor, Alvarez, du wirst langsam, aber sicher eine von diesen typischen, durchgeknallten Hundefreunden und Katzennarren. Der Gedanke ließ sie erschaudern.
Ja, sie liebte diesen Hund, und vielleicht war Roscoe genau das, was sie brauchte. Auf keinen Fall würde sie ihn wieder hergeben.
Während sie ausstieg, den Wagen absperrte und im Schneegestöber aufs Gebäude zueilte, wandten sich ihre Gedanken den vor ihr liegenden Wochen zu. Im Büro würde die alljährliche Weihnachtsfeier stattfinden, und Joelle Fisher, die Empfangssekretärin mit ihrem Weihnachtswahn, würde wie jedes Jahr das gesamte Department in ein Weihnachtswunderland verwandeln und über nichts anderes mehr reden als über die Wichtelaktion. Alvarez konnte keine Begeisterung dafür aufbringen; sie wusste, dass während der Feiertage jede Menge Überstunden auf sie zukämen. Das war für sie an Weihnachten Tradition: Sie arbeitete, damit die Kollegen mit Familie zu Hause bleiben konnten.
So war es leichter.
Auf der Schwelle des Hintereingangs klopfte sie den schmelzenden Schnee von den Stiefeln, trat ein und machte einen Abstecher zum Aufenthaltsraum, wo sie stirnrunzelnd feststellte, dass noch niemand Kaffee gekocht hatte. Widerwillig setzte sie eine Kanne auf, dann begab sie sich auf die Suche nach ihrer Lieblingstasse, erhitzte Wasser in der Mikrowelle und nahm sich den letzten Beutel Orange Pekoe.
Auf dem Tisch stand eine offene knallrosafarbene Schachtel, in der ein paar übrig gebliebene Plätzchen lagen. Alvarez beschloss, diese vorerst zu ignorieren – um diese Jahreszeit schleppte Joelle nahezu stündlich frische Leckereien an.
Sie nahm ihren Schal ab und machte sich auf den Weg zu ihrem Schreibtisch, verstaute Handtasche und Dienstwaffe und hängte ihre Jacke an den Garderobenhaken. Anschließend ging sie ihre Post und E-Mails durch, hörte den Anrufbeantworter ab, vergewisserte sich, dass sämtliche Berichte zu einem Fall, an dem sie gerade arbeitete, abgeheftet waren, dann wandte sie sich einem weiteren zu und sah nach, ob der Obduktionsbericht zu Len Bradshaw eingegangen war, ein einheimischer Farmer, der bei einem Jagdunfall ums Leben gekommen war. Sein Freund, Martin Zwolski, war mit ihm unterwegs gewesen, und während er sich durch einen Stacheldrahtzaun hindurchgezwängt hatte, war seine Waffe losgegangen. Die Kugel hatte Len in den Rücken getroffen und tödlich verletzt.
Unfall oder vorsätzliche Tötung?
Alvarez glaubte an die Unfallversion. Martin war in Tränen aufgelöst gewesen, umringt von Lens Freunden und Familie. Alles sprach zwar für einen Unfall, doch sie war nicht hundertprozentig überzeugt, nicht, solange die Ermittlungen noch liefen. Es gab drei lose Enden, die sie an Martins Geschichte zweifeln ließen.
Zunächst einmal hatten die beiden Männer auf Privatbesitz gewildert, keiner von ihnen hatte eine Jagderlaubnis für Rotwild besessen, außerdem hatten sie gemeinsam einen Landwirtschaftshandel betrieben. Das Geschäft war vor zwei Jahren pleitegegangen, hauptsächlich deshalb, weil sich Len einen Großteil der Einkünfte »geborgt« hatte. Es kursierten auch Gerüchte, nach denen Len früher einmal etwas mit Martins Frau gehabt haben sollte. Martin und Ezzie lebten zu der Zeit zwar bereits getrennt, trotzdem … Das Ganze war für Alvarez’ Geschmack ein kleines bisschen zu chaotisch.
Sie ging ihre E-Mails durch.
Noch immer kein Obduktionsbericht.
Vielleicht später. Sie überflog die Angaben zu den vermissten Personen, um herauszufinden, ob man Lissa Parsons gefunden hatte.
Selena kannte sie aus dem Fitnessstudio, hatte gemeinsam mit ihr mehrere Kurse besucht. Lissa, eine Sechsundzwanzigjährige mit kurzen schwarzen Haaren und einem Wahnsinnskörper, arbeitete als Rezeptionistin in einer ortsansässigen Anwaltskanzlei und war vor einer Woche als vermisst gemeldet worden. Als die Detectives nachhakten, stellte sich heraus, dass Lissa schon länger nicht mehr gesehen worden war. Ihr Freund und sie hatten eine schwere Zeit hinter sich, und er hatte beschlossen »dass sie etwas Abstand bräuchten«. Ihre Mitbewohnerin war vor einigen Wochen zu einer ausgedehnten Floridareise aufgebrochen und hatte bei ihrer Rückkehr eine leere Wohnung mit vergammelnden Bioprodukten im Kühlschrank vorgefunden. Lissas Handtasche, ihr Handy, Auto und Laptop waren ebenfalls verschwunden, doch in ihrem Schrank fehlte nichts; sämtliche Kleidungsstücke hingen auf Bügeln oder lagen ordentlich zusammengefaltet in den Fächern, der Wäschekorb im Schlafzimmer war voller verschwitzter Sportsachen.
Die Mitbewohnerin, der Freund und ein Ex-Freund hatten absolut wasserdichte Alibis. Es gab keinerlei Hinweise auf ein gewaltsames Eindringen in die Wohnung oder auf einen Kampf. Alles sah so aus, als hätte Lissa das Apartment für den Tag verlassen, um am Abend dorthin zurückzukehren. Nach ihrem Verschwinden hatte sie weder mit ihrem Handy telefoniert noch ihre Kreditkarte benutzt.
Alvarez gefiel das absolut nicht. Vor allem nicht die Tatsache, dass sie offenbar seit rund zwei Wochen wie vom Erdboden verschluckt war. Das war nicht gut. Gar nicht gut.
Und es sah ganz danach aus, dass es noch immer keine Spur von ihr gab.
Keine Leiche. Keinen Tatort. Kein Verbrechen.
Noch nicht.
Verdammt.
Man hatte sämtliche umliegenden Krankenhäuser überprüft, doch Lissa Parsons war nicht eingeliefert worden, auch keine unbekannte Frau. Nachfragen bei weiteren Behörden führten ebenfalls zu keinem Ergebnis.
Sie war einfach … verschwunden.
»Wo zum Teufel steckst du?«, fragte Alvarez laut und nahm einen Schluck von ihrem jetzt schon abgekühlten, aber noch lauwarmen Tee. Sie rechnete frühestens in einer Stunde mit ihrer Partnerin, doch erstaunlicherweise tauchte Regan Pescoli heute früher als üblich im Büro auf, einen Pappbecher Kaffee aus einem der auf dem Weg liegenden Coffeeshops in der Hand, das Gesicht gerötet, schmelzende Schneeflocken in den mühsam gebändigten roten Locken.
»Was tust du denn hier – um diese Uhrzeit?« Alvarez wirbelte auf ihrem Schreibtischstuhl herum und blickte ihre Partnerin fragend an. »Ist jemand gestorben?«
»Sehr komisch.« Pescoli nahm einen Schluck Kaffee aus dem Pappbecher. »Ich musste Bianca wegen ihres Tanztrainings früher an der Schule absetzen.« Bianca war Pescolis sechzehnjährige Tochter, die die Highschool besuchte und so eigensinnig wie schön war. Eine gefährliche Kombination, zudem war es nicht gerade förderlich, dass das Mädchen seine getrennt lebenden Eltern geschickt gegeneinander auszuspielen wusste. Was jedes Mal funktionierte. Obwohl Pescoli und ihr Ex seit Jahren geschieden waren, herrschte zwischen ihnen noch immer jede Menge Feindseligkeit, vor allem wenn es um die Kinder ging. Bianca und ihr älterer Bruder Jeremy, ein Dann-und-wann-College-Student, der zwischen seinen wiederholten Versuchen, auszuziehen und auf eigenen Beinen zu stehen, immer wieder Regans Wohnung belagerte, rieben sie beide auf.
»Ich dachte, die Tanztruppe würde nach der Schule üben.«
»Dann ist die Sporthalle belegt.« Pescoli blickte aus dem Fenster. »Basketball, Ringen, die Cheerleader, die Tanztruppe … was auch immer, alle beanspruchen die Halle für sich, und momentan hat meines Wissens Basketball oberste Priorität. Also muss Bianca in den beiden kommenden Wochen um sechs Uhr fünfundvierzig in der Schule sein. Das bedeutet, dass sie um sechs aufstehen muss, was sie fast umbringt, wie du dir sicher vorstellen kannst.« Pescolis Lippen verzogen sich zu einem schmalen Lächeln bei dem Gedanken an den allmorgendlichen Kampf ihrer Tochter. »Und das ist erst Tag eins. Es ist wirklich sehr hart, eine Prinzessin zu sein, wenn man zu solch nachtschlafender Stunde aus den Federn muss, ›wenn jeder, der halbwegs bei Verstand ist, im Bett liegt‹.« Sie schüttelte den Kopf. »Ich sage dir, wir ziehen eine Generation von Vampiren groß!«
»Vampire sind gerade total angesagt.«
»Da soll mal einer schlau draus werden!« Sie wurde ernst und deutete auf das Foto von Lissa Parsons, das gerade auf dem Monitor von Alvarez’ Computer zu sehen war. »Ist der Obduktionsbericht im Bradshaw-Fall reingekommen?«
»Noch nicht.«
Pescoli furchte die Augenbrauen. »Du weißt, dass ich Zwolski die Sache mit dem Unfall wirklich gern glauben würde, aber es will mir einfach nicht gelingen.«
»Das verstehe ich.«
»Irgendetwas passt da nicht ins Bild. Gibt es Neuigkeiten im Fall der vermissten Lissa Parsons?«
»Noch nicht.«
»Mist.« Pescoli nahm einen weiteren Schluck. »Schwer zu sagen, was da los ist«, überlegte sie laut. »Ein flatterhaftes Mädchen, das sich für eine Weile aus dem Staub gemacht hat, oder steckt mehr dahinter?« Offenbar gefiel ihr Letzteres gar nicht, denn die Furchen zwischen ihren Brauen vertieften sich. »Was ist mit ihrem Wagen?«
»Keine Ahnung. Ich gehe gleich mal rüber in die Vermisstenabteilung und rede mit Taj, mal sehen, ob sie was Neues weiß.«
»Sag mir Bescheid.« Pescoli wandte sich gerade zum Gehen, als das vertraute Klackern von High Heels ihre Aufmerksamkeit erweckte. Klick, klick, klick.
»Tüt, tüt! Ich komme!«, warnte Joelle mit ihrer Kleinmädchenstimme. Alvarez erspähte die zierliche Empfangssekretärin, die mehrere aufeinandergestapelte Plastikdosen in Richtung Aufenthaltsraum trug. Heute hatte sie ihre platinblonden, toupierten Löckchen mit rotem und grünem Glitzerspray verschönert, ihre Schneemannohrringe funkelten im grellen Neonlicht.
»Frühstück«, bemerkte Pescoli. »Komm, ich besorge dir einen Kaffee.«
Zusammen folgten sie dem übereifrigen Dynamo, der erst zufrieden zu sein schien, wenn jeder Quadratzentimeter der Polizeistation weihnachtlich dekoriert war. Papierschneeflocken, besprüht mit silbernem Glitzer, hingen von der Decke, künstliche Tannengirlanden schlängelten sich durch die Flure, ein rotierender Weihnachtsbaum verschönerte den Empfangsbereich, und selbst das Kopiergerät war mit einer roten Samtschleife verziert. Dahinter an der Wand war ein Mistelzweig befestigt. Als ob jemand versuchen würde, einen Kuss unter dem Mistelzweig zu stehlen, während er Festnahmeprotokolle fotokopierte. Es gibt doch nichts Romantischeres als ein Küsschen beim Summen und Klappern der Bürogeräte, dachte Alvarez zynisch.
»Das hätten wir!« Joelle stellte die Plastikdosen ab und legte eine grün-rot karierte Decke auf einen der runden Tische, bevor sie die erste Dose öffnete. »Voilà!«
Drinnen befanden sich sorgfältig aufgereihte runde kleine Kuchen, jeder einzelne mit Santa-Claus-, Schneemann- oder Rentiergesichtern verziert. »Die habe ich vom Bäcker mitgebracht«, verkündete sie, als sei das eine Sünde, »aber ich habe auch meine berühmten Weihnachtsmakronen und die russischen Teeplätzchen gebacken.« Eine weitere Dose wurde geöffnet. »Und das pièce de résistance«, flötete sie mit neckischer Stimme, »Großmutter Maxies göttliche Buttertoffees! Hmm!« Sie sauste zum Schrank, worin sie zuvor mehrere Tabletts verstaut hatte, und verteilte, zufrieden, dass alle noch glänzten, ihre Lieblingsleckereien darauf.
»Ich kriege schon einen Zuckerschock, wenn ich das Zeug nur ansehe«, seufzte Pescoli.
Joelle kicherte begeistert. Obwohl sie bereits über sechzig war, sah sie gut zehn Jahre jünger aus und schien über eine schier grenzenlose Energie zu verfügen – zumindest während der Weihnachtszeit. »Nun, bedient euch!« Als die Tabletts fertig waren, sammelte sie die Dosen ein und eilte den Gang hinunter zu ihrem Schreibtisch im Eingangsbereich des Departments. »Und denkt daran, um vier findet die Auslosung für das Weihnachtswichteln statt!«, rief sie Regan und Selena über die Schulter zu. »Detective Pescoli, ich erwarte, dass auch du daran teilnimmst!«
Pescoli hatte bereits in ein Plätzchen gebissen und verdrehte verzückt die Augen. Kauend lehnte sie sich zu Alvarez hinüber und murmelte: »Diese Frau treibt mich zwar in den Wahnsinn mit ihrer Weihnachtsbesessenheit, aber eins muss man ihr lassen: Sie weiß, wie man Makronen backt!«
Kapitel zwei
Detective Taj Nayak hatte keine guten Nachrichten. »Es ist mir ein Rätsel«, sagte sie, als Alvarez später am Vormittag in ihrem Büro vorbeischaute. »Es scheint so, als hätte sich die Frau einfach in Luft aufgelöst. Sie hat die Anwaltskanzlei zu gewohnter Zeit um kurz nach siebzehn Uhr verlassen, ist jedoch nie zu Hause angekommen.
Wir wissen, dass sie zur Tankstelle gefahren ist und vollgetankt hat, außerdem hat sie eine Schachtel Zigaretten gekauft – Marlboro Menthol, falls das von Interesse sein sollte –, dazu eine Cola light und ein Twix. Bezahlt hat sie mit ihrer Kreditkarte. Hier, sieh selbst.« Taj tippte etwas ein. Auf ihrem Monitor erschien ein Schwarzweißfilm. »Da ist sie. Schau mal …« Sie deutete auf den Bildschirm, auf dem jetzt eine Frau an der Kasse des Tankstellenshops zu erkennen war. Die Frau sah aus wie Lissa. »Hier bezahlt sie ihre Einkäufe, dann kehrt sie zu ihrem Wagen zurück.« Das Bild wechselte vom Kassenbereich zu den überdachten Zapfsäulen, an denen bis zu acht Fahrzeuge gleichzeitig tanken konnten. »Man kann nicht allzu viel erkennen«, fuhr Taj fort, »nur dass sie die Tankstelle verlässt und nach Norden fährt, obwohl ihre Wohnung in südlicher Richtung liegt.« Tatsächlich sah man am oberen Bildschirmrand, wie Lissas kleiner Chevy Impala nach rechts abbog. Der Film lief weiter. »Hier ist der Geländewagen zu sehen, der nach ihr die Tankstelle verlassen hat. Wir haben ihn überprüft; er wurde von einer Jugendlichen gefahren, die zusammen mit zwei anderen Mädchen auf dem Weg zum Basketballtraining war. Es handelt sich um einen Toyota 4Runner, der einem Versicherungsmakler aus Grizzly Falls gehört. Die junge Dame ist seine Tochter, und weder ihr noch ihren Freundinnen ist irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen.« Plötzlich stoppte der Film. »Die Suchtrupps haben nichts gefunden, also ist sie entweder verschwunden, weil sie es so wollte, oder …«
»… sie ist tot.«
Taj nickte. Das Telefon klingelte, und sie griff nach dem Hörer. »Dann wird ihr Fall vermutlich auf deinem Schreibtisch landen.«
»Hoffentlich nicht.« Alvarez wollte gar nicht daran denken. Trotzdem: Die Frau wurde seit etwa zwei Wochen vermisst. Wie standen da die Chancen, dass sie noch lebte?
Schon am frühen Morgen war sie schlecht gelaunt gewesen, und jetzt verfinsterte sich ihre Stimmung zusätzlich. Da half es auch nichts, dass sie auf dem Weg zurück zu ihrem Schreibtisch dem Sheriff begegnete.
Dan Grayson, ein großgewachsener, kräftiger Cowboy-Typ, war einer der besten Gesetzeshüter im ganzen Land und schon seit Jahren Sheriff. Er war geschieden und hatte sie im vergangenen Jahr an Thanksgiving zum Essen eingeladen. Sie hatte seine Einladung angenommen und sich zum kompletten Narren gemacht, als sie bei ihm zu Hause aufkreuzte, wo er zusammen mit Hattie, seiner alleinstehenden Ex-Schwägerin, und ihren »reizenden« Zwillingen ein kleines, familiäres Erntedankfest feierte. Sie hatte sich einen romantischen Abend erhofft, hatte trotz des Altersunterschieds von Grayson geträumt, bis sie sich Hattie gegenübersah, was ihm und seiner Ex-Schwägerin offenbar nicht entgangen war. Vermutlich war das gar keine so große Sache gewesen, doch seitdem hatte sie sich zurückgezogen und sich darauf besonnen, dass er nicht mehr war als ihr Boss. Absolut nicht.
»Morgen«, brummte er gedehnt, als er sie sah. Seine Augen blickten freundlich, sein Lächeln war echt. Wenn ihm die Situation letztes Jahr peinlich gewesen war, war er Manns genug, sich das nicht anmerken zu lassen, und im Laufe der Monate hatte ihre Verlegenheit nachgelassen. Er hatte sie in diesem Jahr sogar wieder an Thanksgiving zu sich nach Hause eingeladen, doch sie hatte es vorgezogen, während der Feiertage zu arbeiten, um weitere peinliche Szenen zu vermeiden.
»Guten Morgen. He, Sturgis«, begrüßte sie seinen Hund, einen schwarzen Labrador, der ihm überallhin folgte und bei ihrem Anblick mit dem Schwanz wedelte. Sie tätschelte Sturgis’ breiten Kopf, und er gähnte, wobei er seine langen Zähne entblößte und die rosa Zunge herausstreckte.
»Joelle hat Plätzchen, Kuchen und Gott weiß was sonst noch mitgebracht«, teilte er ihr mit.
»Ich habe mir meinen morgendlichen Zuckerkick bereits geholt«, erwiderte sie grinsend.
Seine Lippen unter dem breiten Schnurrbart verzogen sich. »Ginge es nach ihr, wären wir alle den ganzen Dezember lang auf Zuckerdroge.«
»Und zehn Kilo schwerer«, scherzte sie und sah, wie er zwinkerte, was sie immer so sexy gefunden hatte. Rasch wandte sie sich ab und machte sich auf den Weg zurück zu ihrem Schreibtisch, und zwar ohne einen Abstecher in den Aufenthaltsraum zu machen.
Sie hatte jede Menge Arbeit zu erledigen und absolut keine Zeit, sich noch mehr Weihnachtsnaschereien einzuverleiben, geschweige denn, über Dan Grayson nachzugrübeln.
Gegen Mittag fuhr sie nach Hause und nahm einen völlig überdrehten Roscoe mit auf eine Joggingrunde. Die Wander- und Spazierwege im nahe gelegenen Park auf dem Boxer Bluff waren großteils geräumt, also ging sie mit ihm dorthin. Am Eingang des Parks begann sie zu laufen, wobei sie den Hund zwang, ihr an der Leine zu folgen. Die Luft war knackig kalt und brannte in ihrer Lunge, als sie anfing, schneller zu atmen. Die Strecke war malerisch, wand sich zwischen den Bäumen auf dem Gipfel des Hügels hoch oben über dem Fluss hindurch. Sie hatte weder iPod noch iPhone mitgenommen und lauschte statt der Musik ihrem eigenen Atemgeräusch, dem Tritt ihrer Laufschuhe auf dem Asphalt und dem Rauschen der Wasserfälle. Im Park war alles still, eine dicke Schneeschicht lag auf dem winterlichen Gras und bedeckte die Kronen der immergrünen Bäume.
Sie begegnete ein paar Spaziergängern, die dick eingemummt waren und Mützen und Handschuhe trugen. Ihr Atem bildete weiße Wölkchen in der kalten Luft.
»Links!«, hörte sie einen großen, durchtrainierten Jogger rufen. Er schoss an ihr vorbei, als würde sie auf der Stelle stehen, und verhedderte sich beinahe in Roscoes Leine, als dieser spielerisch auf ihn zustürzte.
»He!«, rief der Jogger, ärgerlich, weil er aus dem Rhythmus gekommen war.
Dir auch frohe Weihnachten.
Alvarez sah ihm nach, wie er in der Ferne verschwand. Es begann wieder zu schneien. Nach einer Weile wurde der Hund langsamer und fiel ein wenig zurück, bis er auf den letzten anderthalb Kilometern anfing zu hecheln, dass ihm die Zunge aus dem Maul hing. »Alles klar?«, fragte Alvarez, als sie zum Reihenhaus zurückkehrten und sie den Hund hineinließ.
Fünf Kilometer brauchte der Hund, egal, was passierte, dann hatte er genug und blieb für den Rest des Tages in seinem Körbchen, bis sie am Abend von der Arbeit zurückkehrte.
Sie wärmte eine Suppe in der Mikrowelle auf, dann ging sie nach oben unter die Dusche und zog sich wieder an. Als sie wieder unten war, stellte sie den kleinen Fernseher an, setzte sich an den Küchentisch und aß hastig, ein Auge auf den Bildschirm gerichtet. Mrs. Smith machte es sich auf ihrem Schoß bequem, während der Hund bettelnd auf jeden einzelnen Bissen starrte. »Meins«, erinnerte sie ihn, als er auf dem Bauch über das Küchenlinoleum zu ihr gerutscht kam und sie mitleiderregend anschaute. »Du bekommst dein Essen, wenn ich wieder zurück bin.«
Er klopfte mit dem Schwanz auf den Boden, doch er hörte nicht auf, sie anzustarren. »Nein, ich lasse mich nicht erweichen.« Nachdem sie ihre Suppe gegessen und Teller und Löffel in die Spülmaschine gestellt hatte, machten sich die beiden Haustiere zu einem Nachmittagsschläfchen bereit, während sie sich ihre Sachen schnappte und zurück zum Büro des Sheriffs fuhr.
Um Punkt sechzehn Uhr überließ Joelle Fisher ihrer Assistentin die Rezeption und marschierte mit ihrer roten Santa-Claus-Mütze mit dem abgenutzten weißen Fellbesatz Richtung Aufenthaltsraum. In der Mütze, so vermutete Pescoli, mussten sich die kleinen Zettel mit den Namen sämtlicher Mitarbeiter des Departments befinden. Im vergangenen Jahr hatte Joelle zu diesem Zweck einen mit rot-weißen Zuckerstangen verzierten Korb benutzt. »Kommt nur, kommt nur, wir wollen Lose ziehen!«, trällerte die Empfangssekretärin fröhlich. »Weihnachtswichteln!«
»Ich dachte, das hätten wir schon hinter uns«, murmelte Pescoli, an niemand Bestimmten gerichtet. Sie war erst vor ein paar Minuten ins Department zurückgekehrt, und nun wünschte sie sich, dass die Befragung der Familie Bradshaw noch ein wenig länger gedauert hätte.
»Kommt schon, kommt schon, du auch, Detective!«, flötete Joelle, blieb kurz an Pescolis Schreibtisch stehen und blickte diese auffordernd an.
»Das kann doch keine Pflicht sein! Verstößt das nicht gegen meine Rechte am Arbeitsplatz oder gegen die Religionsfreiheit?«
»Ach, Unsinn!« Joelle ließ sich nicht beeindrucken. »Sei doch kein Grinch!«
Mit klackernden Absätzen stöckelte sie weiter in Richtung Aufenthaltsraum. Dort angekommen, schnappte sie sich einen kleinen Hocker, stieg darauf und begann mit ihrer Wichtelauslosung, völlig blind gegenüber der Tatsache, dass andere Leute zu arbeiten hatten. Sie wedelte mit der albernen Mütze und bedeutete allen, ein wenig zusammenzurücken. Pescoli wusste aus Erfahrung, dass das noch längst nicht alles war. Sollte es jemand wagen, dieser Veranstaltung fernzubleiben, würde sie ihn höchstpersönlich an seinem Arbeitsplatz aufsuchen und ihn zwingen, ein Los zu ziehen. Und wenn auch das nicht klappte, fände der Betreffende einen Umschlag mit einem Namenszettel darin auf seinem Schreibtisch vor. Es war ungeschriebenes Gesetz, dass jeder Mitarbeiter des Sheriffbüros an Joelles Wichtelei teilnahm, ganz gleich, welcher Religion er angehörte.
»Santa Claus ist konfessionslos!«, hatte Joelle vor einigen Jahren verkündet, als Pescoli die Religionskarte ausgespielt hatte.
»Du meinst, nicht konfessionsgebunden«, hatte Cort Brewster, der stellvertretende Sheriff, korrigiert.
Joelle hatte ihm zugezwinkert und wie ein putziges Mädchen die Nase gekraust – was für ein blondes Dummchen! »Natürlich, genau das meine ich.«
Nun hatte auch Dan Grayson höchstselbst den Aufenthaltsraum betreten. Auf Joelles iPod dudelte ihre Lieblingsweihnachtsliedermischung, die ausschließlich aus Bing Crosbys »White Christmas«, Burl Ives’ »A Holly Jolly Christmas« und Brenda Lees »Rockin’ Around the Christmas Tree« zu bestehen schien, und die Empfangssekretärin hielt dem Sheriff mit nahezu verklärtem Blick die rote Mütze hin. Pescoli verdrehte die Augen und flüsterte ihrer Partnerin zu: »Tu doch etwas.«
»Ja, auf jeden Fall«, erwiderte diese, doch zu ihrer Bestürzung zog Sheriff Grayson lächelnd einen der Namenszettel. »Du bist dran«, sagte er dann, reichte ihr wie selbstverständlich die alberne Santa-Claus-Mütze und öffnete sein Los.
Nach ihr kam Nigel Timmons, der Wichtigtuer aus dem Labor. Er hatte sein dünner werdendes Haar zu einem falschen Irokesen à la David Beckham frisiert und erst vor kurzem seine Brille gegen Kontaktlinsen getauscht, die ihm offenbar ziemlich zu schaffen machten, da er seitdem stets mit weit aufgerissenen Augen durch die Gegend lief. Er hatte eine blasse, teigige Haut, war spindeldürr und ein Genie, wenn es um Chemie oder Computer ging. So nervend er auch war, so unersetzlich war der Sechsundzwanzigjährige für das Department, und das wusste er. Während Bing Crosby wieder einmal von einer weißen Weihnacht träumte, zog Timmons mit einem Schmunzeln auf den Lippen einen Zettel aus der Mütze, faltete ihn auseinander und las den Namen darauf, dann – Blödmann, der er war – steckte er ihn in den Mund, kaute und schluckte. »Top secret«, erklärte er wichtig.
Alvarez verzog gequält das Gesicht. »Wir sind doch nicht in der sechsten Klasse.«
»Du vielleicht nicht.« Timmons grinste sie an und inspizierte die Reste von Joelles Weihnachtsleckereien, dann steckte er sich ein Plätzchen in den Mund, nahm sich Kuchen und probierte auch Großmutter Maxies göttliche Buttertoffees.
»Ich nehme an, Timmons hat in der sechsten Klasse seinen Abschluss in Yale gemacht«, flüsterte Pescoli, und Alvarez’ gequälter Ausdruck verstärkte sich noch.
»Erinnere mich nicht daran, dass er ein verdammtes Genie ist«, flüsterte sie zurück.
Alle zogen ihr Los und kehrten anschließend an ihre Schreibtische zurück. Pescoli, die sich von Joelle nicht wieder zum Narren machen lassen wollte wie im letzten Jahr, fischte einen Namen aus der Mütze. Bitte nicht Cort Brewster; ganz egal, wer, aber bitte nicht Cort Brewster!, flehte sie innerlich. Ihn hatte sie vergangene Weihnachten gezogen, dabei war ihr Verhältnis alles andere als gut, weil ihr Sohn Jeremy und Brewsters Tochter Heidi einfach nicht die Finger voneinander lassen konnten. Beide Elternteile warfen einander das Fehlverhalten ihrer Kinder vor, Pescoli machte Heidi für Jeremys Probleme verantwortlich, Brewster schob seinen Ärger mit Heidi Jeremy in die Schuhe. Beklommen faltete sie den Zettel auseinander – und sie wollte verdammt sein, wenn da schon wieder der Name des stellvertretenden Sheriffs daraufstand. »Entschuldige, ich habe mich selbst gezogen«, platzte sie heraus und reichte Joelle schnell den Schnipsel zurück, bevor diese irgendwelche Einwände erheben konnte. Brenda Lee rockte gerade wieder schwungvoll um den Weihnachtsbaum. Pescoli zog ein zweites Los, und diesmal las sie darauf Joelles Namen. Mein Gott, das war ja noch schlimmer, aber aus der Nummer kam sie jetzt nicht wieder raus. Joelle beäugte sie misstrauisch, also kehrte sie schnell an ihren Schreibtisch zurück, wobei sie fieberhaft überlegte, was zum Teufel sie einer Großmutter, die aussah wie eine Barbie aus den sechziger Jahren, schenken könnte. Vielleicht etwas, das vor einem halben Jahrhundert angesagt gewesen war?
Ihr fehlte einfach die Zeit für einen solchen Unsinn. Wenn sie sich schon den Kopf über Weihnachtsgeschenke zerbrach, dann sollten sie wenigstens für ihre Kinder oder Santana sein. Allmächtiger, was sollte sie ihm bloß dieses Jahr schenken?
»Wie wäre es mit gar nichts?«, hatte er vorgeschlagen, als sie ihn nach seinem Weihnachtswunsch gefragt hatte. »Wenn ich die leere Schachtel ausgepackt habe, könntest du sie dir auf den Kopf setzen.«
»Sehr komisch«, hatte sie erwidert, doch sie hatte ein Lächeln unterdrücken müssen. Sie waren allein in seinem Blockhaus gewesen, und er hatte sie geküsst und in sein Schlafzimmer getragen.
Das hatte vor ihm noch kein Mann getan, und ihr Herz hatte angefangen, schneller zu schlagen. Sie war keine zierliche Frau, obwohl sie bestimmt nicht dick war, aber sie war groß und sportlich. Santana hatte das nichts ausgemacht, als er sie über die Türschwelle und ins Bett gehoben hatte, wo er sie liebte, als wäre sie die einzige Frau im ganzen Universum.
Allein der Gedanke brachte ihr Blut zum Kochen.
Nein, sie würde nicht daran denken, wies sie sich selbst zurecht. Nicht bei der Arbeit. Genauso wenig würde sie zum x-ten Male ihre Gründe durchgehen, warum sie nicht bei ihm einzog. Er hatte ihr diesen Vorschlag vor über einem Jahr – im Grunde waren es mittlerweile fast zwei – unterbreitet, doch sie hatte abgelehnt, angeblich, um auf Nummer sicher zu gehen. Ihre beiden vorherigen Ehen waren alles andere als perfekt gewesen, deshalb hatte sie kein Interesse daran, sich wieder Hals über Kopf in eine zu enge Beziehung zu begeben.
Zu spät, gestand sie sich ein, doch sie zwang sich, sich auf ihren Schreibtischstuhl zu setzen und auf die Arbeit zu konzentrieren. Weihnachtswichteln hin oder her, sie musste herausfinden, ob Martin Zwolski der größte Pechvogel auf dem Planeten oder ein kaltblütiger Mörder war, der der Polizei sonst durch die Maschen zu schlüpfen drohte.
Die Kirchturmglocke schlug zur halben Stunde, als Brenda Sutherland über den vereisten Parkplatz des Gotteshauses eilte. Jetzt war es schon zwanzig Uhr dreißig, dabei hatte Lorraine Mullins, die Ehefrau des Geistlichen, versprochen, dass es nicht später als zwanzig Uhr werden würde. Versprochen.
Andererseits hatte sie auch nicht damit rechnen können, dass Mildred Peeples immer wieder auf den Kosten für die neue Kirche herumreiten würde. Mildred war mindestens neunzig, blitzgescheit und unglaublich starrsinnig. Und die alte Dame war absolut nicht bereit, sich auf den eigentlichen Grund für diese Zusammenkunft des Bibelkreises zu konzentrieren: das Wunschbaumprojekt, das sie in diesem Jahr ins Leben gerufen hatten und das dazu dienen sollte, die Weihnachtswünsche von Kindern zu erfüllen, die sonst nichts geschenkt bekamen. Stattdessen hatte sie immer wieder die »absurden«, »haarsträubenden« Kosten angesprochen, die der Bau der neuen Kirche mit sich bringen würde. »Dies ist ein Gotteshaus«, hatte sie beharrt, »und jeder in der Stadt, jedes einzelne Gemeindemitglied sollte sich mit seiner Zeit, seinem Geld und seinem persönlichen Einsatz daran beteiligen. Lorraine?«, hatte sie sich an die Frau des Predigers gewandt. »Hast du den Kostenvoranschlag für die Sanitäreinrichtungen gelesen?« Ihr Gesicht war unter der dicken Puderschicht rot angelaufen, und sie hatte mit dem Zeigefinger vor Dorie Oestergard herumgewedelt, der Frau des glücklosen Bauunternehmers, der der Kirche, so wusste man, bereits einen Nachlass von fünfundzwanzig Prozent gewährt hatte. Dennoch war Mildred überzeugt davon, dass er sich »die Taschen vollstopfen« wolle, was sie der Bibelrunde lautstark verkündete. »Dein Mann sollte sich schämen, Dorie. Das ist Wucher! Oder blickt er durch seine eigenen Rechnungen nicht durch?«
Dorie hatte empört nach Luft geschnappt, doch Mildred war nicht zu bremsen gewesen. »Wenn ihr mich fragt«, hatte sie lautstark verkündet, »steckt der Teufel dahinter. Satan ist allgegenwärtig, müsst ihr wissen. Er steht direkt hinter euch und wartet nur darauf, sich auf euch zu stürzen.« Sie hatte die Lippen geschürzt, doch bevor sie sich weiter über Dories Mann, Jon Oestergard, auslassen konnte, fragte Jenny Kropft, eine weitere Frau aus dem Bibelkreis, ob sie so nett sein könnte, ihr Brombeerstreuselkuchenrezept für das Backbuch zur Verfügung zu stellen, das die Gruppe plante. Mildred entging dieses Ablenkungsmanöver nicht, doch sie fühlte sich auch geschmeichelt.
»Gott bewahre mich«, flüsterte Brenda, als sie nun den fast leeren Parkplatz überquerte und ihren Wagen aufschloss. Ihr Atem bildete weiße Wölkchen in der kalten Abendluft. Die alte Kirche lag hoch oben am Hügel auf einem Felsvorsprung, der über dem unteren Teil von Grizzly Falls aufragte. Kirche und Pfarrhaus waren in den späten 1880ern errichtet worden, und obwohl man im Laufe der Jahre immer wieder die sanitären Anlagen saniert, Stromleitungen, Heizgebläse und Wärmedämmung erneuert hatte, zog es in beiden Gebäuden nach wie vor kräftig, zudem wuchs die Gemeinde Jahr für Jahr. Sonntagmorgens war selbst die alte Chorempore voller Gemeindemitglieder, und an Ostern und Weihnachten mussten zusätzliche Gottesdienste für diejenigen abgehalten werden, die sich nur zu diesen besonderen Gelegenheiten in der Kirche blicken ließen. Die strengen Winter in Montana setzten den alten Gebäuden zu, genau wie denen, die sich darin aufhielten.
In Brendas Augen war der Bau einer neuen Kirche eine großartige Idee, genau wie Prediger Mullins’ Vorschlag, eine Gruppe junger Musiker aus der Gemeinde Rockversionen traditioneller Kirchenlieder spielen zu lassen. Auch wenn sich Traditionalisten wie Mildred Peeples gegen die Veränderungen sperrten, so brächten sie doch neuen, frischen Wind in die Gemeinde, und das gefiel Brenda. Vielleicht könnte sie sogar ihre beiden Söhne, die mittlerweile im Teenageralter waren, überreden, sonntags früher aufzustehen und die Messe zu besuchen, obwohl das nicht leicht werden würde, zumal Ray, ihr Ex-Mann, ein herausragendes Beispiel eines hedonistischen, selbstsüchtigen Nichtsnutzes war.
Bei dem Gedanken an den Vater der beiden Jungen runzelte sie die Stirn, schickte ein kurzes Gebet zum Himmel, in dem sie Gott um Demut und die Kraft der Vergebung anflehte, dann stieg sie ein und schlug die Autotür zu. Aus dem Rückspiegel blickten ihr ihre zornig funkelnden Augen entgegen. »Herr, gib mir Kraft«, flüsterte sie noch einmal, dann legte sie den Gang ein, setzte ihren alten Ford Escape zurück und rollte vom Kirchenparkplatz. Die Jungen waren heute Abend bei Ray, und sie musste endlich die Tatsache akzeptieren, dass sie einmal diejenige gewesen war, die Ray Sutherland für den perfekten Vater ihrer Kinder gehalten hatte. »Die Torheit der Jugend«, murmelte sie und versuchte, nicht weiter an Ray und sein Versagen als Ehemann und Vater zu denken.
Sie hatte gehofft, ein paar kleinere Weihnachtsgeschenke in der Apotheke und im Geschenkartikelladen besorgen zu können, deshalb fuhr sie hügelabwärts in Richtung Einkaufszentrum und schlüpfte hinein, gerade als die Geschäfte schließen wollten. Schnell kaufte sie ein Plüschrentier für ihren Neffen und Plastikbauklötze mit Weihnachtsmotiven für ihre Nichte. Sie hatte sie schon vor ein paar Wochen ins Auge gefasst, doch mit dem Coupon, den sie am Sonntag aus der Zeitung ausgeschnitten hatte, bekam sie beides zum Preis von einem.
Ihre Stimmung hob sich, als sie ihre Einkäufe bezahlte und darüber nachdachte, ob sie sich mit einer heißen Schokolade im Coffeeshop belohnen sollte, doch dann überlegte sie es sich anders. Mit dem Geld, das sie im Wild Will, einem Restaurant in der Innenstadt, verdiente, konnte sie nicht einmal die Kosten bestreiten, die nötig waren, um zwei halbwüchsige Kinder allein großzuziehen, deshalb beschränkte sie ihre persönlichen Ausgaben auf ein Minimum und zog das Kaffeeangebot im Wild Will vor, auf das sie einen Nachlass von zwanzig Prozent bekam. Sandi, die Besitzerin des Restaurants, war großzügig gegenüber ihren Angestellten; sie hatte Brenda als Kellnerin eingestellt, als Ray die Familie vor fünf Jahren verlassen hatte.
Im Wagen war es kalt, also drehte sie die Heizung höher und machte sich auf den Weg nach Hause. Im Radio lief Weihnachtsmusik, und sie summte leise mit. Schneeflocken tanzten im Licht ihrer Scheinwerfer, schienen Pirouetten zu drehen, während sie sanft zur Erde hinabrieselten. Die Wohngegenden waren mit Plastikweihnachtsmännern, Rentieren aus Weidenflechtwerk, frischen Tannengirlanden und farbigen Lichtern geschmückt. Endlich wurde die Heizung warm. Ihr Haus lag in der Nähe des September Creeks, ein paar Meilen außerhalb der Stadt. Das kleine Blockhaus mit den zwei Schlafzimmern, das Ray gekauft hatte, als sie drei Jahre verheiratet waren, wies langsam, aber sicher Spuren der Zeit auf, eine Renovierung war mehr als überfällig. Bei der Scheidung war ihr das Haus zugesprochen worden, doch sie zahlte Ray noch immer Monat für Monat aus, dafür hatte er Unterhaltszahlungen für die Kinder zu leisten … O ja, das funktionierte. Aber nur auf dem Papier. Sie überlegte, ob sie die Zahlungen an ihn einstellen sollte, doch sie wollte sich nicht mit dem Zurückbehaltungsrecht befassen müssen. Stattdessen hatte sie – auch wenn es ihr zutiefst zuwider gewesen war – einen Rechtsanwalt eingeschaltet, da sie vorhatte, diesen Mistkerl von Ex-Ehemann gleich nach der Jahreswende vor Gericht zu bringen.
Hör auf damit! Es ist Weihnachten! Wieder fing sie ihren Blick im Rückspiegel auf, und wieder sah sie den Zorn, der stets direkt unter der Oberfläche brodelte. Das war etwas, woran sie arbeiten musste. Als Christin glaubte sie inbrünstig an Vergebung. Nur nicht, wenn es um Ray ging.
Irgendwann werde ich ihm verzeihen können, dachte sie, vielleicht wenn sie einen anderen Mann gefunden hätte, der ihre durchhängende Veranda richtete, die alten Rohre unter dem Waschbecken ersetzte und sie nachts in den Armen hielt. Oh, was würde sie nicht darum geben, beim zweiten Mal einen echten Traumprinzen zu finden! Mit zweiundvierzig war sie nicht bereit, ihren Glauben an die Liebe aufzugeben.
Noch nicht.
Die Wohnhäuser wichen Feldern, auf denen eine dichte Schneedecke lag. Auch die Zaunpfähle trugen Hauben aus Schnee, genau wie die Büsche und Sträucher.
Als sie von der Hauptstraße abbog, bemerkte sie auf dem Seitenstreifen einen Wagen. Die Motorhaube war hochgeklappt, ein Mann sah sich den Motor an. Sie fuhr langsamer, erfasste ihn mit dem Licht ihrer Scheinwerfer. Er winkte und bedeutete ihr anzuhalten. »Sei vorsichtig«, sagte sie zu sich selbst, doch dann erkannte sie ihn als Stammgast aus dem Restaurant und aktives Mitglied der Kirchengemeinde.
Sie bremste und kurbelte das Fenster hinunter, während er durch den Schnee auf dem Seitenstreifen zur Fahrerseite stapfte.
»He«, sagte sie. »Gibt es ein Problem?«
»Das verdammte Ding ist einfach stehengeblieben«, erwiderte er, »und ich habe mein Handy zu Hause vergessen, so dass ich meine Frau nicht anrufen kann.«
»Das kann ich doch für Sie übernehmen.«
»Das wäre großartig.« Er warf ihr ein liebenswertes Lächeln zu. »Oder sollte besser ich anrufen?«
»Ich denke schon.« Sie wandte sich um, griff in ihre Handtasche, tastete nach dem Handy und sagte: »Der Akku ist fast leer, aber es dürfte noch reichen …« Als sie sich wieder umdrehte und sich vergewisserte, dass das Handy eingeschaltet war, spürte sie etwas Kaltes in ihrem Nacken. »Was …« Eine Sekunde später schoss ein heftiger Schmerz durch ihren Körper. Was war das? Ein Elektroschocker? Sie schrie auf und zuckte unkontrolliert. Lieber Gott, bitte hilf mir!, dachte sie bebend und stöhnte. Das Handy glitt ihr aus den starren Fingern. Hilflos, entsetzt sah sie zu, wie er durchs offene Fenster griff, die verschlossene Wagentür öffnete und sie hinaus in die Kälte zerrte. Sie versuchte, sich ihm zu widersetzen, zu kämpfen, zu schlagen, zu treten und zu beißen, doch es gelang ihr nicht, ihren zuckenden Körper unter Kontrolle zu bringen.
Nein! Das kann nicht sein!
Sie vertraute diesem Mann, kannte ihn aus der Kirche, und trotzdem warf er sie eiskalt auf den Rücksitz seiner Limousine und schlug die Tür hinter ihr zu. Die Welt um sie herum drehte sich, als er sich hinters Lenkrad setzte und in derselben Richtung weiterfuhr, in der sie unterwegs gewesen war.
Warum?, wollte sie schreien, doch sie brachte kein Wort heraus. Benommen hörte sie, wie er das Radio anstellte. Eine Instrumentalversion von »Stille Nacht« erfüllte das Wageninnere.
Seltsamerweise hatte er die Heizung nicht an, und während sie schweigend Kilometer um Kilometer zurücklegten, fragte sich Brenda, wohin um alles auf der Welt er sie brachte und – was er wohl mit ihr vorhaben mochte.
Er ist ein Christ. Das Ganze ist nur ein übler Scherz, versuchte sie, sich einzureden, doch tief im Herzen wusste sie, dass heute Nacht nichts Gutes auf sie zukommen würde. Mildreds Stimme hallte in ihrem Kopf wider, übertönte die Weihnachtsmusik, quälte sie mit ihrer düsteren Prophezeiung:
Der Teufel steckt dahinter. Satan ist allgegenwärtig, müsst ihr wissen. Er steht direkt hinter euch und wartet nur darauf, sich auf euch zu stürzen …
Kapitel drei
Ich kann nicht«, sagte Pescoli in ihr Handy, während sie den Jeep die lange, schneebedeckte Auffahrt zu ihrem Blockhaus hinauflenkte. Die Räder ihres Wagens hinterließen frische Spuren im Schnee. Vorsichtig rollte sie zwischen den Bäumen hindurch und über eine kleine Brücke, die sich über den mit einer Eisschicht überzogenen Bach spannte, der durch ihr mehrere Morgen großes Grundstück in den Ausläufern der Bitterroot Mountains außerhalb von Grizzly Falls mäanderte. Als sich die Bäume lichteten, erfassten ihre Scheinwerfer die Hausfront. Drinnen brannte kein Licht. »Ich glaube, meine Kinder sind beide verschollen. Wieder einmal.« Das schlechte Gefühl, das sie den ganzen Tag über begleitet hatte, während sie herauszufinden versucht hatte, was mit Len Bradshaw geschehen war, wollte nicht weichen.
»Kein Kommentar«, bemerkte Santana, wofür sie ihm dankbar war. Sie wusste, dass er der Ansicht war, dass die beiden dringend eine ernstzunehmende Vaterfigur in ihrem Leben brauchten. Es war nicht leicht, eine Sechzehnjährige und einen Achtzehnjährigen allein großzuziehen.
»Das ist gut. Dann muss ich nicht die Löwenmutter raushängen lassen.«
»Aber nein, das wollen wir doch um jeden Preis vermeiden.«
»Sicher.« Sie drückte auf die Fernbedienung, um das Garagentor zu öffnen, und betrachtete das Schneegestöber im Scheinwerferlicht. Was würde sie darum geben, auf der Stelle zu Santana zu fahren, seine Einladung zum Abendessen anzunehmen und anschließend die Nacht mit ihm zu verbringen, doch die Pflicht rief. Die Pflicht in Gestalt ihrer Kinder, wo zum Teufel diese auch stecken mochten. »Ich rufe dich später noch mal an.«
»Tu das.« Sie wollte schon die Aus-Taste drücken, als sie ihn sagen hörte: »Regan?«
»Ja?«
»Auch du hast ein Leben verdient.«
»Das stimmt«, pflichtete sie ihm bei. Er hatte recht, was ihre Kinder anbelangte, sie war nur nicht bereit, das zuzugeben. Noch nicht. »Später.« Sie drückte das Gespräch weg und fuhr in die Garage. Die Scheinwerfer strahlten die Rückwand an, wo immer noch Kisten mit Joes Werkzeugen gestapelt waren. Ihr tat das Herz weh, wenn sie an ihren ersten Ehemann dachte, der wie sie ein Cop gewesen war. Joe Strand war bestimmt nicht perfekt gewesen, aber sie hatte ihn geliebt, und er hatte ihr Jeremy geschenkt, der zwar das gute Aussehen seines Vaters geerbt hatte, doch leider nicht dessen Verantwortungsbewusstsein. Joe war bei einem Einsatz erschossen worden, als sie gerade in einer schwierigen Phase steckten. »Ich glaube, ich habe versagt, Joe«, sagte sie, lauschte dem Ticken des Motors und schaltete die Scheinwerfer aus. In der Garage war es jetzt stockfinster. Das Tor hatte sich hinter ihr geschlossen, der Wind rüttelte daran, und ihr wurde bewusst, wie lange sie nicht mehr mit ihrem verstorbenen Mann gesprochen hatte, dabei hatte sie das in den Wochen und Monaten nach seinem plötzlichen Tod regelmäßig getan.
Seit Nate Santana in ihr Leben getreten war, fing Joes Bild an zu verblassen. Endlich.





























