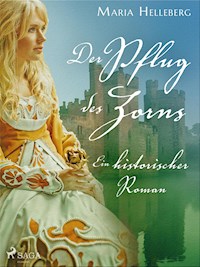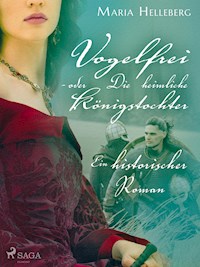
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Spannender historischer Roman um Liebe und Leben im mittelalterlichen Schweden! Schweden im 13. Jahrhundert: Jofrid, die uneheliche Tochter von König Magnusson, wächst bei ihrer Mutter und ihrem Ziehvater auf. Nach einer unglücklichen Liebe zu einem Priester, wird Jofrid zur Heirat mit einem Großbauern gezwungen. Die junge Frau beugt sich ihrem Schicksal – bis sie Jahre später auf den Ritter Sten Alogottsson trifft. Zwischen beiden entflammt eine leidenschaftliche Liebe, die sich über alle Tabus der rauhen schwedischen Gesellschaft des 13. Jahrhunderts hinwegsetzt...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 638
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Maria Helleberg
Vogelfrei - oder Die heimliche Königstochter - Ein historischer Roman
Saga
Vogelfrei - oder Die heimliche Königstochter - Ein historischer Roman
ÜbersetztGerd Weinreich Copyright © , 2019 Maria Helleberg und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726350340
1. Ebook-Auflage, 2019
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk
– a part of Egmont www.egmont.com
Die Welt schuf er, die große, weite,
den Wald, das Feld, des Berges Gipfel und des Berges Seite,
das Laub, das Gras, das Wasser und den Sand,
und manche Freude und auch manches Land,
darunter eins, das Schweden heißt.
(...)
Da sind die Recken, die gut fechten,
die Ritterschaft samt braven Knechten,
doch ebenbürtig nicht dem Dieterich von Bern.
Wie einst die Herren und die Fürsten lebten, was sie trieben,
das findet man in diesem Buch beschrieben.
Wie sie gelebt, was sie getan, wo sie gewesen –
hier steht’s geschrieben, hier kann man’s lesen.
Aus der Erikschronik
Avesta – Ornäs – Nyköping – Mjövik
1311–1318
Es war nicht das erste Mal, daß er auf eine ihrer Art gestoßen war. Aber er glaubte nicht, daß er sich jemals an Menschen wie sie gewöhnen würde. Schon ihre Stimme verriet ihm, daß sie zu einem anderen Leben erzogen worden war, als er es führte. Niemand schien sie je darum gebeten zu haben, ihr Temperament zu zügeln. Aber sie konnte höchstens zwölf Jahre alt sein; weder erwachsen noch Kind, aber durchaus furchteinflößend.
Sie war dünn und groß, ihr Rücken etwas kräftig – das Kleid war zu lang, aber nur vorn, und sie hob es mit beiden Händen hoch, wie ein Kind, das die Sachen der Mutter tragen muß. Der Saum war ausgetreten und die Schürze schmutzig. Grüne Augen hatte sie, zwei Farbstreifen, die so kräftig glitzerten, daß er Herzklopfen bekam, wenn er ihren Blick traf. Diese Augen leuchteten, sogar im Dunkeln, wie die einer Katze.
Er wußte, daß sie gleichsam durch ihn hindurchblicken konnte. Von der guten, etwas abgetragenen Kleidung, die er trug, und die in keiner Weise etwas über sein Anliegen oder seine Ausbildung verriet, ließ sie sich nicht blenden. Unter ihrem grünen, stechenden Blick wurde er wieder zu einem dünnen, hochaufgeschossenen, rothaarigen und tolpatschigen Jungen, mit plumpen Händen und Füßen, die immer im Wege waren. Das braune Wams und der Rock verschwanden, und er fühlte sich wieder genauso unbeholfen und häßlich wie damals, als er im Kloster in Julita herumlief, in einer Kutte, die ein ordentliches Stück über den Knöcheln aufhörte, mit klappernden, viel zu großen, abgetragenen Sandalen an den Füßen und mit einem Strick um den Leib.
Sie aber glich der Heiligen Katarina, deren Bildnis auf einem der Altäre in Julita stand: Die Heiden hatten sie gerädert, weil sie unbeirrt an ihrem Glauben festgehalten hatte.
Allerdings hatte dieses Mädchen hier ganz andere Augen als die Heilige Katarina. Und dann waren da noch die zerrissenen Nägel, die verfilzten Zotteln in dem langen dunklen Haar und die Erdklumpen auf dem Kleid. Aber vielleicht gab es ja Heilige, die es liebten, in ihren wenigen Augenblicken der Muße auf Bäumen herumzuklettern? Er wollte das bei nächster Gelegenheit nachschlagen.
Sie kam ihm entgegen, und er räusperte sich und nannte seinen Namen und sein Anliegen, obwohl es ihm beklommen dabei zumute war, daß nicht der Herr des Hofes ihn empfing, sondern ein zwölfjähriges Mädchen. Die kurze Rede die er eingeübt hatte, war für andere und geübtere Ohren bestimmt als die ihren. Das Mädchen aber bedeutete ihm mit einem Wink, ihr zu folgen, und hob ihr Kleid, so daß er ihre Schuhe sehen konnte.
Selbst die gehörten in eine andere, seltsame Welt, zu der er nie Zugang gewonnen hatte. Das blaue Leder war so fein, daß es sich bei jeder Bewegung am Fuß faltete. Hellblaues Seidenband war darin, und zwei kleine Rosetten aus Silber, und über dem Spann war die obere Schicht in Mustern ausgeschnitten, so daß ein noch dünneres grünes Lederfutter sichtbar wurde. Aber ihre Knöchel waren dünn, bleich, spitz und nicht schön anzuschauen.
Sie hüpfte, Stufe für Stufe, die Füße aneinandergepreßt, die offene Treppe zum Laubengang hinauf, der entlang dem oberen Stockwerk des Hauses verlief, und rief ihm von oben zu – sie lachte, und er wurde rot und zornig. Er war kein komisches Wesen, über das sie sich lustig machen konnte, er war Priester und doppelt so alt wie sie. So würdevoll wie möglich folgte er ihr. Dann standen sie einander kurz gegenüber. Sie wurde unsicher und errötete, aber nur für einen Augenblick – dann bog sie sich so, als schlüpfe sie unter einem ausgestreckten Arm hindurch, und stürzte davon, mit schallendem Lachen, während ihr die Schürze um die Beine wehte. Im vollen Lauf hielt sie plötzlich an, indem sie den Türrahmen ergriff und herumwirbelte.
In sicherem Abstand wandte sie sich um, mit einem merkwürdigen Ausdruck im Gesicht. Er trat folgsam näher und versuchte, seine Kapuze in den Nacken hinunterzuziehen, ohne daß es allzu lächerlich aussah.
Er konnte selbst nicht recht verstehen, warum er es sich so sehr zu Herzen nahm, daß ein dünnes, halberwachsenes Mädchen sich über ihn lustig machte. Aber das Lächeln war erloschen, noch bevor er zu ihr gelangte. Sie streckte eine Hand hoch und ließ sie über sein dickes, rotes Haar gleiten.
»Ich dachte, man bekommt das Haar abrasiert, wenn man Priester wird?« fragte sie und ähnelte wieder einem Kind.
Es gelang ihm nicht, sich unbeirrt und natürlich zu verhalten. Beim Versuch zu lächeln fiel sein Gesicht in sich zusammen – aber sie bemerkte das totgeborene Grinsen nicht, strahlte vor freudiger Dankbarkeit darüber, daß er ihr antworten mochte. »Ich bin noch nicht zum Priester geweiht«, preßte er zwischen den Lippen hervor. Selbst dieser kurze Satz klang aufgesetzt, wenn sie ihn mit ihren glitzernden, grünen, schrägstehenden Augen ansah, die vor Lachen strahlten.
»Das wäre ja auch ein Jammer«, sagte sie, »mir würde es gar nicht passen; wenn jemand mein Haar abschnitte. Komm herein, Priester, oder wie du genannt werden willst – wenn du uns schon besuchst!« fügte sie kichernd hinzu und stieß ihn leicht durch die offene Tür, indem sie ihre spitzen Finger in seine Seite und seinen Rücken bohrte.
Schon auf der Schwelle fiel ihm auf, daß er vergessen hatte, wie angenehm wohlhabende Menschen wohnten. Jene, die es sich leisten konnten, die trübe, erstickende, braune Dunkelheit hinter sich zu lassen und den ewig beißenden Gestank von altem Rauch und Ruß. Im Dachgeschoß waren vier kleine rundbogige Fenster, die man öffnen konnte. Wände, Decke und Fußboden waren sauber gescheuert. Das Holz war schön, jung und hell, und die Luft rein.
Ein paar junge Mädchen hängten gerade schwere, gewebte Teppiche an Eisenhaken an der Wand auf, und seine Gastgeberin ging zu ihnen hin und fragte sie etwas und lachte ein paarmal herzhaft. Sie kehrte zu ihm zurück und zog ihn die Treppe hinunter, wieder auf den Hof. In der Zwischenzeit war sein Pferd verschwunden.
Er war an einem eigenartigen Ort gelandet, und nie zuvor hatte er so deutlich das Gefühl gehabt, überflüssig und lästig zu sein.
Aus diesem Grund hielt er sich demütig hinter dem Mädchen, während sie weiterschritten, durch das Gatter im mannshohen Palisadenzaun, zwischen den Stallgebäuden hindurch, durch das äußere Tor hinaus auf den steinigen Feldweg, den er gerade erst auf dem Pferd zurückgelegt hatte. Sie schritt kräftig aus – eine dünne, energische, kleine Gestalt, die gegen den harten Wind ankämpfte.
Als er sich umdrehte, konnte er den Hof von weitem sehen, eingeklemmt zwischen zwei Zäunen, geschlossen wie eine Faust, allein, so weit das Auge reichte. Hier wurde der Dalelv breit und ruhig und verteilte sich auf Buchten und um Landspitzen, unterbrochen von Schären, kleinen Felsen und steinigen Steilküsten, und auf jeder Seite des Hofes war Wald, Wald und nochmal Wald, durchschnitten von Streifen gelber Felder, den verstreuten Äckern.
Der Reichtum und das Selbstbewußtsein dieser Menschen hatten ihn überrascht. Die Bauern in Bergslagen waren nicht mit der besten Erde des Landes begünstigt, die Entfernungen waren groß, kleine Feldstriche wurden durch undurchdringliche Wildnis abgeschnitten. Er war nicht gerade von der Aussicht begeistert gewesen, Priester in Grytnäs zu werden. Aber man mußte nehmen, was sich anbot.
Das Mädchen blieb am Zaun stehen und rief, mit den Händen als Trichter vor dem Mund. Vier kleine Pferde trotteten zu ihr, zähe Tiere mit Aalstrich auf dem Rücken, bessere Reittiere als der hohlrückige, halbkahle Gaul, den der Priester in Grytnäs für ihn vorgesehen hatte.
Hinter den Tieren gingen drei Männer. Der mittlere zog ein lahmendes Jungpferd hinter sich her. Alle drei Männer trugen ähnliche Kleider, dennoch war sofort zu sehen, wer von ihnen der Hofherr war: Er machte weiter ausladende Schritte in den zerknautschten Lederstiefeln.
Aber er hätte nie gedacht, daß ihr Vater so aussehen würde. Der Mann, der ihm entgegenkam, war stämmig und rotwangig mit schweren, schrägen Schultern und einem Hängebauch, eingespannt von einem breiten Gürtel. Ein gewaltiger, grobschlächtiger Mann. Alles war breit an ihm – die Schenkel, die Beine, die Füße, der Körper, der Kopf. Wabernde Schichten von überflüssigem Fleisch tauchten an Stellen auf, wo man es am wenigsten erwartete. Außerdem hatte er kleine, hervorstehende, argwöhnische Augen, die demjenigen, den er beobachtete, das Feuer in die Wangen trieben.
Das Mädchen wurde mit ein paar brummigen Bemerkungen ins Haus geschickt, und die beiden waren allein, der Priester und der Bauer. Der Priester wurde mit stechendem Blick abgeschätzt, von oben bis unten, bevor sie sich zusammen aufmachten.
Von diesem Menschen also war er in Zukunft abhängig. Der Mann hieß Tore Jonsson, und ihm gehörte Avesta – mit Erzgrube, Wasserfall und Fischereirechten, wie er selbst sagte. Jedenfalls mit dem Maul war er einer der großzügigsten Wohltäter der Kirche in diesem Jahrhundert, das allerdings noch recht jung war. Während er an den dicken, behaarten Fingern abzählte, berichtete er von seinen reichen Geschenken im Klarakloster in Norrmalm und für Totenmessen hier und dort. Der Bischof in Västerås und der Erzbischof und Dompropst in Uppsala waren nahe Verwandte seiner Frau.
Sie setzten sich in eine enge, alte, dunkle Stube und tranken Bier, und der Priester empfand einen unbändigen, vehementen Widerwillen gegenüber seinem Gastgeber, daß ihm übel wurde.
Tore Jonsson schlürfte und rülpste aus tiefstem Herzen, wischte mit dem Daumen den Schaum aus den Mundwinkeln und lehnte sich so plump zurück, daß die solide Holzbank ächzte.
»Wir brauen das beste Bier in Östrabergslagen«, betonte er.
Göran nippte vorsichtig an dem angenehmen, kalten, süßen Bier und mußte ihm recht geben.
»Es gibt nichts, was meine Frau nicht besser macht als alle anderen Frauen, die ich kenne«, sagte der Hausherr, »du hättest diesen Ort sehen sollen, bevor ich geheiratet habe! Eine kleine, gammelige Wirtschaft.«
Der Priester lauschte geduldig, aber mit wachsendem Mißtrauen: Tore Jonsson war noch selbstgefälliger und prahlerischer, als er gedacht hatte. Aber er hatte Grund dazu. Er hatte Glück gehabt, sich gut verheiratet, besaß die hübscheste Tochter, die man sich wünschen konnte. Die Äcker trugen gut, die Gruben gaben Erz her und der Fluß den besten Lachs im Lande. Von diesem sich ständig vermehrenden Reichtum schnitt er eine kleine Scheibe für die Kirche ab, die dafür höflich über mögliche Vergehen von seiner Seite hinwegsehen mußte. Als wenn Gott ein geiziger Kaufmann wäre, der seine Gnade nach bar entrichteten Leistungen bemaß.
Er kämpfte mit seinem Unwillen. Dieser Mensch hatte bereits Macht über ihn, er war der reichste Bauer der Gemeinde, er konnte es sich leisten, Grytnäs zu einer dreischiffigen Kirche mit spitzen Fenstern und Gewölbe anstelle einer Holzdecke umzubauen und Reliquien zu kaufen. Und er hatte die Macht, seinem Priester das Leben schwer zu machen.
Dieser hatte nicht viel Glück bei dem Versuch, seinen Widerwillen niederzukämpfen; ihm wurde ganz schwindelig vor Überdruß, er versuchte, ein aufmerksames Gesicht aufzusetzen, er war höflich und korrekt, aber es gelang ihm einfach nicht. Das einzige Thema, zu dem er gern zurückkehrte, war die Tochter, die Tore Jonsson ein paarmal erwähnt hatte.
»Du hast sie ja selbst gesehen«, sagte Tore Jonsson und antwortete sich selbst mit einem gewaltigen, rauhen, dröhnenden Lachen, das einen Schwall von Spucke und Bier quer über den Tisch in Richtung des Priesters schickte, »da kann man’s sehen, sogar einer von den Kirchenröcken hat Augen im Kopf! Derjenige, der sie bekommt, bekommt alles, was ich angesammelt habe – und das ist nicht wenig, Herr Örjan!«
»Göran Gregori«, warf der Priester ruhig ein, ohne die geringste Hoffnung, daß der Mann die Richtigstellung hören oder gar befolgen würde.
Es drehte sich in seinem Kopf, das Bier und die Anspannung und all das Unerwartete, das in den letzten Stunden auf ihn niedergeprasselt war. Aus dem ganzen Wirrwarr heraus erwuchs ihm das leuchtendklare Gefühl, daß der Herrgott alles ausschließlich mit der Absicht so zurechtgelegt hatte, sein Schicksal zu ändern.
Tore Jonssons Tochter, deren Namen er nicht einmal kannte, war und hatte all das, was er selbst niemals sein und besitzen würde. Das war rührend und einfach und einleuchtend und selbstverständlich. Gottes Zeigefinger auf seiner Brust: Greif nach der Möglichkeit, wenn sie sich bietet, das erste und das letzte Mal!
»Ich möchte gern deine Tochter heiraten«, sagte er. Sehr schnell und ernst, aber ohne die Ängstlichkeit, die in ihm gegärt hatte, seit er auf den Hof gekommen war.
Kaum daß die Worte aus seinem Mund geschlüpft waren, hätte er sich würgen können, um möglichst jeden Laut zurück in die Kehle zu rufen und die Worte hinunterzuschlucken, so daß sie verschwanden und für immer ausgelöscht waren. Aber falls es zu Handgreiflichkeiten kommen sollte, schien es, als wolle Tore Jonsson ihnen nicht aus dem Weg gehen. Der Mann sah plötzlich ganz nüchtern aus – bleich und lang sein großes Gesicht, saß er sprachlos da, mit hängendem Unterkiefer, und betrachtete seinen Gast.
»Da bist du sicher nicht der einzige, der das gern wollte! Aber ist er denn nicht Priester, Örjan?« fragte er.
Weder zuvor noch später hörte Göran dieses Wort jemals mit einer solch bodenlosen Verachtung ausgesprochen.
»Noch nicht zum Priester geweiht«, wandte er ernst ein, mit einer Todesverachtung, die ihn selbst überraschte, »ich habe noch kein bindendes Gelübde abgelegt, alle Wege stehen offen, und sie ist das Herrlichste, was ich je gesehen habe.« Er saß und starrte flehend auf den Mann, um wenigstens die geringste Spur von Wohlwollen zu entdecken. Aber das einzige, was er erblicken konnte, war hämische Nachsicht. Das Blut schoß ihm in die Wangen, stechend, brühheiß. Die Schlacht war verloren; aber er hatte nicht vor, sich in planlosem Durcheinander zurückzuziehen.
»Bis ich heiraten und einen Hausstand gründen kann, arbeite ich als Schreiber beim Landvogt in Sörmland. Es wird Herrn Måns freuen, wenn er hört, daß ich mich mit Heiratsgedanken trage. Er konnte noch nie verstehen, warum ich Priester werden wollte.«
Tore Jonsson unterbrach sein langwährendes Schweigen mit einem Grunzen und fing an zu lachen. Es hörte sich an, als brande das Bier in seinem Magen unter starkem Druck von oben. Der Laut wandelte sich zu einem hustenden, dröhnenden Prusten, bevor das Lachen selbst schließlich aus seinem Munde quoll.
Mitten im Anfall hämmerte er mit der fleischigen Faust auf den Tisch – der Priester fuhr zusammen, konnte den Blick nicht von der Hand des Bauern wenden, dieser schweren Bärentatze mit fünf dicken, groben Fingern, roten Borsten auf dem Handrücken und geradegeschnittenen weißen Nägeln mit schwarzen Rändern.
»Zum Teufel noch mal, du bist der witzigste Priester, dem ich je begegnet bin!« sagte der Hauswirt, trocknete die Lachtränen aus den Augenwinkeln, lehnte sich über den Tisch und haute seinem Gast auf die Schulter, fast liebevoll. »Wir werden uns schon verstehen, Örjan!« feixte er und saugte schlürfend den Speichel auf, der ihm auf Abwege geraten war. Göran versuchte, an der Heiterkeit des Mannes teilzunehmen und die Sache aus Sicht seines Gegners zu sehen. Was war er, ein unehelicher Priestersohn, der erstaunlich weit gekommen war und der sich geehrt fühlen mußte, daß Tore Jonsson sich durch seine Frechheit unterhalten ließ.
Die Welt würde sich niemals für ihn öffnen – höchstens wie ein Reliquienschrein, den man einen Spaltbreit öffnen kann, so daß man gerade eben die Heiligenreliquie erahnt. So sah sein Leben nun einmal aus, und er hatte keine andere Wahl, als sich damit abzufinden und zu schweigen.
Er befand sich draußen auf dem Laubengang und sah sie kommen – die Sonne stand tief, und die Schatten waren zu langen, schmalen Streifen geworden, das Licht fiel kräftig und schräg. Zwei junge Männer waren bei ihr – schlaksige Halbwüchsige mit großen, schweren Händen. Sie knufften einander und lachten, rauften ein bißchen, drehten sich gegenseitig die Arme um und versuchten, sich ein Bein zu stellen, auf die gleiche gutmütige Art, wie große Welpen nacheinander schnappen.
Göran stand reglos da und fror. Sogar der halberwachsene Sohn eines Armen, der sich seinen Lebensunterhalt durch das Striegeln und Satteln von Tore Jonssons Pferden verdiente, war glücklicher und freier als er selbst, der Priestersohn.
Ein verdrecktes, quiekendes Ferkel sauste in zielgerichteter Flucht heran und schoß zwischen den beiden jungen Männern hindurch, die lachend Platz machten, anstatt es zu fangen. Hinter dem Ferkel tauchte sie auf, mit wehenden Haaren und Röcken, auf ihre Art genauso entschlossen wie das Tier und ebenso schnell auf den Beinen. Aber nicht ganz so sicher. Sie rutschte aus in den nassen Vertiefungen, die Pferdehufe und Wagenräder in der Erde hinterlassen hatten, lief ein paar Schritte weiter, bevor ihr linker Fuß erneut seitwärts abrutschte und sie hinfiel. Langsam, fast widerstrebend, so daß sie es gerade schaffte, sich im Fallen mit beiden Händen abzustützen, bevor sie mit dem Hintern und mit ausgestreckten Beinen auf der Erde landete. Die Fersen wühlten Matsch auf, und es gab ein schweres, platschendes Geräusch.
Wenn ihm das passiert wäre, so wäre er vor grenzenloser Scham in die Erde gesunken. Sie aber lachte. Das Lachen sprang von ihr zu den jungen Männern über, während sie auf die Beine kam und versuchte, sich von dem zähen, triefenden Matsch zu befreien, der an ihren Füßen und Schuhen, Knöcheln und Schienbeinen klebte und am Rock, besonders hinten. Es war ein wildes, unbekümmertes Lachen. Sie hatte nichts verloren, soviel begriff er, nicht einmal die Fassung. Bohrender, schmerzender Neid pochte in ihm: so frei, so selbstsicher zu sein. Mit der eigenen zerbrechlichen Würde so großzügig umgehen zu können.
Als sie die Kleidung gewechselt hatte und zurückkam, um ihn abzuholen, war keine Spur mehr von dem Zwischenfall zu erkennen – sie hatte eine neue Aufgabe von großer Wichtigkeit und erledigte diese mit entsprechendem Ernst. Göran sollte bei ihnen wohnen, daher zog sie ihn mit zu einem der Vorratshäuser, wo er ihre Mutter begrüßen konnte. Nach dem Treffen mit ihrem Vater war er gespannt auf das Fabelwesen, das dieses Kind geboren hatte.
Über eine steile, wackelige Leiter gelangten sie in die Dachkammer, mitten hinein zwischen Schinken, gesalzenem und geräuchertem Fleisch, Tonnen, aufgehängtem Wild und runden Käselaiben, die auf Borden lagen. Hinter diesem schamlosen Überfluß an Speisen, der seinen Magen in heftigem Hunger zusammenkrampfen ließ, kam eine Frau zum Vorschein. Ihre große, biegsame Gestalt wuchs aus dem duftenden, eßbaren Reichtum hervor. Eingehüllt in eine Wolke von Gewürzen, duftete sie nach frischer Milch und Käse. Die Frau war nicht viel besser gekleidet als Görans eigene Mutter. Aber das Kopftuch war aus feinem Linnen, das Haar geflochten und in einem Kranz über die Stirn gelegt, und das Tuch war unter dem Kinn gekreuzt und im Nacken mit einer dünnen Silbernadel mit kleinen, blinkenden, roten Steinen am Haarkranz befestigt. Die Finger waren voller Ringe, und ein breiter Silbergürtel lag fast nachlässig um die schmalen Hüften. Ein großer Schlüsselbund, eine Silberschere im Etui und ein kleiner Damendolch hingen am Gürtel: unverkennbare Zeichen des Reichtums.
Aber er vergaß seine eigene Mutter völlig, als er den Blick hinauf zu ihrem Antlitz gleiten ließ – sie konnte höchstens Anfang Dreißig sein, arme Leute wurden selten viel älter. Das Gesicht war ebenmäßig, die Haut glatt und rein; geschaffen zum Anschauen und zum Bewundern. Er sperrte Mund und Augen auf, stand reglos da und starrte sie gebannt an. Schönheit war etwas sehr Seltenes, Gott hatte die Zeichen seiner Liebe sehr knapp verteilt, und diese Frau war in fast beängstigendem Maße damit gesegnet. Als ihr Blick den seinen streifte, begriff er, daß sie es gewohnt war, wegen ihrer Schönheit bestaunt zu werden – und es kam ihm vor, als nehme sie seine Bewunderung gewohnheitsmäßig, dankbar und doch selbstverständlich als ein Geschenk an. Ihre Seele aber schien sie hinter einer dicken Reifschicht zu verbergen – die Augen waren eiskalt und scharf wie bei einem wachsamen Raubtier.
Tore Jonsson mußte ein paarmal um sie herumreichen können – unter dem weichen Gewand war sie so mager wie eine ausgezehrte Mähre, nur das Gesicht war jung. Die Hände waren grob von harter Arbeit – große, flache, gegerbte Hände mit knotigen Knöcheln und bleichen Nägeln. Es beruhigte ihn außerordentlich, diese Zeichen von Verschleiß zu sehen. Das Mädchen stürzte ihr entgegen, schlang die langen Arme um ihren Leib, und lehnte das Gesicht gegen ihre Brust – die Frau lachte trocken und gerührt, strich ihr über das verfilzte, schmutzige Haar, leicht entschuldigend, leicht stolz. Das waren merkwürdige, unbegreifliche Menschen, bei denen er gelandet war. Sie machten ihn stumm, und obwohl er Augen und Ohren aufsperrte, kam er des Rätsels Lösung nicht näher.
In den folgenden Wochen, die er auf Avesta verbrachte, sollte er herausfinden, daß seine Wirtsleute noch sonderbarer waren, als er auf den ersten Blick festgestellt hatte. Tore Jonsson zum Beispiel hatte nicht die geringste Ahnung von Religion. Göran ertappte ihn dabei, wie unbedarft er über das schreckliche Martyrium von Sankt Helfer sprach. Dafür wußte der Mann alles über die verschiedenen Arten, Kupfer und Eisen zu gewinnen, und über die Preise für Osmundeisen auf dem Markt in Arboga. Die Erzgruben hatten seinen Reichtum begründet – zehn Jahre vor seiner Heirat hatten die deutschen Meister vom Rammelsberg ihm gezeigt, wie man Erz und Kupfer abbauen konnte, und seitdem hatte man gearbeitet, sowohl im Kupferberg als auch hier weiter südlich. Die Landwirtschaft und die Lachse warfen gute Erträge ab, aber nichts brachte so viel ein wie Kupfer und Eisen. Daher ließ er nun am Wasserfall Storfossen Schmieden bauen, dann war es vorbei mit der Einsamkeit und dem Frieden. In der Stadt Hedemora würde man leicht arbeitslose Knechte finden, die bereit waren, zu anderen Bedingungen als den gewohnten zu arbeiten, und da so etwas dem Land nur nutzte, konnte Göran nichts Schlechtes über Tore Jonssons Ideen sagen. Und dennoch: Er mochte diesen Mann nicht!
Trotz ihres Reichtums ähnelten die Jonssons ihm auf eine Art. Sie gehörten zu der seltenen Art von Menschen, die keine nahen Verwandten haben. Sie schwebten frei in der Luft wie Göran selbst.
Weihnachten und Ostern fuhren sie zur Messe nach Västerås, obwohl Grytnäs zum Erzbistum Uppsala gehörte und obwohl Tore Jonsson überall eifrig erzählte, daß seine vornehme Frau eng mit dem Erzbischof verwandt war. Die Jonssons wirkten einschüchternd und ließen Fremde nicht zu nahe an sich herankommen; als ob sie Angst hätten, daß Außenstehende dann leichter hinter ihre ungeheuren Geheimnisse kommen könnten, die sie um jeden Preis zu verbergen suchten. Aber sie liebten die Tochter, ihr einziges Kind; hatten sie in unbegrenzter Freiheit aufwachsen lassen, ganz ohne Zucht.
Göran hielt einen gewissen respektvollen Abstand von dem Mädchen, wenn er ihre Eltern besuchte; aber er glaubte zu spüren, daß sie ihn mochte. Wenn sie über jemanden lachte, war das nicht aus böser Absicht, so viel hatte er gelernt, aber ihm brannten immer noch die Wangen vor Verlegenheit, wenn sie Scherze machte.
Am Tag bevor er nach Uppsala aufbrechen sollte, um vom Erzbischof zum Priester geweiht zu werden, fand er sie sitzend am Hang des Dalelv, mit wilden Erdbeeren, die sie in ihrem Schoß gesammelt hatte, mit bloßen Beinen, das Haar voller Grashalme und Schmutz. Ihre Hände waren verklebt und rot vom Saft der Beeren, und sie wollte die Beute mit ihm teilen. Er wußte inzwischen, daß es so gut wie unmöglich war, ihr etwas auszureden, was sie sich in den Kopf gesetzt hatte. Aus diesem Grund gab er nach und setze sich zu ihr. Sie aßen schweigend. Sie suchte die kleinsten Beeren für ihn aus, die am meisten Geschmack hatten, legte sie in seine Hand oder steckte sie ihm mit kleinen spitzen Fingern zwischen die Lippen.
Als alle Erdbeeren aufgegessen waren, leckte sie ihre Handflächen sauber, kletterte zum Ufer hinunter und wusch sich die Arme, während er in dem langen, trockenen, kühlen Gras sitzenblieb und sie betrachtete – endlich davon überzeugt, daß sie ein Kind war, vor dem er keine Angst zu haben brauchte.
»Es ist warm heute, Priester«, rief sie zu ihm hinauf und hielt das Haar mit den nassen Händen vom Gesicht weg. »Wollen wir nicht zum anderen Ufer hinüberschwimmen und wieder zurück? Du mußt ja eingehen vor Wärme, mit all dem Zeug, das du anhast!«
»Ich glaube, das geht nicht, antwortete er, stand auf und bürstete seinen Rock sauber. »Was würden deine Eltern sagen, wenn etwas passierte, wo ich doch die Verantwortung für dich habe?«
»Was sollte mir passieren?« fragte sie aufrichtig erstaunt und kletterte prustend zu ihm hinauf, als würde sie ihn nur verstehen können, wenn sie von Angesicht zu Angesicht vor ihm stünde. »Bisher ist noch nie etwas passiert. Glaubst du nicht, Priester, daß ich schon viele Male dort hinüber und wieder zurückgeschwommen bin?«
»Wenn du es sagst, glaube ich dir«, antwortete er in dem Bestreben, sich beschwerliche Fragen zu ersparen; aber jetzt hatte er sie wütend gemacht, und sie ließ ihre Beute nicht so leicht entkommen.
»Wenn du mir nicht glaubst, kann ich dir zeigen, daß ich recht habe!« drohte sie. Fast erschreckt über den Ton, den sie angeschlagen hatte, griff er in dem Augenblick nach ihr, als sie sich hitzig zum Gehen wandte. Er wollte eigentlich ihre Hand fassen, aber als sie einen Schritt die Böschung hinuntermachte, verschlangen sich die Arme des Priesters und des Mädchens ineinander, und sie drehte sich erstaunt um und sah ihn mit großen, verwunderten Augen an.
»Du kannst wohl nicht schwimmen, Priester?« fragte sie, und das Lächeln kam wieder hervor. Jetzt hatte sie eine neue Erklärung für seine Weigerung gefunden, und die Erinnerungen an eine Unstimmigkeit waren tot und begraben.
»Komm, dann zeige ich dir, wie man es macht, wir gehen ins Schilf, da ist es leichter.«
Sie hat keine Geschwister, dachte Göran Gregori, keine gleichaltrigen Freunde, woher sollte sie wissen, daß es nicht ging, daß ein zwölfjähriges Mädchen mit dem Gemeindepriester, einem Mann von vierundzwanzig Jahren, quer über den Dalelv schwamm. Er brachte es nicht übers Herz, ihr die Unbefangenheit zu nehmen – die war ein Teil von ihr. Während sie sich beide auszogen, vermied er es angestrengt, den Blick auf sie zu richten. Auf eine Art war er genauso unschuldig wie sie, war er doch noch unberührt.
Sie aber kannte keine Scham. Als er mit seinen Fingern durcheinanderkam, als er etwas von dem ganzen Zeug, mit dem er sich gegen die Welt und andere Teufeleien schützte, aufknöpfen wollte, half sie ihm, und als er endlich nackt dastand, nahm sie seine Hand und zog ihn eifrig hinter sich her ins Wasser.
Dieses ekelhafte, heimtückische, treibende und strömende lauwarme Wasser, das Hechte genauso verbarg wie Unterströmungen und Untiefen.
Wenn sie zu weit in die eine Richtung kommen würden, rief sie, würden sie zum großen Wasserfall getrieben werden, und wenn sie zu weit in die andere Richtung kämen, würden sie bei der Fährstelle bei Brunnbäck landen. Aber es bestand keine Gefahr, sie kannte den Fluß in- und auswendig.
Göran war kein guter Schwimmer. Er verkrampfte, schlug mit den Armen aus und versuchte, mit den Zehen den Grund zu erreichen. Das Mädchen schwamm mit sorgloser Selbstverständlichkeit, als wäre es das Ungefährlichste von der Welt. Sie tauchte wie ein weißer, zarter Schwimmvogel, verschwand tief unter ihm, tauchte weit weg wieder auf, prustete Wasser aus Mund und Nase und winkte. Als sie hinterher im Gras lagen und sich von der Sonne trocknen ließen, hatte er für ein paar Augenblicke das Gefühl, daß nichts ihm etwas anhaben könnte – nicht einmal der Umstand, daß ihr Vater ihn Örjan nannte. Sie wrang das Wasser aus dem langen Haar, das von der Nässe dunkel geworden war; hatte Probleme, es durchzukämmen, und drückte ihm den Kamm in die Hand. Um nichts in der Welt wollte er ihr weh tun, aber das Haar war in großen, festen Klumpen verfilzt und verdreckt, und es schauderte ihn jedesmal, wenn er kräftig ziehen mußte.
Als sie endlich zufrieden war, breitete sie umständlich das noch nasse Haar aus und legte sich auf seinen Arm, mit geschlossenen Augen, weil die Sonne brannte.
Zu Hause auf dem Hof zog sie wieder zielstrebig mit ihm los, hinter Zäune und in einen Ziergarten mit gleichförmig angelegten Beeten, Vogeltränken, kleinen und großen Apfelbäumen, schön geharkten Wegen und Holzbänken. Ein Gemüsegarten und auch ein Nutzgarten verbargen sich auch darin. Jedesmal, wenn sich ihre Blicke über den Gewächsen trafen, huschte ein breites erwartungsvolles Lächeln von ihrem Mund zu den Augen. Jetzt war es ihr gelungen, ihm Freude zu machen. Sie hatten alles: Brunnenkresse, Liebstöckel, Meerrettich, Minze, Melisse, Salbei, Wermut, Mädesüß, Petersilie, Majoran, Thymian und Porst. Schnittlauch, Knoblauch und rote Zwiebeln. Die Bäume im Apfelgarten waren nach allen Regeln der Kunst veredelt, auf jedem Baum wuchsen drei verschiedene Sorten.
Er erzählte von den geduldigen Brüdern in Julita, die mit Pfirsichen und Weinanbau experimentierten. Er ging die Heilkräuter durch und erklärte, welche Krankheiten sie lindern oder heilen konnten. Obwohl sie wahrscheinlich das meiste schon wußte, hockte sie vor ihm und lauschte gespannt. Aber als sie zum Haus zurückgingen, sprudelte das Lachen wieder hervor, und sie schlang ihren Arm um seinen.
»Sag mal«, fragte sie, »bist du bald so sehr Priester, daß du nicht mehr allein mit einem Mädchen in den Kräutergarten ihrer Mutter gehen darfst?«
»Mit dir könnte ich überall hingehen«, antwortete er, ohne zu bedenken, daß sich sein Tonfall geändert hatte. Ihr Lachen hatte ihn angesteckt, die Worte flossen zu leicht und zu schnell – ohne daß er ein Gelübde brach.
»Denk daran und sag mir Bescheid, wenn du zu sehr Priester geworden bist, um noch mein Freund zu sein«, sagte sie.
Etwas in ihm erzitterte und zersprang wie dünne Haut über einer entzündeten Stelle. Ihr Vater mußte von seinem Heiratsantrag erzählt haben. So mußte es zusammenhängen. Aber sie lachte ihn zumindest nicht aus.
Die Blumen wuchsen hoch an dem spitzen Giebel empor, und sie bat ihn, sie hochzuheben, damit sie an die Blüten herankam. Sie war schwerer, als er geglaubt hatte. Aber es war seltsam, ihr so nah zu kommen, zu spüren, wie die Wärme ihres Körpers auf seinen übersprang, die schnellen Atemzüge, das leise Klopfen des Herzens, das Spiel der Muskeln in ihrem langen, sehnigen Rücken. Dieser herbe, süße, kräftige Duft ihrer Haut und ihres Haares! Sie setzten sich auf die Steintreppe und genossen die letzten Sonnenstrahlen. Es wurde kühl, wenn die Sonne unterging. All die üppigen Gewächse ergrauten langsam in der Sommerwärme, als wenn die lange Reifezeit sie niederdrückte. Der Sommer ging langsam in den Herbst über, trug den Tod und den Winter in sich. Er fühlte sich genauso – ausgemergelt, ausgelaugt, Seite an Seite mit der Jugend, dem Leichtsinn und der Unschuld der Welt, versammelt in einem Wesen, das weder Kind noch Erwachsener war.
Ihre Hand berührte sein Knie. Sie wollte etwas sagen, und die grünen Augen leuchteten. Ihr Onkel hatte ihr einen Kranz von vergoldeten Rosenblättern geschenkt, den sie auf dem offenen Haar tragen konnte, und nun war sie unsicher, ob sie ihn das nächste Mal, wenn sie mit ihren Eltern zur Messe ritt, aufsetzen sollte, damit Göran ihn sehen konnte.
Warum sollte er nein sagen, wenn er wußte, daß sie sich freuen würde – wem sollte sie den Kranz sonst zeigen? Aber dann verfiel sie wieder in dieses mürrische Insichgekehrtsein, das er nicht verstand. Auf eine ihm selbst bis jetzt verborgene Weise mußte er sie verletzt haben.
»Warum wirst du Priester? Daran denke ich, seit du gekommen bist«, sagte sie, »und Vater und Mutter können es mir nicht erklären.«
Ein kurzer, schmerzhafter Anflug von Unbehagen durchfuhr ihn – niemand hatte ihn jemals so keß und direkt nach dem Kern seines Lebens gefragt.
»Ich besitze ja nichts«, sagte er mit einem Schulterzucken, »wovon sollte ich sonst leben?«
»Warum besitzt du nichts?« fragte sie mißtrauisch; und als er nicht sofort antwortete, schlug sie die Arme um die Knie, legte das Kinn auf die Hände und sah ihn an. »Besitzt du wirklich nichts?«
Er schüttelte den Kopf und streckte beide Arme vor, um seine augenscheinliche Armut zu zeigen.
»Das Zeug, das ich trage, ist meins. Sonst habe ich nichts.«
»Nicht eine Kuh oder ein Pferd?«
Er schüttelte den Kopf.
»Wie kann das angehen?« fragte sie – aus einer gewaltigen, erschreckenden Verwunderung und Neugier heraus, wie er spürte. »Mein Vater war Kanonikus in Strängnäs«, stieß er endlich hervor und betrachtete sie vorsichtig aus den Augenwinkeln, ob sie überhaupt verstehen konnte, was das für ihn bedeutete. Dann fuhr er fort: »Mein Vater war Domherr. Er kaufte einen Schiffer in Visby, der die Vaterschaft übernahm, damit ich eine Ausbildung und einen Namen erhalten konnte.« Göran hatte eigentlich gedacht, daß er die alte Sehnsucht nach Strängnäs überwunden hatte, aber nun war sie erneut da – unerwartet, heftig, ungeschwächt. Die enge, wohlvertraute Stadt – die Kinder, die ihn geneckt hatten, weil sein Name so merkwürdig klang. Sie hatten richtige schwedische Namen, und wenn sie nach Heiligen benannt worden waren, hießen sie Erik oder Oluf.
Es waren verschnodderte, schmutzige, krakeelende Kinder gewesen, die dort aufwuchsen, um eines Tages Schmied, Schuhmacher oder Kaufmann zu werden. Und dann waren da noch die wenigen gepflegten, bleichgesichtigen Kinder gewesen, die Ritter oder große Herren wurden. Mit vierzehn Jahren öffnete sich ihnen die Welt. Sie bekamen unruhige, hochbeinige Pferde, und zu keiner Zeit ihres Lebens lernten sie Hunger oder Not kennen. Die Stadt war eng, aber die Enge schenkte auch Geborgenheit. Für ihn war es weitaus beängstigender gewesen, sich zu Pferd auf die tagelangen Reisen zwischen den abseits gelegenen Höfen zu wagen.
»Der Bischof war unzufrieden mit meinem Vater«, erklärte er, um sein Heimweh zu verscheuchen. Jetzt hatte er einmal angefangen, da konnte es egal sein, ob sie alles verstand oder nur zufällige Bruchstücke.
»Die Dorfpriester haben Kebsen bei sich wohnen«, sagte er und atmete tief, »aber Bischöfe und Kanoniker müssen nach den Gesetzen der Kirche leben. Als mein Vater dann starb, wurden wir vor die Tür gesetzt. Wir kamen zu einem Kaufmann ins Haus, bis meine Mutter heiratete.«
Das klang einfach und stimmig. Aber es war ganz anders verlaufen – eine Reihe von überstürzten, schreckenerregenden Umwälzungen, die Spannung in sein Leben gebracht hatten.
Auf dem Hof, beim Stiefvater, hatte die Wirklichkeit ihn schnell im Würgegriff gepackt. Es war am ersten Tag gewesen, als der Stiefvater seine mitgebrachten Besitztümer durchsah und das seiner Meinung nach Überflüssige wegwarf. Bis an sein Lebensende würde er sich an die Hände dieses Mannes erinnern: gierig, verkrustet, schwarz in den Runzeln, voller Mißgunst und unwidersprochener Macht.
»Dann lernte ich, Holz zu hacken und Wildfallen aufzustellen«, erklärte er, »das war nicht leicht, und mein Stiefvater machte sich nicht sonderlich viel aus mir. Deshalb schickte er mich zu den Brüdern in Julita.«
Er konnte ihr nicht genauer erklären, wie es dazu gekommen war. Die großen Hände des Stiefvaters, die wie ein unabwendbarer Fluch über ihm geschwebt hatten. Julita war mehr als eine Befreiung gewesen. Die Stille, das Regelmäßige, die Vorhersehbarkeit aller Ereignisse, die Geborgenheit, die Selbstbeherrschung. Er hätte in heilsame Unauffälligkeit gleiten, sich wiederholen und wiederfinden können. Aber wie sollte er das diesem zwölfjährigen Mädchen erklären. Alle waren mild und sanft zu ihr, selbst Tore Jonsson behandelte seine Tochter, als sei sie aus syrischem Glas.
»Von Julita aus schickten sie mich auf die Priesterschule in Skänninge«, sagte er und mußte lachen: »Bei den Mönchen habe ich vergessen, wie Menschen leben.«
Außerhalb des Klosters unternahmen die Menschen die seltsamsten Dinge: Sie aßen, tranken, schissen, pißten und paarten sich lustig in Gesellschaft anderer. Er aber hatte sich daran gewöhnt, daß alles, was er tat, in keuscher Abgeschiedenheit vor sich zu gehen hatte. Aber auf den Abtritten saß man in langen Reihen, jeder mit dem Hintern auf das Latrinenbrett gepflanzt, und ließ die Scheiße fallen, so daß sie zu all dem anderen Dreck hinunterplumpste, bis später geleert wurde. In Julita war die Latrine genau über dem Bach angebracht gewesen, der die Unappetitlichkeiten mit der Strömung fortschwemmte.
Um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, war Göran Schreiber beim Landvogt in Sörmland geworden. Der Mann konnte weder lesen noch schreiben, konnte den jungen Mann also gut gebrauchen. Allerdings war der Vogt, der Måns hieß, ziemlich verwundert und ratlos, was einen gesunden, jungen Menschen dazu bringen konnte, sich freiwillig für den Rest seines Lebens in einem Kloster einzuschließen.
Durch den Landvogt traf er Menschen aller Schichten – die meisten waren gewöhnliche, arme Tröpfe wie er selbst. Aber es waren auch Reiche und Mächtige darunter – die, ohne darüber nachzudenken, andere zur Seite schubsten, um zu zeigen, wie hübsch und andächtig sie vor dem Kreuz knieten; ruchlose Männer, die sich gegenseitig im Rausch umbrachten, sich gegenseitig gefangennahmen und Lösegeld forderten, Bauernmädchen (oder wechselseitig ihre Töchter) vergewaltigten und die um des eigenen Vorteils willen jedes Gesetz brachen, das Gott und die Menschen gemacht hatten. Ihre Welt war lärmend, gewaltig, aufdringlich und fremd, bar jeder Moral. Sie stank nach allem Schlechten – Blut, Unrat, Fäulnis und Samen.
Vom zarten, geruchfreien Leben in Julita führte sein Weg in die Gosse. Die Gesangschule in Linköping war eine neuerliche Befreiung gewesen. Man hatte seine gute Singstimme entdeckt. Hätte er reiche Verwandte gehabt, so hätte er in Frankreich studieren können. Aber selbst das größte Talent reicht nicht, wenn man nichts außer einem klugen Kopf, zwei Händen und einem hungrigen Magen hat, den es zu füllen gilt.
Er wollte am liebsten nichts mehr erzählen – zwischen ihren Augenbrauen sah man zwei schmale Falten, aber ein neuerliches Lächeln zeigte sich, als warte sie darauf, daß er bald mit etwas anderem anfangen würde. Schließlich schlug sie die Augen nieder, hielt die Hände vor sich ausgestreckt, wählte einen Ring und ließ ihn wieder los, fand einen anderen, nahm ihn ab und steckte ihn in seine unvorbereitete Hand und schloß diese um das Geschenk.
»Jetzt hast du etwas«, erklärte sie, »der andere ist hübscher, aber das ist mein Verlobungsring, den kann ich dir nicht schenken, sonst wird Ture böse.«
Die Sonne war hinter dem Dachrücken verschwunden, und die Kälte kroch in ihnen hoch. Er zog seinen abgewetzten Mantel aus und legte ihn um ihre nackten Arme, immer noch tief bewegt von ihrem Einfall.
Den Ring würde er nie zu tragen wagen. Tore Jonsson würde seinem Priester, zu Recht, die Haut abziehen lassen, wenn er erfuhr, was auf der Steintreppe vor sich gegangen war. Ganz zu schweigen davon, zu welchen Racheakten der junge Mann, der als ihr Zukünftiger ausersehen war, sich hinreißen lassen würde.
»Dann bist du also ein Hurenbalg!« sagte sie. Es war eine arglose Feststellung, und doch durchfuhr ihn ein Stich. Allmählich würde er sich an ihre überraschenden schonungslosen Bemerkungen gewöhnen müssen.
»Mich nennen sie auch so«, fügte sie hinzu, und zupfte an dem Kranz, den sie geflochten hatte und der vor ihren spitzen Füßen lag. »Mutter will nicht darüber sprechen, aber Alva sagt, daß Vater Avesta bekam, als er dem König diente. Eines Tages kam er mit Mutter nach Hause, und keiner hatte vorher davon gehört, daß er heiraten wollte. Drei Monate später wurde ich geboren. Du mußt nicht traurig sein, daß du ein Hurenbalg bist, davon gibt es mehr, als man glaubt!«
Er hatte ein paar zweideutige Bemerkungen von dem alten Priester gehört, ohne sich weiter darum zu kümmern – aber die Worte des Mädchen ließen ihn nun verstummen. Daß sie so leichthin, so unerschrocken mit einer Sache umgehen konnte, die für ihn die größte und furchtbarste Schande war!
Sie saßen eng beieinander, und sie war warm und fremdartig, zutiefst fremdartig, und duftete nach Erde und Gras und Salzwasser und Schweiß und Sonne. Und er hatte nicht das gelernt, worauf es ankam, das spürte er. In Julita hatten sie ihm drei Sprachen beigebracht, sowie Jura, Kirchenrecht und Medizin. Aber niemand hatte ihm jemals erklärt, was man nun tun und lassen durfte, wenn man neben einem jungen Mädchen saß. Nichts hatte ihn darauf vorbereitet, daß es solche unverwundbaren, in sich ruhenden Wesen wie dieses Mädchen gab. Menschen, in denen der böse Wille sich nicht eingenistet hatte und die nicht das geringste Anzeichen ererbter Sündhaftigkeit zeigten.
Er konnte sich niemandem anvertrauen – höchstens ihr, und das ging nicht. Nur wenn sie zusammen waren, hatte er eine Art Schild gegen die gewaltige, öde Natur, die sie zu allen Seiten umgab. Sie, die niemals in einer Stadt gewohnt hatte, bewegte sich weit draußen im Wald, als könne sie nichts Böses ereilen. Frieden herrscht im Lande, sagte sie und hatte sicherlich recht; aber er hatte nun einmal keine Angst vor Straßenräubern oder Bären, eher vor seiner eigenen erdrückenden Einsamkeit, mitten in dem endlosen, weglosen, wilden Wald – als habe Gott ihm den Rücken zugewandt und könne ihn nicht mehr erblicken.
Für sie hatte alles einen Zweck – der Wald bedeutete Schutz, die Erde war ihr Erbe, alles von den Menschen zum gemeinsamen Besten genutzt.
Sie lief eifrig um ihn herum und zeigte über die braunen und goldenen Gürtel von Ackerland, verteilt zwischen den Wäldern – es war nicht wenig, was sie ihrem Zukünftigen einbringen würde. Ture müßte sich freuen, sie zu bekommen, bemerkte er spöttisch.
Nein, erwiderte sie lachend, Ture in Ornäs komme bestimmt nicht darum herum, der Kirche Land und Geld zu schenken, wenn er sie heimführte.
Göran hörte nicht gern den Namen dieses Mannes aus ihrem Mund.
Wie so vieles von dem, was er in Julita gelernt hatte, stellte sich jetzt auch der Begriff der Sünde als mangelhaft heraus. Früher hatte er eine kristallklare, moralisch begründete Auffassung vertreten: Man erlag einer Versuchung, sündigte, bereute, beichtete und tat Buße, es wurde einem vergeben und man war gereinigt. Nichts hatte ihn darauf vorbereitet, daß irgend etwas in ihm selbst sich gegen die Reinheit sträuben konnte.
Er hatte gelernt, daß die Sünde gleich groß war, ob man nun Unzucht im Fleisch oder in Gedanken trieb. Jeder Mensch war Austragungsort für den Kampf zwischen dem absolut Guten und dem absolut Bösen. Und bei dem Gedanken, daß er von vornherein das gute Teil gewählt hatte, hatte er sich oft wie ein Auserwählter gefühlt. Ganz so leicht war es nicht, wie er jetzt einsehen mußte. Er schlief schlecht, teils, weil seine Gedanken ihm selten Ruhe gaben, teils einfach aus Angst, daß sich das Böse seiner bemächtigen könnte, sobald er seine Verteidigung schwächte.
Wenn er wachte, nahm es Vogelgestalt an und flatterte durch den Rauchabzug im Dach herab. Der Teufel hatte in ihm Einzug gehalten, mit Palmzweigen und Hosianna.
Es half nichts, bei trockenem Fladenbrot und gekochtem Wasser zu fasten, nackt auf dem Lehmboden zu schlafen oder sich den Rücken blutig zu peitschen. Der Böse schlüpfte wie einer, der sich auskennt, in seinen Körper hinein und aus ihm heraus, grinste verständnisinnig, wie von Mann zu Mann, über seine Schulter und kitzelte ihn unter der Haut.
Von Kindesbeinen an hatte er eine tiefe Abscheu vor allem empfunden, was mit dem Geschlechtlichen zusammenhing. Aber während seiner Zeit als Schreiber des Landvogts hatte er es nicht vermeiden können, das umtriebige Liebesleben des Mannes zu verfolgen.
Eines Morgens war er vor der abgemachten Zeit gekommen, und der Landvogt war mit einem der Dienstmädchen beschäftigt gewesen. Die Ankunft des Schreibers hatte ihn nicht im geringsten gestört; mitten in seiner prustenden, grunzenden Betriebsamkeit hatte er gerufen, Göran brauche nicht zu gehen, er sei gleich fertig. Göran hatte etwas gefunden, womit er sich die Wartezeit vertreiben konnte, damit er das, was da geschah, nicht sehen mußte; aber die Geräusche waren so aufdringlich, und seine Hände zitterten derart, daß er es nicht mehr aushalten konnte und Messer und Gänsekiel auf den Boden fallen ließ. Während er unter dem Tisch danach suchte, ertönte vom Landvogt ein erleichterter Schrei. Und als Göran sich auf allen vieren unter dem Tisch umdrehte und erschreckt nach dem großen Mann blickte, ob er vielleicht von der gewaltigen Anstrengung krank geworden sei, begriff er, daß die Unanständigkeit weit gediehen sein mußte. Der Mann zitterte am ganzen Körper, wie er so vor dem Bett stand, und gab einen wunderlichen, schmerzvoll angespannten Laut von sich, preßte sich so hart an den Frauenkörper, der auf dem Bauch vor ihm lag, daß dieser sich in einem Bogen vom Lager erhob, und knetete ihren Hintern mit den großen Händen. Dann seufzte er erleichtert, trat einen Schritt zurück und brachte ungerührt seine Kleidung in Ordnung.
Göran hatte noch nicht die Fassung wiedergewonnen, als Måns sich mit einem breiten Grinsen zu ihm wandte und der jungen Frau, die immer noch auf dem Bauch lag, während ihre Beine über die Bettkante hingen, auf das Hinterteil klatschte. Der tiefe Ekel hatte gegen die Neugier in ihm gekämpft, und keines der Gefühle wollte er sich eingestehen. Das Mädchen kannte er. Wenn er sich nicht sehr irrte, war es ein zartes, blondes Wesen, das sich kaum traute, aufzusehen und dem Blick anderer zu begegnen. Aber da lag sie, mit dem Kleid bis zum Rücken hochgezogen, den Hintern in der Luft, und mit etwas Unbeschreiblichem, Rotem, Feuchtem und Behaartem, das auf ihn gerichtet war. Das konnte es doch unmöglich sein, was Herrn Måns noch vor einem Augenblick so großes Wohlbehagen bereitet hatte.
»Bitte, es ist serviert«, sagte der Landvogt und lachte laut, teils über seinen eigenen Einfallsreichtum, teils über das errötende Entsetzen des Schreibers.
»Er muß es dringend nötig haben, er kommt aus Julita«, hatte der große Mann gesagt. Was die Worte nötig haben auch immer bedeuten sollten – er konnte sich nicht vorstellen, daß er jemals so tief sinken würde, daß es ihn zu solchen erniedrigenden Handlungen drängen würde, die ihn auf eine Stufe mit dem vernunftlosen Tier stellen würden.
Er war aus dem Zimmer gelaufen, und draußen im Schnee hatte er erbrochen, so daß all das gute Essen verloren war – und Göran dachte gern an Essen, an Schweinefleisch mit feuchten Salzkörnern und knuspriger Schwarte, an Senf und in Buttermilch gekochtem Kohl. Aber mit diesem Teil der menschlichen Natur konnte er sich nicht versöhnen: Das junge Mädchen hatte nicht erkennen lassen, ob sie es mochte oder verabscheute, was der Hausherr mit ihr anstellte. Und er hatte gedacht, als er die junge Frau vom Bett aufstehen sah, daß auf diese Weise sie und auch er benutzt wurden von dem Mächtigen. Rücksichtslosigkeit, Gewalt und Übergriffe – die drei Dinge gehörten zum Geschlechtlichen und dessen Handlungen.
Er schämte sich grenzenlos seiner eigenen Gedanken, aber die waren beharrlich und anscheinend unausrottbar. Selbst als sie ihm ihre Mitgift zeigte, flatterten seine Gedanken durcheinander wie eine Schar angeschossener Vögel; und er betete, daß sie nicht ahnen möge, was mit ihm los war. In acht Truhen hatte sie all das verstaut, was mit nach Ornäs sollte. Dinge, ohne die Göran bisher glücklich gelebt hatte, aber die für diese Menschen unverzichtbar schienen: silberne Kerzenleuchter, Zinnkannen, französische Emailleschüsseln für die Handwäsche, Bronzekannen, die wie Turnierritter und Troubadoure geformt waren, Schmuck, Spangen, Überkleider, Linnen und Seide.
Er bekam süßen Wein in kleinen Bechern zu trinken, und sie warf Nüsse und Kuchen in seinen Schoß, redete und lachte und trank vom Wein, bekam rote Wangen, knackte Nüsse in der Tür, zerkrümelte Kuchen und freute sich über alles mögliche.
Ture von Ornäs wurde zweimal nebenbei erwähnt – Göran fragte sich, ob sie überhaupt wußte, was es bedeutete, verheiratet zu sein.
Den Sommer über gelang es ihm, ihr aus dem Weg zu gehen, ohne daß es auffällig wirkte. Aber als sie im Herbst heiraten sollte, inzwischen vierzehn Jahre alt und erwachsen, ließ es sich nicht länger hinausschieben. Göran Gregori wurde zum Hof geholt, weil sie beichten sollte.
Es war früh am Morgen, der Nebel lag schwer und drückend über dem Dalelv, ein Belag von stechender, feuchter Kälte mit einem schwachen Geruch von Verwesung. Görans Haar und seine Wimpern tropften vor Feuchtigkeit, als er zum Hof ritt – am Fluß entlang wehte es schon beißend, und das Wasser stand hoch, das Wetter war dunkel, düster und bewölkt.
Die Mutter war noch wortkarger als sonst, als sie ihn empfing und zur Dachkammer der Tochter begleitete. Die Tür war so niedrig, daß er sich tief bücken mußte, um hineinzugelangen, alle Läden waren geschlossen; nur das oberste runde Drittel der zwei kleinen Fenster im Giebel ließ ein wenig mattes Tageslicht herein.
Sie stand mitten im Raum und wartete, die Hände vor ihrem Bauch gefaltet. Die Tür wurde geschlossen, und er lauschte auf die schnellen, leichten Schritte, die die Treppe draußen hinabstiegen, auf das leichte Ächzen im Holz, wenn es nachgab. Endlich erlaubte er sich, sie richtig anzusehen. Seit der Michaelsmesse war sie nicht mehr in der Kirche gewesen, und er hatte nichts auf dem Hof zu tun gehabt. Sie hatte sich verändert, sah er, mit einem Anflug von Sehnsucht. Sie hatte ihre geschmeidige, unbewußte kindliche Art zu gehen verloren, der Rücken war lang und biegsam wie der eines Raubtiers gewesen, wenn sie sich im Wasser drehte. Die Hüften waren breiter geworden. Das Kleid saß stramm mit tiefen Falten über der Brust und unter den Armen, ihre Brüste mußten also auch gewachsen sein. Auch von dem strahlenden Licht in den grünen Augen war nicht mehr viel übrig. Im letzten Herbst hatte eine andauernde, glückliche Unruhe über ihr gelegen, als könne sie nur funkeln, wenn sie in ständiger, heftiger Bewegung war.
Es wäre ihm nie eingefallen, sie einzusperren. Sie, die am besten unter freiem Himmel gedieh, der freieste und furchtloseste Mensch, den er kannte, sonnenverbrannt und barfuß, mit dem süßen Duft von Sonne, Erde und Gras in Haut und Haaren.
Er verlor den Faden in seiner wohlvorbereiteten Rede, aber sie lachte nicht wie sonst. Ihre langatmige, ernsthafte Beichte von unbedeutenden kleinen Sünden konnte seine Gedanken auch nicht fesseln. Statt dessen wartete er begierig auf eine große Sünde, die er an Land ziehen konnte – wie ein armer Mann, der auf einen Lachs hofft, der groß genug ist, um die ganze Familie zu ernähren. Aber sie biß nicht an. Sie hatte am Weihnachtstag geflucht, ihr größtes Vergehen.
»Wenn alle so christlich lebten wie du, bräuchte es keine Priester«, sagte er, bevor er ihr die Vergebung der Sünden erteilte. Endlich gelang es ihm, ihr ein Lächeln zu entlocken.
Jetzt hatte er eine Schranke zwischen ihnen errichtet. Alles, was sie während der Beichte gesagt hatte, unterlag seiner Schweigepflicht. Aber was sie danach sagte, gehörte allen. So kam es ihm auf jeden Fall heute vor. Und er sollte eigentlich gehen, aber er konnte sich nicht dazu bringen, sich zu erheben und den ersten Schritt zu tun. Einer der Lehrsätze aus Julita schoß ihm in den Kopf, es war wie ein ironischer Kommentar zu seiner gegenwärtigen Lage: Kann der allmächtige Gott einen Stein schaffen, der so schwer ist, daß nicht einmal er ihn tragen kann?
Sie rettete ihn aus seiner Verlegenheit, indem sie etwas hervorzog und über die Rückenlehne der Bank legte und über seine Knie und Hände ausbreitete. Es sah aus wie eine mattgoldene Flamme aus schwerer Seide. Der Stoff fiel weich, glänzend und kühl zwischen seinen Fingern, so daß es ihm kalt den Rücken hinunterlief. Es war ein Hemd. Ihre Mutter hatte es erwähnt, daß sie an einem Geschenk für den Bräutigam nähte. Er sah sie verstohlen an, während sie die Säume glattstrich, damit er sehen konnte, wie geschickt sie mit einer Nadel umgehen konnte. Stolz, strahlend vor Freude und Erwartung und Lieblichkeit.
Aber in seinem Magen saß eine geballte Faust schwelender Angst; ihm fiel nichts ein, was er sagen könnte, um die Spannung zu zerreißen. Sie hockte sich vor ihn und breitete mit einem leichten Wurf die Seide aus. Die Bank war so niedrig, daß sie gerade zwischen seinen Knien Platz fand. Um ihr zu helfen, ließ er die Seide über seine Hand gleiten und suchte blindlings unter der Herrlichkeit, traf auf ihre Hand, die still dalag und wartete.
Taumelig vor Glück und voller Angst vor einer Entdeckung, ließ er seine Fingerspitzen über den fremden Handrücken fahren, zwischen ihre Finger, und schloß seine Hand um die ihre. Sie ließ es zu. Endlich konnte er sie anblicken, aber nicht die Augen, er traute sich nicht, weiter als bis zum Mund zu sehen.
Ohne auch nur im geringsten ihre Stellung zu wechseln, hob sie die freie Hand und legte sie über sein Gesicht, strich mit gespreizten, neugierigen Fingern über seine Wange und sein Haar, das zu einem dichten roten Kranz direkt über den Ohren geschnitten war.
Dann vergaß er Julita, den großen Stein Gottes, Ture in Ornäs und die Schweigepflicht und küßte sie.
Es ging leicht, sogar ohne Übung. Dabei hatte er seit seiner Kindheit nicht gesehen, wie diese Kunst ausgeübt wurde. Nicht einmal die Stellung der Nase machte ihm Probleme. Es ergab sich von selbst.
Er hätte es vielleicht schon vor langer Zeit tun sollen – aber woher sollte er wissen, daß sich ihr Mund öffnen würde wie eine Blume, wenn die Sonne aufgeht, und daß die Zunge, die er sonst kaum beachtete, sich in einen anderen Mund wagen und auf eine schlanke, geschmeidige, unruhige, liebkosende fremde Zunge treffen würde, die sich um seine wand?
Leider mußte er sie loslassen, um Luft zu holen, aber sie lachte ihn nicht aus. Sie blieb auf den Knien vor ihm sitzen, lehnte ihre Stirn an seine Brust, die Arme um seinen Leib geschlungen; und er bezweifelte sehr, daß ihm seine Beine und Füße gehorchen würden, wenn er irgendwann den Entschluß fassen würde, aufzustehen und wegzugehen.
Kurzes, heftiges Zittern durchlief sie, und er erschrak und hob ihr Gesicht, die Hand unter ihrem Kinn, um zu sehen, was los war. Sie wehrte sich dagegen, aber er sah alles. Sehr einfach und einzigartig zugleich. Sie weinte, und das war seine Schuld. Sie weinte wie alle anderen Menschen, wurde rot um die Augen und bekam Flecke auf den Wangen, konnte ihren Mund kaum beherrschen. Das zarte, feste Fleisch, wo die Haut kaum einen Kratzer zeigte. Sie setzte sich wieder auf die Bank neben ihn, hob das Seidenhemd vom Boden auf, wo es gelandet war, zupfte mit den Nägeln in einem der Säume, während die Tränen große, dunkle Flecke auf dem feinen Stoff hinterließen. Sie fädelte den Faden ein und begann zu nähen, während das Weinen ihr Gesicht zu einer kleinen, verkrampften Maske der Unermüdlichkeit verzerrte. Er haßte die Nadel so von Herzen, daß er sie hätte zerbrechen und alle Stiche auftrennen können. Aber sie nähte unangefochten weiter, hart und bitter, und das gönnte er Ture von ganzem Herzen.
»Die haben mal gesagt«, erklärte sie flüsternd, und trocknete ihr Gesicht mit dem Ärmel, »daß ich die Absprache rückgängig machen könnte, wenn ich Ture doch nicht haben wollte. Aber wie sollte das zugehen – ich kenne ja nur dich.«
Das Weinen setzte wieder ein, aber sie kämpfte tapfer dagegen an. Er wußte, was sie meinte. Tore Jonsson würde sie mit Gewalt vom Kleinbauernhof des Priesters in Grytnäs zurückholen, bevor auch nur ein Tag vergangen war.
Aber es erschütterte ihn – daß sie so sehr mit der Sache beschäftigt war, daß sie sich solche Gedanken gemacht hatte, ohne daß er es geahnt hatte.
Dieses war der Anfang und das Ende ihrer Beziehung. Gleichgültig, was er sonst noch erleben würde, kein anderer Moment könnte so viele widersprüchliche Gefühle auslösen wie dieser.
»Du bist mein Freund, ich habe keine anderen«, sagte er«, überrascht von seiner Selbstbeherrschung. Sie waren viel zu ernst, alle beide, fand er – und im selben Augenblick verschwamm sein Blick, und etwas Warmes lief über die Wange zum Mund, schmeckte salzig und warm. Das Schwindelgefühl ließ den festen Boden unter ihm in einem Zug schwanken. So war es, wenn man etwas verlor. Eigentlich sollte er dieses Gefühl kennen; sein ganzes Leben war eine Kette unerwarteter, schmerzhafter Verluste gewesen.
Mit der Sicherheit von Besitztümern konnte man sie nicht locken, das hatte er erkannt. Die Sicherheit, die sie in reichem Maße bei Ture in Ornäs finden würde, wer immer der Mann auch war, dieser glückliche, verhaßte Unmensch. Ihr die scharfen Steine aus dem Weg zu räumen – welch eine Dummheit! Wenn sie es sich in den Kopf setzte, würde sie barfuß über Glasscherben gehen.
Sie stand nackt mitten im Raum, umgeben von den fremden Frauen – ihre Mutter und Margareta, Tures Schwester, legten das rote Seidenhemd zu einem Ring zusammen und ließen es über sie gleiten. Die Frau ihres Onkels, Kristina, wartete mit dem steifen Überkleid aus schwerem, dunkelblauem Stoff, gewebt mit Silberfäden, die es schwer machten. Auch das Überkleid mußte ihr über den Kopf gezogen werden, und es legte sich wie eine liebevolle Hülle um sie. Mit Ärmelausschnitten, eingefaßt mit weißem Leder, die bis zu den Hüften hinunterreichten. Wie eine neue Hautschicht schmiegte sich das Hemd um ihren Körper, ihre Hüften, ihre Taille, ihre Brüste und ihre langen, dünnen Arme. Oben an den Schultern bestand das Überkleid nur aus schmalen Riemen, welche die vielen Falten des weichen, schweren Rockes trugen.
Aber die Kleidung war nur ein Teil der Pracht. Sie hängten ihr das Reliquienkreuz um den Hals, mit dem kleinen Splitter von der Schädeldecke von einem der Gebrüder Unaman, Sunaman oder Vinaman. Der Gürtel aus zwanzig runden Silberplatten, wie Seerosenblätter, ruhte auf ihren schmalen Hüften. Und die Brautkrone, die Kristina und ihr Onkel Ingemar mitgebracht hatten.
Sie drehten sie herum, um das Werk zu bewundern, und wirkten zufrieden. Die Sprecher des Bräutigams waren auf dem Weg zurück zum Gefolge, um den jungen Mann zu holen. Sie hörte sie draußen rufen. Es war höchste Zeit, sie hinauszulassen. Sie war seit Monaten eingesperrt gewesen, konnte es kaum erwarten, daß die Tür geöffnet wurde und ihr Vater die Gäste begrüßte, bevor sie auf den Laubengang hinausgeführt wurde.
Weiter kam sie zunächst nicht, blieb stehen, geblendet und überwältigt, und blinzelte ins Licht. Die scharfe, wache Sonne des Spätherbstes. Die Luft war klar vor Kälte. Wie durch glitzerndes, klares Glas sah die Braut die Menschen und Tiere, erhellt und gesättigt von Farbe, wie die Bilder im illuminierten Gebetbuch des Herrn Michael. Der Hofplatz und das Plätzchen zwischen den Ställen war voller Menschen und Pferde, ein Wirrwarr von flimmernden, unruhigen Farben, die wie in Erwartung wogten.
Die Gäste hatten sie entdeckt und winkten und klatschten – unten, beim hintersten Hoftor, versuchte eine kleine Gruppe von Reitern sich mühsam, Schritt für Schritt, einen Weg zu bahnen. Mehr bekam sie nicht zu sehen; ihr Vater legte seine Hand auf ihre Schultern und zwang sie sanft, die ersten Treppenstufen hinabzusteigen. In den langen Kleidern geriet sie plötzlich ins Stolpern, ihr Rücken schwankte für einen Augenblick nach hinten, aber sie fand das Gleichgewicht wieder und ging weiter.
Unten zwischen den Gebäuden zogen die Menschen sich zurück, so daß um sie herum Platz geschaffen wurde. Die Vorreiter des Bräutigams waren ins Gedränge gekommen, sie riefen einander aufmunternde Worte zu, und einer von ihnen sonderte sich ab und trat näher.
Es war das Pferd, das sie sah. Eine rote, glänzende, hochbeinige Stute, mit Geschirr aus geflochtenen roten und gelben Lederriemen, einer viereckigen Satteldecke aus rotem, seidenbesäumtem Stoff, steif vor Stickereien, Wappenschilden und blitzenden Adlern. Kleine rote Seidenquasten hingen vom Zaumzeug und von den vier Ecken der Satteldecke herab.
Eine Krone und der Schmuck drückten die Braut nieder, so daß sie nicht zu dem Mann aufsehen konnte. Sie hatten sie gebeugt und unterwürfig gemacht, sie wagte keine plötzliche Bewegung mehr. Es war ein unbehagliches, unbekanntes Gefühl.
Er zog seine Kleidung zurecht, bevor er das rechte Bein über den Pferderücken schwang und sich hinabgleiten ließ, klirrend und schwer. Aber sie sah ihn erst richtig an, als er sie an die Hand nahm. Der Käfig von einem Gewand, in das man sie gesteckt hatte, machte ihre Bewegungen schwerfällig, und das gefiel ihr gar nicht.
Ein Jahr zuvor hatte er sie auf Avesta besucht. Sie waren verlegen gewesen und hatten erwachsen und vernünftig miteinander geredet; aber sie hatten nie das peinliche Thema berührt, daß sie heiraten sollten, und dann auch noch einander. Wann immer sie sich von ihm unbeobachtet wähnte, hatte sie ihn mit einem kritischen Blick abgeschätzt – überzeugt, daß er das gleiche tat. Den Jagdhabicht, den er ihr zu Weihnachten geschenkt hatte, hatte sie ihrem Vater gegeben – was sollte sie denn damit anfangen? Wußte er denn so wenig von ihr, daß er ihr ein Tier schenkte, das man nur zum Töten von Singvögeln gebrauchen konnte? In ihren Gedanken und Träumen hatte sie sich nie sonderlich mit Ture beschäftigt. Aber er mußte an sie gedacht haben, wenigstens gelegentlich, denn er hatte die Hochzeit verschoben, bis sie vierzehn Jahre alt war.