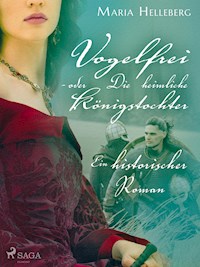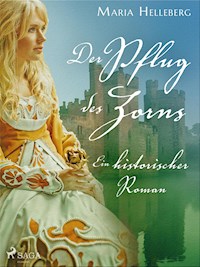Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Aufregender historischer Roman aus der Zeit der AntikeOhne Eltern wächst Thaïs in einem Hurenhaus auf, wo die schöne, kluge Frau zur Hetäre, einer gelehrten Gespielin wichtiger Männer ausgebildet wird.Thaïs verkehrt schon bald mit großen Rednern und Philosophen. Sogar Alexander der Große gerät in den Bann der schönen Kurtisane. Thaïs begleitet die Männer auf ihren Feldzügen, bringt unterwegs Kinder zur Welt, feiert Orgien und wird zur wichtigsten Frau im Leben des Großkönigs. Am Ende ihres Lebens beauftragt sie den Eunuchen Menandros, ihr Leben aufzuzeichnen.Die Kurtisane des Kaisers" ist die unglaubliche Lebensgeschichte der Griechin Thaïs, eine der sagenumwobensten Frauen der Antike. "Insgesamt hat mir das Buch allerdings sehr gut gefallen, da man einen schönen Einblick in die Zeit zu Alexander dem Großen erhält." Kerstin, Lesestunde.wordpress.com-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 460
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Maria Helleberg
Die Kurtisane des Kaisers - Ein historischer Roman
Saga
Die Kurtisane des Kaisers - Ein historischer Roman ÜbersetztKerstin Schöps Copyright © , 2019 Maria Helleberg und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726350845
1. Ebook-Auflage, 2019
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk
– a part of Egmont www.egmont.com
Während eines Gelages, als man schon viel getrunken hatte und vom Weine ziemlich erhitzt war, ergriff die Berauschten eine wahre Raserei. Es sagte nämlich eine von den Weibern in der Gesellschaft, namens Thaïs, daß unter Alexanders Taten in Asien jene die schönste wäre, wenn er einen Bacchantenzug, einen Komos, mit ihnen anführen würde und die Königsburg in Brand steckte, so daβ die Herrlichkeit der Perser durch Weiberhände in kurzer Zeit vernichtet würde. Man kann sich denken, daβ auf diese Worte, zu jungen Männern gesprochen, die durch den Wein die Besonnenheit verloren hatten, sogleich die Gäste »Wohlan« riefen, und begehrten, man sollte die Fackeln anzünden und den an den Tempeln der Griechen verübten Frevel rächen. (...)
Der König selbst wurde durch diese Reden Feuer und Flamme, und so sprang die ganze Trinkgesellschaft auf und erklärte, als Siegesfeier eine Prozession zu Ehren Dionysos veranstalten zu wollen. Bald waren viele Fackeln herbeigebracht, und der Zug begann, da Musikerinnen an der Trinkgesellschaft teilgenommen hatten, unter Gesang und Pfeifen- und Flötenspiel. Der König ging voran, und die Hetäre Thaïs leitete das Ganze. Sie war es, die als zweite nach dem König eine brennende Fackel in die Königsburg schleuderte. Dasselbe taten dann die anderen, und schnell war die Burg und alles ringsumher von den gewaltigen Flammen verzehrt. Das Bemerkenswerte daran war nun, daß, was der gottlose Perserkönig Xerxes der Burg der Athener angetan hatte, durch ein einziges Weib, eine Bürgerin der von dem Unglück betroffenen Stadt, viele Jahre später aus purem Vergnügen mit derselben Münze heimgezahlt wurde.
(Diodor Von Sizilien, Universalgeschichte,
Buch xvii, 72)
Als er im Frühjahr im Begriff war, erneut gegen Dareios zu ziehen, nahm er noch eine Einladung seiner Freunde zum Zechen und Feiern an. Bei diesem Gelage nahmen auch Frauen teil, um dort ihre Liebhaber zu treffen. Unter ihnen genoß Thaïs besonderes Ansehen, die Geliebte des späteren Königs Ptolemaios, eine Bürgerin Attikas von Geburt.
Im Verlauf der Feier hob sie an und machte Alexander mal Komplimente, mal scherzte sie mit ihm, und ließ sich endlich im Rausch zu einer Rede hinreißen, die wohl die Haltung ihres Vaterlandes widerspiegelte, aber ihrem Stand nicht angemessen war. Sie sagte nämlich, daß sie für die Mühseligkeiten, die sie auf der langen Reise durch Asien erduldet habe, an jenem Tag den Lohn empfange, an dem sie in dem stolzen Königspalast der Perser feiern dürfe. Noch lieber aber würde sie hinziehen und das Haus des Xerxes, der Athen niedergebrannt habe, in Brand stecken und selber vor den Augen Alexanders die Fackel hineinwerfen, damit es unter den Nachkommen heiße, daß sich die Weiber im Gefolge Alexanders härter an den Persern für die griechischen Leiden gerächt hätten als ihre Generäle.
Ihre Rede wurde mit lautem Klatschen begrüßt. Die Freunde des Königs feuerten ihn so lange an, bis er sich schließlich überreden ließ, aufsprang, sich eine Fackel griff und mit einem Kranz auf dem Haupt den Zug anführte. Die übrigen Festteilnehmer folgten ihm mit Geschrei und umringten tanzend den Palast.
(Plutarch, Lebensbeschreibungen, Alexandros, 38)
Der erste tag des vierten monats im 54. Jahr nach der gründung alexandrias
Von Menandros, Dem Soeben Ernannten Vorsteher Der Verschlossenen Königlichen Archive Im Museion Von Alexandria
Ein Kurzes Vorwort Zu Dem Hier Eingemauerten Manuskript, Mit Besonderer Genehmigung Des Königs
Heute, unmittelbar nach meinem Amtsantritt, ist es meine Pflicht, dieses Manuskript einzumauern, das indirekt das Schicksal des Reiches und meines Lebens beeinflußt hat.
Nichts von alldem, was mir widerfahren ist, seitdem Demetrios von Phaleron meine Wenigkeit unter Hunderten von jungen Schreibern im Museion auserwählt hat, hätte in der Alten Welt der Königinmutter Thaïs geschehen können. Freiheit war in dieser untergegangenen Welt nur sehr wenigen vorbehalten. Mein Aufstieg ist nur hier in Alexandria möglich gewesen, in der Neuen Welt, der sie so sehr mißtraute.
Die Erinnerungen eines einzelnen Menschen lenken meinen Blick nun zurück auf die Alte Welt. Niemand außer mir, dem König und seiner Gemahlin kennt Thaïs’ Erinnerungen. Das verbindet uns.
Es ist im Interesse der Königin Arsinoë, daß meine Kenntnisse – jetzt, da ich Minister und ein Freund des Königs geworden bin – versiegelt und verborgen werden. Aber es hat mir großes Vergnügen bereitet, mich bei Tagesanbruch von meiner Vergangenheit zu verabschieden und zukünftigen Lesern die wahre Geschichte zu erzählen. Ich hoffe, daß es mir gelungen ist.
Ich empfehle hiermit den kommenden Generationen, aus diesem exklusiven Wissen zu lernen und dem Begründer der Dynastien, dem göttlichen Ptolemaios I. Soter, dem Erlöser, nachzueifern und nicht seinem Sohn, Ptolemaios Keraunos, dem Donnerkeil.
1.
Der fünfte Tag des Monats hekatombaion im 44. Jahr nach der Gründung Alexandrias
Von Menandros, Schriftführer Ersten Ranges an den Vorsteher Der Verschlossenen Königlichen Archive im Museion von Alexandria, Demetrios Von Phaleron
Erst nach langen Überlegungen wage ich es heute, dieses Material an das Archiv zurückzusenden. Nachdem ich nun zwei Jahre versucht habe, den Auftrag der Zweiten Abteilung des Reichsarchivs im Museion zu erfüllen, muß ich feststellen, daß wir zu keinem Ergebnis gekommen sind.
Dies sind meine vorläufigen Erträge, die ich nur äußerst ungern in der gegenwärtigen Form abliefere, aber ich mußte feststellen, daß die Königinmutter keinerlei Interesse hat, die Arbeit zu beenden.
Ich habe mich dieser Aufgabe anfangs mit den besten Absichten und Wünschen gewidmet. Heute ist es genau zwei Jahre her, daß Ptolemaios Soter mich auserwählte, die Lebensgeschichte der Hetäre Thaïs niederzuschreiben, und ich habe mein Bestes gegeben, um diesem ehrenhaften Befehl nachzukommen. Als meine Familie mich damals in die Obhut der Eunuchen gab, war mir niemals der Gedanke in den Sinn gekommen, daß ich mein Wissen und Können vielleicht eines Tages in den Dienst des Königs stellen dürfte.
Ich habe mich allen Forderungen bedingungslos unterworfen. Sieben Jahre lang habe ich von den besten Lehrern im Museion die Kunstfertigkeit des Schreibens und Verfassens erlernt und fühlte mich danach in der Lage, diese Aufgabe zu übernehmen. Doch auch Gehorsam hat seine Grenzen, und meine sind seit langer Zeit erreicht.
Mein Nachfolger sollte folgendes wissen: Es gibt weder ein Arbeitszimmer noch Mitarbeiter oder besondere Hilfsmittel. Es wird erwartet, daß man die mündlichen Erinnerungen der betreffenden Person mitstenographiert und danach den Text nach allen Regeln der Kunst ausformuliert. Den Befehl für diese Arbeit erließ Demetrios von Phaleron, der wiederum den Auftrag vom König selbst erhalten hat. Darum muß ich die Umstände genauer beschreiben.
Die Dame wohnt in dem größten Haus südlich des Palastes im Stadtteil Brucheion, mit Aussicht auf das Mausoleum des Alexander, das wir Alexandriner nur »das Grab« nennen. Es ist derselbe Alexander, den sie beständig als »ihren Freund« bezeichnet. Sie ist zwar schon sehr betagt, aber im Besitz eines erstaunlichen Erinnerungsvermögens, das sich auch auf Tagebucheinträge und Aufzeichnungen stützt. Sie leidet nicht unter Altersschwäche. Vielleicht wäre meine Aufgabe leichter gewesen, wenn sie vom Alter gezeichnet gewesen wäre.
Sie ist es gewohnt, ihren Willen zu bekommen, und begegnet allen Männern entweder ausgesprochen argwöhnisch oder mit einer noch nicht erloschenen Glut ihrer Verführungskünste. Mir mißtraute sie tief in ihrem Inneren. Sie glaubte offensichtlich nicht, daß ich gekommen sei, um ihren Text zu redigieren, sondern um ihre Erinnerungen auszuradieren. Ich, der ich seit meiner frühesten Kindheit auserwählt war, die Erinnerungen anderer für die Nachwelt zu bewahren!
Sie nannte sich selbst eine Perfektionistin, und ich muß ihr darin vollends recht geben. Im Laufe dieser Monate habe ich mindestens zwanzig Versionen durchgelesen, korrigiert und abgeliefert. Und wir sind noch weit vom eigentlichen Kern der Geschichte entfernt!
Kein Mensch kann einem solchen Druck standhalten!
Ich bitte um eine schnelle Antwort und um die Entbindung von meinem Posten.
Dionysos Pserenkare, Stellvertretender Vorsteher Der Verschlossenen Königlichen Archive, An Menandros, Schriftführer Ersten Ranges
Mit großer Bekümmerung habe ich deinen Brief gelesen, in dem du um Befreiung von deiner Aufgabe ersuchst, die dir von unserem König, Ptolemaios Soter, durch unsere Abteilung zugeteilt worden ist. Mir bereitet diese Befehlsverweigerung größtes Unbehagen, und ich kann dich nur auffordern, deine Arbeit fortzusetzen. Aber zuallererst verlange ich von dir, daß du die Hintergründe für deine Weigerung darlegst und ich umgehend eine vollständige Ausführung des Manuskriptes in seiner jetzigen Form erhalte, wie unfertig es auch sein mag.
Die Tragödie, die das königliche Haus und das Museion durch Demetrios von Phalerons überstürzte Abreise in Begleitung des verstoßenen Königssohnes, Ptolemaios Keraunos, erlebten, darf keinen Einfluß auf deine Aufgabe nehmen. Selbst in seiner Verbannung bei den Schlammbauern auf dem Land in Oberägypten wird Demetrios von Phaleron von deiner Weigerung gehört haben. Sein Wort ist Gesetz. Kein Eunuch im Museion darf sich seinem Befehl verweigern. Wir sind darum gezwungen, deinen Brief an den König weiterzureichen und ihm die Bemessung deiner Strafe zu überlassen. In meinem Haus läuft man nicht vor einer unerledigten Arbeit davon!
Für die Zukunft wünsche ich nicht nur den eigentlichen Text für die Reinschrift und Archivierung zu erhalten, sondern überdies einen vertraulichen und persönlichen Bericht über den Charakter der einzelnen Treffen und die Entwicklung der Geschichte. Wie mir bekannt ist, fertigen alle meine Schreiber solche Berichte für ihren eigenen Gebrauch an. Ich wünsche die Leinen zur Einsicht, eventuell bereits in Reinschrift als Anhang zu dem eigentlichen Text.
Im übrigen möchte ich noch an die Tatsache erinnern, daß Ptolemaios Soter einen Termin für die Abgabe des Werkes festgesetzt hat.
Ich bin mir vollkommen über die Natur der Aufgabe und die Fallgruben bewußt, die ein Berichterstatter umgehen muß. Aber gerade die erfolgreiche Bewältigung einer so widerspenstigen Aufgabe unterscheidet den guten von dem herausragenden Berichterstatter. Darum befehle ich dir hiermit unmißverständlich, die Aufgabe unverzüglich wiederaufzunehmen, das bereits zurückgesandte Material wieder abzuholen, zu sortieren und in einer vernünftigen Form erneut abzuliefern. Das geschieht zum Wohl des Auftraggebers, des Schriftführers und der Archivarbeiter.
Von Menandros, Schriftführer Ersten Ranges, an Dionysos Pserenkare, Vorsteher Der Verschlossenen Königlichen Archive im Museion von Alexandria
Hiermit akzeptiere ich demütigst Ihre Forderungen und sende anbei den ersten Auszug aus den Erinnerungen der Königinmutter. Dennoch muß ich um Verständnis bitten, daß aus dem vorliegenden, von ihr freigegebenen Material noch keine chronologische Erzählung entstanden ist.
Menandros’ Notizen zu dem Text:
Ich hatte weder die Wahl zu gehorchen noch mich zu verweigern. Gewaltsam wurde ich zum königlichen Palast im Brucheion gebracht und zwischen zwei stumme Diener plaziert, die nach Schweiß und billigem Öl rochen.
Dort begegnete ich zum ersten Mal Ptolemaios Soter, dem ersten seines Namens. Zwar hatte ich ihn schon unzählige Male zuvor gesehen, als er durch die Stadt getragen wurde oder sich als Oberster Richter zeigte, aber bislang schien er mir einem Gott ähnlicher zu sein als einem Menschen.
Der Mann, der sich vor mir aufbaute, war uralt und groß wie ein Scheunentor. Eingehüllt in einen golddurchwirkten Stoff, der die Umrisse seines Körpers verdeckte, stützte er sich auf zwei Stöcke und gelangte so zu einem riesigen hölzernen Thron. Viel zu spät erkannte ich, daß er meine Hilfe benötigte, aber als ich mich ihm näherte, winkte er mich irritiert beiseite.
»Du verstehst, wie verlautet wird, nicht, warum ich die Erinnerungen der Königinmutter niederschreiben zu lassen wünsche«, sagte er mit einer Stimme, die aus den Tiefen seines gewaltigen Körpers emporzusteigen schien, und heftete dabei seinen Blick auf mich. Wo Zeus seine tödlichen Blitze schleudert, benutzen Könige dafür ihre Augen. Er hielt meinen Blick fest, und ich ging in die Knie, um ihn nach allen Regeln der Kunst zu begrüßen. Ich erkannte sein Gesicht von den Münzen und zahlreichen anderen Abbildungen wieder: das dichte, lockige Haar und die vollen Lippen, die breiten Wangen und hervorstehenden Augen. Und doch war er ein Zerrbild seiner selbst. Götter altern nicht.
»Laß mich versuchen, dir meine Beweggründe zu erläutern«, sagte er und trocknete sich seine Mundwinkel. »Ich bin als einfacher makedonischer Bauernsohn geboren worden und werde als König von Ägypten sterben. Ich kenne die Alte Welt, ihre guten und schlechten Seiten. Jene Welt, die Thaïs erhöht und weit über Gebühr bewundert und verehrt. Das Fundament jener Neuen Welt, die sie und ich zusammen mit einer Handvoll von Makedonen aus dem Nichts erschaffen haben, besteht aus den wunderbaren hellenistischen Idealen, die Thaïs verficht. Zumindest in der offiziellen Version. Ich bin der einzige, der die ganze Wahrheit kennt. Denn nur ein König darf Einsicht in diese untergegangene Welt nehmen. Thaïs hat unzähligen Schreibern von der wundervollen ›Freiheit‹ in den hellenistischen Stadtstaaten vorgeschwärmt. Aber diese Freiheit war mörderisch und brachte Chaos und Ungerechtigkeit mit sich. ›Freiheit‹ in den hellenistischen Stadtstaaten bedeutete in Wirklichkeit, daß alle außer den freien Männern in noch größerer Unfreiheit lebten als unsere Sklaven in Alexandria. Hier haben wir eine Neue Welt für sie erschaffen, in der wahre Freiheit viel mehr zählt. Die Frauen in meiner Stadt können sich ihre Ehemänner selbst aussuchen, sich wieder von ihnen scheiden lassen und ihr Eigentum ohne Vormund selbst verwalten. In dem von Thaïs so geliebten Athen war selbst die vornehmste Frau ihr Leben lang unmündig. Erinnere sie daran, wenn sie sich wieder in Lobeshymnen über die Vergangenheit verliert!«
Ich war zunächst wie gelähmt, beeilte mich dann aber, seine Worte niederzuschreiben, um später seinen Rat befolgen zu können. Mir fiel auf, daß der König sie schlicht bei ihrem Namen nannte – für ihn war sie nicht die Königinmutter, sondern Thaïs. Er liebt sie noch immer, schoß es mir durch den Kopf.
Wer von den beiden hat nun recht mit seiner Einschätzung, sie oder der König? Ich weiß es noch immer nicht, aber neige dazu, dem König recht zu geben. Mein eigenes Schicksal kann als Bestätigung seiner Aussage gelesen werden. In Athen hätte ich kein Stimmrecht gehabt, ich wäre so unmündig gewesen wie ein Kind oder eine Frau. In Alexandria allerdings gibt es gar keine Abstimmungen, dem König gehört die Stadt, so wie ihm auch seine Untertanen und ganz Ägypten gehören. Seine Gerechtigkeit ist göttlich.
In Alexandria gibt es auch keinen Bürgerkrieg, hier wird kein hochgeehrter Politiker abgesetzt und durch die Stadt gejagt, während seine Wähler ihn bespucken und wüst beschimpfen. Hier wird auch kein Politiker gezwungen, den Schierlingsbecher zu leeren. Dafür kann der König sogar seinen ältesten Sohn verbannen, wie er es mit Ptolemaios Keraunos, dem Donnerkeil, getan hat. Die brutale Macht und Gewalt versammelt sich hier im Hause des Königs und seiner Nachkommen, und doch ist es hier viel besser als in Athen, wie ich verwundert feststellen muß, jetzt, da es zu spät ist, um ihre Antwort zu hören.
Und damit stehen wir unmittelbar vor dem Tag, an dem ich zum ersten Mal Thaïs aus Athen, die Königinmutter, traf. Das liegt jetzt zehn Jahre zurück.
Der neunte Tag des ersten Monats im 44. Jahr nach der Gründung Alexandrias
Von Menandros, Schriftführer Ersten Ranges, an den Vorsteher Der Verschlossenen Königlichen Archive im Museion von Alexandria
Bei unserer ersten Begegnung zog Thaïs eine Reihe von Aufzeichnungen aus der Schublade, die ihrer Meinung nach das Gerüst der Erzählung bilden könnten. Aber wie es für eine Frau ohne richtige Ausbildung charakteristisch ist, verkannte sie offenbar das Problem einer so komplizierten literarischen Arbeit wie des Aufzeichnens persönlicher Erinnerungen, die sich über fast achtzig Jahre erstreckten.
Zunächst mußte ich mich mit ihrer Person vertraut machen und darum fragte ich, wann sie die Bekanntschaft mit Ptolemaios Soter gemacht und ob sie bereits damals sein besonderes Wesen erkannt habe. Ich hatte den öffentlich zugänglichen Unterlagen im Archiv entnehmen können, daß sie bereits befreundet waren, als Ptolemaios Soter noch ein junger Mann war. Und darum ging ich davon aus, daß seine Göttlichkeit sie damals so betört hatte, daß sie ihm nach Makedonien folgte.
Sie verstand mich nicht, glaube ich, aber sie lachte.
Da hier die Rede von einer (mindestens) achtzigjährigen Frau ist, die nicht mehr im Besitz besonders vieler Zähne war, ist Gelächter nur eine weitere Verunstaltung, die sich zu den anderen gesellte. Dennoch überraschte sie mich. Sie erklärte ihr Verhalten nicht, sondern bat mich, andere Fragen zu stellen, die einfacher zu beantworten seien.
»Den König habe ich nämlich nie kennengelernt«, fügte sie hinzu.
Es ist an der Zeit, etwas über ihre Erzählweise zu sagen, die mir von Anfang an meine Arbeit erschwert hat. Thaïs spricht sehr langsam und deutlich und flötet beinahe die Vokale. Als ich eine Bemerkung über ihre Sprache fallenließ, lachte sie geschmeichelt und erwiderte, daß sie Attisch sprechen würde, die echte, reine Muttersprache, die ihre Landsmänner über Jahrhunderte feingeschliffen hätten. Sie spreche das gleiche Attisch wie Aischylos, fuhr sie fort und rezitierte einige Zeilen. Ich erkannte den Ausschnitt aus Pindars Olympischen Oden wieder.
Ich erinnere mich genau, wie sie ihre knochigen, aber noch immer schönen Hände behutsam übereinanderlegte, so wie sie es bestimmt schon vor sechzig Jahren gemacht hatte. Sie brachte sie nicht nur in eine bestimmte Position, sie präsentierte sie regelrecht. Nicht ihre Ringe, ihr Alter oder ihre Gebrechen, sondern ihre Anmut. Alles, was sie tut, geschieht, um beim Gegenüber Behagen auszulösen und ihrer Schönheit Ausdruck zu verleihen.
Ich bemerkte den Glanz in ihren Augen: Meine Unwissenheit amüsierte sie und regte sie an, mich damit zu necken. Darum fragte ich sie, ob sie den Grund kenne, warum wir im Reichsarchiv des Museions den Auftrag erhalten hätten, ihre Erinnerungen aufzuschreiben und sie in den Verschlossenen Königlichen Archiven aufzubewahren.
»Warum sollten sie das nicht wollen?« lautete ihre Gegenfrage. »Er ist doch wie Alexander vor ihm auch Perser geworden!«
Ich antwortete wahrheitsgemäß, daß die Archive bisher nur die Aufzeichnungen von Ptolemaios Soters Autobiographie sowie das Originalmanuskript seiner Beschreibung vom Feldzug Alexanders des Großen beherbergten. Und in dieser Gesellschaft erschienen mir die Erinnerungen einer ehemaligen Hetäre doch etwas fehl am Platz.
Da erhob sie sich und schlug mit dem Stock zu, auf den sie sich beim Gehen stützt. Das geschah so unerwartet, daß ich keine Zeit hatte auszuweichen, so daß ich lange mit einem zugeschwollenen Auge herumlaufen mußte und starke Schmerzen in meiner rechten Gesichtshälfte spürte.
»Ich habe Persepolis niederbrennen lassen!« schrie sie mich an. »Man tut gut daran, mich mit Vorsicht zu behandeln!«
Ich bezweifle nicht, daß ein Gesprächspartner mit mehr Erfahrung und Würde sie bezwungen hätte. Aber ich war und wurde (und bin es immer noch) nun einmal der für diese Aufgabe Auserwählte.
Eine Frau kann also offenbar auch Erfahrungen gesammelt haben, die es wert sind, andere daran teilhaben zu lassen, selbst wenn sie in ihrer Bedeutsamkeit wohl kaum die eines Mannes erreichen können. Folglich ist weder die Fülle des Materials noch seine Bedeutsamkeit verantwortlich dafür, daß das Werk unvollendet ist, sondern lediglich die Widerspenstigkeit und Sturheit der Erzählerin.
Sie ist es gewohnt, über Männer zu gebieten und mit ihnen zu spielen. Jetzt hat sie aber nur mich, und ich besitze zu wenig Erfahrung, um ihr den Widerstand zu bieten, den sie einfordert und den ihre Geschichte verdient hätte.
Bericht von der zweiten Begegnung
Sie bat mich – nach dem Zwischenfall mit dem Stock –, sie eines späten Abends bei sich im Garten aufzusuchen, der bis hinunter zum Fluß reicht. Ihr Haus war größer, als ich es erwartet hatte, und bereits bei unserem ersten Treffen hatte sie mir erklärt, daß sie niemals auf Luxus verzichtet habe. Sie habe zu den ersten Griechen und Makedonen gehört, die nach Alexandria gekommen seien, und habe damals selbst die Grenzen ihres Grundstückes bestimmen können. Ich ahnte das Schlimmste und hoffte das Beste.
Während wir stumm im Garten saßen und den unzähligen Booten zusahen, die träge den grauen Fluß hinabtrieben, wartete ich darauf, daß sie mit ihrem Bericht beginnen würde. Aber erst als die Dunkelheit sich über uns gesenkt hatte, fing sie an zu sprechen. Ich konnte ihr Gesicht nicht mehr erkennen, nur ihre Stimme hören.
Die kleine Öllampe neben meiner Papyrusrolle spendete gerade soviel Licht, daß ich meine Schrift sehen konnte. Ich hatte gehofft, daß sie ihre Lebenserinnerungen schlüssig und zusammenhängend vortragen würde.
Aber Frauen werden, wie auch die Priester wissen, in weit größerem Ausmaß von ihren Gefühlen und plötzlichen Eingebungen beherrscht. So begann die Dame mit einemmal von den Straßen in Baktrien zu plaudern und von den Bergen Sogdiens, die so grau wie die Erde seien und mit Schwefel überzogen. Sie erzählte von den Flöten der Hirten in den engen Flußtälern, vom Lachen der kleinen Jungen auf den Rücken der Elefanten in Indien und vom Geräusch des Quellwassers in den schmalen Schluchten. Und von der Wüste sprach sie, von der Gedrosischen Wüste, die am Ende doch noch ihren Geliebten und sein ausgehungertes Pferd freigegeben hatte. Sie beschrieb diese Einzelheiten so lebendig, daß ich zum Schluß den Faden verlor.
Dann verstummte sie, trank und wartete ab. Auch ich wartete, ohne zu wissen, was sie von mir wünschte. So kann man unmöglich eine Lebensgeschichte beginnen! dachte ich. Aber hätte ich ihr das sagen können?
Meine hervorragende Ausbildung und Erziehung im Museion lehnten sich dagegen auf. Ich wußte, daß ich recht hatte. Man muß den Wert von Ordnung anerkennen und lernen, Prioritäten zu setzen. Sie überhörte alle meine Einwände geflissentlich, oder vielmehr: sie übertönte sie – wenn ich so frei sein darf.
»Bist du ein Eunuch, kleiner Schreiber?« fragte sie milde. Es gab keinen Grund, das zu leugnen, und meine Antwort zauberte ein Lächeln in ihr Gesicht und ließ ihren Blick erneut liebkosend an mir herabgleiten, dieses Mal meinen Nacken hinunter.
»Das soll dich nicht bekümmern, mein Freund, du bist sicherlich glücklicher ohne diese Unruhe, die alle anderen erfüllt«, sagte sie und brach in ein höhnisches Gelächter aus.
»Sag mir, da du ja im Brucheion und in dem neuen Palast ein und aus gehst, ob du weißt, mit wem der König zur Zeit zusammenlebt? Ist es seine Halbschwester, die Tochter seiner vorherigen Frau oder seine Stieftochter?«
Ich versuchte stumm mein Entsetzen zum Ausdruck zu bringen, was aber nur einen erneuten Lachanfall bei ihr auslöste. Ich solle mich daran erinnern, setzte sie hinzu, daß sie Ptolemaios Soter seit seinem zwanzigsten Lebensjahr kenne.
»Ich habe gesehen, wie sich der gute Wille in Gewalt verwandelt hat, wie Größe sich erniedrigen ließ«, sagte sie, als ich mich verabschiedete. Und dabei zeigte sie auf ein Bild des Alexander, als würde sie es nicht wagen, seinen Namen laut auszusprechen.
»Ich bin keine Greisin, die Hülle trügt«, sagte sie. »Ich bin noch immer die junge Thaïs. Glaube mir. Jede Nacht träume ich von meinem schönen großen Haus in Athen und von meinem kleinen weißen Haus in Dion. Und dann bin ich wieder dreißig Jahre alt und sitze eingehüllt in dicke Wolldecken, um der Kälte zu trotzen. Und ich warte darauf, daß mein Geliebter zurückkehrt und meinem Leben einen Sinn gibt. Doch etwas nagt an meiner Seele, ich weiß nicht mehr, was es ist. Das Haus, das ich vor mir sehe, hat keine
Wände, ist zu allen Seiten offen. Ich sehe hohe graue Berge, die nicht in Makedonien stehen, und in der Halle der Hundert Säulen schwelt es noch an vielen Stellen, meine Kinder spielen und lachen, aber ich kann sie nicht sehen. Ich habe Angst, daß sie sich verbrennen, hinfallen und sich verletzen könnten, aber die Decken sind so eng um meinen Körper geschlungen, daß ich nicht aufstehen kann und dennoch alles sehe und weiß. Ich weiß, daß ich niemals nach Dion zurückkehren werde, daß mein Leben ein anderes ist und daß ich selbst dafür gesorgt habe, daß es ein anderes wurde. Doch die Fäden der Erinnerung werden dünner und dünner. Aber noch halten sie, ich will nicht fort von Dion. Dann erwache ich, erschöpft und verschwitzt von meiner Erinnerung, und erkenne, daß ich in Alexandria bin, sehe mein tatsächliches Alter und begreife, daß ich noch nicht einmal mehr singen kann. Ich bin freier als zu jedem anderen Zeitpunkt in meinem Leben, aber diese Freiheit hat einen bitteren Beigeschmack bekommen.
Weißt du, wann ich zum ersten Mal gestorben bin, kleiner Eunuch? Als meine Stimme verstummte, und das sage ich ohne jede Übertreibung. Als meine Stimme verstummte, wie das im Alter leider geschieht, da starb ein Teil von mir.«
Was hätte ich ihr nur sagen können? Ich war ein Eunuch und kannte nur mein eigenes junges Leben und die Schriften, die ich abschrieb, wieder und immer wieder! Sie hat keine Vorstellung davon, wie festgelegt mein Leben ist, daß ich von jetzt an und bis zu meinem Tod immer und immer wieder dasselbe abschreiben würde, denn das Museion verdient Geld mit dem Verkauf dieser Kopien.
Sie nahm mich mit in die Stadt. Sie selbst war in der großen Sänfte verborgen, aber sie steckte ihre kleine, vom Alter gezeichnete Hand heraus, zeigte auf dies und jenes und führte mich so durch die Stadt. Und wenn sie fand, daß ich zu begriffsstutzig war, nahm sie meinen Kopf in ihre Hände und drehte ihn in die entsprechende Richtung.
Als Alexander und sein Heer Ägypten erreichten, befand sich an der Stelle des heutigen Alexandria nur ein kleines Fischerdorf namens Rakotis. Inzwischen sind die Straßen so breit, daß die Garde des Königs dort marschieren kann, sieben Männer Schulter an Schulter. In einem der Tempel hängt ein Streitwagen aus Bronze unter der Decke, der von Magneten gehalten wird. Im Museion befinden sich Abschriften aller bekannten Manuskripte, Theaterstücke und wissenschaftlichen Abhandlungen. Keine andere Stadt außer unserer besitzt eine solche Bibliothek oder verfügt über so viele Wissenschaftler. Nirgendwo sonst werden die Menschen so alt wie hier, essen so gut und können so gut ausgebildete Ärzte aufsuchen.
Aber hier herrsche keine Freiheit, wiederholte sie unablässig. In Athen habe man wirkliche Freiheit gekannt. In Athen gäbe es freie Bürger, die sich in der Führung des Staates abwechseln würden. In Ägypten würde dem König alles gehören, das Land und die Menschen. Der Staat sei sein Eigentum, ihm würden auch die Götter gehören, er hätte ja sogar selbst eine Gottheit erschaffen, die überall angebetet werde.
Diese Neue Welt sei zu ihren Lebzeiten entstanden. In Ägypten, Syrien, Persien, Makedonien und Kleinasien würde jetzt Griechisch gesprochen werden, es seien dort griechische Tempel und Theater errichtet worden.
Die Königsschlösser hingegen wären persisch, behauptete sie. In Athen gäbe es auch keine Eunuchen, nur freie Männer oder Sklaven.
Die Könige in Athen würden auf der Akropolis leben, ihr Schloß sei verschwunden. Nur Athens Stadtgöttin Athene würde noch oben auf dem Felsen wohnen, die einzige Frau, vor der sich die Athener verneigen.
»Die Geschichte hat mein Leben geschrieben«, sagte sie. »Das Leben aller Menschen, die in irgendeiner Form mit Alexanders Feldzug in Berührung kamen, hat sich verändert. Ich lebte so nah bei ihm, daß ich zu einem Teil des Krieges wurde. Der Wendepunkt in meinem Leben ist also auf große historische Ereignisse zurückzuführen. Darum kann man die Geschichte des Reiches und meines Lebens in einem Zug erzählen.«
Da dachte ich zum ersten Mal, daß dies ihrer Meinung nach der Grund war, warum wir ihre Erinnerungen aufschrieben.
Thaïs weiß nicht genau, wann und wo sie geboren wurde. Aber ihre Eltern kennt sie: Der Vater war ein erfolgreicher Schildhersteller in Athen, und die Mutter stammte aus Milet, war also eine Metökin. Die Eltern waren verheiratet, aber die gemeinsamen Kinder erhielten dennoch kein volles Bürgerrecht. Die Mutter starb zuerst, worauf der Vater eine athenische Bürgerstochter heiratete.
Nur ein Jahr später starb auch er, und Thaïs, noch ein Kind, wurde weggeschickt. So entging ihr ein großes Erbe, das ihr Leben und ihre Möglichkeiten entscheidend verändert hätte. Sie selbst formulierte es so: »Wenigstens bin ich niemals auserwählt worden, im Tempel von Brauron eines von Athens Bärenjungen zu sein.« Was das auch immer bedeuten mochte, ich wagte nicht, sie danach zu fragen. Andere Völker haben sonderbare Bräuche, die sie selbst als etwas ganz Natürliches empfinden. So war das bestimmt auch früher bei den Athenern.
Ich aber war es, der sie daran erinnern mußte, daß ihr so ein erhebliches Erbe verlorengegangen sei, woraufhin sie nur mit den Schultern zuckte. Dann gab sie mir, nahezu ohne jede Regung, eine kurze Zusammenfassung von dem Schicksal ihrer Eltern. Sie konnte noch nicht einmal angeben, wo in Athen ihr Vater gewohnt hatte.
»In Wirklichkeit bin ich sogar froh darüber, daß sie mir mein Erbe und meinen Rang gestohlen haben«, lachte sie. »Überleg doch, mein kleiner Eunuch, wenn die Familie meines Vaters mich anerkannt hätte, dann wäre mein Leben anders verlaufen. Ich hätte in vollkommener Abgeschiedenheit und Unwissenheit leben müssen, scheu wie jede andere Tochter und Frau eines athenischen Bürgers. So hätte ich mich selbst niemals kennengelernt.«
Ich glaube, daß ich sie verstand, aber ich wollte nicht, daß sie sich weiter in diesem Thema verlor, denn ich war gekommen, um ernsthaft zu arbeiten. Das teilte ich ihr dann auch mit, woraufhin sie laut auflachte und mir recht gab.
Das erste, woran sie sich erinnerte, waren die Schläge auf ihre Finger. Rhodope, die Besitzerin des Hauses, in dem sie für ihre weitere Erziehung untergebracht worden war, hatte sie geschlagen. Rhodope schlug so lange mit einem Stock auf ihre Finger, bis sie aufhörte zu weinen. Ein äußerst unlogisches Verhalten. Thaïs forderte, daß diese Erinnerung einen besonderen Stellenwert in der Erzählung einnehmen sollte, und ich habe mich, wie man sieht, ihrem Wunsch gebeugt, obwohl sie im selben Atemzug ihr »kleines weißes Haus in Dion« sowie einen Mann namens Phokion erwähnte.
Ich erinnere mich genau an das erste Mal, als ich in das Andron, den Festsaal der Männer, mit einer Flöte geschickt wurde. Ich erinnere mich an die erwachsenen Frauen in dem Raum und an ihr – mir damals unverständliches – Verhalten. An die Männer erinnere ich mich nicht, denn sie kannte ich nicht. Männer hatten bis dahin keine Bedeutung in meinem Leben gehabt, sie hatten keine Gesichter. Ich sehe es noch sehr genau vor mir, wie sich die Frauen plötzlich verwandelten. Vieles habe ich vergessen, aber nicht Rhodopes Haus und seine Geräusche: das herzerweichende Weinen, die Laute der Doppelflöte, wenn die Mädchen stundenlang übten, ohne den richtigen Ton zu treffen. Ich erinnere mich an Rhodopes Jünglinge, an Streit, Versöhnung und Trennung. Ich habe dort unfaßbare Niedertracht gesehen und erlebt, alles im Namen des jämmerlichen Versuchs, die guten alten Zeiten wiederaufleben zu lassen. Jede Widerwärtigkeit war erlaubt. Die reichen Männer mußten nur eines dieser Bilder auf ihrer Trinkschale entdecken, und schon wurde es nachgestellt. Oft genug hatte ich große Lust, jenen meiner athenischen Landsmänner ins Gesicht zu spucken, die glaubten, daß ein Symposiou vorsah, daß man sich um seinen Verstand trank.
Nach dieser Erzählung stand Thaïs auf und verließ mich. Offensichtlich hatte sie die Erinnerung zu sehr aufgewühlt. Die nächsten Tage erschien ich wie verabredet an ihrer Tür und wurde von wunderschönen Dienerinnen bewirtet. Aber Thaïs selbst bekam ich nicht zu Gesicht, und kein einziger Laut im Haus verriet ihre Anwesenheit. Aber ich wußte, daß sie da war, daß sie allem im verborgenen beiwohnte und mich überwachte. Am vierten Tag empfing sie mich mit freundlicher Herablassung und erzählte stundenlang von ihrer Kindheit. Aber in ihrer Stimme war keine Wärme. Ich tat, als würde ich mitschreiben, und wünschte mir genug Mut, sie zu unterbrechen und um die Wahrheit zu bitten. So glücklich, geborgen und umgeben von Freundschaft, wie sie mich glauben machen wollte, war wohl kaum ein Kind in einem Bordell in Piräus aufgewachsen.
»Liest der König diese Aufzeichnungen?« unterbrach sie vorsichtig ihren Bericht. Das war also der Grund. Sie wollte vor ihm, den sie früher einmal so gut kannte, nicht in einem schlechten Licht erscheinen.
»Glaube ihm kein Wort, wenn er von dem großen Erbe Athens redet«, sagte sie ruhig, aber mit einem spöttischen Unterton. »In Wirklichkeit hat er nicht vor, aus meinen Erinnerungen irgendwelche Lehren zu ziehen. Er will sie einmauern, so daß alle Welt für immer glaubt, daß er die griechische Freiheit bewahrt hat. Dabei hat er sie unterdrückt.«
Das waren ihre Worte. Ich sah weg, um sie nicht unnötig zu reizen.
Sie hatte sich diese neue Version ihrer Geschichte in den letzten drei Tagen ausgedacht, in denen sie mich auf Abstand gehalten hatte, und das irritierte mich. Hatte sie sich schon so weit vom eigentlichen Ziel entfernt, daß sie in mir nur eine Feder sah, die sie benutzen und zerbrechen konnte, wie es ihr gefiel?
Wir aßen zusammen, ohne ein Wort zu wechseln. Sie mußte mein Unbehagen gespürt haben, denn als die Dunkelheit uns wieder unsichtbar machte, ergriff sie das Wort und entschuldigte sich. Sie habe sich eine erträgliche Kindheit aus den Bruchstücken gebastelt, die sie aus ihrem früheren Leben retten konnte, sagte sie. In Wahrheit würde sie sich kaum an die erste Zeit in Rhodopes Haus erinnern, sie wüßte nur, daß sie das jüngste von sieben Kindern gewesen sei. Verschreckte Tiere, die weder Sklaven noch Freie waren. Sie sollten erzogen werden. Oder besser gesagt: Sie waren Schüler in Rhodopes Schule, in der die Unbrauchbaren im Laufe der Jahre ausgesondert wurden. In der Zwischenzeit galt es, soviel Nutzen wie möglich von den Kindern zu haben. Sie schleppten Wasser, putzten und servierten Essen.
Sobald die Mädchen ihre Milchzähne verloren hatten, brachte man ihnen das Flötenspiel bei und ließ sie an den Versammlungen und Mahlzeiten der Männer teilnehmen. Da ich selbst niemals ein solches Etablissement aufgesucht habe, weiß ich nicht, ob sie lügt oder übertreibt, aber ich glaube, daß sie zu Recht verbittert ist.
Die Kinder kamen und gingen, ich aber blieb. Ich war gehorsam, schnell, verstand die Befehle schon beim ersten Mal und hatte ein hübsches Gesicht. Darum setzte Rhodope große Erwartungen in mich. Ihr Etablissement war ein ehrenwertes Haus, sie hätte niemals ihre achtjährigen Kinder an die Kunden verliehen und besaß auch keine Sklaven. Allerdings mußte sie für die Erziehung der Kinder beträchtliche Summen zahlen, und darum waren ihre Preise schwindelerregend. Sie selbst entdeckte die Kinder und suchte sich unter den Mädchen, die von vornehmen athenischen Bürgern ausgesetzt worden waren und gestorben wären, die hübschesten und tauglichsten aus. Oft habe ich gedacht, daß auf diese Weise sicherlich viele Männer mit ihren eigenen Schwestern und Töchtern Verkehr hatten.
Die Hübschen bildete sie zu Prostituierten aus, die Häßlichen verschwanden wieder, entweder wurden sie umgebracht oder verkauft. So hatte Rhodope einigen Reichtum angehäuft, und sie war stolz auf ihren Ruf Unangemessen hohe Preise ziehen allerdings eine besonders vulgäre Klientel an. Rhodope hatte nur einen Feind, und das waren die richtigen Hetären, die edlen Damen. Mit ihnen konnte sie nicht konkurrieren, und darum lästerte sie bei jeder Gelegenheit über sie.
Ob die sich einbildeten, etwas Besseres zu sein, nur weil sie einen statt zehn Kunden hatten? Nur weil sie sich ihre Kunden selbst auswählen konnten? Oder weil ihre Häuser nur für die besten und nicht nur für die reichsten Kunden offenstanden? So konnte sie stundenlang verbittert über diese Frauen herziehen und erreichte doch nur, daß ich die Hetären bewunderte und beneidete. Deren Leben klang so viel verheißungsvoller als unseres, sie mußten auch nicht Doppelflöte während der Symposien spielen. Doch am meisten zog mich der Gedanke an, selbst über mein Leben bestimmen zu dürfen.
Rhodope wählte sich die Mädchen aus, mit denen sie in ihren Gemächern zusammenleben wollte, das bemerkte ich sehr früh. Doch sie wählte niemals mich, denn sie spürte, daß ich sie verachtete. Ich hatte sie durchschaut und war die einzige, die sie eines Tages übertreffen würde. Darum waren wir vom ersten Tag an Feinde.
Eine Bemerkung vom Schriftführer:
Ich habe vor, Rhodopes Wirkungsstätte in Piräus ausfindig zu machen, aber die Dame Thaïs hat mir geraten, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Im Gegenzug hat sie mir aber empfohlen, ein ähnliches Haus für Feldstudien aufzusuchen, um eine Vorstellung von einem derartigen Etablissement zu gewinnen. Das würde ich allerdings niemals tun, obwohl ihre Angaben sehr ungenau sind.
Ich fragte ziemlich ungeduldig und ohne meine Unzufriedenheit zu verbergen, ob sie sich an den Augenblick erinnere, in dem sie begriff, wo sie gelandet war. Sie beantwortete meine Frage mit einem tiefgründigen, aber verschlossenen Blick und redete stundenlang über andere Dinge.
Es geschieht, daß ich vergesse, in welchem Ausmaß mein Zustand und meine Aufgabe mich vom Leben der anderen entfernt haben. Das ist der eigentliche Grund dafür, daß ich niemals eine Hetäre aufsuchen würde. Sie würde nicht den tieferen Sinn meines Daseins begreifen können, geschweige denn verstehen, welch große Ehre damals meiner Familie zuteil wurde. Sie würde nur sehen, daß ich ihr nicht von Nutzen sein und sie an mir kein Geld verdienen könnte. Eunuchen sind in diesem Land noch ein so junges Phänomen, daß die Menschen in uns in der Regel nur jämmerliche Schwächlinge sehen.
Thaïs als Hetäre
Ich saß in einer Ecke und sang. Da kam der große Mann, hob mein Kinn hoch und sah mich an. Ich verstummte augenblicklich und verschloß mich, ließ jede Berührung an meiner Oberfläche abperlen, so wie es mir Rhodope für Situationen, die einem unangenehm sind, beigebracht hatte. Die vollkommene Selbstbeherrschung war ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung, die wir erhielten, bevor wir den Männern im Andron das erste Mal begegneten. Er strich mir übers Haar, und ich schloß die Augen.
»Sie wird dir noch sehr nützlich sein. Ist sie eine Sklavin?« fragte er Rhodope, so als wäre ich ein schöner Stein, den er gefunden hatte. »Nein«, beeilte sie sich zu antworten. Ich war so neugierig, was sie sagen würde, denn ich wußte selbst nicht, wer ich war. Ich sei eine frei geborene Athenerin, ob er das nicht an meinem Haar wie Sand und meiner Haut wie Sahne sehen könne? Nur in Athen würde man diese rundwangigen Mädchen finden, die früh reif wurden. Mein einziger Fehler sei, fügte sie hinzu, daß ich so kleinwüchsig wäre.
»Hast du sie noch nie singen hören?« fragte er und strich mir über Wange und Haar. »Mein kleines Mädchen, hast du etwa eine Nachtigall verschluckt?« Dann hob er mich hoch auf seinen Schoß und bat mich, für ihn zu singen. Da dachte ich mir, daß er mir vielleicht doch nichts Böses wollte, und sang das Lied, das mir einer von Rhodopes Sklaven beigebracht hatte. Das war meine erste Berührung mit Makedonien gewesen, aber das wurde mir erst später bewußt, als ich das Lied erneut im Palast von Aigai hörte. Ich sang, und Rhodope kam zu uns und hörte mir zu. Später nahm sie mich beiseite und betrachtete mich eingehend. Sie saß in der Sonne und fragte mich, ob ich nicht von jetzt an jeden Abend für sie und ihre Gäste singen wolle. Ich errötete, und meine Kehle schnürte sich zusammen. Singen war für mich die intimste Handlung, die ich kannte. Man sang eigentlich nur für sich selbst. Rhodope schlug mich nicht, wie sie es mit den anderen Kindern tat, die nicht gehorchen wollten.
»Laß dir alle Zeit der Welt, aber ich will dich heute abend singen hören«, sagte sie leise und hielt einen Augenblick inne. Dann gab sie mir einen Klaps auf die Wange, halb strafend, halb zärtlich, und verließ mich.
Ich starrte auf die kleinen Vögel aus Terrakotta an der Dachkante und versuchte mich zu beruhigen. Den Rest des Tages blieb ich dort sitzen und wartete auf den Augenblick meines Untergangs. Es wurde Abend, und Rhodope holte mich zu sich und ihren Freunden. Als ich meinen Mund öffnete, entströmten meinen Lippen die schönsten Töne. Erst als ich das Lied beendet hatte, wagte ich es, wieder zu Rhodope hinüberzusehen. Kalt und unnahbar stand sie da, mit einem Gesichtsausdruck, der kaum ihre Gefühle verriet. Und dennoch sah ich eine einzige Träne ihre Wange hinunterlaufen. Er habe recht gehabt, sagte sie anerkennend, kam zu mir, umarmte mich ohne jede Herzlichkeit und wühlte in meinem Haar. Zu mehr war sie nicht in der Lage. Sie kannte keine Liebkosungen um der Zärtlichkeit willen.
Ich war elf, und Rhodope hatte eine Idee. Sie würde viel Geld mit mir verdienen können, darum sollte ich eine besondere Ausbildung bekommen. Es konnten mitunter Jahre vergehen, bevor sich die Eignung zur Hetäre offenbarte, doch die galt es dann zu fördern. Ich hatte mich von einem wertlosen Kind in eine Investition verwandelt.
Am Tag darauf erzählte Thaïs kühl und mit großer Distanz von ihrem ersten Besuch in einem der Häuser oben in Athen in Begleitung der erwachsenen Frauen. Sie erinnerte sich an jede Einzelheit. Offenbar wollte sie sich damit geißeln.
Du kennst doch Platons Symposiou, nicht wahr? Und du denkst sicherlich, daß alle griechischen Symposien genauso verlaufen? Aber nein, nein und nochmals nein – wenn es doch nur so wäre! Ich sah dort einen betrunkenen und ungehobelten Mann aus Theben, der einer Frau mit seinem Schuh in den Nacken schlug, während er ungezügelt und rücksichtslos seinen Penis in sie stieß und sie vor Schmerzen schrie. »Ich habe nicht dafür bezahlt, daß du dich dabei amüsierst«, rief er und schlug weiter auf sie ein.
Und diesen Menschen soll ich vorsingen? dachte ich. Wo bin ich hier nur gelandet? Für Schönheit war überhaupt kein Platz in ihrer Welt. Das sagte ich auch Rhodope auf unserem Heimweg, aber sie lachte nur und wehrte die Frage ab. Ich solle nicht so viel grübeln und urteilen, ich sei ausschließlich für den Gesang zuständig. Also gehorchte ich und sang, aber immerhin geschah das aus meinem eigenen freien Willen, und keiner bezahlte mich dafür. Sie genossen es – ohne mich auch nur mit dem kleinen Finger zu berühren.
Nur an einem einzigen Abend, an dem sogar ein glühendheißer Wind wehte, in der dunklen Nacht der Zikaden, griff ein Mann meinen Arm und zwang mich auf alle viere. Ich drehte mich zu ihm und sah ihm fest in die Augen. Er hielt mitten in seiner Bewegung inne, und sein dummes Grinsen in seinem bärtigen Gesicht erstarb augenblicklich. Dann erhob ich mich, und wir standen uns gegenüber. Wir waren, soweit ich mich erinnere, in seinem Haus zu Gast und hielten uns in seinem Andron auf Wir waren umgeben von seinen Freunden, und er hatte für alles bezahlt, womit Rhodope aufwarten konnte. Ich gehe davon aus, daß er somit auch das Recht gehabt hätte, alles mit mir zu machen. Im Halbdunkel neben uns wälzten sich nackte Körper, es herrschte ein heilloses, lautstarkes Durcheinander. Es wäre ein leichtes für ihn gewesen, mich auf den Boden zu zwingen. Anstelle dessen fiel er in sich zusammen, als hätte er erst in diesem Moment begriffen, was da in seinem Haus vor sich ging, und daß dies nichts mit Lust zu tun hatte.
Er ließ mich los, und als er einen Schritt nach hinten machte, sah ich, daß auch sein Glied erschlafft war, und ich spürte einen unerklärlichen Triumph in mir aufsteigen.
Und du, der niemals bei einer Hetäre war, glaubst sicher, daß es ein wunderbares Leben sein muß, neben klugen Männern zu Tisch zu sitzen, ihren Diskussionen beizuwohnen und ihnen danach zu Diensten zu stehen und sich ihnen hinzugeben? Du meinst sicher, daß es unsere Natur sei, sich anderen auf diese Weise zu fügen?
Ihre Stimme war hart und voller Hohn, als sie mich das fragte. Ich war tief verletzt, meine Seele schmerzte, als hätte sie mich mit der Frage bestrafen wollen. Warum ließ sie ihre Wut gerade an mir aus, der sich noch niemals einer der Übergriffe, die Frauen von Männern erdulden müssen, schuldig gemacht hatte? Ich wußte nicht, was ich antworten sollte, ich war doch nur hier, um ihre Erinnerungen aufzuschreiben. Außerdem wollte ich endlich zu weitaus interessanteren Themen vorstoßen, wie beispielsweise ihrer ersten Begegnung mit Alexander dem Großen.
»Du machst dir keine Vorstellung von der Häßlichkeit des Menschen«, sagte sie. »Wie solltest du auch?« Dann holte sie zwei Trinkschalen und zeigte auf die Bilder, die ich bereits kannte.
»Schon zu meiner Zeit empfanden die besseren Familien solche Aktivitäten als entwürdigend«, dozierte sie. »Diese Schalen galten als ›Großvaters schmutziges Symposiou-Geschirr‹, und viele von ihnen wurden von wütenden Erben zerstört. Und dennoch führten sich die meisten Männer auf wie Satyrn, wenn sie ausreichend getrunken hatten und Hetären in ihrer Nähe waren.«
Es dauerte lange, bis ich sie wieder beruhigt hatte und ihr erklären konnte, daß mein Auftrag nur lautete, die Wahrheit zu erfahren. Doch Thaïs genügt es nicht, nur zu erzählen, sie will, daß ich sie verstehe und alles mit ihr zusammen noch einmal erlebe, so daß meine Haut von den Schlägen brennt und vor Scham errötet.
Ich kannte sie noch nicht lange, und doch hatte sie sicher schon den Eindruck, daß sie sich mit ihrem bisherigen Bericht eine Blöße gegeben hatte.
»Bist du noch immer neugierig? Ich habe vor, meine Briefe zu verbrennen, aber vielleicht können wir sie später ja noch gebrauchen. Dann verbrenne ich sie besser hinterher«, sagte sie und sprach dabei mehr zu sich selbst als zu mir.
Bericht von einem Treffen mit der Königinmutter Text nach Diktat niedergeschrieben
Er muß dich eigentlich gar nicht zu mir schicken, er erinnert sich doch an alles, mein Ptolemaios. Die erste Nacht in Memphis. Die Häuser, deren dicke Mauern die Hitze verschluckten; der Wüstensand, der wie kalte Asche an den Wagenrädern und Füßen klebte. Ich mochte Memphis nie besonders gern, aber so lernten wir Ägypten kennen. Wir kamen zwar aus dem reichen Persien, waren aber dennoch genügsam. Wir hatten damals keine großen Ansprüche, schließlich hatten wir jahrelang wie Feldherren im Krieg gelebt. Er sprach mit seinen Offizieren und den ägyptischen Ratsgesandten, die ihn anflehten, das Land von seinen korrupten Herrschern zu befreien. Danach kam er zu mir, wie er es immer tat, wenn etwas Bedeutendes geschehen war. Wir saßen lange nebeneinander, sahen in den Sonnenuntergang und genossen die fernen Geräusche der Stadt und die frische Brise. Seine Hand ruhte auf meinem Knie, und sein Gesicht strahlte vollkommene Ruhe aus, was so selten geschah.
Aber selbst jetzt, da er zum Gott geworden ist, wagt er es nicht, sich auszuruhen. Und bei wem sollte er auch Ruhe finden? Sollte er womöglich bei den großen, stolzen Königinnen Zuflucht suchen, die kein einziges Mal die Erde mit ihren Füßen berührt haben, seit sie in Ägypten angekommen sind?
Er legte seinen Kopf in meinen Schoß und schluchzte, wie bei unserer ersten Begegnung.
Da erinnerte ich mich wieder.
Sogar meine aufgesprungenen Fingerspitzen erinnern sich an Rhodopes Feste, an meine Abscheu und meinen Widerwillen. An diese abstoßende Gier, wenn Männer vergessen, daß auch Frauen über Ohren, Sprache und Gedächtnis verfügen.
Ich schrieb und schrieb und wagte nicht, von meinen Sätzen aufzusehen. Und ich Narr hatte doch tatsächlich gedacht, daß es mir gelingen würde, einen zusammenhängenden und chronologischen Bericht von ihr zu bekommen! Ich, der sie förmlich genötigt hatte, zu erzählen, was »wirklich« passiert ist. Aber man erinnert sich anders, wenn man achtzig ist.
»Du kannst bei der Gelegenheit gern den großen Gott auf Kypros fragen, wie wütend Ptolemaios geworden ist, als ich sein Heiratsangebot ausschlug«, sagte sie unvermittelt.
»Er hat meine Beweggründe nie verstanden, glaube ich. Aber meine schönen Söhne sollten Griechen werden und keine Untergebenen eines makedonischen Königs. Weißt du eigentlich, daß mein ältester Sohn alle Wettkämpfe bei den Olympischen Spielen gewonnen hat? Sogar das Wagenrennen!«
Ja, das wußte ich. Auch Ptolemaios war sehr stolz auf seinen griechischen Sohn.
Nach diesem Treffen zog sie sich für eine Weile zurück und schickte mir lediglich ein paar Briefe mit fadenscheinigen Entschuldigungen. So beklagte sie, krank zu sein, obwohl ich ihre Sänfte am Tag zuvor auf der Agora der Stadt gesehen hatte. Deshalb war ich sehr überrascht, als ich eines Tages zu ihr gebeten wurde und sie mich gutgelaunt und fast streitlustig empfing.
»So, junger Mann – oder wie immer man euch anspricht«, sagte sie und legte drei Papyrusrollen vor mir nieder. »Du bist eigentlich nur daran interessiert, etwas über Alexander den Großen zu erfahren, habe ich recht? Kaum jemand weiß etwas über ihn, mit Ausnahme des Königs und mir. Wer weiß zum Beispiel, daß er Linkshänder war?«
Ich wollte kein fertiges Mahl serviert bekommen, ohne selbst nach meinem Geschmack Gewürze hinzufügen zu können. Darum bat ich sie, den Inhalt der Rollen laut vorzulesen und mir dann zu erzählen, was ihr dazu einfiel. Sie reagierte verwundert, ließ dann aber Wein bringen, von dem sie selbst am meisten trank. Um mich zu beeindrucken, befahl sie ihren Sklaven, einen riesigen goldenen Krater aus Makedonien hereinzutragen. Etwas so Vulgäres hatte ich in einem privaten Haus zuvor noch nie gesehen.
Sie öffnete die Rollen nicht, sondern begann in fast überstürzter Eile zu erzählen, so als habe sie den Vortrag schon unzählige Male zuvor gehalten und auswendig gelernt. Mir kam in den Sinn, daß ich ihr Retter war, denn ich hatte die Aufgabe übernommen, ihre Version der Ereignisse zu verewigen. Bis zu diesem Augenblick hatte ich das in mir gesehen, was sie wohl in mir sah: ein nervtötendes Insekt, dessen Stichen sie auszuweichen versuchte. Erst jetzt akzeptierte sie meine Nähe. Sie respektierte mich nicht, hatte aber offenbar ein nützliches Werkzeug in mir erkannt.
Ich begriff, daß sie schon vor langer Zeit gewittert hatte, was der König wirklich wollte. Denn sie hatte ihre Erinnerungen im großen und ganzen bereits selbst niedergeschrieben und ließ mir nun ab und zu ein paar unschuldige Auszüge zukommen, die ich dann zu einer chronologischen Geschichte zusammenstückeln durfte. Aber da irrt sie sich gewaltig! Ich werde mich dem nicht beugen. Sie hat ihre Form gewählt, und an die werde ich mich halten. Darum folgt jetzt ihre Beschreibung des Alexander, des großen makedonischen Königs, den sie demonstrativ nur als »meinen Schwager« bezeichnet.
Ich habe den Eindruck, daß sie diese Beschreibung direkt an Ptolemaios Soter adressiert hat, darum zittert meine Hand, während ich ihren Bericht anhefte.
Thaïs’ Erzählung vom Mord an Kleitos durch Alexanders Hand in Marakanda
Ich sehe mich gezwungen, von der gespaltenen Persönlichkeit des Königs zu berichten. Es ist eine furchtbare Geschichte, die alle gern vergessen würden, die aber durch unsere Erinnerungen geistert und von der Fremde so fasziniert sind. Ich war Augenzeugin und habe nichts zu verlieren, wenn ich erzähle, was sich wirklich ereignet hat.
Dir zuliebe, junger Freund, werde ich kurz den Verlauf des Krieges skizzieren.
Alexanders Vater, König Philipp, wurde ermordet und Alexander mit nur zwanzig Jahren zum König ernannt. Über Nacht mußte er die Macht in Hellas und Makedonien übernehmen.
Zwei Jahre zuvor hatte Philipp die freien Stadtstaaten in Hellas unterworfen und als Ersatz für die verlorene Freiheit versprochen, den größten Feldzug aller Zeiten gegen unsere alten Feinde, die Perser, zu führen. Denn unsere Kolonien in Kleinasien wurden von den Persern unterjocht und sehnten sich nach Freiheit, ebenso wie die griechischen Städte des großen Tyrannen im Osten ledig sein wollten.
Mit 50000 bewaffneten Männern überquerte Alexander den Hellespont und fiel in Asien ein. Der Perserkönig Dareios unternahm nichts, um das feindliche Heer zu stoppen. Nur sein General Spithridates, Gouverneur in Ionien und Lydien, stellte sich uns in den Weg und hätte uns um ein Haar bezwungen. Aber Alexander gelang es, die drohende Niederlage in einen triumphalen Sieg zu verwandeln.
Von diesem Tag an übernahmen die Makedonen die Führung. Unsere Städte in Kleinasien wurden eine nach der anderen befreit und eine demokratische Führung wiedereingesetzt. Erst da mischte sich Dareios in den Krieg ein und erlitt eine schwere Niederlage in Issos. Er selbst konnte entkommen, aber seine Familie, seine Kriegskasse und der Haushalt des Großkönigs fielen in unsere Hände. Als auch Tyros und Sidon unterlagen, war der Weg nach Ägypten frei, und Alexander gründete unsere Stadt Alexandria und wurde als Pharao inthronisiert.
Von da an schien nichts mehr unmöglich. Bei Gaugamela schlug Alexander Dareios’ Heer zum zweiten Mal. Die Perser öffneten die Pforten nach Babylon und setzten Dareios ab – wir fanden ihn sterbend vor. Alexander sagte, daß schlimmer noch als ein Aufstand gegen den König sei, daß der Herrscher über den größten Teil der Welt einsam und jämmerlich sterben würde. Dareios’ Reich starb mit ihm.
In den folgenden Jahren bezwang Alexander Persien, Parthien, Baktrien, Sogdien und gelangte schließlich bis nach Indien. Dort weigerten sich seine Soldaten allerdings, ihm noch weiter zu folgen. Alexander kehrte um und trat die Heimreise an, kam aber nur bis Babylon. Ich selbst war dabei und sah alles mit eigenen Augen, aber in meiner Erinnerung vermischt sich Wichtiges und Unwichtiges. Das ist das Dilemma von Augenzeugen.
Wir selbstbewußten Griechen hatten uns geirrt. Wir hatten in den Makedonen immer nur Barbaren und Gorgonen gesehen und waren der Ansicht, daß nur wir in wahrhafter Freiheit lebten. Wir ahnten nicht, daß wir in Wirklichkeit die letzten Tage unserer Alten Welt erlebten, sondern wähnten uns in dem Glauben, unsere Staatsform und Weitsicht in alle Länder tragen zu können. Die Makedonen wollten um jeden Preis Griechen sein. Und wir konnten sie nicht daran hindern, über uns und unsere Welt die Kontrolle zu übernehmen. Darum endeten wir hier, als Untertanen von Königen, die sich Götter nennen. Unsere Welt ist ausgelöscht. Ich bin die einzige, die erzählen kann, wie es dazu kam, denn ich habe nichts mehr zu verlieren.
Die Begebenheit, von der ich jetzt berichten will, ereignete sich während des Krieges in einem fremden Land. Gerade waren wir Zeugen einer Verschwörung geworden, wie Alexander es nannte: der engste Freund seines Vaters, Parmenion, war aufgrund des Verdachtes gegen seinen Sohn Philotas umgebracht worden. Wir waren weiter nach Baktrien gezogen, und im Frühjahr darauf eroberten wir die sogdische Klippenburg. Da war Alexander Roxane noch nicht begegnet, er war unverheiratet und seine Zuneigung zu Hephaistion ungebrochen – so glaubten wir.
Als König mußte Alexander den Überblick bewahren und am besten in die Zukunft sehen können. Darum machte es ihn unruhig, tatenlos im Winterquartier ausharren zu müssen. Er zog lieber durch die Wüste, als nur abzuwarten, nachzudenken und zur Besinnung zu kommen. Das wußten wir bereits – alle, die ihm nahestanden, wußten es, aber der Moment, um einzuschreiten oder gar das Unglück zu verhindern, war vorbei.
Es geschah in Marakanda, das andere auch Samarkand nennen. Alle tranken an diesem Abend hemmungslos. Nicht etwa, um die begangenen Verbrechen und Sorgen zu vergessen oder Dionysos zu feiern. Alle tranken ohne Grund Unmengen von ungemischtem Wein, und alle Gäste waren nach makedonischem Brauch mit vulgären goldenen Kränzen geschmückt.
Alexander wich von seinen eigenen Regeln ab und opferte den Dioskuren, Zeus’ und Ledas Söhnen. Warum er das tat, weiß ich nicht, und keiner wagte ihn danach zu fragen, denn er war die letzten Tage niedergeschlagen und schweigsam gewesen. Es geschah ihm zu wenig, der Krieg war bei weitem nicht mehr so grandios und aufregend wie zu dem Zeitpunkt, als wir dem fliehenden Perserkönig Dareios auf den Fersen waren.
Ptolemaios versuchte vergeblich, Alexanders Stimmung zu heben, indem er es ihm nachtat, Becher für Becher, aber den König verlangte es eher nach hemmungslosem Lob, nicht nach hemmungslosem Rausch. Einige der unterwürfigen griechischen Generäle erkannten seine Schwäche und begannen, ihn mit Lob zu überschütten. Seine wahren Freunde lobten ihn nie, sie kannten ihn und seine Qualitäten ja.
Es hätte falsch geklungen, wenn Ptolemaios seine Bewunderung so geäußert hätte. Doch diesen Umstand nutzten die anderen für sich. Zu Beginn lachte Alexander laut über ihre Andeutungen, daß er eine Art Gott sein müßte. Ptolemaios griff diesen Gedanken auf und gab sich als den sterblichen der beiden Dioskuren aus, denn sie seien ja Halbbrüder. Mein Geliebter war betrunken, aber fröhlich. Im Verlauf des letzten Jahres hatte er sich die Position an Alexanders Seite sichern können.
An diesem Abend hatte er mich erst gerufen, als das Fest langweilig wurde. Ich war die einzige Frau, wie so oft zuvor. Zu Hause in Dion hatte ich es immer genossen, Gastgeberin zu sein, hatte gern den Wein gemischt und serviert und sorgfältig darauf geachtet, daß meine Gäste das Fest genossen. Doch im Winterlager von Marakanda war nichts dergleichen möglich.