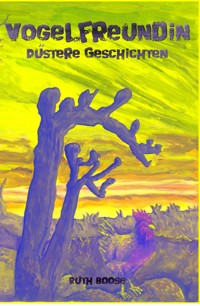
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Übertriebene Liebe wird für die Betroffenen sehr gefährlich, egal ob sie Tieren, Steinen, Berühmtheiten oder ganz gewöhnlichen Menschen gilt. Sowohl Arbeitslose als auch Anwälte werden von den Dämonen ihrer Vergangenheit heimgesucht. Dass es immer noch schlechter kommt, als man denkt, erlebt eine verzweifelte Teenie-Schwangere. Andererseits wird pietätloses Verhalten am Ende zum echten Lichtblick für einen kleinen Teddy. 13 wundersame Geschichten bieten Einblicke in eine alternative und erschreckend nahe Wirklichkeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Titel und Impressum
Vorwort
Vogelfreundin
Nachspiel
Der Teddy im Müll
Das zweite Kind
Entfremdung
Echte Leidenschaft
Grüne Hölle
Das vorweggenommene Geschenk
Längst vergessen
Adalbert (Alternative Realität)
Der perfekte Selbstmord
Herz um Herz
Inkassobüro
Danksagung und Ausblick
Ruth Boose
Vogelfreundin
Düstere Geschichten
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Autor, Herausgeber, Verlag, Titelbild, Satz und Korrektorat: Ruth Boose, 2023, Berlin
Druck und Vertrieb: epubli, Service der neopubli GmbH, Berlin
Kontakt: [email protected]
Vorwort
Nach langer Schaffenspause habe ich eine erkleckliche Anzahl meiner Geschichten überarbeitet und musste dabei feststellen, dass neben „Legopocken – Düstere Geschichten“ ein weiterer Band erforderlich wird.
Der geneigte Leser möge mir verzeihen, wenn einige Ideen im wahrsten Sinne des Wortes von der Realität eingeholt worden sind und mittlerweile noch unrealistischer erscheinen.
Ich halte nichts von konkreten Inhaltswarnungen, da mündige Erwachsene selbst für ihren Konsum verantwortlich sind und die Handlung nicht vorweggenommen werden soll. Also weise ich an dieser Stelle lediglich darauf hin, dass ein Testleser die letzte Geschichte als bizarr und verstörend empfunden hat.
Vogelfreundin
Es war unklar, ob es Schmerzen verspürte. Mühselig setzte es den klobigen, verkrüppelten Stumpf auf, der bei jedem Schritt auszugleiten drohte. Mindestens zwei Krallen fehlten daran. Dennoch hinkte das Geschöpf unverdrossen und tapfer weiter.
Sein Humpeln wurde abrupt durch das laute „Haaaa!“ eines herantrampelnden Menschen unterbrochen. Mit letzter Kraft und nur von Panik getragen flog der Vogel auf und brachte sich gerade rechtzeitig in Sicherheit, bevor ein hartbeschuhter Fuß seine zarten, hohlen Knochen zerbrechen konnte.
„He, was soll das, lass gefälligst das arme Huhn in Ruhe! Was würdest du sagen, wenn jemand dich so behandeln würde?“, fuhr eine etwa Dreißigjährige den mindestens zwei Köpfe kleineren Missetäter an.
Mindestens genauso erschrocken wie das Huhn zuvor zuckte der Elfjährige zusammen. Aber schon als er sich zur Frau umwandte, war seine Ertapptheit einer höhnischen Dreistigkeit gewichen. „Sie haben mir gar nichts zu sagen, Sie sind nicht meine Mutter“, erwiderte er patzig.
„Wenn die dich richtig erzogen hätte, dann hätte sie dir beigebracht, dass man keine unschuldigen Tiere quält.“
„Ist doch nur ein Huhn“, rechtfertigte sich der Junge bockig.
„Nur ein Huhn? Nur ein Huhn?“ Kriemhild wusste, sie sollte sich besser im Zaum halten, aber der Zorn überschwemmte sie wie eine Flutwelle, sie konnte einfach nichts dagegen tun. „Soll ich dich mal zusammentreten und dir deinen Oberschenkel oder ein paar Rippen brechen? Bist doch nur ein kleiner Rotzlöffel!“
Sofort machte der Junge einen Schritt zurück. Als er sich weit entfernt genug für eine Flucht wähnte, rief er herausfordernd: „Ich werde meinem Vati erzählen, dass du dicke Hure mich bedroht hast, dann bricht er DIR ein paar Rippen!“
Damit wandte er sich eilig um und verschwand hinter der nächsten Hausecke.
„Das war wieder eine tolle Heldentat! Bist du jetzt stolz auf dich, weil du dich mit einem Kind angelegt hast?“ Kriemhilds Schwester Gundula hatte keinen Sinn für Tiere, es sei denn, sie waren nützlich.
„Ich habe lediglich versucht, dem Bengel Respekt beizubringen.“
„Was würdest du als Mutter tun, wenn jemand deine Tochter auf der Straße so bedrohen würde?“
„Meine Tochter würde niemals grundlos einem Tier etwas zuleide tun“, rechtfertigte sich Kriemhild. „Sie ist vielleicht halb so alt wie der und hat trotzdem schon verstanden, dass auch Tauben Schmerzen und Gefühle haben wie wir.“
„Das war nicht meine Frage. Weißt du, dass du dafür angezeigt werden kannst?“
„Das interessiert mich nicht! Warum werden Tierquäler nicht angezeigt? Ach ja, ich habe es schon wieder vergessen, Tiere haben keine Rechte wie wir. Wir Menschen meinen ja ständig, etwas Besseres zu sein.“ Sie sah gar nicht ein, jetzt als die Böse hingestellt zu werden. Wer einem Tier etwas antat, der bekam es mit ihr zu tun.
Ihr Blick fiel auf das braun-weiße Huhn, das nur wenige Meter weit geflattert war. Es schien jetzt noch schlimmer zu hinken.
„Hilf mir mal bitte. Ich möchte nachsehen, ob der Nichtsnutz es womöglich doch erwischt hat. Und ob das kaputte Füßchen sich entzündet hat.“
Unwillig blieb die Schwester stehen. „Warum ist das jetzt unsere Aufgabe? Wenn der Eigentümer seinen Zaun nicht ordentlich instand hält, ist er selbst schuld, wenn seine Hühner ausbüxen und dann von Autos überrollt oder vom Fuchs gefressen würden.“
„Du siehst doch, dass es verletzt ist. Hilfst du mir nun oder nicht?“, drängelte Kriemhild, schon auf halbem Wege beim Huhn. „Na, schnupperst du ein bisschen Freiheit?“, begrüßte sie es.
Sofort hielt das Tier inne und sah sie für einen Moment misstrauisch von der Seite an. Trotzdem machte es kaum Anstalten zu fliehen. Es schien schwer Luft zu bekommen. Sein Hals sah angeschwollen aus, oder bildete Kriemhild sich das ein?
„Ach du Armes, hast du etwa Plastik in dein Schnäbelchen bekommen? Dass die Leute auch immer so gedankenlos ihren Müll in die Natur schmeißen müssen! Na komm, wir schauen uns das mal an.“
Liebevoll nahm sie das entkräftet wirkende Tier auf. „Du meine Güte, du bist ja völlig erschöpft.“
Das Hühnchen nieste und hustete erbärmlich, aber es brachte den Fremdkörper, der es quälte, nicht heraus.
Mitfühlend streichelte Kriemhild sein weiches Federkleid, und das Tier ließ es apathisch geschehen. Die Entscheidung war rasch gefallen: „Ich glaube, es ist das Beste, wenn wir dich jetzt schnellstmöglich zu einem Tierarzt bringen.“
Gundula wusste, es war zwecklos, mit ihrer Schwester zu diskutieren. Genervt blickte sie auf ihre Uhr: „Na schön, ich fahre dich. Aber ich fasse das Viech nicht an – und es kommt in den Kofferraum!“
Der Tierarzt war überhaupt nicht begeistert, eine potenzielle Keimschleuder mit unbekanntem Besitzer in seiner Praxis zu haben, aber Kriemhilds großzügiges Trinkgeld überzeugte ihn davon, den kleinen Patienten trotzdem zu behandeln.
„Ich konnte keinen Fremdkörper entdecken. Allerdings sieht das Huhn kränklich aus. Ich würde gern etwas Blut abnehmen und untersuchen. Haben Sie den Eigentümer schon kontaktiert?“
„Nein, ich dachte, es sei dringender, dem Tier in Not zu helfen. Aber es gehört jemandem aus dem Ort, in dem meine Schwester wohnt. Ich werde gleich zurückfahren und mich umhören. Er meldet sich dann bei Ihnen.“
Kurze Zeit später musste Kriemhild Gundula erneut um Hilfe bitten: „Du, kann Finnja heute Nacht noch einmal bei dir schlafen? Ich fürchte, mich hat eine böse Erkältung erwischt.“
„Erkältung?“
„Ja, ich habe sogar Fieber über 39 Grad. Aber nachher mache ich mir einen Salbeitee mit Ingwer, dann wird das schon wieder.“
„Ach herrje! Hoffentlich ist es kein Corona.“ Gundula hörte sich besorgt an.
„Und wenn schon! Das ist doch eine harmlose Erkältung. Meine Tochter und ich hatten letztes Jahr Corona und nur ein bisschen Halsschmerzen und Husten. Nach einer Woche war alles wieder vorbei. Obwohl wir nicht geimpft sind.“
„Ja ja, darüber will ich jetzt nicht zum hundertsten Mal mit dir diskutieren. Gut, ich nehme deine Tochter, aber unter einer Bedingung.“
„Welche wäre das?“
„Dass du gleich morgen früh, wenn er öffnet, zum Arzt gehst und dich untersuchen lässt!“
„Das hatte ich sowieso vor“, meinte Kriemhild bissig. Dass Gundula sie immer noch wie die „kleine“ Schwester behandeln musste.
Der Hausarzt rief am übernächsten Morgen an und erkundigte sich, wie es Kriemhild mittlerweile ginge.
„Ehrlich gesagt eher schlechter als besser. Ich glaube, ich schaffe es heute nicht mehr in die Praxis.“
„Also, der abrupte Krankheitsbeginn und das immer noch hohe Fieber deuten auf Influenza hin. Ich verschreibe Ihnen Tamiflu.“
„Danke vielmals. Kann ich meine Schwester vorbeischicken, um das Rezept abzuholen?“
Einen Tag später stand ein kleines blondes Mädchen ganz verloren an der Hand seiner Tante in der Arztpraxis. „Warum muss meine Mutti ins Krankenhaus?“, fragte es traurig.
„Ja, ich verstehe das auch nicht“, pflichtete Gundula dem Kind bei. „Warum kann Kriemhild ihre Grippe nicht daheim bei ihrer Familie auskurieren? Sie ist erst 31 Jahre alt und hat keinerlei Vorerkrankungen.“
Der Arzt seufzte. „Es ist keine gewöhnliche Grippe. Sie leidet an aviärer Influenza, besser bekannt unter dem Namen Vogelgrippe.“
Bestürzt riss die Erwachsene die Augen auf. Die Kleine blickte verständnislos drein, doch in ihren Blick mischte sich Furcht.
An sie gewandt erklärte der Mann: „Deine Mutter hat sich aller Wahrscheinlichkeit nach bei dem kranken Huhn angesteckt, das sie vor einer Woche zum Tierarzt gebracht hat.“
„Wird Mutti sterben? Muss ich jetzt auch sterben?“, bangte die Sechsjährige ahnungsvoll. Sie fühlte sich elend, hundeelend. Bis vor einer Stunde, als ihre Mutter von einem Notarztwagen abgeholt worden war, war sie noch auf dem Bett herumgehüpft wie auf einem Trampolin.
„Aber nicht doch, und deine Mutter wird auch nicht sterben. Sie wird im Krankenhaus super versorgt, bis sie wieder zu dir kommen kann. Es handelt sich bei der Vogelgrippe um eine klassische Zoonose, die nicht von Mensch zu Mensch übertragbar ist.“
„Ah, was für ein Glück!“, rief Gundula übertrieben fröhlich aus. „Das ist doch wenigstens eine gute Nachricht.“
„Oh ja“, bekräftigte der Arzt ernst. „Wenn das Virus sich dahingehend verändern würde, dass Menschen sich gegenseitig infizieren könnten, wäre das verheerend.“
Für einige Sekunden trat ein angestrengter Ausdruck in das glatte, kindliche Gesicht. Dann brach das kleine Mädchen in Tränen aus. Die Verantwortung einer Entscheidung, für die sie viel zu jung war. Ihre Mutter könnte sterben. Was bedeutete ihr schon der Rest der Welt?
„Was ist denn? Hat der Arzt dir Angst gemacht?“, fragte Gundula nach, nicht ohne dem Mediziner einen bösen Blick zuzuwerfen.
„Ich will nicht ohne meine Mutti weiterleben“, erwiderte das Mädchen ehrlich. „Tante Gundula, ich fühle mich sooo müüde.“
„Na komm, ich nehme dich ausnahmsweise auf den Arm. Herr Doktor, vielen Dank für alles und dass Sie sich so spontan die Zeit für uns genommen haben.“
„Aber das ist doch selbstverständlich. Und keine Sorgen, das Uniklinikum ist das beste auf diesem Gebiet! Ihre Schwester bekommt die modernste Behandlung, die es derzeit gibt.“
Mitfühlend blickte der Allgemeinmediziner dem armen Mädchen nach … nicht wissend, dass auch er sich sehr bald sehr erschöpft fühlen würde.
Nachspiel
Winfried von Arnstein hebt den Blick und lässt ihn durch den großen Raum schweifen, um seine müden Augen auszuruhen. Ein geschmackvoll mit antiken Stücken ausgestattetes Arbeitszimmer, das im krassen Gegensatz zu seinem modernen Büro in der Innenstadt steht. Die kunstvoll gearbeiteten Drechslerarbeiten ragen geheimnisvoll in die Luft und führen zu phantastischen Einbildungen. Dabei brütet er hier bis spät in die Nacht nicht über wundersamen Geschichten, sondern nüchternen Fakten, die in mausgrauen Aktenbergen gesammelt werden.
Heute hat er weitaus weniger geschafft, als es sein hoher Eigenanspruch erwarten ließe. Immer wieder lenken ihn die Gedanken an den vergangenen Prozess vom Entwurf der vergleichsweise einfachen Anklageschrift für das kommende Verfahren ab. Einfach, da die Beweislage bei diesem Bankraub eindeutig und obendrein mit einem umfassenden Geständnis garniert ist.
Warum beschleichen ihn Versagensgefühle? Der Richter bestätigte doch sein gefordertes Strafmaß! Diesem Sieg wohnt ein schales Gefühl inne. Winfried kann sich darüber nicht so recht freuen. Liegt es daran, dass das reiche und berühmte Opfer selbst einen nie gesühnten Mord begangen hat? Das verächtliche Gesicht der Angeklagten schleicht sich als höhnische Fratze in die schattigen, verschlungenen Muster der massiven Schranktüren. Die verurteilte Kannibalin kann ihm nichts anhaben, sie sitzt nun wegen Mordes und Störung der Totenruhe im Maßregelvollzug, aus dem sie auch mit den besten Strafverteidigern erst das Altersheim erlösen wird.
Seine Augen sind überanstrengt, die Linien verschwimmen – er sollte für heute Schluss machen. Mit ein paar schnellen Mausklicks fährt er seinen Laptop herunter, dann reibt er sich über die geschlossenen Augenlider. Eine unbestimmbare Furcht hindert ihn daran, das Licht seiner Schreibtischlampe zu löschen, als er aufsteht. Solange er die aufgesetzten Holzverzierungen erkennen kann, verwandeln sie sich nicht in etwas anderes.
Wie kommt es nur, dass ihn nach so vielen Berufsjahren ein Mordprozess derartig erschüttert und nicht loslässt? Abgesehen vom bizarren Anlass war der Tathergang vergleichsweise sanft. Da hatte er als erfahrener Staatsanwalt schon weitaus schlimmere Fälle auf dem Tisch: Bandenkriminalität, die steht in puncto Brutalität ganz oben, oder Verbrechen an Kindern. Letztere prägen sich ihm besonders ein, ist er doch selbst erst vor Kurzem Großvater eines entzückenden Mädchens geworden.
Er schreitet durch den Flur, auch im Privatleben strahlt sein Gang Autorität aus, und betritt das Badezimmer. Geisterhaftes Leuchten dringt von der ruhigen Nebenstraße aus herein. Welcher seiner Nachbarn mag so spät mit dem Auto heimkommen? Der Grunewald ist keinen Steinwurf entfernt, Winfried genießt die Nähe zur Stadtnatur. Heute Nacht jedoch wünscht er sich sehnlichst Lärm und Licht der Großstadt in diese merkwürdige Lautlosigkeit. Gewiss, dieses alte Villenviertel ist grundsätzlich eine ruhige Gegend, aber heute liegt etwas Bedrohliches darin.
„Ich muss dringend schlafen, morgen wird wieder ein langer Tag“, mahnt er sich laut, um die erdrückende Stille zu durchbrechen. Seine eigene nüchterne Stimme klingt ihm plötzlich so fremd in den Ohren – wie die eines anderen. Rasch knipst er das Deckenlicht an … und erstarrt.
Im Spiegelglas, das rund die Hälfte der langen Wand einnimmt, erkennt er eine Gestalt neben sich stehen. Sie wirkt, als sei sie schon länger hier und habe auf ihn gewartet. Jetzt, da er sie wahrgenommen hat, bewegt sie sich.
„Was suchen Sie in meinem –?“ Er bricht ab und mustert besorgt das wie in weiter Ferne schimmernde Fenster. Es ist verschlossen. Niemand kommt hier herein, ohne dass die Alarmanlage losgeht.
Und doch sieht Winfried die Gestalt ganz deutlich. Es ist ein Mann asiatischen Aussehens, Anfang siebzig, schmal und mindestens einen ganzen Kopf kleiner. Seine tief liegenden, kleinen schwarzen Augen starren den körperlich Überlegenen unverhohlen hasserfüllt an. Trotz seines weitläufigen Bekanntenkreises kann sich der Staatsanwalt an niemanden erinnern, zu dem dieses Gesicht gehört. Auch zu keinem, den er vor Gericht näher kennengelernt hat, will es passen. Und er hat für gewöhnlich ein außerordentlich gutes Personengedächtnis. Trotzdem kommen ihm die Züge merkwürdig bekannt vor.
„Wer sind Sie? Ich rate Ihnen, rasch zu antworten. Die Polizei wird automatisch über einen stillen Alarm informiert, sobald jemand unbefugt das Grundstück betritt“, beginnt Winfried von Neuem und versucht, möglichst herrisch zu klingen. Von den Drohungen rachsüchtiger Verurteilter oder ihrer Angehörigen hat er sich noch nie einschüchtern lassen, also fängt er jetzt nicht damit an. Auch nicht, wenn es offenbar jemandem gelungen ist, wie ein Ninja an allen Sicherungssystemen vorbei in seinen privaten Bereich einzudringen.
Der Fremde zieht es vor zu schweigen und starrt Winfried nur weiterhin heimtückisch an.
Dieser versucht, mögliche Motive und Schwachstellen seines Gegners – wer in fremde Häuser einbricht und sich nicht zu erkennen gibt, muss ein Gegner sein – einzuschätzen. Ist er auf Wertsachen aus? Warum sollte er dann im Bad auf ihn warten, anstatt sich im Dunkel des weitläufigen Anwesens zu verbergen? Es kostet Winfried große Überwindung, den kleinen Mann zu betrachten, doch er muss sich dessen Gestalt und Züge gut einprägen, um sie gegebenenfalls für ein Phantombild oder bei einer Gegenüberstellung abgespeichert zu haben.
Erst jetzt fällt Winfried auf, wie eingefallen und gelbstichig das fremdartige Gesicht wirkt. Unter den Augen liegen tiefe Ringe. Die Falten auf der breiten runden Stirn sind tief wie Gebirgsschluchten. Oder ist es die Badezimmerbeleuchtung, die Farben und Schatten verfälscht und eine Bedeutung gibt, die ihnen nicht innewohnt? Das Männlein ist mit einem schwarzen Anzug bekleidet. Winfrieds professioneller Blick erkennt sofort den teuren, edlen Stoff und Schnitt. Maßgeschneidert. Aber wo sind seine Füße, sie sind nicht zu erkennen? Für einen lächerlichen Moment fühlt sich Winfried an Mörderpuppen aus geschmacklosen Horrorfilmen erinnert, die er nur vom Hörensagen kennt.
„Wenn er eine Schusswaffe bei sich trägt, ist sie gut kaschiert“, denkt er, als urplötzlich die Beleuchtung ausfällt. Ein erschrockener Blick in den Korridor zurück zeigt ihm, dass auch dort das Licht erloschen ist.
Hastig versucht er sich gegen einen möglichen Angriff zu wappnen – was eignet sich am besten zur Verteidigung? Absurderweise empfindet er trotz seiner Sportlichkeit und knapp zwei Meter Größe eine körperliche Angst vor dem schmächtigen, winzigen Asiaten im schwarzen Anzug. Keine Sekunde lang zieht er eine Sinnestäuschung in Betracht; er kann sich nicht nur auf seinen messerscharfen Verstand, sondern auch auf seine Wahrnehmung voll verlassen. Adrenalin durchströmt ihn.
Seine Hände greifen ins Leere, er dreht sich in Richtung der frei stehenden Badewanne, deren Füße im Dunkel golden leuchten.
„Aber Moment, das sind nicht die Füße der Badewanne!“, schießt es Winfried durch den Kopf. Dazu ist das Leuchten viel zu nahe. Ein kehliger Laut des Entsetzens entringt sich ihm, als er die vage Silhouette im zittrigen goldenen Licht erkennt, das keinen Ursprung zu haben scheint.
Winfried stürzt in sein Arbeitszimmer, dort liegt ein geladener altmodischer Revolver in einem seiner Safes. Natürlich besitzt er einen Waffenschein dafür. Entgegen verbreiteten Vorurteilen gegen seinen Berufsstand ist Winfried von Arnstein weder kriminell noch korrupt; er glaubt an das Rechtssystem, dem er dient, trotz all seiner Mängel. Aber wenn es sein muss, dann wird er hier und heute Nacht einen Menschen erschießen – aus Notwehr.
Fahrig tastet er sich zum doppelten Boden der Ledercouch, stößt einige Male gegen hölzerne und metallene Hindernisse und ertastet das Nummernfeld des Safes, in den er mit fliegenden Fingern den fünfstelligen Zahlencode eintippt. Denn er spürt, dass ihm der furchterregende Eindringling auf den Fersen ist, auch wenn er ihn im finsteren Arbeitszimmer weder sehen noch hören kann.
„Zum Glück ist meine Frau erst am Sonnabend wieder in Berlin“, denkt er noch, als ein ohrenbetäubender Schlag die Verglasung seines Bücherschrankes trifft. Winfried schreit auf, vor Schreck entgleitet ihm der Revolver und poltert auf den Dielenfußboden.
Es macht ein Flupp, und er verschwindet im Kurzflor des orientalischen Teppichs.
„Ich träume!“, ruft Winfried verzweifelt, denn es kann keine andere Erklärung für die Auslöschung seiner Waffe geben. Es darf keine geben!
Unter normalen Umständen würde er sich für diese Entgleisung schämen, er erhebt seine Stimme nur, wenn es im Gerichtssaal taktisch oder dramaturgisch geboten ist. Jetzt brüllt er aus Leibeskräften weiter: „Verschwinde! Lass mich in Ruhe! Ich bin bewaffnet!“
Keine Antwort, aber er spürt die Nähe des Fremden. Bewegt sich da nicht ein Schatten neben dem Sofa? Langsam dämmert Winfried, dass der vermeintliche Räuber nicht hinter seinem Hab und Gut, sondern hinter ihm persönlich her ist.
Seine Finger umschließen kühles, hartes und vor allem schweres Eisen. Er spannt seine Muskeln an, holt mit dem Briefbeschwerer aus und ein gut berechneter Schlag … schneidet durch die leere Luft, sodass Winfried sich durch seine Wucht beinahe selbst von den Füßen holt.
Er fängt sich wieder ab und blickt gehetzt um sich, kann aber nur wenig erkennen. „Das ist unmöglich“, stammelt er fast lautlos. Genau an dieser Stelle stand der Unheimliche – nein, er steht doch immer noch dort und schaut ihn hinterhältig an. Oder ist der kleine Kampfsportler etwa so wendig, dass er ihm im Bruchteil einer Sekunde ausgewichen ist und nun wieder an derselben Stelle verharrt wie vor dem Schlag? Will er Winfrieds Langsamkeit verspotten?
Gleich wird der Gegenangriff erfolgen. Eine aufsteigende Spannung erfüllt die Luft, Winfried fühlt sie bei jedem Einatmen. Instinktiv hält er die Hände vors Gesicht.
Ein zweiter Knall fegt durch das Zimmer, diesmal trifft es die Fensterscheiben. Ein Regen von großen und kleinen Scherben ergießt sich in den Garten. Aber wie ist das möglich, der Fremde steht doch direkt vor ihm?! Winfried sieht nun genau die golden erhellte Gestalt, er glaubt sogar, ihr leises Atmen zu hören.
Jetzt wäre die beste Gelegenheit, laut zu rufen. Er hat bei den Nachbarn Licht im ersten Stock gesehen, als er vom Gericht heimgekehrt ist. Winfried öffnet seinen Mund und überwindet die Scham: „Hilfe! Einbrecher in meinem Haus!“
Kurz überlegt er, selbst aus dem Gebäude zu fliehen oder „Feuer!“ zu schreien, denn davon fühlen sich Unbeteiligte eher zum Handeln bemüßigt.
Dann verschließt ein eisiger Hauch seine Lippen und gebietet ihm zu schweigen. Das Licht der Straßenlaternen erlischt. Selbst das Leuchten der Gestalt ist vergangen. Absolute Schwärze umfängt ihn. Wimmernd weicht Winfried dem Männlein nach hinten aus, bis der Schrank seinen Rückzug aufhält. Glassplitter stechen in seine Haut, aber er registriert den Schmerz nur ganz beiläufig am Rande seiner Wahrnehmung.
Ein Ton erschallt unangenehm schrill in Winfrieds Ohren. Es dauert einige Augenblicke, bis er begreift, dass das Geräusch real ist. „Die Türglocke!“
Schlagartig gehen alle Lichter wieder an. Verstört blickt er sich um. Vom nächtlichen Eindringling ist keine Spur zu sehen. Doch das Blut an seinen Händen und die Scherben am Boden sind eindeutige Beweise, dass die bedrohlichen Ereignisse keine Ausgeburt seiner Phantasie sind.
Mühsam erhebt sich Winfried und eilt zur Haustür. Die Videoüberwachung des Eingangsbereichs zeigt seinen Nachbarn. Eilig betätigt der Staatsanwalt die Öffnungsanlage für das eiserne Gartentor.
„Wir haben das Klirren und Ihre furchtbaren Schreie gehört. Die Polizei ist bereits informiert. Geht es Ihnen gut?“
Winfried unterdrückt das Zittern in seinem Körper, als er seinem eilfertigen Nachbarn antwortet. „Ja, ich … er … stand plötzlich mitten im Badezimmer. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das geistesgegenwärtige Handeln. Die Klingel hat ihn verjagt und mir vielleicht das Leben gerettet.“
„Ach, du liebe Zeit! War er bewaffnet? War er allein?“
„Ich habe zumindest keinen Komplizen gesehen. Es ist mir ein Rätsel, wie er unbemerkt eindringen konnte.“
„Ja, Haldor hat auch keinen Mucks von sich gegeben. Ich wollte ihn zur Verstärkung mitbringen, aber sonderbarerweise hat er sich geweigert, auch nur eine Pfote vor die Tür zu setzen. Vielleicht hat ihn das Bersten des Glases verängstigt. Da es dringend war, bin ich dann rasch allein herübergekommen. Oh! Sie sind ja verletzt!“
„Ach, das ist nichts weiter. Der Eindringling hat im Haus Scheiben zerschlagen und ich habe mir am Glas die Handflächen aufgeschnitten.“
„Soll ich die Feuerwehr rufen? Ich ahnte ja nicht, dass Sie in solcher Gefahr –“
„Die Verletzungen sind harmlos, aber ich werde sie von den Beamten dokumentieren lassen.“
Winfried hat seine liebe Mühe, den aufgeregten Nachbarn zu beruhigen – oder sich selbst? Mit aller Macht kehrt nun die Müdigkeit zurück. Hundeelend fühlt er sich, wie ausgelaugt. Trotzdem dauert es noch die ganze Nacht, bis auch die Kriminalpolizei den Tatort in Augenschein und seine Zeugenaussage aufgenommen hat.
Pflichtbewusst verzichtet Winfried darauf, sich krankzumelden. Zwar hat er kein Auge mehr zugetan, doch staut sich die Arbeit bereits und er hasst selbst verschuldete Verzögerungen.
„Ich habe gehört, bei dir wurde letzte Nacht eingebrochen? Das tut mir schrecklich leid. Ich hoffe, der Täter wird bald gefasst. Wenn es irgendetwas gibt, womit ich dir behilflich sein kann …“ Das rundliche, glattrasierte Gesicht des eloquenten Strafverteidigers RA Ingo Bollheimer, mit dem er sich vor einigen Jahren angefreundet hat, wirkt nicht minder übermüdet als sein eigenes.
Wie schnell sich derartige Nachrichten doch verbreiteten! Oberflächlich genervt, innerlich dankbar für die freundliche Anteilnahme, entscheidet sich Winfried dazu, das Gespräch gleich im Keim zu ersticken: „Das ist tatsächlich wahr. Da ich den Täter offensichtlich überrascht habe, ist jedoch nichts entwendet worden. Lediglich ein paar Scheiben gingen zu Bruch. Bitte entschuldige mich, ich habe in einer Dreiviertelstunde eine wichtige Beschuldigtenvernehmung, der ich persönlich beiwohnen muss. Mit meiner Anklageschrift bin ich auch im Verzug.“
Dass die Spurensicherung weder eine einzige Scherbe der zerstörten Fenster innerhalb des Hauses aufgefunden noch Fußabdrücke noch sonstige Spuren im Garten entdeckt hat, verschweigt er. Wäre er kein angesehener Bürger, könnte man ihm unterstellen, die Schäden selbst verursacht zu haben.
„Verzeih mir, Winfried“, der Anwalt sieht ihn flehentlich an, „aber dürfte ich dich kurz in einer persönlichen Angelegenheit sprechen?“
„Na schön, was gibt es denn Dringendes? Ist es wieder wegen der Scheidung?“
Ingo wird nicht auf fester tariflicher Basis vergütet und seine Ex-Frau hat sich anscheinend vorgenommen, ihn bis aufs letzte Hemd auszunehmen.
„Nein nein“, versichert Ingo rasch, „bestimmt nicht. Können wir bitte ins Besprechungszimmer nebenan gehen?“ Er schaut sich unruhig auf dem Gang um.
Winfried klopft ihm gutmütig auf die Schulter. „Wo drückt denn der Schuh?“, erkundigt er sich, als er die Tür hinter sich geschlossen hat. Nun sind sie ungestört, niemand wird mithören.
Trotzdem sieht Ingo kein bisschen ruhiger aus, eher noch unsicherer und vor allem unschlüssig. „Es ist … ich habe … letzte Nacht ist etwas geschehen“, setzt er zögernd an.
Ruhig, aber ein wenig bedenklich mustert Winfried seinen Anwaltskollegen. Worum auch immer es sich handeln mag, es setzt dem jungen Mann zu.
„Bitte hör mir erst bis zum Ende zu und lach mich nicht gleich aus“, bittet dieser, „ganz gleich, wie verrückt es klingt.“
„Das ist mein Job“, erklärt Winfried.
Ingo presst seine schmalen Lippen kurz aufeinander, dann gibt er sich einen Ruck. „Also schön. Ich habe mich gestern gegen 22:30 Uhr zu Bett begeben. Kurz vor Mitternacht, ich weiß das, weil ich sofort auf mein Handy geschaut habe, wurde ich durch ein schepperndes Geräusch geweckt. Mir war sofort klar, dass es von innerhalb der Wohnung kam. Ich lauschte und das Scheppern wiederholte sich, weshalb ich mich dazu entschloss, den Notruf zu wählen. Doch in diesem Augenblick schaltete sich das Gerät einfach aus und reagierte nicht mehr. Dabei hatte ich den Akku am Abend voll aufgeladen. Ich bin dann ganz leise aufgestanden und wollte mich in die Küche schleichen, um mich mit einem Messer zu bewaffnen. Aber kaum betrete ich die Küche –“
Der Mann stockt. Um seine Mundwinkel zuckt es.
Winfried wartet geduldig, bis er weiterspricht.
„Es ist mir unbegreiflich: Als ich über die Schwelle gehe und das Licht einschalten will, da fliegt ein Messer direkt auf mich zu! Mein Gott, mit welcher Wucht es in das Holz eingeschlagen ist! Hätte ich nicht so schnell reagiert und die Tür zugeschlagen, säße ich jetzt vielleicht nicht hier, um mich mit dir zu unterhalten.
Ich schlussfolgerte aus dem Angriff, dass sich doch jemand in der Küche befand, und versuchte, die Wohnungstür zu erreichen. Aber kaum habe ich den Flur halb durchquert, nehme ich so ein sonderbares gelbliches Leuchten wahr. Es ist mir schleierhaft, woher es kam, denn alle Türen waren geschlossen und der Korridor besitzt keine Fenster, wie du weißt. Ich schwöre dir, dass sich auch die Küchentür keinen Millimeter geöffnet hat! Wie kann das möglich sein?“
„Ist das alles?“, hakt Winfried anstelle einer Antwort nach.
„Ehrlich gesagt wird es noch gruseliger: Wie aus dem Boden gewachsen steht jemand vor mir und versperrt mir den Weg. Ich habe ihn wiedererkannt. Und du kennst ihn ebenfalls.“
„Oh?“, macht Winfried erstaunt. Eine ungute Ahnung umspült sein Bewusstsein. Ein wichtiges Detail, das er bislang erfolgreich verdrängt hat, weil es schlichtweg nicht möglich sein kann.
„Es handelte sich um das Opfer der Amazone, diesen kleinwüchsigen Japaner. Ich habe seine Leiche zwar nicht gesehen, sondern nur die Bilder aus den Akten, aber er war es.“
Natürlich! Deshalb kam Winfried der Mann so bekannt vor. „Du meinst den Prozess um die kannibalistisch veranlagte Mörderin?“ Die Frage ist vollkommen überflüssig, aber er muss etwas sagen. Er muss sein Gehirn zu irgendeiner Tätigkeit zwingen, um zu verhindern, dass das Grauen wie eine dunkle Woge über ihn hinwegspült.
Ingo deutet sein Schweigen falsch. „Ja, ich weiß, dass es wissenschaftlich unmöglich ist. Tote stehen nicht wieder aus ihren Gräbern auf. Aber wenn diese Erscheinung nur ein Alptraum war, warum steckt das Messer noch im Türholz? Ich habe so eine gottverdammte Angst, und ich weiß nicht, an wen ich mich sonst wenden soll. Dieser Fall war … anders als alles, was ich jemals verhandelt habe. “
Zu Ingos allergrößter Verwunderung antwortet Winfried: „Ich glaube dir.“
„Aber weshalb …?“
„Weil es derselbe Einbrecher ist, der auch mich heimgesucht hat. Eine Waffe im Teppich verschwinden oder Fenster nach außen explodieren lassen, das klappt nur mit aufwendigen Spezialeffekten. Dieser Täter handelt allein, und ich habe Grund zu der Annahme, dass es sich um nichts anderes als den Geist des Opfers der Amazone handelt.“
Entsetzt starrt Ingo den Staatsanwalt an. Vielleicht hat er eine nüchterne Erklärung erhofft, eine Beruhigung. Doch nun werden seine schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Eine Weile spricht keiner von beiden etwas. Dann rafft sich der junge Verteidiger auf: „Wir müssen handeln. Wir müssen Richter Jenkens informieren.“
„Vermutest du, dass er sich ebenfalls in Gefahr befindet?“ Winfried runzelt nachdenklich seine Augenbrauen. Wie man mit lebendigen Verdächtigen umgeht, hat er gelernt, aber wie soll man den Untaten ein Gespenstes Einhalt gebieten?
„Immerhin hat er für die Verurteilte lediglich die Unterbringung in einer Anstalt des Maßregelvollzuges angeordnet.“
„Das wird doch auf das Gleiche herauskommen wie ein lebenslänglicher Urteilsspruch.“
„Nun, womöglich verlangt der Geist des Ermordeten die Todesstrafe oder wenigstens die Feststellung der vollen Schuldfähigkeit.“
Winfried schüttelt langsam den Kopf. „Das ergibt keinen Sinn. Dann würde er doch zuallererst seine Mörderin verfolgen und nicht uns, die alles getan haben, um für Gerechtigkeit zu sorgen.“ Ein ungeheuerlicher Verdacht steigt in ihm auf: „Was aber, wenn sich das Opfer freiwillig in die Hände seiner Mörderin begeben hat?“
„Wäre das nicht von der Verteidigung angeführt worden?“
„Nicht, wenn es keine ausreichenden Beweise gab.“ Hastig springt der Staatsanwalt von seinem Stuhl auf. „Wir müssen unbedingt noch einmal Einsicht in die Akten des psychiatrischen Gutachters nehmen, der die verminderte Schuldfähigkeit festgestellt hat.“
Diese Sache kann nicht warten, und so sagen sie kurzfristig alle anberaumten Termine ab. Mit geübtem Blick und unter Zuhilfenahme moderner Technik findet Winfried den entscheidenden Hinweis erstaunlich schnell:
„Hier, sieh dir diese Textstelle im Protokoll der neunten Sitzung an:
„Er soll freiwillig zu Ihnen gekommen sein, obwohl er selbst Kannibale war?“
„Nun, er war alt geworden. Als letzte Erfüllung wollte er die andere Seite erfahren. Er berichtete mir, angesichts seines kleinen und schwächlichen Wuchses gäbe es kein schöneres Ende für ihn, als nach dem Tode für immer Teil einer großen, starken Frau zu werden.
Da hat er mich ausgewählt. Er war reich, stinkreich. Erbe irgendeiner großen Firma. Er hat mir Millionen versprochen.“
„Warum ausgerechnet eine arbeitslose Deutsche? Sein eigenes Opfer war eine französische Studentin.“
„Die deutsche Kultur und vor allem Literatur faszinierten ihn. Sein Lieblingsmärchen aus Kindertagen war Hänsel und Gretel. Was läge also näher als eine Deutsche mit wallenden, blonden Haaren wie ich?““
Die sonst so sportlich-elegante Haltung des jungen Anwalts ist zusammengesunken. Er sieht beinahe schuldbewusst aus. „Wir haben diesen Ansatz nicht weiter verfolgt, da er nach aktueller Rechtsauffassung für das Mordmotiv der Täterin keinen Unterschied gemacht hätte. Ich muss zugeben, dass auch ich als Strafverteidiger eine mögliche Freiwilligkeit des Opfers nicht angemessen berücksichtigt habe.“
„Damit ist alles klar“, stellt Winfried fest und klappt seinen Laptop und den dicken Ordner zu.
„Alles klar?“ Verdattert hebt Ingo den Blick.
„Selbstverständlich. Schenken wir dieser Aussage Glauben, dann ergibt sich hieraus ein eindeutiges Motiv des Opfers. Mit der zeitnahen Ergreifung der Täterin haben wir die Vollendung seiner perversen Sehnsüchte vereitelt. Sein Geist fühlt sich um diese Erfahrung betrogen und sucht nun alle Beteiligten heim.“
Ratlos blickt Ingo ihn an. „Und nun? Wir sind Anwälte, keine Geisterjäger.“
Ein Rauschen geht durch den Raum. Binnen Sekunden steigert es sich zu einem heulenden Sturm. Bücher stürzen zu Boden. Papiere flattern durch die Luft.
„Er ist hier“, flüstert Winfried entsetzt. „Aber halt! Es besteht noch Hoffnung.“
Verbissen kämpft er sich durch das Zimmer und tippt dabei eine Nummer in sein Diensthandy. Während sein Freund unter dem schweren Schreibtisch Deckung vor herumwirbelnden Geschossen gesucht hat, telefoniert er im Flur.
Als er den Raum wieder betritt, ebbt der Wind bereits ab. Doch sein Gesicht ist aschfahl, als er Ingo aufklärt: „Ich habe gerade mit dem Krematorium telefoniert. Issei Sagawas Leiche wurde gestern um 16:00 Uhr eingeäschert. Damit ist jegliche Möglichkeit vertan, seinen letzten Wunsch noch wahr werden zu lassen.“
„Deshalb hat er uns ausgerechnet in der letzten Nacht angegriffen! Was tun wir denn jetzt? Es ist bereits nach Mittag und wenn die Nacht einbricht, wird er bestimmt zurückkommen, um uns den Garaus zu machen.“ Die Stimme des jungen Mannes schwappt vor Verzweiflung über.
Fast väterlich legt Winfried seinem Freund – würden Arbeit und Familie ihn weniger vereinnahmen, wären sie sich nähergekommen – seine Hand auf den Rücken. Er nickt ihm bestätigend zu.
„Es gibt nichts mehr, das wir tun können, außer abzuwarten. Dieser furchtbare Geist will offenbar all jene zu bestrafen, die seinen kranken Plan vereitelt haben. Manche Menschen können auch im Tode keine Ruhe finden. Meine Expertise ist nicht dazu geeignet, Unschuldige vor solchem verderblichen Fluch zu schützen.
Was uns jedoch anbelangt, so habe ich eine ausgezeichnete Idee: Wir wollten irgendwann mit meinem Boot auf den Wannsee fahren. Lass uns für heute ausnahmsweise freinehmen und segeln. Ich rufe gleich meine Frau und die Familie meines Sohnes an. Wenn dies unser letzter Tag auf Erden sein könnte, möchte ich mit meiner Familie und meinem Schicksalsgenossen noch einmal die herrliche Landschaft genießen …“
Der Teddy im Müll
Das Jubilieren verschiedenster Singvögel erfüllte die Luft, nur hin und wieder unterbrochen von den lauten Rufen der Krähen. Schmutzig ruhte der kleine, braune Teddy inmitten von Abfällen und wartete darauf, gefunden zu werden. Jemand hatte ihn achtlos auf der Abraumhalde eines Grabfeldes entsorgt. Seine schwarzen Knopfaugen starrten sehnsüchtig den gepflasterten Weg entlang.
Da näherte sich ein Kinderwagen. Er wurde von einer lässig gekleideten Frau mittleren Alters geschoben, ein ungefähr fünf Jahre altes Mädchen lief neben ihr her. Die Sitzfläche auf dem Wagen war vorübergehend von einer geblümten Gießkanne in Beschlag genommen worden.
„Abteilung 167“ stand auf der verblichenen, türkisfarbenen Metallplakette, die auf den Meilenstein geschraubt war. Helga langweilte sich. Einen Opa zu besuchen, den sie nicht kannte und der weder mit ihr reden noch etwas unternehmen konnte, wozu sollte das gut sein? Mit ihrem Ball und ihren Barbiepuppen durfte sie hier nicht spielen. Warum, verstand sie nicht, denn sie machte doch gar nichts kaputt.
Eine unerwartete Entdeckung hellte ihr Gesicht auf. „Guck mal, Mutti!“ Mit dem fachkundigen Blick einer Spielzeugkennerin mit Vorschulwissen erkannte sie, dass es sich um ein Kuscheltier handelte. Sie löste ihre Hand vom Griff des Kinderwagens und stürmte auf die Müllsammelstelle zu.
„Halt, warte!“, versuchte ihre Mutter den Tatendrang des Kindes zu bremsen.
Helga griff so weit sie konnte durch das eiserne Gitter, das die rechteckige Abraumstelle umgab. Ihre Hände streckten sich dem ersehnten Gegenstand entgegen. Was für ein niedlicher Teddy! Wer war denn so blöd und warf so einen schönen Bären weg? „Darf ich den mitnehmen?“
„Ich weiß nicht.“ Die Mutter zögerte. Ihr fiel kein stichhaltiger Grund ein, es zu verbieten. Das Kuscheltier sah edel aus. Sicherlich fehlte es niemandem, sonst wäre es nicht entsorgt worden.
„Bitte!“, drängte Helga. „Er hat bestimmt Angst hier ganz allein. Ich werde dafür auch eine Barbie aussortieren.“
Das wirkte. Helgas Mutter hasste diese scheußlichen Barbies. „Na gut. Hier hast du eine Tüte.“
Freudig ergriff das Kind sie und kletterte über die Umrandung der Abraumstelle, um den Teddy zu ergreifen.
Die erboste Stimme einer älteren Dame ließ sie erschrocken zusammenzucken.
„Also das gibts doch nicht! Unmöglich!“
Helga blickte schüchtern über die Schulter. „Mutti?“, fragte sie unsicher.
„Pack ihn nur ein“, ermutigte die Mutter sie, „ich regle das schon.“
An die bucklige Frau gewandt, die mit ihrem Rollator stehen geblieben war, sprach sie in bestimmtem Ton: „Kümmern Sie sich bitte um Ihre eigenen Angelegenheiten und lassen Sie meine Tochter in Frieden!“
„Also, da hört sich doch alles auf!“, ereiferte sich die alte Frau. Sie mochte etwa achtzig Jahre zählen und etwas bucklig sein, doch in ihrer Stimme und ihren Bewegungen lagen eine erstaunliche Zähigkeit und Energie. „Schämen Sie sich denn gar nicht?!“, keifte sie. „Ihre Tochter im Müll auf dem Friedhof spielen und obendrein fremder Leuts Eigentum entwenden zu lassen? Ihnen sollte man das Kind wegnehmen!“
Damit deutete sie drohend auf Helga, die sich ängstlich an das Gitter der Abraumhalde drückte.
„Jetzt reicht's aber, Sie machen ihr Angst! Scheren Sie sich fort, oder ich mach Ihnen Beine!“, brüllte Helgas Mutter auf einmal los. Selten hatte Helga sie so wütend erlebt. Sogar die alte Hexe war beeindruckt. Langsam und mürrisch verzog sie sich, nicht ohne der Kleinen einen giftigen Seitenblick zuzuwerfen. „Du bist ein ganz böses Mädchen“, zischte sie halblaut.
„Los, beeil dich doch mal“, drängte die Mutter nach kurzer Zeit. „Und pack endlich den Teddy ein, ich habe keine Lust auf weitere Diskussionen!“
Ein kniehoher Zaun aus schmiedeeisernem, weiß lackiertem Metall umgrenzte das ein mal zwei Meter große Kindergrab. Auf dem frischen Grabstein standen ein Bronzevögelchen und ein Legomännchen. Blumen, Schleifen und Engel ruhten zwischen liebevoll gepflegten Blumen.
„Rosalias Teddy ist weg!“, kreischte eine verhärmt aussehende Frau. „Ich habe ihn doch gestern neben den Stein gestellt. Fünf Zentimeter halb rechts von der Steckvase mit den Rosen.“ Sie erklärte den Standort, als spräche sie mit einem Ermittler.
Ihr Schluchzen war hemmungslos und verzweifelt. Der Ehemann versuchte vergeblich, sie zu beruhigen. Einige Friedhofsbesucher sahen sich neugierig nach ihnen um, setzen ihren Weg aber rasch wieder fort, als sie bemerkten, wo das Elternpaar stand.
„Ja, das stimmt“, bekräftigte ihr Mann.
„Wer tut denn so etwas?“, stammelte die Mutter. „Wie kann jemand –?“ Sie rang nach Worten und warf sich dann in seine Arme.
Das Lieblingskuscheltier, das ihrer kleinen Tochter Rosalia im Hospiz Trost gespendet hatte, war spurlos verschwunden.
„Ich rufe auf der Stelle in der Verwaltung an“, versprach der Vater, „und wenn die mir auch nichts über den Verbleib sagen können, dann erstatten wir eine Anzeige bei der Polizei.“
Wie ein quengelndes Kind wiederholte die Mutter wieder und wieder: „Wo ist ihr Teddy?“
Sein neues Lieblingslied auf den Lippen begab sich Rolf vergnügt zu seiner Arbeitsstelle. Stelle mochte übertrieben sein; es handelte sich lediglich um eine befristete, als MAE-Maßnahme betitelte Beschäftigungstherapie des Jobcenters.
Doch im Gegensatz zur letzten machte sie ihm Spaß: Er war an der frischen Luft, konnte sich körperlich verausgaben, und die Erwartungen an ihn waren erträglich. Häufig durfte er eine halbe Stunde früher Feierabend machen. Deshalb nahm Rolf die neue Tätigkeit ernst und versuchte alle Aufgaben, die man ihm übertrug, so gewissenhaft wie möglich zu erledigen.
Kurze Zeit später machte er sich mit einem Rasenbesen und einer Schubkarre bewaffnet daran, den frisch vertikutierten Rasen abzuharken, der an das Kindergräberfeld grenzte. Zufrieden mit sich sah Rolf auf den ansehnlichen Berg bräunlichen Mooses, den er nach wenigen Minuten angesammelt hatte. Danach wären die Steinplatten vor der anonymen Belegungsfläche dran, die von Gras und Moos überwuchert waren.
Die Ruhe des Ortes wurde durch eine greinende Frau und ihren lautstark in sein Handy schimpfenden Begleiter gestört. Rolf ließ seinen Blick nachdenklich über das benachbarte Grabfeld schweifen. Ein ungutes Gefühl stieg in ihm auf, denn die beiden standen vor dem Grab, von dem er tags zuvor einen unzulässigen Grabschmuck entfernt hatte.
‚Hätte ich meine Maßnahme der Verwaltung melden müssen?‘, überlegte er. Andererseits war er genau belehrt worden, welche Arten von Dekoration erlaubt waren. Nein, er hatte sich nichts vorzuwerfen.
Da er im Umgang mit trauernden Angehörigen unbeholfen war, konzentrierte sich Rolf ganz auf seine Arbeit und blendete das Ehepaar so gut es ging aus. Zehn Minuten später erschien einer der Friedhofsmitarbeiter, sein Vorgesetzter Herr Lux, vor Ort. In gebührendem Abstand, doch nahe genug, um das Gespräch zu belauschen, gab sich Rolf weiter sehr beschäftigt. Es ging wahrhaftig um das unerlaubte Stoffspielzeug.
„Ich frage mal unseren Praktikanten“, erklärte Herr Lux plötzlich und kam zu ihm herüber. „Sagen Sie mal, Rolf, haben Sie vielleicht ein ungefähr fünfzehn Zentimeter großes, braunes Plüschtier gesehen? Oder sind Ihnen Besucher begegnet, die sich auffällig verhalten haben?“
Rolf gab ihm bereitwillig Auskunft: „Ja, allerdings, Herr Lux.“ Er wies auf besagte Stelle neben dem kleinen Marmorherz. „Da lag ein Teddy. Da er nicht den Vorgaben für Grabschmuck entsprach und Sie ja erklärt haben, weshalb wir es mit dem Umweltschutz sehr genau nehmen, habe ich ihn hinten auf die Abraumhalde geworfen.“
„Geworfen!“, heulte die Mutter auf.
„Ich verlange, dass dieser Praktikant auf der Stelle entlassen wird!“, entrüstete sich ihr Mann.
„Aber ich hab mich doch nur an die Vorgaben gehalten!“, rechtfertigte sich Rolf.
„Ihre Aufgabe“, schnitt ihm Herr Lux streng das Wort ab, „besteht darin, hier sauber zu machen. Sie haben nichts auf den Gräbern anzurühren --- ohne vorherige Rücksprache mit der Friedhofsverwaltung!“ Die letzten Wörter schrie er fast.
,Bitte, bitte, keinen Ärger‘ – es lief gerade so gut. Rolf fühlte Bitterkeit in sich aufsteigen. Wieso ging ständig etwas schief? In zwei Monaten hätte er das Geld für einen neuen Rechner beisammen. „Hören Sie, es tut mir leid. Ich wusste nicht –“
„Leid?“, fuhr ihn der Vater an. Die Mutter begann wie auf ein Signal erneut zu weinen.
„Sehen Sie, was das mit meiner Frau macht?“, erklärte der Mann anklagend an den Friedhofsmitarbeiter gewandt.
Dieser machte das betroffenste Gesicht, das er in seinem Beruf gelernt hatte. „Wir werden den Teddy Ihrer Tochter wieder beschaffen“, versicherte er. „Rolf, weißt du wenigstens, wo genau du ihn gestern abgelegt hast?“
„Ja. Ja!“, bekräftigte dieser. Sein Blick wanderte unstet zwischen den dreien hin und her und sein schlaksiger Körper war vor Aufregung in ständiger Bewegung. Seine motorische Unruhe trug nicht zur Entspannung der Lage bei.
„Was stehen Sie dann noch hier herum? Los!“, befahl sein Vorgesetzter.
Rolf führte die drei aufgebrachten Leute an einer Parkbank vorbei zur nächsten Abraumstelle, die neben einer großen Kiefer angelegt war.
„Da.“ Er zeigte auf das rechte der beiden Metallschilder, die auf der Rückseite der Umfassungen standen. Plastik, Glas, Steine kündete die weiße Schrift auf graugrünem Grund.
Das Gesicht der Mutter wurde aschfahl, als sie auf den Haufen blickte.
„Da ist nichts“, flüsterte sie tonlos. Dann schrie sie laut auf: „Da ist nichts!“, als erwartete sie, dass ihr jemand widersprach. Ihr Blick wanderte von einem zum anderen, doch die Männer sahen stumm zur Seite.
Zu viert umstanden sie die erkleckliche Müllsammlung. Drei ratlos, eine fassungslos.
‚Ich darf auf keinen Fall eine Sperre bekommen‘, flehte Rolf inbrünstig an jede göttliche Instanz, welche ihn hören mochte.
„Ich schwöre Ihnen, es war hier. Sicher hat irgendein Besucher ihn mitgenommen.“
„Sicher? Oder sollen wir besser zur nächsten Halde nachschauen gehen?“, fragte Herr Lux lauernd. Sein streng geschnittenes Gesicht mit dem düsteren Ausdruck verfinsterte sich noch mehr.
„Aber wenn ich es Ihnen doch sage!“, beteuerte Rolf. „Ich bin mir hundertprozentig sicher. Daneben habe ich nämlich das Eichenlaub entsorgt. Schauen Sie, hier. Da liegt es doch.“ Er wies auf den zweiten Abfallhaufen im umzäunten Bereich, der mit Kränze, Pflanzen, Erde ausgewiesen war.
‚Die Nichtnennung von Stofftieren auf beiden Halden beweist eindeutig, dass sie auf naturnahen Begräbnisstätten nichts zu suchen haben‘, dachte er.
„Das wird ein juristisches Nachspiel haben“, kündigte der Vater an. Er sah hilflos aus. Eins war klar, die Tränen in den Augen seiner Frau wären durch einen Richterspruch nicht zu trocknen. Sie würde viel Zeit benötigen, mehr Zeit, als gegenüber Rosalias nun zum Einzelkind verdammtem Geschwisterchen zu verantworten war.
„Und wenn ich Sie Ihnen den Bären erstatte? Von meinem eigenen Geld natürlich“, erbot sich Rolf. Das fand er ein großzügiges Angebot, denn den Kaufpreis müsste er von seinem Ersparten abknapsen.
„Dieser Bär ist unersetzlich!“, erklärte die Mutter empört. „Meine Rosalia ist an Leukämie gestorben. Wissen Sie überhaupt, was das ist?“
„Krebs, oder?“, fragte Rolf, doch die Frau hatte keine Antwort erwartet.
„Dieser Teddy darf einfach nicht weg sein.“
Wortreich entschuldigte sich Herr Lux bei den Trauernden. Keine Stunde später war Rolf seine MAE-Maßnahme los und damit die Aussicht, in diesem Jahr einen Rechner finanzieren zu können.
„Scheiße!“, fluchte er. „Drecksfotzen!“ Mit voller Wucht trat er gegen das Eingangstor und brüllte vor Wut und Schmerz, als der solide Metallrahmen seinem Fuß schmerzend Einhalt gebot.
Jetzt hätte er sich überlegen müssen, was er seiner Vermittlerin beim Amt erzählte, um die drohende Regelsatzkürzung abzuwenden.
Stattdessen drehten sich seine Gedanken um die Entscheidung, ob er seinen Frust eher an der Fensterscheibe der Verwaltung oder dem restlichen Grabschmuck der Familie auslassen sollte, die lautstark seine Entlassung eingefordert hatte.
„Ich habe einen guten Namen für ihn gefunden“, verkündete Helga.
„Ja, Liebling?“ Die Mutter, die beim Wäscheaufhängen war, bemühte sich, interessiert zu klingen.
„Er heißt Hugo. Wie mein Lieblingserzieher im Kindergarten, der gestern mit uns Fensterbilder gebastelt hat“, legte Helga fest.
„Ein schöner Name“, antwortete die Mutter geistesabwesend. 18:30 Uhr. Eine weitere Maschine würde sie nicht schaffen. Das Abendessen für die Kleine war auch noch nicht fertig.
„Darf Hugo heute Nacht in meinem Bett schlafen?“, drang Helgas Stimme erneut in ihre Planung.
„Nein, Liebling, er ist zu schmutzig.“
„Du hast gesagt, wir waschen Hugo“, sagte das Kind vorwurfsvoll. „Mit Seife und Bürste. Weil er so teuer aussieht und nicht in die Waschmaschine darf.“ Liebevoll kraulte sie das weiche, an einigen Stellen verklebte Fell des Bären.
„Geht das nicht auch morgen?“





























