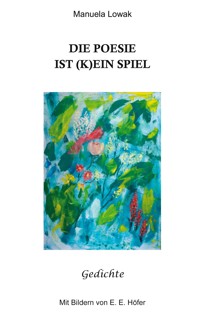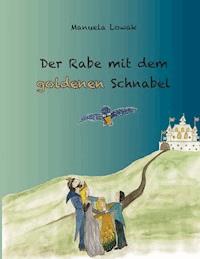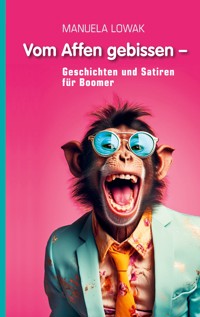
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vom Affen gebissen - 13 Geschichten und Satiren voller Überraschungen, Ironie und manchmal auch bitterem Humor. Trotz des scharfen Blicks auf gesellschaftliche Schieflagen, laden sie dazu ein, dem Alltag mit einem nachsichtigen Lächeln zu begegnen und die eigenen Erfahrungen als Teil eines großen, manchmal absurden, aber immer faszinierenden Ganzen zu sehen. Megafood für Sparfüchse Seit Brigitte ihren Rentenbescheid im Briefkasten fand, leidet sie unter Schlafstörungen. Nachts blättert sie in ihrer Rezeptsammlung, die sie an alte Bekannte, Kolleginnen und ihren Ex-Mann erinnert, der sich am liebsten von Käsebroten ernährte. Schließlich hat sie eine Idee, wie sie sich in Zukunft finanziell über Wasser halten könnte. Vom Affen gebissen Torsten Sommer, Anfang 60, frustrierter Angestellter und gehörnter Ehemann, begibt sich nach einer Vision im Fahrstuhl auf einen spontanen Roadtrip gen Süden. Unterwegs hat er eine kurze Affäre mit einer Umweltschützerin und nimmt seltsame Veränderungen an sich wahr. Sein Traum, bei den Berggorillas im Urwald zu leben, endet mit einem bösen Erwachen. Der bellende Klassenfeind Bonn, Oktober 1983. Nach ihrer Rückkehr aus Spanien und dem Ende ihrer Beziehung zu Diego zweifelt Resi an ihrem Studium, ihrer politischen Arbeit und ihren bisherigen Überzeugungen. Nach einem Besuch in einer Bonner Altstadtkneipe läuft sie nachts alleine nach Hause und macht auf der Kennedy-Brücke die Bekanntschaft mit einem schwarzen Hund, der nicht nur bellen kann. Anita, oder- Von nix kommt nix Anita ist für die Geburtstagsfeier ihrer jüngeren Schwester aus den USA angereist. Ihre Heirats- und Auswanderungsabenteuer sowie ihre finanziellen Erfolge werden aus der Sicht ihrer jüngeren, rivalisierenden Schwester erzählt. Am Ende zeigt sich, dass die große Boomer-Schwester - trotz ihrer vermeintlichen Oberflächlichkeit und Eigensinnigkeit - eine großzügige Person ist, die alle überrascht. Drei weitere Erzählungen handeln von Kindheitserinnerungen, Jugendwahn und Traumhäusern. Zwischen den längeren Geschichten nehmen sechs kurze, pointierte Stories und Satiren die Absurditäten unserer modernen Welt aufs Korn.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 216
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
13 Geschichten und Satiren –
Humorvoll, überraschend und manchmal skurril
Seit Brigitte ihren Rentenbescheid im Briefkasten fand, leidet sie unter Schlafstörungen. Nachts blättert sie in ihrer Rezeptsammlung und hat schließlich eine Idee, wie sie sich in Zukunft finanziell über Wasser halten könnte. („Megafood für Sparfüchse“)
Torsten Sommer, Anfang 60, begibt sich nach einem beruflichen Tiefschlag auf einen spontanen Roadtrip gen Süden. Unterwegs nimmt er seltsame Veränderungen an sich wahr und begegnet im Traum einem Berggorilla. („Vom Affen gebissen“)
Oktober 1983: Resi zweifelt an ihrem Studium und an ihrer politischen Arbeit. Nach einem Besuch in einer Bonner Altstadtkneipe läuft sie nachts alleine nach Hause und macht auf der Kennedy-Brücke eine unheimliche Bekanntschaft. („Der bellende Klassenfeind“)
Weitere Erzählungen führen Sie in das abenteuerliche Leben einer Friseurin („Anita, oder: Von nix kommt nix“), in eine Arbeitersiedlung am Rande des Westerwalds („Flausen im Kopf“), in die erfolglosen Verhandlungen eines Immobilienmaklers („Das Traumhaus“) und in die Lebenskrise einer Bonner Boomerin („Wachgeküsst“).
Zwischen den längeren Geschichten nehmen kurze, pointierte Stories und Satiren die Absurditäten unserer modernen Welt aufs Korn.
„Der Generationenkonflikt ist die Folge des Fortschritts“.
Albert Einstein
„Das Leben ist viel zu ernst, um es ernst zu nehmen“.
Loriot
„Man muss nicht jeden Quatsch mitmachen“.
Volksweisheit
INHALT
Achtung: Heiß und fettig!Statt eines Vorworts
Megafood für Sparfüchse
E-Mail an Mama
Vom Affen gebissen
Androiden
Der bellende Klassenfeind
Grenzgänger
Anita, oder: Von nix kommt nix!
Das LWS-Syndrom
Das Traumhaus
„Neben-Bouler“
Flausen im Kopf
Der letzte Hocker
Wachgeküsst
Nachwort
Danksagung/Anmerkungen
Achtung: Heiß und fettig!
Statt eines Vorworts
„Von nix kommt nix.“ Als ich diesen Satz neulich aus dem Mund eines alten Freundes hörte – wir diskutierten mal wieder über die ungleiche Verteilung des Vermögens in Deutschland, die durch das Erben und Vererben noch ungerechter wird – dachte ich zum ersten Mal: „OK Boomer!“ Dabei übersah ich, dass unser Freund kein Boomer ist, sondern der westdeutschen Nachkriegsgeneration angehört. Er bezeichnet sich selbst gern als „Alt-68er“ und sieht sich als rebellischen Wegbereiter des politischen Wandels und gesellschaftlichen Fortschritts in unserem Land.
Ich selbst bin es, die zu den vermeintlich „bösen Boomern“ zählt, den geburtenstarken Jahrgängen zwischen 1955 und 1964, die bald die Renten- und Pensionskassen sprengen werden; den Eigenheimbesitzern mit den dicken Dreckschleudern – die für die Klimakrise und den Fachkräftemangel verantwortlich sind, weil sie zwar für Wirtschaftswachstum gesorgt haben, aber nicht für genügend Nachwuchs. Wir Baby-Boomer sind die Erfinder der Durchschnittsfamilie mit 1,47 Kindern und der egoistischen „Dinkies“, double income, no kids, die selbst angesichts einer drohenden Klimakatastrophe nicht dazu bereit sind, auf Verbrenner-Auto, Ölheizung und Flugreisen zu verzichten – und erst recht nicht auf ihre fetten Grillsteaks.
Soweit das Klischee.
Die Vorwürfe mögen pauschal und überspitzt klingen, aber ich denke, wir Boomer haben nicht ganz zu Unrecht einen schlechten Ruf in Sachen Nachhaltigkeit. Allein schon aufgrund der Tatsache, dass es so viele von uns gibt, haben unsere Jahrgänge einen nicht geringen Beitrag zur Erderwärmung geleistet. Und das nicht nur aufgrund unserer Körperwärme, die gefühlt etwas höher ist als bei den nachfolgenden Generationen, bei denen alles „cool“ sein musste. Wir Boomer mochten es noch „heiß und fettig“. Vielleicht, weil viele von uns noch ohne Zentralheizung, warmes Wasser und geheizte Schlafzimmer aufgewachsen sind. Nur diejenigen überlebten, die sich in den langen, eiskalten Wintern der 50er- und 60er-Jahre von Kohl und fettem Speck ernährten und durch Fußballspielen oder Stricken in Bewegung blieben, um sich vor Erfrierungen zu schützen …
Ironie beiseite: Den relativ geringen CO₂-Fußabdruck unserer Kindheit haben wir Boomer später reichlich kompensiert – ja, überkompensiert. Schon mit achtzehn machten die meisten von uns den Führerschein und kauften sich ihr erstes Auto. Viele hatten zu diesem Zeitpunkt bereits eine Ausbildung abgeschlossen und verdienten ihr eigenes Geld, um den Wagen abzubezahlen. Wer zur Uni ging, bekam das Geld für den Wagen von Papa oder fuhr mit Bus und Bahn. Einige Jahre später, wenn der Bausparvertrag endlich reif war, wurde die Jugendliebe geheiratet und ein Haus gebaut – natürlich mit Zentralheizung, die mit billigem Öl aus den Golfstaaten befeuert wurde. In ländlichen Regionen konnten sich sogar Facharbeiter und kleine Angestellte ein Haus leisten, Handwerker sowieso, da sie die Hälfte der Baukosten durch Eigenleistungen aufbrachten. Bei den Uni-Absolventen dauerte es ein paar Jahre länger, bis ihnen die Banken Geld für ein Eigenheim liehen. Aber dann holten sie schnell auf: Sie kauften sich großzügige Altbauwohnungen mit hohen Decken, die kernsaniert und mit neuen Gasheizungen ausgestattet wurden. Sie hielten diese für umweltfreundlich, weil es ihnen so verkauft wurde. Wie auch immer: Auf diese Weise hatten es spätestens Ende der 80er-Jahre die meisten schön warm, ohne im Herbst Kohlen schaufeln zu müssen oder im Wald das gute Holz zu schlagen, das wir alle ja so lieben. Elektrische Herde, Kühlschränke und Warmwasserboiler – ich sage nur „Stiebel Eltron“ – waren durch die Automatisierung der Produktion bereits in den 60ern für den „kleinen Mann“ erschwinglich geworden. „Kleine Frauen“ haben ebenfalls davon profitiert. Außerdem freute sich bereits in den 70ern nicht nur die Oberschicht, sondern auch die mittlere und obere Unterschicht und die untere und mittlere Mittelschicht – also fast jeder, der einen Job hatte – über Telefon, Farbfernseher, Kassettenrekorder und Stereoanlage, vor allem aber über erschwingliche Haushaltsgeräte, wie Staubsauger, Waschmaschinen und elektrische Bügeleisen. Wer hätte dazu „nein“ gesagt?! Letztere erlaubten es den Boomer-Frauen, „sich selbst zu verwirklichen“, was im Klartext hieß, einer mehr oder weniger erfüllenden Erwerbstätigkeit nachzugehen, um sich in angemessener Höhe am Familieneinkommen zu beteiligen, ohne dabei die Arbeit im Haushalt zu vernachlässigen, versteht sich, die ihnen nach wie vor keiner abnahm. Allerspätestens in den 80ern legten sich viele Familien einen Zweitwagen zu – für die arbeitende Ehefrau oder den ältesten Sohn, die jüngste Tochter. Auf ein Auto waren inzwischen fast alle angewiesen. Schließlich arbeitete fast niemand mehr auf der eigenen Scholle oder in den Geschäften und Werkstätten im eigenen Viertel oder Dorf, sondern in Fabrikhallen auf der grünen Wiese oder in den Kaufhäusern und Büros der Zentren, oft dreißig Kilometer und mehr vom eigenen Wohnort entfernt.
Das Automobil brauchten wir außerdem, um in den „wohlverdienten“ Urlaub zu fahren, vorzugsweise in den Süden Europas, wo wir alte Fischerdörfer, junge Südländerinnen und Südländer, gefüllte Pasta, ölige Tapas und Eimer voller Sangria kennenlernten. Letzteres wäre vielleicht wirklich nicht nötig gewesen.
Das Ganze wäre ja nicht so aus dem Ruder gelaufen, wenn wir nicht so verdammt viele wären. Aber dafür können wir nun wirklich nichts! Denn das kam so: Ab Mitte der 1950er-Jahre ging es wirtschaftlich stark bergauf, und nach der Kriegslücke waren wieder genügend zeugungsfähige Männer unterwegs. Dadurch stieg die Geburtenrate bis zum sogenannten Pillenknick stetig an. Allerdings dauerte es noch ein paar Jahre, bis auch die fromme Familie auf dem Land ihre Bedenken über Bord warf und lernte, die Vorzüge einer Familienplanung zu schätzen, bei der man nicht auf Spaß verzichten musste.
Zuvor war es jedoch anders gewesen. Die verfügbaren Verhütungsmittel waren unzuverlässig oder verpönt, unsere Eltern und Großeltern hörten noch auf den Papst oder andere religiöse Autoritäten. Folglich war Kinderreichtum ein Zeichen dafür, dass man körperlich gesund, moralisch integer, finanziell am Limit und kräftemäßig – spätestens mit fünfzig – am Ende war. Man könnte meinen, das seien die besten Voraussetzungen, um nicht auf dumme Gedanken zu kommen – doch das Gegenteil war der Fall, wie uns die beiden Weltkriege gezeigt haben …
Zumindest kann man meiner Generation bis dato nicht vorwerfen, einen Weltkrieg angezettelt zu haben – im Gegenteil: Die Baby-Boomer haben die Friedensbewegung und den Umweltschutz zwar nicht erfunden, aber populär gemacht, so dass sie von großen Teilen der Bevölkerung unterstützt wurden. Viele junge Boomer haben den Kriegsdienst verweigert und als Zivis in sozialen Einrichtungen geschuftet. Sie sind zu hunderttausenden für den Frieden auf die Straße gegangen und haben patentierte Friedenstauben auf Sticker, Tassen, T-Shirts, Aufkleber, Fahnen, Kugelschreiber, Regenschirme, Schlüsselanhänger und Luftballons drucken lassen.
Nebenbei war das für einige ein gutes Geschäft – richtig: „Von nix kommt nix“.
Und nun tauchen Sie ein in meine unterhaltsamen, manchmal auch nachdenklich stimmenden Geschichten, die den Lebenswegen und Überzeugungen von Menschen meiner Generation auf kreative Weise gerecht werden möchten – denn oft sagen Geschichten mehr als tausend Statistiken!
Viel Spaß beim Lesen!
Megafood für Sparfüchse
„Froh zu sein bedarf es wenig …“
Mein Name ist Brigitte Schultz – Schultz mit TZ. Ich bin 66 Jahre alt, habe mein Leben lang hart gearbeitet – zunächst als Messebauerin, später im Büro – und war immer kerngesund. Aber seit genau fünf Wochen und drei Tagen leide ich an Schlaflosigkeit. Mitten in der Nacht sitze ich in der Küche in meinem weißen Korbstuhl – dem einzigen Stuhl, der mir nach meiner Scheidung geblieben ist, trinke Yogi Glückstee mit Schuss und blättere in Büchern aus dem letzten Jahrtausend und Magazinen, die meinen Namen tragen.
Auf der Suche nach einem Gedichtband von Mascha Kaléko fiel mir heute Nacht der fleckige, blaue Aktenordner in die Hände, in dem ich seit frühester Jugend Kochrezepte sammle. Der Ordner enthält ein wahres Sammelsurium: Eintöpfe und Suppen in allen Variationen, Kuchen und Weihnachtsgebäck aus aller Herren Länder, aber auch Fleisch-Pasteten, exotische Fischgerichte und italienische Vorspeisen. Während ich die Seiten durchblättere, tauchen Erinnerungen an Bekannte und Verwandte auf, an alte Freunde, verflossene Liebhaber und ehemalige Kolleginnen, die ich sonst wahrscheinlich längst vergessen hätte. Die ältesten Rezepte sind noch von Hand geschrieben, oft von denjenigen selbst, die sie mir großzügig überlassen haben. Die vergilbten, fleckigen Zettel wirken wie Zeugnisse aus einer vordigitalen Zeit, verfasst von weiblichen Verwandten, die „nur“ Hausfrauen waren oder auf dem Feld und in Fabriken geschuftet hatten, von väterlichen oder tyrannischen Chefs, mütterlichen Freundinnen, kaffeekochenden Sekretärinnen und schüchternen Zivis.
Das Rezept für knusprige Waffeln mit heißen Kirschen – noch in steiler Sütterlinschrift verfasst – ist wohl das älteste Rezept in meiner Sammlung. Die Waffeln wurden in einem schweren Waffeleisen aus Gusseisen gebacken, das man auf die heiße Platte des Kohlenherds stellte. Es stammt von der ältesten Schwester meines Vaters, der einzigen weiblichen Verwandten aus dieser Generation, die schon vor dem Zweiten Weltkrieg als Arbeiterin in der Industrie tätig war. Mit dem „stahlhart“ erarbeiteten Geld – später litt sie an Arthrose – erwirtschaftete sie sich ihre eigene Aussteuer: ein kleines Stück Bauland, auf dem noch heute ihre Nachfahren leben.
Den mit Backpflaumen gefüllten Schweinebraten gab es immer bei meiner Schwiegermutter, der Mutter meines Exmanns wohlgemerkt, die – als ich sie kennenlernte – immer gut gelaunt war, und zum Leidwesen ihres Sohnes die bürgerliche Küche liebte. Ich hatte ihr das Rezept an ihrem fünfundsiebzigsten Geburtstag entlockt, als sie selbst schon zittrig war und nicht mehr schreiben konnte. Es enthielt ziemlich viel Portwein und sogar Cognac. Vielleicht – kommt mir gerade in den Sinn – war ja der Weinbrand, den sie stets im Haus hatte, der Grund für ihre gute Laune und auch für ihre spätere Krankheit. Wundern würde es mich nicht – bei dem Sohn …
Die Rezepte für Markklößchen-Suppe, Kartoffelbrot, Kalten Hund und Zunge in Madeira-Soße hatte meine Mutter in ihrer steilen, sehr individuellen Schrift auf liniertes Papier geschrieben. Ich war damals Mitte Zwanzig und beabsichtigte, nach Portugal auszuwandern. Sicher wäre ich meinem damaligen Freund wohl bis zum Nordpol gefolgt, aber nicht ohne die Rezepte meiner Mutter. Die Zunge in Madeira-Soße habe ich allerdings nicht ein einziges Mal nachgekocht. Mag das Fleisch auch noch so zart und schmackhaft sein: Schon der Anblick einer frischen, noch nicht gehäuteten, pickeligen Rinderzunge verursacht bei mir einen leichten Brechreiz. Ich blättere weiter und komme zu den Rezepten meiner Oma. So bodenständig wie sie selbst war auch ihre Kochkunst: ohne Schnörkel, aber immer regional und schmackhaft. Ob es der würzige Sauerbraten war, der mit einer perfekten Balance aus Süße und Säure begeisterte, oder ein einfacher, aber delikater Kartoffelsalat – ihre Gerichte waren immer ein Highlight. Sie hatte die Fähigkeit, selbst aus den einfachsten Zutaten etwas Außergewöhnliches zu kreieren und bei Familienfeiern eine Atmosphäre der Wärme und des Miteinanders zu schaffen.
Das Rezept für den Sylter Lammtopf, das mit dem Fleisch von Lämmern zubereitet wird, die auf Salzwiesen geweidet haben, floss aus dem Montblanc-Füllfederhalter meines Bentley fahrenden zweiten Chefs. Er war ein Mann von beeindruckender Präsenz, doch hinter seiner charmanten Fassade verbargen sich ziemlich große Schwächen. Aus heutiger Sicht würde ich sagen: ein Narzisst und Frauenverachter, der sich selbst für ein Genie hielt und keine Kritik erlaubte, vor allem nicht, wenn sie von weiblichen Mitarbeitern geäußert wurde. Wer es wagte, an seinem Ego zu kratzen, wurde systematisch runtergemacht und kündigte früher oder später freiwillig. Ich selbst blieb nur verschont, da ich keine Konkurrenz für ihn darstellte, und weil wir uns ab und zu über Kochrezepte austauschten. Er pflegte nach außen das Image eines Gourmets und Hobbykochs, obwohl er am liebsten Currywurst mit Fritten aß, wie er mir einmal am Ende einer Weihnachtsfeier gestand. Das muss Ende der 90er-Jahre gewesen sein. Die extrem ausgelassene Feier glich eher einem Besäufnis bei einem Junggesellenabschied und endete mit einem Autounfall, der meinen Chef den Führerschein und seinen Bentley kostete. Danach war der Konsum von Alkohol im Büro – auch bei Firmenfeiern – strengstens verboten. Und was seinen Lammtopf betrifft: Da ich die Hauptzutat nie auftreiben konnte, gehört es zu den Rezepten, die in meinem Ordner verschimmeln wie eine vergessene Sellerieknolle.
Die schärfste Mitternachtssuppe, die man sich vorstellen kann, kam – trotz lauter Proteste meines Exmanns – in jeder Silvesternacht auf den Tisch, sofern wir Freunde eingeladen hatten. Das Rezept datiert aus den 80er Jahren. Ich glaubte damals, vor meiner Eheschließung noch schnell einen Kochkurs besuchen zu müssen, was ein Irrtum war, wie sich später herausstellen sollte. Der Kursleiter stellte sich uns als Künstler, Koch und Kräutersammler vor, und er hielt, was er versprach: Mit viel Kreativität, Ehrgeiz und einer sprühenden Energie zauberte er die köstlichsten Gerichte, die selbst die anspruchsvollsten Gaumen begeisterten. In der Liebe war er weniger erfolgreich; seine Beziehungen hielten nie länger als drei Monate. Vielleicht lag es daran, dass er in der Liebe ebenso leidenschaftlich und impulsiv war wie beim Kochen – er ließ eben nichts anbrennen. Auch in meinem Leben blieb er ein faszinierendes, aber flüchtiges Kapitel, während die scharfe Mitternachtssuppe noch lange Zeit ein fester Bestandteil unserer Silvesterfeiern war.
Mein von mir selbst mit der Schreibmaschine festgehaltenes und mit einem dampfenden Topf illustriertes Couscous-Rezept, das ich bereits in den 80er-Jahren von einer tunesischen Freundin in Frankreich bekommen habe, machte damals hierzulande schnell die Runde, zunächst in meiner Familie, später im gesamten Freundes- und Bekanntenkreis. Als ich Jahre später in einer anderen Stadt bei neuen Freunden zu einem Couscous-Essen eingeladen wurde, erzählte mir die Gastgeberin, das Gericht sei nach einem Original-Rezept einer Tunesierin zubereitet worden. Ich tat erstaunt und bezeugte meine Bewunderung. Allerdings fehlten die wichtigsten Zutaten, denn ich fand auf meinem Teller weder Lammfleisch noch Kichererbsen. Sogar die scharfe Gewürzpaste Harissa fehlte. Offenbar hatte man versucht, das Gericht mit dem deutschen Gaumen zu harmonisieren, oder die Zutaten waren beim häufigen Weitersagen einfach verlorengegangen, als hätte man mit dem Original-Rezept „Stille Post“ gespielt.
Die Menschen, die sich in meiner persönlichen Rezeptsammlung verewigt haben, waren alles andere als Kostverächter – mit einer Ausnahme: Das war ausgerechnet mein Mann, also mein Exmann. Er hinterließ mir sein Rezept „Variationen eines Toast Hawaii“, wie er es nannte, dessen Geheimnis er mir in den ersten Wochen unserer Beziehung großzügigerweise verriet. Es bestand aus dem in Deutschland berühmten Toast, den er entweder mit einer grünen Olive oder mit einem Cornichon statt mit der ansonsten üblichen Cocktailkirsche belegte. Diese an Originalität nicht zu überbietende Gaumenreizung hätte mich gleich stutzig machen müssen. Stattdessen lobte ich seine Variationen, als hätte mein vierjähriger Neffe ein Drei-Gänge-Menü gezaubert. Wie hätte wohl die kulinarische Welt auf diese „Kreation“ reagiert? Vielleicht mit einem Michelin-Stern für den Mut zur Olive? Oder mit einem Preis für die kreativste Verwendung von Cornichons? Ich stelle mir vor, wie er stolz in der Küche stand, während ich versuchte, meine Begeisterung für seine „Kunstwerke“ zu zügeln. „Schatz, das ist ja – innovativ!“, hätte ich sagen sollen, während ich überlegte, wie ich diese Beziehung so schnell wie möglich beenden könnte.
Ein weiteres, vielleicht etwas anspruchsvolleres Rezept meines Exmanns sucht man vergebens in meiner Sammlung, denn das einzige, was er gerne aß, waren Käsebrote. Ja, Sie haben richtig gelesen: KÄSEBROTE, der deutscheste aller Snacks und – neben dem Verbrenner-Auto – quasi der zweite Stützpfeiler unserer Leitkultur. Von wegen Kartoffeln – nein: Käsebrote sind des Deutschen Leib- und Magenspeise. Mein Exmann jedenfalls aß sie jeden Abend punkt neunzehn Uhr vor dem Fernseher und sah sich dabei das „heute journal“ an. Bei „Käsebrot“ denken Sie vielleicht an ein kerniges Dinkelbrot mit cremigem Ziegen- oder Schafskäse. Dazu eine Tomate aus dem Garten, schwarze Oliven, ein Glas Bordeaux. Weit gefehlt! Das Käsebrot meines Exmanns bestand aus einer Scheibe Graubrot aus dem Discounter, die er nachlässig mit billiger Margarine beschmierte, danach mit normiertem Gummi-Gouda belegte und – zu meinem Leidwesen – mit Zwiebelringen dekorierte. Den Billig-Käse hatte er zuvor mit größter Sorgfalt von seiner Plastikhülle befreit, als wäre es ein eingeschweißter Comté, der endlich seine teuren Aromen entfalten sollte. Dazu trank er ein Bier aus der Flasche – eine Billigmarke natürlich. Man könnte fast meinen, er hätte eine geheime Käsebrot-Philosophie entwickelt: „Weniger ist mehr – vor allem, wenn es um Qualität geht!“
So saß er da, mein Captain Cheese, bei dem es nichts zu lachen gab: mit dem Brot in der einen Hand und dem Bier in der anderen, während er die Weltpolitik im „heute-journal“ kommentierte. Ein Hoch auf die deutsche Butterbrot-Kultur! Mein kreolisches Hühnchen mit selbstgemachtem Curry und Kokosmilch, meine Mangold-Quiche mit Salbeiblättern, meine Polenta mit gebratener Sucuk auf Radicchio, mein Couscous mit Fisch oder die rote Linsensuppe mit einem Schuss Noilly Prat – all das wusste er nicht zu schätzen. Stattdessen bemängelte er nur die teuren Zutaten und den „Aufstand“, den ich ums Essen machte. Für ihn war Essen lediglich eine notwendige, aber lästige Art der Energiezufuhr, und er hoffte inständig, dass die unzeitgemäße Art der Ernährung bald durch effizientere, klimaschonendere und für alle zugänglichere Nahrungsmittel in Form von Pillen, Pulvern oder Implantaten ersetzt würde. Bis es soweit sei, würden ihm seine Käsebrote mit Zwiebeln und ab und an mal ein Apfel durchaus reichen, denn diese Kombination enthielte alles, was ein Mensch brauche: Eiweiße, Fette, Kohlenhydrate, Ballaststoffe und sogar Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. Das Wort „gesund“ kam ihm dabei nicht über die Lippen. „Gesund“ lebe bestenfalls ein Hai, dessen Gattung schon seit etwa 200 Millionen Jahren die Weltmeere unsicher mache, ohne jemals seine Essgewohnheiten geändert zu haben. Ob das stimmt, habe ich nie in Zweifel gezogen, denn mein Ex verpasste keine wissenschaftliche Doku und war quasi der geheime Champion der Quiz-Sendung „Wer weiß denn so was“.
Tja, wer braucht schon Haute Cuisine, wenn man die Kunst des Butterbrot-Genusses perfektioniert hat … An besonderen Tagen wurde das Käsebrot zusätzlich mit einem sauren Gürkchen verziert, das sogar krumm sein durfte. Allerdings waren diese Tage selten. Denn für meinen Ex gab es keine besonderen Tage. Da ihm sowohl der Glaube an etwas Höheres als auch die Achtung vor Traditionen fehlte, bedurfte es auch keiner Sonn- und Feiertage. Wozu den Ruhetag eines nicht existierenden Gottes würdigen, geschweige denn die Geburt und die Auferstehung seines Sohnes? Er weigerte sich, diesen „Humbug“ mitzumachen und arbeitete an allen Sonn und Feiertagen durch, was ihm sein Job als selbstständiger Steuerberater ermöglichte. Immerhin war er konsequent. Und ganz nebenbei brachte ihm der Verzicht auf Ruhetage rund 28 Prozent mehr Umsatz, wie er mir vorrechnete. Urlaub machten wir nur, wenn ich ihm eine von mir bis ins Detail durchorganisierte, höchstens fünftägige Reise schmackhaft machen konnte und mit einem Drei-Gänge-Menü drohte, falls er mich nicht begleiten würde. Letzteres half im Monat unserer Trennung dann auch nicht mehr. So kam es, dass ich alleine in die Provence reiste. Es war für mich seit Jahren der schönste Urlaub – und wahrscheinlich auch der letzte. Als geschiedene Rentnerin würde ich mir so bald keine Reise mehr leisten können.
Natürlich hatte mein Steuerberater-Ehemann rechtzeitig vor der Eheschließung einen Ehevertrag aufgesetzt, den ich – verliebt und blauäugig, wie ich damals war – ohne Bedenken unterschrieb. Die Vorteile eines solchen Vertrages machte er mir bei einem Sektfrühstück schmackhaft. Er argumentierte dabei so geschickt, dass ich der Überzeugung war, mit diesem Vertrag meine Zukunft abgesichert zu haben. Das Gegenteil war der Fall. Ich hätte vielleicht besser auf mein Bauchgefühl hören sollen, welches mir sagte, dass ein Ehevertrag oft mehr nach Käsebrot ohne Käse schmeckt, als nach einem Sektfrühstück mit echtem Champagner …
Nach meinem dreiwöchigen Provence-Urlaub betrat ich schweren Herzens unsere Wohnung und glaubte ich im ersten Moment, mich in der Haustür geirrt zu haben. Wo waren Garderobenschrank und Spiegel geblieben? Wo der Schirmständer aus Messing? Auch die angrenzenden Zimmer bestachen durch Leere: kein Schrank, kein Tisch, kein Bett – alles war weg. Ich fühlte mich wie in einem alten Schwarz-Weiß-Film, in dem der heimtückische Ehemann versuchte, seine ihm lästig gewordene, etwas naive Frau in den Wahnsinn zu treiben.
Was war hier los?
Geblieben waren nur die künstlichen Zimmerpflanzen und ein paar Dinge, die ich mit in die Ehe gebracht hatte: ein Ikea-Bücherregal samt Büchern, eine Stereo-Anlage mit defekten Lautsprechern, die Nähmaschine meiner Großmutter (die ich nie benutzt habe, aber sie sieht so nostalgisch aus), mein weißer Korbstuhl und ein kleiner Beistelltisch mit Fayencen aus Marokko. Wenigstens die Einbauküche hatte er mir dagelassen – ich schätze, der Ausbau hätte sich nicht gerechnet. Und im Briefkasten lagen die Stromrechnung und mein Rentenbescheid …
Prost Mahlzeit!
Im Kühlschrank fand ich überraschenderweise die Hauptzutaten für ein Abendessen: Brot, Margarine und Käse. Wer hätte das gedacht!? An die Tür hatte er mit einem Magneten ein Blatt Papier befestigt, das wohl als eine Art Abschiedsbrief gedacht war. Darin rechnete er mir bis auf den Cent genau vor, wie viel Geld ich im Laufe unserer achtunddreißigjährigen Ehe für überflüssige Lebensmittel ausgegeben habe. Die Zahlen basierten auf seinem akribisch geführten Haushaltsbuch in Form einer Excel-Tabelle, in die er täglich unsere Ausgaben eingetragen hatte. Mit Zins und Zinseszins kam er auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. (Ich wusste gar nicht, dass ich eine geheime Karriere als Gourmet-Köchin hinter mir hatte!) Um einen gerechten Ausgleich zu schaffen, sehe er sich daher gezwungen, die Möbel mitzunehmen, die er von seinem Geld angeschafft habe. Das entspreche übrigens auch dem Ehevertrag. Außerdem nannte er die Gründe für die Trennung: „Ich ziehe es vor, mich tagein, tagaus von Käsebroten zu ernähren, als noch länger mit einer maßlosen Fresserin (!) und Cross-Over-Gläubigen mit Hang zu rot-grünen Ideologien unter einem Dach zu wohnen, die null Interesse an Sex hat. Jedenfalls nicht mit mir!“
Soweit mein Exmann.
Was den Sex betrifft, muss ich ihm leider recht geben. Nicht nur sein ätzender Mundgeruch, verursacht durch Käsebrote mit Zwiebeln – vielleicht auch durch seinen krankhaften Geiz – haben bei mir schon seit Langem jegliches Gefühl von Lust im Keim erstickt. Betrogen habe ich ihn allerdings nie – was ich jetzt bereue. Denn er hat schon längst eine Neue, die ihn zu bekochen und zu bekehren versucht. Ich hoffe, sie hat schon ihren Geruchssinn verloren. Zu beneiden ist sie jedenfalls nicht. Allerdings überrascht es mich immer wieder, wie schnell selbst der kauzigste Mann – vorausgesetzt er nagt nicht am Hungertuch – eine neue, meist jüngere Lebensgefährtin findet, die bereit ist, Bett und Tisch mit ihm zu teilen. Wir Frauen müssen uns nach einer Trennung oft mit One-Night-Stands begnügen, und auch diese Gelegenheiten nehmen ab einem gewissen Alter quasi exponentiell ab, auch wenn wir uns noch so sehr um vielseitige Kontakte und ein jugendliches Äußeres bemühen. Vielleicht, weil wir uns mit den perfekt aussehenden, jungen Frauen in den sozialen Medien vergleichen – oder verglichen werden? Oder weil wir die digitale Dating-Welt ablehnen und auf die romantische Zufallsbegegnung à la Rosamunde Pilcher hoffen, die uns den Prinzen samt Schloss beim Stadtbummel vor die Füße fallen lässt …
Es ist schon faszinierend, wie unterschiedlich das Altern von Frauen und Männern immer noch wahrgenommen wird. Während die Männer glauben, sich mit der Zeit wie ein guter Wein zu entwickeln – je älter, desto besser – fühlen sich ältere Frauen oft wie Mettbrötchen auf einem Kirchweihfest: schnell verderblich und einfach nicht mehr hip. Und so sitze ich hier, mit einer Tasse Glückstee in der Hand und – dank des Wodkas – mit einem Lächeln auf den Lippen, während ich darüber nachdenke, wie ich mit meiner Rente demnächst über die Runden kommen soll. Zum Glück habe ich ja immer noch meine Nähmaschine und die Fayencen aus Marokko – die bringen sicher ein kleines Vermögen auf E-Bay – oder ich versuch’s mal bei „Bares für Rares“ …
Zurück zu meiner Schlaflosigkeit und ihren Verursachern: der alten Luftmatratze meines Sohnes und meinem Rentenbescheid. Letzter bestätigte mir schwarz auf weiß, was ich zwar schon seit langem wusste, aber bisher erfolgreich verdrängt hatte: Im Falle einer Scheidung würden meine Einkünfte vorne und hinten nicht reichen. Um weiterhin meine Miete zahlen zu können und gleichzeitig am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben – geschweige denn, um ein Auto oder einen Urlaub finanzieren zu können – müsste ich entweder weiterarbeiten oder eine Bank ausrauben. Da ich letzteres aus ethischen Gründen ablehne (und ich auch nicht sicher bin, ob ich mit einem Banküberfall wirklich die nächste Reise in die Provence finanzieren könnte), werde ich mir wohl oder übel eine Arbeit suchen müssen.
Mein alter Arbeitgeber, ein Messebauer, hat leider die Pandemie nicht überlebt, so dass ich meine Dienste als Bürokauffrau noch einmal auf dem freien Arbeitsmarkt anbieten muss – wie vor fünfundvierzig Jahren. Na toll! Sicher habe ich heute bessere Chancen. „Schließlich gibt es jetzt auch Online-Bewerbungen!“, meinte mein Sohn. „Vielleicht kannst du ja sogar von zu Hause aus arbeiten, so wie ich – in Pyjama und mit einer Tasse Kaffee in der Hand.“
„Ohne Tisch und ohne Laptop?“, fragte ich entnervt, denn beides hatte mein Mann mitgehen lassen …