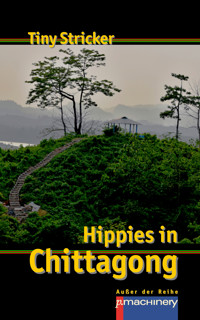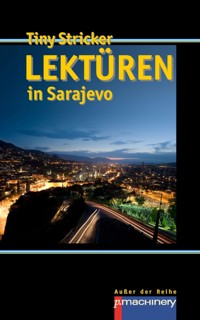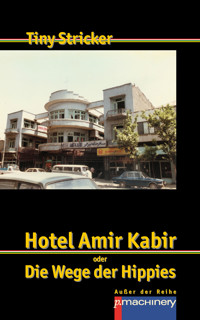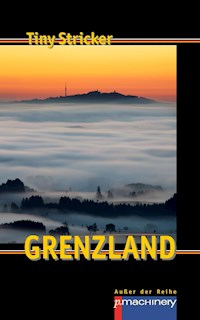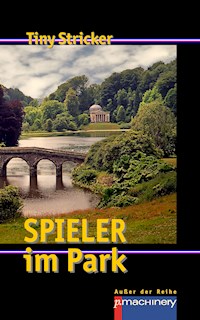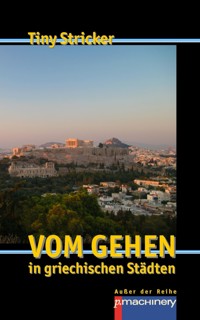
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: p.machinery
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Heinrich ("Tiny") Stricker beschäftigt sich nicht mit gängigen Griechenland-Themen, stattdessen mit streunenden Hunden, Politikerinnen, Migranten, Neubausiedlungen an der Küste, Amüsierlokalen und abgelegenen antiken Stätten. Dennoch (oder gerade deshalb) ist ein schönes, anderes, ausdrucksstarkes Griechenland-Buch entstanden. Dass darin auch Streifzüge in angrenzende Länder wie Albanien, Makedonien und die Türkei vorkommen, darf nicht verwundern. Überhaupt zeigt das Buch die durchlässige Grenze zwischen Okzident und Orient, ist ein beständiges und faszinierendes Spazieren zwischen Ost und West. Tiny Stricker lebte und arbeitete von 2002 bis 2007 in Thessaloniki. Seine Aufzeichnungen aus dieser Zeit sind zum ersten Mal in diesem Band versammelt. Vielen Lesern ist Tiny Stricker durch seine Werke "Trip Generation" und "Soultime", beides auf ihre Art längst Kultbücher, bekannt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 162
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Tiny Stricker
VOM GEHEN IN GRIECHISCHEN STÄDTEN
Werkausgabe Tiny Stricker
Band 5
Außer der Reihe 21
Tiny Stricker
VOM GEHEN IN GRIECHISCHEN STÄDTEN
Werkausgabe Tiny Stricker
Band 5
Außer der Reihe 21
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© dieser Ausgabe: September 2017
p.machinery Michael Haitel
Neuausgabe des 2010 bei Books on Demand erschienenen Werkes
Titelbild: Jan Schuler, fotolia.com
Layout & Umschlaggestaltung: global:epropaganda, Xlendi
Lektorat: Michael Haitel
Herstellung: Schaltungsdienst Lange oHG, Berlin
Verlag: p.machinery Michael Haitel
Ammergauer Str. 11, 82418 Murnau am Staffelsee
www.pmachinery.de
ISBN der Printausgabe: 978 3 95765 100 6
Die amerikanische Familie
Die Tochter der amerikanischen Familie unter uns übt Klavier. Es ist eine Art Kulthandlung, die zu jeder Tageszeit durchgeführt werden darf und der sich nichts entgegenzusetzen hat. Mich ärgert der hartnäckige sportliche Ehrgeiz, mit dem sie übt, wie sie erst mit der linken Hand den Bass und dann mit der rechten Hand die Melodie förmlich trainiert, alles mechanisch zusammensetzt, die Geschwindigkeit hechelnd steigert und schließlich auf altkluge Weise das Stück herunterrasselt, auf ihre Art gebieterisch, arrangierte, selbstgefällige Klassik oder, noch schlimmer, amerikanische Weisen, die sie besonders laut, strahlend und triumphierend vorträgt.
Vielleicht ist es die archaische amerikanische Familie, die ganze Woche erfüllt sich in einem Ritual, das seinen Höhepunkt am Samstag in einem ungeheuren, lärmenden Einkauf erreicht. Die Kinder springen aus dem Auto, der Vater erhebt sich träge und zufrieden vom Steuer, und ein allgemeines Glück breitet sich aus.
Ihre Handlungen sind klar und linear, und doch scheint es dunkle Geheimnisse zu geben. »We miss our winters in Salt Lake City«, sagt die Tochter mit angelernter Melancholie (und dieses »unsere Winter« scheint wieder ein Zeichen ihrer grenzenlosen Inbesitznahme aller Dinge zu sein). Spätnachts im strömenden Regen stoße ich auf die Amerikanerin, die völlig abwesend und wie aus einem anderen Bereich daherkommt. »Oh, you frightened me!«, schreit sie auf, und ihr Schrei ist wie eine Mischung aus tiefem Vorwurf und lang gezogener Hysterie.
Die Reporterin
Die Fernsehreporterin, die zum Laternenfest kommt, spricht Englisch mit den viel zu offenen Vokalen des Südens, die allem etwas Überschwängliches, ja Überkippendes geben. Es ist, als locke sie mit einem wilderen, heftigeren Lebensgefühl, hauche es mit knallrotem Mund dem nördlichen Idiom ein. Wenn sie spricht, das heißt, wenn man das Glück hat, längere Sätze mit ihr auszutauschen, gibt es undeutliche, ineinander verwobene Lautkombinationen, die ihrer Rede einen trügerischen und faszinierenden Untergrund verleihen, der Aussage den sicheren Boden entziehen.
Sie entsteigt dem Amphitheater der Menge und wendet sich, als hätte sie etwas durch und durch Magisches entdeckt, einem Kind mit Laterne zu oder vielmehr beugt sich leicht zu ihm hinab, wobei sie gleichzeitig die ganze Gewagtheit ihres unglaublich kurzen Mini-Woll-Kleids zeigt, das die kalte Jahreszeit einfach negiert … Sie hält ihm ein Mikrofon hin, das wie ein Szepter ist, Mittelpunkt der Fernsehwelt, denn sofort drängen wie übereifrige Vasallen die Kameraleute nach, und das Kind ergreift es scheu, aber auch begierig. Es erzählt von der Bedeutung des Fests in einem fernen Land, Deutschland, und später im Film schwenkt an dieser Stelle die Kamera hinüber zu den im Gras abgestellten Laternen, die jetzt wie bunte Zauberhütten wirken …
Tatsächlich entführt sie in eine andere, märchenhafte Welt, sie und der Produzent, der eigentlich immer gleichzeitig telefoniert, mit einer Vielzahl von wichtigen Persönlichkeiten in dauerndem Kontakt, erzeugen eine rauschhafte, alles möglich machende Atmosphäre. Sie verspricht, mich kurz vor der Sendung anzurufen, mit ihrer verführerischen, das Publikum betörenden Stimme. Aber es ist ein flüchtiger Glanz, natürlich ruft sie nicht an, ja schon Minuten später, als sie hoch erhobenen Hauptes durch die Menge geht, erkennt sie mich kaum mehr.
Die blonde Politikerin
Als wir in der Stadt ankamen, herrschte Wahlkampf, und die blonde Politikerin lächelte von vielen Plakaten. Je näher der Wahltag rückte, umso mehr häuften sich die Plakate, auf Lampen, Telegrafenmasten, an Haltestellen und Hausecken, den ganzen Berg hinauf, es war ein einziger Jubelschrei. Die Sonne brannte auf die Plakate und veränderte sie, noch heller erstrahlte das Blond, das Papier krümmte sich, man meinte, sie neige sich einem mit besonderem Mienenspiel zu.
Ihr Bild verschmilzt mit dem anderer künstlicher Blondinen, die typisch für den Stadtteil P… zu sein scheinen. Vornehmlich in Autos, die ebenso Symbol des erreichten Wohlstands sind, mit Sonnenbrille und Schmuck auf dem Beifahrersitz oder mit Kindern im Jeep, immer perfekt, in tadelloser Haltung, aber etwas unduldsam. Durch ihre Gepflegtheit und Makellosigkeit scheinen sie ihren Lebensstil noch zu überhöhen, zum allein gültigen Gesetz zu erheben. Der einzige Unterschied zu der blonden Politikerin ist, dass sie völlig privat sind, noch privater als andere Personen, während sie sich überraschend an die Öffentlichkeit wendet, sich selbst zur Botschaft macht.
Ihre Wahlkampfbroschüre, die immer wieder im Briefkasten steckte, wegen der unerwarteten Regenfälle in Plastikfolie wie ein teures Geschenk, aber es gab in diesen Tagen gar keine materiellen Grenzen, enthielt neben einem Text, den ich nicht lesen konnte, der aber nicht so wichtig schien, hauptsächlich Farbfotos von Partys, auf denen viele junge, gut aussehende Leute in einem Zustand feierlicher Erwartung verharrten. Manchmal trat sie wie eine gefeierte Künstlerin ans Mikrofon, das noch fern wirkte. Auf den Mittelseiten der Broschüre sah man, in Computersimulation bereits realisiert, ihr Lieblingsprojekt, ein großes Freilufttheater am Hang, purer Luxus, reines, überhaupt nicht notwendiges Accessoire und als solches schon wieder Botschaft. Erst auf der Rückseite Bilder der echten Wirklichkeit, Neubau-Slums mit Müll und Graffiti, aber mehr wie Spuren von Wilden, die hier nichts zu suchen hätten.
Die Lehrerin
Nora, unsere Lehrerin in der neuen Sprache, empfängt uns mit einem wütend bellenden Hund. Er bellt laut und anhaltend, bis wir uns in demütige Studenten verwandelt haben und als solche Nora in ihr Studierzimmer folgen. Dort nimmt sie in ihrem Schaukelstuhl Platz, und der Hund, der auf den vornehmen englischen Namen »Earman« hört und offenbar Englisch spricht, bezieht neben ihr Posten und setzt eine zufriedene und glückliche Miene auf. Er schließt sogar die Augen voll Befriedigung über die nunmehr geregelte Situation, und nur manchmal, wenn Nora eine besonders scharfe Frage ausstößt, zuckt er unruhig mit den Ohren.
Nora überzieht uns mit Fragen, verwickelt uns in eine Art kokette Plauderei, die für unser Niveau viel zu hoch ist. Bisweilen meint sie, indem sie ein Wort eigenartig ausspricht und uns dabei fixiert, uns schon die Bedeutung zu vermitteln.
Auch bewegt sich das Spiel innerhalb enger Grenzen, ist oft nur der formelhafte Abtausch von Wendungen, und man weiß nicht, ob dies ein Zeichen der Landeskultur ist oder die Dominanz der Sprachlehrerin, die nur den mustergültigen Ausdruck duldet.
Ihre eine Liebe gehört der Plauderei, ihre andere eindeutig dem Diktat. Es erscheint gewissermaßen als die absolute Form des Lehrens. »Ich möchte, dass ihr möglichst frühzeitig Schrift und Sprache miteinander verbindet«, sagt sie hochtrabend, aber in Wirklichkeit zwingt sie uns zu äußerster Aufmerksamkeit. Wir lauschen ihrer Stimme, hören auf jede Endung, auf jeden Laut. Es ist der Zeitvertreib angeregter Potentaten, der Hund schnurrt wohlgefällig dabei.
Natürlich ärgert uns ihre altertümlich lehrerhafte Art, auch die Diktate, die sie frei erfindet und in denen wir als sehr konventionelle Wesen wieder auftauchen, und doch: Ihre ganze bürgerliche Wohnung mit den säuberlich aufgereihten, mitunter zitternden Gläsern und Teeservicen, den Bildern und Zierstücken erscheint manchmal als sorgsam gestalteter und gehüteter Gegensatz zum brodelnden Chaos draußen und das Diktat fast als eine Form von Meditation, die die Hektik der Stadt besiegt und alles minutenlang in der Schwebe hält.
Das Mädchen aus Xanthi
»Du kommst also aus Xanthi«, sagt Frau S. bei der Prüfung mit der ihr eigenen süßen Liebenswürdigkeit und gleich darauf, »Aus Xanthi kommst du also«, wie in einem sich selbst überlassenen Singsang, als wäre Xanthi nur ein wohlklingender Name, um den sich leicht die Sätze flechten lassen, aber man spürt doch, dass etwas Besonderes an diesem Xanthi ist, auch weil das Mädchen dabei deutlich errötet.
Denn Xanthi ist der Hauptsitz der Minderheit, und tatsächlich sieht das Mädchen ganz anders aus als die übrigen Anwesenden im Saal: Der braune Teint, die dicken, dunklen Locken, die großen, leuchtenden Augen, der ganze Zauber des Orients geht von ihr aus … Sie ist erst dreizehn, gerade erst zur Prüfung zugelassen, und vielleicht fühlt sie sich ohnmächtig in diesem Augenblick und weiß nicht, was dieses »Du kommst also aus Xanthi« bedeuten soll. Aber gleichzeitig ist sie jetzt ein großes Mädchen, sie befindet sich auf einer weiten Reise (in der Erinnerung stelle ich sie mir wirklich mit einem Reisehut vor), dazu steigt ihr die Prüfungshitze in die Wangen. Eine gewisse Kühnheit erfasst sie, und sie wählt entschlossen das Thema »Tiere«.
Ich weiß nicht, ob sie Tiere besonders gern hat, und es ist auch etwas schwierig, dem Inhalt zu folgen, ihr unglaublich singender Tonfall löst die deutsche Sprache auf, und einzelne Wörter öffnen sich wie wundersame Blüten. Aber man spürt den Mut und das Engagement, und manchmal denke ich, dass alles, was sie zum Schutz der Tiere vorbringt, auch eine Verteidigung ihrer selbst ist, ihrer Minderheit, eine kindlich-beherzte Rede zum Schutz der Schwachen und Unterdrückten.
Die Straße
Jeden Morgen ergreifen mich die Wirbel der Straße, der Verkehrsstrom trägt mich hinab in die Stadt, und nur an den Ampeln finde ich kurze Rast.
Das Innehalten am Berg ist angenehm, man ist wie herausgehoben aus der Flut, empfindet einen Moment der erhabenen Ruhe, und auch das Loslassen und Wiedereintauchen hat eine befreiende Wirkung. Aber innerhalb des Stroms regiert die Hektik, das ungestüme Drängeln, ein harter, körperlicher Fahrstil ist angesagt, und die Ampeln, die von Rot sofort auf Grün schalten, sozusagen kompromisslos, unterstützen dies.
Die Fahrer, die sich, ohne im Geringsten zu warten, aus den Seitensträßchen einfach hineinschieben, grüßen und danken nicht. Das reine Vorwärtskommen erscheint noch als urtümliches Recht, und man wartet vergebens auf vermittelnde Blicke und Gesten. Die Autos kommen einem eher wie fahrbare Hütten vor, abgeschirmt von der Außenwelt, die Sonnenbrillen bestätigen es, und die Bewohner nicht teilnehmend oder nicht interessiert an dem, was man Öffentlichkeit nennt.
Natürlich gibt es die Hupe und mit ihr ein reiches Inventar an Zurufen von spitzen, höhnischen Bemerkungen bis hin zu erbostem Gebrüll, aber es ist ein losgelöstes Instrument, und wenn man sich umdreht, erblickt man einen Fahrer, der starr aus dem Fenster sieht.
Man durchquert die Vorstädte … Leute gehen, ohne sich umzusehen, mit einer Art von schroffem Stolz plötzlich vor einem über die Fahrbahn, Verhaltensweisen aus verschiedenen Zeiten und Räumen überlagern sich, genau wie am Rand niedrige, einfache Behausungen mit riesigen Reklametafeln und Betonblocks abwechseln, alte Leute laufen die Straße entlang wie auf der Suche nach verlorenen Wegen, an einer Bushaltestelle aus schäbigem Metall sitzt eine alte Frau in der Sonne, als wäre es der Dorfplatz.
Und dann ist man unten, und um einen her ist eindeutig Stadt, die Integrationskraft der angestammten Metropole entfaltet sich, die großen Straßen empfangen einen: die Botsari, die Egnatia, die Vassilisis Olgas, wie Grand Old Ladies, etwas verlebt, aber immer noch vital, im Schmuck ihrer Boutiquen und überquellenden Obstläden, Arenen und Theaterschauplätze des Lebens: Beifahrerinnen lassen sich mit unnachahmlicher Grazie vom Rücksitz gleiten, moderne Varianten von Kellnerjünglingen balancieren, Moped fahrend, ihr Tablett mit Wasserglas und Kaffee, ein Fahrer verlässt genau für eine Ampellänge sein Auto und findet genug Zeit, etwas an einer Tür abzustellen, dem Kioskbesitzer ein Scherzwort zuzurufen, ein paar Züge an der Zigarette zu nehmen und einer schönen Frau einen längeren Blick nachzuwerfen.
Das Wäldchen
Einmal lief ich schon nach Anbruch der Dunkelheit den Weg im Wäldchen empor, und eine weiße Wolke stieg mit mir auf, deutlich sichtbar durch die glitzernden Zweige, und dieses nahezu gleichzeitige Aufsteigen erfüllte mich mit einer ungeheuren Leichtigkeit nach einem harten Tag. Es war fast, als ob mich die Wolke selbst hinaufgetragen hätte.
Dies nur, um zu zeigen, wie schön das Wäldchen immer noch sein kann. Umgeben und ständig bedroht von P… mit seinen Neubauburgen und fantastischen Sicherheitsanlagen, Baugerippen und Zeugnissen verfehlter Spekulation, seinem Müll, seiner Flut von Autos … Aber noch immer streifen hinter dem Wäldchen zarte Wolken durch die Vorgebirge und Talschneisen um den Hortiatis und verursachen diese Träumerei. Vielleicht liebte ich das Wäldchen sogar umso mehr wegen seiner Bedrohung. Die Art, wie es sich auf den letzten Hügelabsatz zurückgezogen hatte, wie belagert von allen Seiten, schnürte einem das Herz zusammen, eine starke Emotion, ein Beschützerdrang überkam einen und steigerte noch die Empfänglichkeit.
Mein Lieblingseintritt in das Wäldchen geschah denn auch in der Dämmerung, wenn die Umrisse draußen schon nachgiebig im Dunst verschwammen und im Innern alles noch einmal in unwirklicher Farbenpracht aufleuchtete. Das zog einen hinein, dieses letzte Aufglimmen, die Farbtupfen da und dort waren wie Wegweiser … Jetzt war es leicht, dem Alltag zu entfliehen!
Auch war mein Weg so ausgedacht, dass ich nur besondere Ausschnitte der Außenwelt wahrnahm, die mir überdies wie Ausblicke in eine neue Welt erschienen. Zunächst das Hotel »Panorama« hinter der Hügelkuppe, das zu dieser Stunde ein ätherisches Gebäude im diffusen Licht war und wie gebannt auf das Meer hinausstarrte.
Dann den »Weg der Läufer« entlang, an Schutt und Brandspuren vorbei … Aber die ganze Hässlichkeit führte nur dazu, dass man den Blick noch entschiedener auf wahrhaft schöne Details heftete. Es kam dadurch zu einer neuen Hingabe, einem Zurückfinden und Aufgehen in der Natur.
Das Verlassen des »Hains« (denn so hieß er immer noch auf einem alten Straßenschild) musste natürlich oben am Restaurant »The Taste of China« geschehen, wo es am exotischsten war. Ein unvermuteter Seitenpfad führte aus dem Wäldchen, man erblickte das Chinarestaurant, das wie verknotet mit Telegrafenmasten in der Luft hing, und der Blick schweifte über die Dächer in die Ferne, wo die Dämmerung jetzt ein neblig-rauchiges, weites Bergland als Hintergrund entworfen hatte.
Vom Gehen
Das Gehen genießt hier kein hohes Ansehen. Hunde, vermutlich im Einklang mit ihren Herren, finden es äußerst verdächtig und rennen, das Privateigentum schützend, keifend und alle Welt alarmierend, den Zaun entlang. Besonders schlimm ist das langsame, nachdenkliche Gehen, das überhaupt nicht nach Sport oder dringender Besorgung aussieht, und am schlimmsten das Spazieren im Dunkeln: Männer, ihren Autos entstiegen, drehen sich mit der Miene treu sorgender Familienväter nach einem um. Geradezu gehässig reagieren die Autofahrer selbst. Der schlendernde Mensch erscheint ihnen als Rückschritt in der Zivilisation, etwas, das ihrer Weltordnung, ihrem Vorwärtsstreben völlig zuwiderläuft, sie haben ihre Freude daran, ihn aus seinem Gleichmut zu bringen und aufgescheucht über die Straße zu hetzen.
Insofern ist das Gehen hier eine Kostbarkeit, und als eine solche begreife ich es zunehmend. Welches Wohlgefühl durchströmt einen bereits, wenn man ein paar hundert Schritte gegangen ist! Der Körper schüttelt sich zurecht, findet seine Mitte wieder, Harmonie stellt sich ein, die Ruhe der Gedanken.
Gleichzeitig genießt man die wiedergefundene Elastizität und die Energie, die einem während des Tages abgegangen ist, wie ein einsamer Comicstripheld, der noch auf seine natürlichen Kräfte vertraut, bewegt man sich durch die sonst nur von Autos belebten Straßen. Überhaupt kehrt das Selbstbewusstsein zurück, denn mit dem körperlichen scheint auch ein innerliches Sichaufrichten verbunden zu sein. Die angespannte Stellung im Büro weicht einer freien, aufrechten Haltung, einem Gefühl innerer Stärke.
Dass es einem gelungen ist, Spazierwege in dieses schwer passierbare Terrain zu schlagen, erfüllt einen mit Befriedigung. Es ist, als ob man eine vergessene Stadtlandschaft wiedergewinnen würde, denn nur durch langsames, aufmerksames Gehen kann man die Atmosphäre des Ortes wirklich erfahren: die postmodernen Bauwerke, die dörflichen Ecken daneben, die übersehenen Gärtchen … Seit Neuestem gesellt sich sogar unsere griechische Katze zu uns auf unseren Spaziergängen, offenbar ebenso von einem abendlichen Erkundungs- und Freiheitsdrang erfasst, mit großen Sprüngen, die Lauscher hochgestellt, und in unserem Windschatten die wild bellenden Hunde der Umgebung kühn ignorierend.
Satellitenfernsehen
Nachts Satellitenfernsehen: Wir betreten ein Land mit meist amerikanischen Großstädten, in denen seltsamerweise Deutsch gesprochen wird. Diese Synchronstimmen faszinieren mich.
Sie haben kaum lokale Färbung, kein deutsches Umfeld, in das sie einzuordnen wären. Insofern fehlt ihnen Vergangenheit und Tiefe, stattdessen legen sie eine saloppe Munterkeit an den Tag, und man kann dies als Befreiung empfinden, als eine Art Unschuld, als Aufgehen im reinen Alltag.
Die englischen Wörter im Text scheinen sie allerdings zu verherrlichen (obwohl sie alles sehr deutsch aussprechen, um die Zuschauer nicht zu verunsichern), bei Wörtern wie »College« und »Highschool Ball« erheben sie emphatisch die Stimme, und sie brauchen diese Ausdrücke auch dringend, um ihre brüchige Identität zu wahren.
Sie wollen mitreißen, versprühen eine gewisse Begeisterung für Entschlusskraft und rasches Handeln. Auf diese Weise huldigen sie einem Amerikanismus, verschreiben sich ganz der Tatphilosophie der amerikanischen Filme.
Wenn man länger zuschaut, stellen sie aber eben diese Filme wieder infrage. Die Sätze wirken oft gekünstelt, als wären sich die Personen ihrer Sache doch nicht ganz so sicher, die Lippenbewegungen stimmen mit dem Gesagten nicht ganz überein, es entsteht eine Pause, ein Gefühl der Leere, ein fragender Gesichtsausdruck mitten in einem klaren Actionfilm.
Hinzu kommt, dass in diesem großen südlichen Raum, der zugleich Eingangshalle und Wohnzimmer darstellt, Fernsehen etwas anderes ist. Spätnachts steht der Fernseher abseits mit flackerndem Schein in der Ecke, kein zentraler Kultgegenstand mehr, sondern eher ein einsames Gerät, das zum Nachdenken anregt.
Die alten Königsstädte
Pella hatten wir zuerst gesehen, an einem grauen Herbsttag, der mit Regenmassen begann, aber vielleicht war so ein Tag, der gar nichts versprach, gerade richtig. Es traf sich auch gut, dass wir uns zuerst verfuhren, an einer unübersichtlichen, leicht überschwemmten Kreuzung auf eine Ausfallstraße nach Norden abgedrängt, auf der wir eine Weile in einem unergründlichen Stau standen. Dies lehrte uns Geduld und eine andere Zeiteinteilung.
Endlich fanden wir dann doch die Ausfahrt und Straße nach E…, eine schnurgerade Strecke durch die Ebene, auf der man schnell Weite und Abstand gewinnt. Das Axios-Delta zog vorüber, mit auffliegenden Vogelschwärmen wie ein alter Traum, darauf Schilfmeere, Straßendörfer mit in der Sonne verblassten Schildern, einzelne Erdhügel, schließlich Pella.
»Dies ist keine allzu erhebende Stätte«, hatte es schon in unserem betagten Reiseführer geheißen, und tatsächlich empfing uns ein zunächst liebloser Ort. Eine Fernstraße durchschneidet das Areal, auf der die Laster dahinbrausen.
Die Kasse des Museums, das wir zuerst aufsuchten, war mit drei Mädchen besetzt, die in einem äußert lebhaften Dauerschwatz begriffen waren und mit dem Museum nicht das Geringste zu tun haben wollten. Die Karten gaben sie völlig nebenbei und geistesabwesend an die spärlichen Besucher ab. Die Hüterinnen schienen bewusst so ausgewählt zu sein, dass sie keinen Bezug zu ihrer Umgebung zeigten und eine stolze Nichtachtung zur Schau trugen. Erst dies schien sie für ihre Tätigkeit richtig zu qualifizieren und sie sozusagen amtlich genug zu machen. Immerhin hatte es den Vorteil, dass man die Räume ganz für sich hatte und sich ohne emotionale Einmischung gewissermaßen ganz den Gegenständen, einige davon frisch und sorglos-bunt restauriert, überlassen konnte.
Anschließend liefen wir über die Straße hinüber zur Hauptausgrabungsstätte, und das Dröhnen des Verkehrs wurde jetzt zum meditativen Sog, der keine Gespräche mehr zuließ (später beobachtete ich mit einer gewissen Befriedigung einen Fremdenführer, der Schwierigkeiten hatte, seine auswendig gelernte, eingebildete Litanei aufzusagen). Eingesponnen in einen Kokon aus Lärm und grauer Herbstluft irrten wir über das Gelände, aber man konnte sich dadurch in Details verlieren, auf Wegbiegungen und Hausecken achten und einem antiken Stadtleben nachspüren. Ein paar der Mosaike waren noch »in situ« und Schutzkonstruktionen darüber errichtet, die nun wie durchsichtige, kleine Fantasiepaläste in der Landschaft standen.
Wir trafen uns wieder bei einem der Mosaike, und meine Freundin wies auf das Vermion-Gebirge im Hintergrund, das ich vor lauter Archäologie und Spurenlesen gar nicht bemerkt hatte. Von dichten Wolkenschwaden überzogen, wirkte es wie ein dampfendes Weihrauchgefäß. In diesem Moment löste sich überdies, von einem aufgebrachten, scharfen Wind getrieben, eine große, märchenhaft geschwungene Wolke von den Gipfeln, blieb noch kurz an der Bergflanke hängen, um sich dann wie ein zauberhaftes Gefährt auf den weiten Weg über das Land zu begeben.
Der Tanz
Es gibt hier noch den Schreittanz, und seine Kunst ist eine weit höhere als die des Geschwindigkeitstanzes. Mit wenigen Schritten und Bewegungen dieses Schwebende zu erlangen, das dem Geschwindigkeitstänzer mit aufkommender Raserei gleichsam mechanisch zufällt, erscheint schwierig und geheimnisvoll. Es beginnt mit einer Verlangsamung der Gebärden, einem großen Innehalten im Tagesgerenne, bei gleichzeitigem Strecken und Öffnen der Glieder wie Flügel. Oft taucht der Tänzer oder die Tänzerin aus der Tiefe, das heißt aus gebückter Haltung auf wie ein Vogel. Ein oder zwei Anfeuerer, die eigentlich magische Diener geworden sind, knien neben ihm, gleichmäßig und obsessiv klatschend, und machen dabei den Höhenunterschied deutlich, diesen Aufstieg, denn jetzt ist jede Bewegung ein herrlicher Akt im Raum, aus dem der Tänzer zugleich neue Kraft schöpft. Er wirft seinen Arm nach vorn, und man hat das Gefühl, durch diesen Ausgriff erhebt sich der übrige Körper in die Luft. Er verschränkt die Arme zu einer wundersamen Krone über dem Kopf (und hier ist es genau wie im russischen Ballett), und in einer einzigen fließenden Bewegung beruhigt sich der ganze Körper und steht schwerelos inmitten der Musik, ja fliegt mit ihr dahin.
Tirana
Während der Prüfungen in Tirana schaute ich oft aus dem Fenster oder vielmehr verfiel in ein sinnendes Starren. Den Blick zum Beispiel auf ein Schülerheim gerichtet, das ich längere Zeit für eine Jugendstrafanstalt hielt, so schmucklos war das Gebäude. Einziges bemerkenswertes Objekt auf dem weiten, steppenartigen, sonst nur von Schülergruppen bevölkerten Hof war der ergraute Mercedes des Direktors, Inbegriff seiner Macht und Stellung, stundenlang gewaschen und abgerieben von ärmlich gekleideten Gehilfen, wobei der Direktor immer wieder hinzutrat und mit strenger Miene auf ein winziges ungeputztes oder schon wieder staubiges Detail deutete. Wie bei einem Herrscher der Feudalzeit schien ihm der Erhalt seiner Symbole am wichtigsten zu sein.