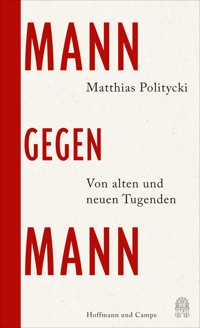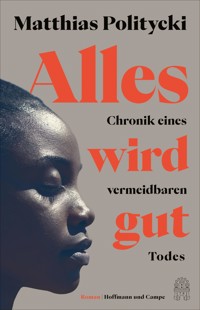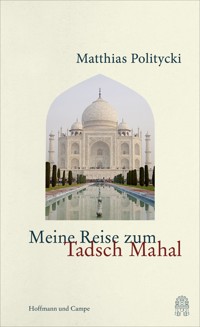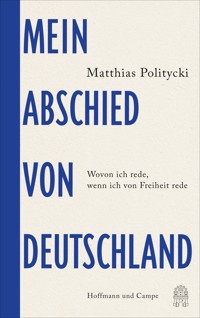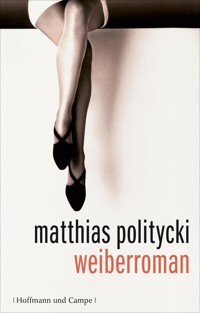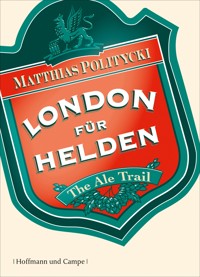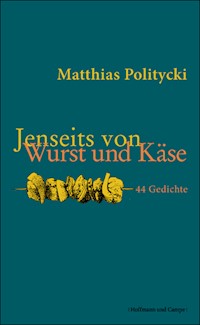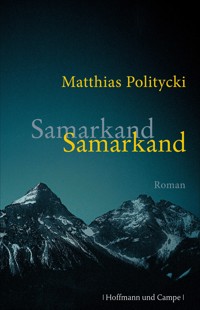6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Matthias Politycki ist als Romancier und Lyriker bekannt; er hat sich aber auch immer den ästhetischen oder politischen Fragen der Zeit gestellt, in Debatten eingegriffen oder sie, dem herrschenden Konsens meist einen Gedankengang voraus, überhaupt erst angestoßen. »Erzählende Essays« könnte man die Texte dieses Bandes nennen, der Matthias Polityckis viel beachteten Streitschriften wie »Relevanter Realismus«, »Der amerikanische Holzweg« oder »Weißer Mann - was nun?« versammelt, aber auch stillere Prosastücke, die ihn als notorischen Ausflügler in unsere digitale oder ganz reale Alltagswirklichkeit zeigen. Geharnischte Abrechnungen und temperamentvolle Liebeserklärungen, das Ende der Volksparteien oder die nicht enden wollende Welttournee der Rolling Stones: Matthias Politycki schreibt stilistisch stets auf höchstem Niveau, voller leidenschaftlichem Ernst und luzider Bissigkeit. Und er hat das Ganze mit einer fulminanten Grundsatzerklärung »Alt werden, ohne jung zu bleiben« versehen, die ihn als politischen Autor verortet, aber als einen, der nicht aus einer weltanschaulich fixierten Ecke heraus schreibt, sondern aus postideologischer Lust an nahezu allem, was der Fall ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 451
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Matthias Politycki
Vom Verschwinden der Dinge in der Zukunft
Bestimmte Artikel 2006–1998
Hoffmann und Campe Verlag
IAlt werden, ohne jung zu bleiben
Eines Tages wurde Meister Me-ti beim Spazierengehen von seinem Jugendfreund Yang-tschu überrascht, der ihm mit dem freudigen Ausruf des Wiedererkennens von hinten auf die Schulter klopfte.
»Oh!« konnte Yang-tschu ein kleines Entsetzen nicht verbergen, als sich Me-ti vollends zu ihm gewandt: »Du bist alt geworden!«
Lange betrachtete Me-ti seinen Freund, schüttelte dann mißbilligend den Kopf: »Nicht alt bin ich geworden, Yang-tschu, sondern älter. Wohingegen du immer noch genauso jung bist wie an jenem Tag, da ich dich das erste Mal sah.«
»Aber das ist über fünfzig Jahre her!« fühlte sich Yang-tschu geschmeichelt: »Du willst mir tatsächlich sagen, ich hätte mich gar nicht verändert?«
»Das will ich«, bestätigte Me-ti und fügte hinzu: »Schon damals warst du genauso alt wie heute.«
(Bertolt Brecht: Me-ti, Buch der Wendungen)
Alt werden, ohne jung zu bleiben
Seit dem 28. Februar 1992 führe ich mit meinem Freund Christoph Bartmann[1] das immerwährende »Prager Protokoll«: Begonnen anläßlich eines Besuchs im dort gerade neugegründeten Goethe-Institut und noch ganz im Zeichen privater Irrungen und Wirrungen stehend, widmete es sich im Zuge der Zeit – auch wenn wir uns andernorts trafen, hielten wir am Namen unsrer Gesprächsnotate fest – zunehmend den allgemeinen Weltläuften, festgehalten in holzschnittartigen Kurzzusammenfassungen unsrer Weitschweifigkeiten: Es steht nicht gut um die deutsche Kultur, wenn man vom Ausland auf sie blickt, so eines unsrer von Jahr zu Jahr verzagter intonierten Leitmotive, welch grassierendes Desinteresse an der deutschen Sprache, welch rasanter Verlust an Strahlkraft dessen, was jenseits von Mercedesstern, Adidasstreifen und Niveadose unterm Label »deutsch« firmiert![2] Mit den kläglichen Darbietungen der Nationalelf fing es an,[3] mit der Flucht von Spitzensteuerzahlern und -wissenschaftlern ins Ausland, dem konstanten Anwachsen von Staatsschuld, Arbeitslosenzahl und allgemeiner Politikverdrossenheit hörte es noch lang nicht auf.
Soweit das Holzschnittartige. Selbstredend hätten all die angeschnittnen Themen differenzierter angegangen werden müssen; ihre schiere Benennung schien uns jedoch als Hintergrundsrauschen auszureichen, vor dessen anschwellender Intensität das Prager Protokollieren erst so richtig in Fahrt kam: »Es muß sich was ändern, die Frage ist nur: was wo wie wann.«[4] Fürs übrige Mitteleuropa sah es unsrer Meinung nach im Verlauf der späten 90er ebenfalls zunehmend düster aus, für die Gründerstaaten der EWG, deren wichtigste Vertreter denn auch nach der Jahrtausendwende als »Altes Europa« explizit auf einen weltpolitischen Abstiegsplatz verwiesen wurden.[5] Und in Bälde wahrscheinlich auch auf einen weltwirtschaftlichen, wohingegen die jungen Industrienationen Asiens immer häufiger für Schlagzeilen sorgten, und zwar längst nicht mehr in Sachen Verlagerung von Produktionsstätten in Billiglohnländer, oh nein! Sondern indem sie mit ihrer rasant wachsenden Wirtschaftskraft altehrwürdige Industriestaaten wie Frankreich auf die Plätze verwiesen[6] oder sich im Handstreich riesige europäische Großkonzerne einverleibten,[7] indem sie sich also dem wachsenden Druck der Globalisierung weit besser anzupassen wußten als der Rest der Welt und damit für Verwerfungen sorgten, die man als erste Vorboten einer völlig neuen Wirtschaftsordnung lesen konnte: Ob wir von einem »Kleinen Tiger« wie Taiwan auf Mitteleuropa blickten oder von einem der dynamisch aufstrebenden Staaten des ehemaligen Ostblocks – und beide taten (und tun) wir das als überzeugte »Alte Europäer«, keine Frage –, vermeinten wir, Symptome des drohenden Abstiegs aus der »Ersten Welt« zu entdecken, zumindest schon mal die entsprechende Lähmung, Verkrustung, diffus muffige Untergangsstimmung. Zugegeben, auch wir frönten beim Prager Protokollieren der allgemeinen Verdrießlichkeit, wie sie hierzulande über Jahre zum guten schlechten Ton gehörte. Waren wir auf diese Weise etwa zu »Konservativen« geworden? Oder lediglich kritischer im Umgang mit Illusionen, sprich: leidenschaftsloser, kälter, älter?
Älterwerden erlebten wir während der 90er, in unsrer Eigenschaft als Bürger eines Gemeinwesens, auch als Verlusterfahrung, mit dem Zusammenbruch des Ostblocks war ja nicht nur die sozialistische Utopie an ein real existierendes Ende gekommen, sondern auch die des »freien Westens«, in der soziale Marktwirtschaft so berauschend schlicht mit Demokratie und Glück gleichgesetzt werden konnte: Erst ging mit Pauken und Trompeten die DDR unter, dann, sang- und klanglos bis zum heutigen Tage, die alte BRD. Gegen unsern Willen gerieten wir östlich wie westlich der alten Demarkationslinie Into the Great Wide Open, in eine rundum offene Gesellschaft, in der nichts mehr tabu, unhinterfragbar, heilig, hingegen alles möglich und paradoxerweise trotzdem ohne echte Zukunftsperspektive war. Schon bald schien unsre Idee von Freiheit auf den Sachverhalt zusammenzuschnurren, daß wir zwischen den diversen Stromversorgern, Netzbetreibern, Spaßlieferanten wählen und uns ansonsten als »Ich-AG« würden durchschlagen dürfen; an der Abschaffung unsres klassischen Kulturbegriffs hatten wir selber maßgeblich mitgewirkt, an derjenigen des oft geschmähten (und in der jetzigen Eventkultur arg vermißten) Bildungsbürgertums bereits die Generationen vor uns;[8] von idealistischen Gesellschaftskonzepten kündeten schließlich nur noch diejenigen, die wir als »Verlierer der Einheit« gern zu Wort kommen ließen, weil wir ihnen dann nicht auch noch Gehör schenken mußten. Das Ende der inneren Nachkriegsordnung gestaltete sich zwar als ein längst überfälliges Großreinemachen im Feld der alten, verbrauchten Werte, Logoi und Diskurshoheiten, auf das wir selber einst voll Hoffnung hingearbeitet hatten, lief dann aber, da die verschlissenen ästhetischen Hierarchien und utopischen Konzepte zwar verworfen, aber keine neuen postuliert wurden, vor allem auf eines hinaus: auf eine sehr grundsätzliche Orientierungslosigkeit, und mit ihr: auf das schleichende Ende sämtlicher Visionen. Glück schien im Zeichen der neuen Unübersichtlichkeit nurmehr als Privatbiotop zu erlangen und dann durch flächendeckenden Zynismus zu verteidigen; unter Berufung auf »Toleranz« und »Ironie«[9] ließ sich ungehemmt der eignen Ignoranz frönen, es war schlichtweg zum … Oder waren wir, die gealterten Prager Protokollanten, im Lauf der Jahre lediglich erfahrener geworden im Umgang mit Etikettenschwindlern und Phrasendreschmaschinen, sprich: leidenschaftlicher, dünnhäutiger, älter?
Nun ist das Älterwerden seit dem Siegeszug von Pop und Rock zu unser aller Kardinalproblem geworden, in dem weltanschauliche Aspekte – »Trau keinem über dreißig!« – mit latent sexistischen zusammenfließen: In einer dem Körperkult ergebenen Gesellschaft kann man’s sich im Grunde nicht leisten, älter zu werden, und wenn doch, dann nur, wenn man dabei trotzdem Forever Young bleibt. Man betrachte in die Jahre gekommene Berufsjugendliche, wie sie Szenekneipen bevölkern und dort auf ihren siebzehnten, womöglich bauchnabelgepiercten Frühling warten; wie sie sich lässig ihr Hemd aus der Hose gezogen oder ein Baseballkäppi schräg aufgesetzt haben, um Lebensart, Selbstironie, Frauenverstehertum vorzutäuschen, »erfahrne Rock ’n’ Roller«, die nach Sympathy for the Devil gieren. Freilich kommt anstelle des Keith-Richard-mäßigen dabei zumeist nur das Roberto-Blanco-hafte an ihnen heraus.
Alter Schwede! Spätestens mit dem Ende der Nachkriegsordnung ist die einstmals revolutionäre Jugendkultur zur reaktionären Spaßkultur verkommen, und jeder blamiert sich, so gut er eben kann. Würdevoll altern ist out, statt dessen huldigt man einer neuen Schamlosigkeit, notfalls als Narr, die mit aller Gewalt den Eindruck erzeugen will, man fröne zumindest noch einem pharmazeutisch geregelten Geschlechtsleben. Als ob geistige Potenz kein ausreichender Virilitätsnachweis wäre! Als ob Älterwerden schon dasselbe wie Altsein wäre! Und nicht vielmehr der ewige Lebemann auf eine Weise vergreist und erstarrt, wie es dem bewußt Alternden bereits die fortwährende Dynamik des Vorgangs versagt! Wer bis zum finalen Akt nichts als jung bleiben will, versäumt in aller Regel die Hälfte des Lebens – warum sollte man das, was man in seiner Jugend erträumt, erlitten, erlacht hat, auf immergleiche Weise bis zum letzten Atemzug erleben, allenfalls ergänzt um das Wissen über sämtliche toskanischen Olivenöle einschließlich ihrer Falschpressungen? Ein Schisser ist man mit dieser anhaltenden Selbstbetrügerei obendrein.
Hingegen alt werden, ohne jung zu bleiben![10] Ein permanenter Prozeß, in dem jedes neue Lebensjahr, jedes neue Lebensjahrzehnt zum intellektuellen Abenteuer gerät, zum Ausgangspunkt neuer Ansichten, die sich mit bisherigen Ansichten sukzessive zu Einsichten verbinden, freilich auch im Handumdrehen alles bisher Postulierte als liebgewonnenen Lebensirrtum decouvrieren könnten: Man denke an das jähe Wiedererstarken des Nationalismus in Europa, nicht nur in den Ländern des ehemaligen Ostblocks, wie man ihn längst überwunden glaubte. Einsicht in die Relativität aller Wahrheit, gerade auch der festreden- und leitartikelsubventionierten, bei gleichzeitig ungebrochnem Idealismus, sie wenigstens in ihrer flüchtigen Erscheinungsform immer wieder neu zu erhaschen oder gar für sie zu kämpfen – welch eine Herausforderung! Und so wenige, die sich ihr in angemessener Weise stellen; schließlich fällt es viel einfacher, in der Unverbindlichkeit einer perpetuierten Jugendlichkeit zu verharren, keinem andern verpflichtet als sich selbst.
Es ist nicht nur eine Frage des Stils, den klassischen Erwachsenenstatus vorzuziehen und mit ihm die klassischen Tugenden des Alters. Ein wohlstrukturiertes Zusammenleben, sprich: die bewußte gesellschaftliche Einbindung aller Bevölkerungsgruppen und -schichten ins große Ganze, Gemeinsame, beginnt bekanntlich erst dort, wo Erfahrung ins Spiel kommt, wo sich der Blick auf die Zukunft übers unmittelbar Zukünftige hinweghebt. Und stehen wir Älteren nicht überdies unterm erhöhten Druck der laufenden Ereignisse; ist die Bedrohung des Westens (als einer spätaufgeklärten Wertegemeinschaft jenseits von Himmelsrichtungen) nicht de facto fundamentaler, weil irrationaler, dezentraler, fraktaler geworden als in den Jahrzehnten des weltpolitischen Stellungskrieges bis zum Mauerfall? Und sind wir folglich, sofern wir noch einen Rest an Verantwortung fürs Allgemeine in uns verspüren, sind wir nicht sogar gezwungen, vieles neu zu überdenken, was sich während zweier lax vergroovter und vergeigter Jahrzehnte verbraucht oder, angesichts brennender Vorstädte,[11] sogar als gefährliche Illusion enttarnt hat? Alt werden, ohne jung zu bleiben, das heißt auch, wieder und genauer dorthin zu blicken, wo man gar keine neuen An- und Einsichten mehr erwartet hätte, heißt vor allem, den Mut zur Revision einstiger Gewißheiten zu finden, heißt am Ende, unangenehme neue Erkenntnisse zu einer neuen Form von Gesamternüchterung zu bündeln (aus der sich dann womöglich auch wieder eine neue Form von Hoffnung schöpfen ließe) und sie mit klaren Worten gegen die politisch korrekte Verbrämungskultur des Zeitgeists in Position zu bringen. Selbst wenn sie, die Gesamternüchterung, im Verhältnis zur liberalen Utopie des eignen Knabenmorgenblütentraums schwer zu ertragen, bestenfalls noch als linkskonservativ zu verbrämen wäre.
Linkskonservativ? Ich habe lange über ein Wort nachgedacht, das den Spagat auf den Begriff bringt, den zu vollziehen sich der ehemals »linke« Teil unsrer Gesellschaft gerade mittels erster Lockerungsübungen und unter schwersten Gewissensbissen anschickt, ein Wort, das sich jeder »rechten« Lesart explizit verweigert und in dem auch sonst keinerlei unausgelüftete Ideologien mitschwingen, ein Wort, in dem die einstige Leidenschaft utopischen Denkens noch aufgehoben und das also bereits durch seinen leicht angestaubten Unpragmatismus klar abgesetzt ist von sämtlichen kursierenden Begriffen des Konservativen.[12] Schwierig! Nichts wäre in diesem Zusammenhang fataler als Beifall aus der falschen Ecke; und nur als einer, der sich nicht im lamentierenden Rückbesinnen auf vergangne Werte erschöpft, sondern darin allenfalls den Ausgangspunkt neuer Visionen sieht, nur als einer, der auch beim kritischen Blick in die Zukunft das utopische Potential seiner Jugend nicht verrät, will ich mich versuchsweise als linkskonservativ bezeichnen.
Denn die Blauäugigkeit der einstigen Linken ungebrochen weiterzupropagieren, ohne konterkarierende Ergänzung zum Oxymoron, dafür ist die Zeit lange abgelaufen. Zutage getreten ist hingegen die weltanschauliche Herausforderung unsrer Generation – der neu angebrochne Kampf der Kulturen wird ja selbst durch eine Lösung des Palästinaproblems nicht so schnell zu beenden sein. Allerorten entstehen derzeit neue Frontlinien nicht so sehr zwischen islamischen und nichtislamischen, sondern zwischen fundamentalistisch religiösen und laizistischen Gesellschaften. Auch innerhalb der »Festung Europa«, wie sie einige Hardliner schon eifrig fordern, man wird sich in der Auseinandersetzung mit beiden Seiten noch warm anziehen müssen.[13]
Alt werden, ohne jung zu bleiben, das heißt also nicht nur (im Hinblick aufs Einzelschicksal), Anmut gegen Würde einzutauschen, sondern auch (im sozialen Miteinander), vorrangig Pflicht statt Neigung zu empfinden; alt werden, ohne jung zu bleiben, ist gleichermaßen Menschenrecht wie -pflicht. Die in letzter lästiger Konsequenz darauf hinausläuft, eine weltanschauliche Position beziehen zu müssen, deren Resonanzboden nicht unter den fetten Bässen der Gegenwart vibriert, sondern im fernen Taktschlag des Kommenden erzittert. Eine Art Aufsichtspflicht, der man sich gerade auch als Schriftsteller, meine ich, nicht entziehen darf, sofern man Schreiben nicht als bloßen Broterwerb, sondern als existenzielle Aufgabe begreift, die über serielle Produktion von Texten hinausgeht: Ein Schriftsteller ist mehr als die Summe seiner Bücher,[14] er hat einen Standpunkt, der sich in der Wahl seiner Adjektive ebenso ausdrückt wie in der Wahl seines Lieblingstürken.[15] Für diesen Standpunkt, der wiederum mehr ist als die Summe seiner Meinungen, ist er persönlich haftbar, weit mehr als für jede einzelne seiner kontextabhängig gewonnenen Thesen. Denn im Gegensatz zum bloßen Autor, der als Plotist seriell Texte erstellt, kann der Schriftsteller seine Werke nur mit eigner Lebenserfahrung beglaubigen; will er seinem Leser mehr als das reine Lesevergnügen bereiten, muß er zusätzlich zu allen Qualen einer relevanten literarischen Gestaltung das Wagnis auf sich nehmen, Zeitgenosse zu sein. Muß sich als Teil des regionalen, nationalen, globalen Zusammenlebens begreifen, wie es aus der Warte eines Elfenbeinturmbewohners nie in all seiner Komplexität wahrzunehmen und entsprechend detailreich zu schildern gelänge.
Gehört man mit dieser Selbstverpflichtung zu teilhabender Neugier, zu neugieriger Teilhabe am Allgemein-Menschlichen bereits zur altbacknen Art des politischen Schriftstellers, wie er sich in Gestalt einiger bundesrepublikanischer Vorzeige-Mahner und -Warner gerade selbst überlebt? Erste reflexhafte Antwort: allerhöchstens immer mal wieder, vor allem wider Willen. Hastige Ergänzung: und auf keinen Fall im früheren, enggefaßten Verständnis desselben.[16] Ein politischer Schriftsteller, wie ich ihn verstehe, ist kein Debattenschwein vom Dienst, kein permanent auf stand-by geschaltetes Kontrollgremium des Kleingedruckten; das kann er getrost den politischen Autoren überlassen. Der politische Schriftsteller hingegen verkörpert die ästhetische Variante einer außerparlamentarischen Opposition; sein Nachdenken kann angesichts des derzeitigen Vakuums an Utopien nur ein verkappt philosophisches sein, und zwar ein freigeistiges, diesseits wie jenseits herrschender Meinungen, Parteien, Systeme, unter wechselnden Perspektiven und Prämissen, mit wechselnden Gesprächspartnern und Antipoden.
Dieser neue Typus des politischen Schriftstellers läuft in seiner emphatischen Weltzugewandtheit möglicherweise sogar aufs Gegenteil dessen hinaus, was frühere Vertreter des Genres in bemühtem Rollenspiel darzustellen suchten – den personifizierten Ernst des Lebens. Das Lamento dessen, der in der Gegenwart vorrangig Verfall einer besser strukturierten Vergangenheit sieht, versucht er so selten wie möglich anzustimmen; vielmehr huldigt er einer prinzipiellen Leidenschaft, die jenseits abgegriffner Schubladisierungen an allem lustvoll Anteil nimmt, was unser kulturelles, politisches, gesellschaftliches Umfeld ausmacht: Die Verse eines entlegnen karibischen Lyrikers sind ihm a priori genauso »hoch« oder »niedrig« wie die neuesten Trends der gesamtdeutschen Schamhaarfrisur. Seine Intellektualität ist wesentlich ungebundener, sein Begriff von Bildung ist wesentlich offener als derjenige früherer politischer Schriftsteller; und doch weiß er sich mit ihnen in einem wesentlichen Punkt überein: dem Wunsch, dieses schrecklich schöne Leben noch ein Stückchen schrecklich schöner zu machen.
Ist politische Schriftstellerei in diesem umfassenden Verständnis vielleicht selbst nur eine Utopie? Mit Sicherheit eine undankbare Aufgabe! Die Gefahr der Verbitterung über ubiquitär grassierende Mediokrität steigt durch anhaltende Beschäftigung mit derselben erheblich; dazu die Entsetzensschreie flüchtig rezipierender Leser, nicht selten als Häme notdürftig getarnt, sofern einer ihrer wunden Punkte berührt wurde. Selbst wenn man nicht beständig mit erhobnem Zeigefinger auftritt, wird man als politischer Schriftsteller vorrangig allein sein, sofern man sein Amt (mit all dem gebotnen Unernst) ernst nimmt – allzu breite Zustimmung wäre für einen, der sich jedem Lagerdenken verweigert, ja auch verdächtig.
Und das alles auch noch in postmodern entfesselten Zeiten, die unterm Alarmismus der medialen Katastrophen- und Feuermelder gerade zur Aftermoderne depravieren! Staunend registrieren wir die weltweite Renaissance unaufgeklärten Denkens – und hätten statt dessen im Wettlauf der Weltanschauungen längst Gegenvisionen zu entwickeln, die sogkräftiger, zukunftsträchtiger sind als die saturiert säkularen unsrer décadence. Komplizierte Zeiten, weit komplizierter als unter den dialektischen Herausforderungen der Nachkriegsära! Angemessen ausgewogene Antworten für das Chaos unsrer Gegenwart zu finden, kann da die Aufgabe des Schriftstellers als eines Fachmanns fürs Allgemeine nicht sein; es ist schon viel, wenn ihm die eine oder andere Frage gelingt, die den festgefügten Horizont unsrer Alltäglichkeiten für all die Experten aufreißt, die’s dann ja sogleich besser wissen. Ein Schriftsteller wird keine schlüsselfertigen Lösungen anbieten, schließlich beglaubigt er seine wechselnden Ansichten mit nichts als den eignen – im Lauf des Älterwerdens wechselnden – Lebenserfahrungen. Wenn er damit aus der herrschenden Konsensessayistik ausschert, ja mit seinen spekulativen Thesen bewußt übers Ziel hinausschießt, um wenigstens mit rhetorischen Mitteln an der Verbesserung von Mitteleuropa mitzuwirken, so mag man das bitte noch lange nicht als seinen endgültigen Standpunkt mißverstehen. Je älter man wird, desto ferner gerät der Konsens, aber je älter man wird, desto größer wird auch die Sehnsucht, irgendwo zustimmen zu können![17]
Aus dieser Grundüberzeugung, als Schriftsteller jenseits des selbstreferenziellen Egotrips von Buch zu Buch auch eine gesellschaftliche Bringschuld zu haben,[18] ist vorliegende Textauswahl zusammengestellt, als vorläufige Quersumme dessen, was sich im Abarbeiten am »Politischen« der großen Welt- wie der kleinen Alltagsgeschichte während der letzten Jahre als mein Standpunkt herauskristallisiert hat. Manches davon – das Selbstverständnis als europäischer Patriot, als Parteigänger einer kosmopolitischen Weltordnung – zieht sich seit je durch mein Denken; manch andres – Zweifel am spätdemokratischen Glücksversprechen der Aufklärung, Respekt für religiöse Welterklärungsmodelle – ist mir als dem bekennenden Nietzscheaner, der ich natürlich immer noch und vor allem anderen bin, erst in jüngster Zeit virulent geworden, da die grundsätzliche Krise des Westens auch die Orangenhaut ans Tageslicht brachte, die unsre von den noch Älteren ererbte Weltsicht mittlerweile bekommen hat.[19]
Wer von uns hätte noch vor zehn Jahren ernsthaft in Erwägung gezogen, daß ein ästhetisches Engagement auf moralische Lösungen hinauslaufen könnte? Daß Relevanz der Themenstellung wichtiger sein könnte als ihre artistische Gestaltung? Ja, auch in meiner Liebe zum Formalen bin ich älter geworden, ohne jung zu bleiben, und ich bin dabei mit mir im Reinen. Diese Textsammlung kann das bestenfalls »im Prinzip« belegen, schließlich bleibt jedes Buch hinter der Vision seines Verfassers zurück. Aber es wird ja wohl hoffentlich nicht mein letztes sein; und wenn ich im Verlauf weiteren Älterwerdens dem Ideal einer freigeistigen Zeitgenossenschaft noch ein Stückchen nähergekommen sein sollte, so gewiß nicht ohne Prager Protokoll bzw. die Gespräche, die es begleiten. Denn alles, was es im Leben zu erreichen gilt, erreicht man nur mit Hilfe seiner Freunde – oder gar nicht.
IIDick & durstig
Politik, Gesellschaft
Der Deutsche ist schüchtern und schön, seine Haut hat jenen geheimnisvollen Bronzeschimmer, den bereits die antiken Chronisten an ihm rühmten. Vom tiefen Wunsche beseelt, ein Weltbürger zu werden, kauft er sich gern Calvin-Klein-Unterhosen oder Chicago-Bulls-Kappen und bemüht sich tapfer, alles cool zu finden. Ansonsten wirkt er am liebsten im Verborgenen – wenn er schweigt, dann schweigt er übern Sinn des Lebens; wenn er singt, dann lassen sich sogar die Vöglein des Waldes zu ihm nieder und haben ihn lieb.[20] Gefällt ihm aber eine Charakteristik des eignen Wesens so gut wie diese hier, dann pfeift er ganz leise durch die Zähne und sagt »wow«.
(1998)
Der Deutsche ist schüchtern und schön … – revisited
Wir waren Deutschland
Nirgendwo war das Bild des häßlichen Deutschen so allgegenwärtig wie in Deutschland selbst; wahrscheinlich gab es – trotz aufwendiger Imagekampagnen à la »Du bist Deutschland« – weltweit keine Nation, die so beharrlich mit sich haderte, deren Verhältnis zur eignen Geschichte so nachhaltig korkte, deren Vertreter sich im Ausland so systematisch voreinander verleugneten. Nation? Konnte man das Wort überhaupt noch gebrauchen, ohne von besorgten Bedenkenträgern als Nationalist, Faschist, Nazi, zumindest als erzkonservativ gebrandmarkt zu werden? Man mußte es sogar, sonst hätten es bald wirklich nur noch die »Rechten« verwendet; mit der Folge, daß es von den »Linken« wie viele andre unschuldige Vokabeln vor ihm auch zunehmend mit Bedenklichkeit aufgeladen und schließlich als »rechts« aus dem Sprachschatz verbannt worden wäre. Erstaunlich ohnehin, daß niemand während all jener politisch korrekten Selbstzerfleischungsjahre auf die Idee verfiel, das Wort »deutsch« zum Unwort des Jahrhunderts zu erklären, das durch den Verlauf unsrer jüngeren Geschichte so nachhaltig beschädigt, ja zum Quasisynonym für Unmenschlichkeit und Barbarei geworden sei, daß man es besser … genau: gar nicht mehr in den Mund nehme. Zum himmelhoch jauchzenden, zu Tode betrübten Wesen des Deutschen hätte eine derartige Selbstausmerzung eigentlich gepaßt.
Dann aber kam eines Tages Jürgen Klinsmann und mit ihm eine unverkrampft schwarzrotgoldene WM-Party, wie wir sie uns zuvor selber nie zugetraut hätten. Allerorten feierte man die längst überfällige Rückkehr der Deutschen zur Normalität im Umgang mit der eignen Identität – gerade auch im Ausland. Plötzlich war der, der jetzt noch fragte »Dürfen wir das? Mit unsrer Geschichte?«, selber ein Konservativer, jedenfalls einer, der nichts aus der Geschichte gelernt hatte: Im neuen Fußballpatriotismus verwandelte sich ja nichts abstrakt Bedachtes und auf den ideologischen Begriff Gebrachtes, keine Idee von Deutschland und womöglich dem Deutschtum, sondern jeder einzelne Deutsche, sogar in seiner Spielart als Türke, und zwar ebenso spontan wie unreflektiert. Allerdings so entschlossen, daß man seiner kollektiven Selbstumwandlung einen Wunsch zur Nachhaltigkeit nicht absprechen konnte: Würde er sich nach der WM wieder als die alte Dumpfbacke gerieren, deren deutsche Tugenden er insgeheim selber nicht sonderlich schätzte, er würde im In- wie im Ausland schlichtweg unglaubwürdig sein, seine konkrete Erscheinung würde einfach nicht mehr zum neuen Bild des Deutschen passen und wahrscheinlich als Ausnahme der Regel achselzuckend beiseitegelächelt. Im Ernst: Es wird nicht leicht sein, diesem neuen möchtegernmediterranen Selbstverständnis als Deutscher auch weiterhin gerecht zu werden; dahinter zurückzufallen wird man sich aber einfach nicht erlauben können.
»Ein Land braucht eine jüngere Geschichte, auf die es stolz sein kann«, hatte uns noch rechtzeitig vor dem Eröffnungsspiel die amerikanische Philosophin Susan Neiman empfohlen (SZ,21./22. 1. 2006); spätestens seit dem glücklichen Sieg gegen Argentinien, dem tragischen Ausscheiden gegen Italien und dem beherzten »Kleinen Finale« gegen Portugal, für das uns selbst Holländer und Engländer nicht länger hassen konnten, haben wir wieder eine: Schließlich wurden wir (»wir«) mit unserem dritten Platz »Weltmeister der Herzen«, und darauf kann man als Deutscher wirklich stolz sein. Insbesondere im Ausland: Ob wir nebenbei auch noch aus dem Land der Dichter und Denker kommen oder doch eher aus dem der Richter und Henker, wird dort erfahrungsgemäß die allerwenigsten interessieren – sofern der deutsche Fußball auch weiterhin so attraktiv bleibt.
Aber ja, so erschreckend einfach erringt man bei weiten Teilen der Weltbevölkerung Sympathie oder eben nicht; wenn in Zukunft auch deutsche Rucksacktouristen nationale Embleme aufs Gepäck nähen (wie Vertreter anderer Nationen schon lange), so wird das mehr über die schlichten Mechanismen unsres Selbstverständnisses aussagen als jeder komplizierte Essay. Und falls wir zu dieser neuen Lockerheit in Zukunft ab und zu auch außerhalb von Spaß- und Freizeitkultur fänden, könnte aus dem Flirt mit der Fahne tatsächlich eines Tages noch eine ganz vernünftige Liebesbeziehung werden. Ob sich Fußballpatriotismus allerdings dabei zum Verfassungspatriotismus läutern läßt, wie ihn Jürgen Habermas so beharrlich für uns alle anmahnt, mag bezweifelt werden. Ganz ohne Patriotismus wird es indessen auch bei uns nach diesem berauschenden Sommer 2006 nicht mehr gehen, und wir tun gut daran, seine Kanalisierung nicht wieder nur den radikalen Kräften unsrer Gesellschaft zu überlassen.
Weißer Mann – was nun?
Ein Nachruf zu Lebzeiten
Wer sich ein bißchen außerhalb Europas herumgetrieben hat, weniger als Tourist denn als Reisender, und dabei manchmal, wie ich, gerade noch mit dem Schrecken davongekommen ist, wird vielleicht schon ahnen, was ich im folgenden schlaglichtartig zu beleuchten suche, wenn ich vom »Untergang des Weißen Mannes« spreche. Ich gebrauche den Begriff ausdrücklich nur in polemischer Absicht – als Kürzel für das, was ich unter der kerneuropäischen, nach wie vor der Aufklärung verpflichteten Spielart westlicher Kultur verstehe; mit der Hautfarbe im engeren Wortsinn hat er lediglich metaphorisch zu tun. Daß die gewählte Metapher zu einigen Karl-May-haften Assoziationen reizt, darf nicht davon abhalten, sie für komplexere Gedankengänge zu funktionalisieren; die Wirklichkeit läßt sich nun mal am besten demaskieren, wenn man sie erst einmal auf ihr Klischee reduziert.
Für die Recherchen zu meinem Roman »Herr der Hörner« lebte ich einige Monate auf Kuba, im schwarzen Süden der Insel, und zwar nach Möglichkeit nicht wie ein Dollar-Tourist, sondern auf Peso-Basis: eine unvergeßliche Zeit, in deren Verlauf ich sämtliche Positionen, für die ich früher fraglos einstand, zu überdenken hatte. Eine Zeit auch, in der ich mitunter den Tränen nahe war, so hart empfand ich sie, körperlich wie seelisch. Die Brutalität des alltäglichen Lebens, keinerlei Rücksicht auf die moralischen oder gar ästhetischen Standards eines Alten Europäers nehmend, häufig noch nicht mal die allermindesten Höflichkeitsformen beachtend, diese ungebremste Wildheit des Willens, die sich nicht selten in schierer Gewaltanwendung Bahn brach – durfte ich sie als Mangel an Kultur verachten? Oder hatte ich sie als Überschuß an Vitalität zu bewundern, angesichts dessen ich von vornherein den kürzeren zog? Daß man sich, nach ein, zwei Stunden Schlangestehen für ein Brot, schließlich um den Einlaß in die Bäckerei prügelte, konnte ich noch verstehen; daß man das auch um einen Sitzplatz im Bus tat, schien auf mehr zu deuten als den puren Kampf ums Überleben, auf einen Kraftüberschuß zumindest, von dem man sich im saturierten Europa keine Vorstellung macht. Wohlgemerkt, es ging nicht um die Lust randalierender Banden, sich an Schwächeren auszutoben, sondern um spontane Energieentladung einzelner, bei denen sich ganz offensichtlich so viel angestaut hatte, daß sie’s bei erstbester Gelegenheit ablassen mußten.
Wohingegen ich? zunächst stirnrunzelnd danebenzustehen suchte, wenn sich die archaische Grobheit des Alltags mal wieder Bahn brach, auf Dauer aber so nicht weiterkam. Was tun? Mitunter war ich so restlos beschämt von diesen Eruptionen physischer Macht – und sie spiegelte sich für mich noch in der machohaften Heftigkeit gewisser Begrüßungscodes –, daß ich mir einzureden suchte, in meiner weißen Haut die epochale Erschöpfung der gesamten Alten Welt zu spüren; es half mir gar nichts, die schiere Schwäche angesichts des Faktischen als Überlegenheit einer verfeinerten Vernunft zu camouflieren. Im Gegenteil, bald spürte ich die Kraft dieser Menschen auch dann, wenn sie nur herumlungerten und mich vom Straßenrand beobachteten, da lag mitunter ein Lauern in der Luft, daß man sich als Europäer jedenfalls arg zusammenreißen mußte, um erhobnen Hauptes seiner Wege zu gehen.
Die größte Massenschlägerei habe ich freilich gar nicht in Kuba, sondern im schwarzen Südzipfel von Indien erlebt, auch hier in der Rolle des (einzigen) Weißen, der seine körperliche Unterlegenheit mit der Überlegenheit dezenter Zurückhaltung zu kaschieren suchte: in Trivandrum, einem tristen Millionendorf, dessen Sehenswürdigkeiten selbst von Gutwilligen innerhalb eines halben Tages abgehakt sind. Bleibt ein Besuch im Zoo, warum nicht, und erstaunlicherweise wartet man vor dem Eingang nicht allein, zusehends gesellen sich Paare und Passanten dazu, und als das Kassenhäuschen dann endlich öffnet: herrscht im Handumdrehen eine solch ernsthafte Schlägerei um die Plätze, jeder will der erste sein – nicht in einer Bäckerei, deren Angebot aller Voraussicht nach nicht ausreichen wird, nein!, sondern in einer Freizeitanlage, bei deren Besuch man zwischen traurig dahinsiechenden Tieren eine Art Freizeitdepression erleiden wird. Zuvor aber, ich übertreibe nicht, mußte die Polizei anrücken, um mit wahllos ausgeteilten Schlagstockhieben wenigstens vorübergehend eine Ordnung wiederherzustellen: Klaglos nahmen die potenziellen Zoobesucher die Prügel hin, duckten sich Richtung Kassenhäuschen, denn von ihrem Ziel ließen sie nicht ab, um wenig später, wenn man ihnen drinnen wieder begegnete, den müßigen Flaneur zu geben.[21]
Was ist da eigentlich eben passiert? fragt man sich, während man das vereiterte Knie eines Lamas betrachtet: Welch ein gewaltiger Wille steckt in jedem einzelnen dieser ausgemergelten Kerle, daß sie allesamt vor dem bräsig abwartenden Europäer Einlaß fanden? Und wieso ist man in derartigen Szenarien stets der einzige, der sich zur Pauschalironie dessen flüchtet, der’s angeblich besser weiß? Während alle andern auf ganz unbeirrbare Weise ihr konkretes Ziel verfolgen, dafür einen Preis in Kauf nehmend, der bei unsereinem allenfalls die Frage aufwirft, ob man davon bleibende Schäden davontragen, ob man sie dann wenigstens bei irgendeiner Versicherung geltend machen könnte.
Und die bedrohlichste Erfahrung des Belauertwerdens? Nach wie vor wird mir unwohl, wenn ich an eine Situation in Burundi denke, die sich nur auf den ersten Blick als friedliche Straßenszene darstellte: Während einer der Pausen im damaligen Bürgerkrieg zwischen Tutsi und Hutu, der bereits zu nächtlichen Abschlachtereien unvorstellbaren Ausmaßes geführt hatte, fuhren wir auf einem umgerüsteten Lkw in die Hauptstadt des Landes ein, Bujumbura, und ich spüre noch heute dies intensive Lauern, das uns vom Straßenrand entgegenkam, aus jedem Hauseingang. Geradezu körperlich zu registrieren, selbst von instinktgeschwächten Weißen, daß es hier jeden Moment vorbei sein konnte mit der trügerischen Ruhe, daß sich etwas Bahn brechen konnte, bei dem höchstwahrscheinlich auch wir und unser Lkw auf der Strecke bleiben würden.
Wünschten wir uns in dieser Situation wenigstens Waffen? Nicht mal das wagten wir, anerkannte Kriegsdienstverweigerer oder jedenfalls überzeugte Humanisten, die wir waren, hatten im übrigen ausreichend zu tun, unsre schlimmsten Befürchtungen voreinander zu verbergen: Um Gottes willen, die würden doch nicht? die waren doch wohl denselben ethischen Werten verpflichtet wie wir? die konnten doch nicht einfach, aus heiterem Himmel? Oh, die würden sehr wohl, die waren überhaupt nicht, die konnten.[22]
An dieser Stelle fällt mir die Geschichte eines Farmers aus Zimbabwe ein, die durch die Presse ging: Zu Zeiten grassierender Zusammenrottungen schwarzer Landarbeiter, bei denen es, von Staats wegen stillschweigend gebilligt, zunehmend zu Exekutionen weißer Großgrundbesitzer kam, fragte der besorgte Farmer seine eignen Arbeiter, ob sie ihm etwa Ähnliches anzutun gedächten, schließlich sei er ihnen doch jahrzehntelang ein guter Dienstherr gewesen. Bewahre! dementierte man: Jeder der ihren gehe ausschließlich zu benachbarten Farmen, sei der Weg auch noch so lang.
Wie beruhigend![23] Und daher skizziere ich jene Erlebnisse ja: Nicht einer heimlichen Sehnsucht nach Gewalt zollen sie Tribut, sondern der schieren Angst, wie man sie in dieser Form in Mitteleuropa gar nicht mehr kennt – am deutlichsten in Schwarzafrika, heftig noch in den karibischen Slumgegenden, in homöopathischer Dosis selbst in einem Land wie Indien zu spüren, sofern man die touristischen Hochburgen verläßt und sich einem Leben konfrontiert sieht, dem man in seiner archaischen Härte erst einmal nichts entgegenzusetzen weiß, nichts.
Denn selbstredend kann es nicht angehen, unsre kulturelle Entwicklung hin zu einer relativ friedliebenden und gesittet miteinander kommunizierenden Spezies rückgängig zu machen, das wäre die reinste Bankrotterklärung. Überdies ist das Problem kein rein physisches; im Fernen Osten erfahren wir unsre Kraftlosigkeit eher auf intellektueller Ebene, als Versagensangst angesichts eines wirtschaftlichen Expansionsstrebens, dessen ungebremste Energie uns weniger mit spezifischen ethischen Bedenken als mit einem grundsätzlichen Gefühl der Ohnmacht erfüllt, gerade auch in Alltagssituationen. Wer sich je in solch kapitalen Megametropolen wie Seoul, Tokio oder neuerdings Shanghai seinen Weg bahnen mußte, der kennt den kleinen Schrecken, wenn die Fußgängerampel auf Grün springt und sich Hunderte phalanxartig aufeinander zu bewegen, in offensichtlicher Weise zielstrebiger und entschlossener als man selber; kennt den großen Schrecken, wenn der Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen mit 300 Stundenkilometern am Bahnsteig vorbeischießt wie eine Langstreckenrakete. Sekunden später wird alles wieder von einer trügerischen Höflichkeit unkenntlich gemacht, bald weiß man nicht mehr, in welchem Film man gerade ist.
Immer nur lächeln? Die Aggressivität, die den Turbo-Kapitalismus in Fernost so erfolgreich und für uns so bedrohlich macht, läßt nur unter Alkoholeinfluß kurz die Maske sinken: »Natürlich wollen wir die Welt beherrschen!« hört man dann von betrunknen japanischen Managern, ihr ökonomischer Größenwahn sattelt auf einem bestürzend ungebrochnen nationalen Sendungsbewußtsein, einem ungeschmälerten Stolz auf die eigne »überlegene« Kultur. Die europäischen Märkte seien im Grunde sogar leichter zu erobern als das neuerdings erwachte China, erfährt man an solch denkwürdigen Abenden; und in der Tat, auch von Maos Erben wird mit beänstigender Energie an der Zukunft gebaut. Daß dabei ohne Skrupel abgerissen, umgesiedelt, Vergangenheit geflutet wird, daß dabei komplette Großstädte auf dem Reißbrett entstehen, sind nur die überdeutlich sichtbaren Indikatoren einer weit tiefergreifenden Entwicklung, hin zu einer neuen Unfreiheit des einzelnen zugunsten des florierenden Gesamtsystems – war Kapitalismus zu Zeiten des Kalten Krieges nicht mal so was wie der kleine Bruder der Freiheit gewesen?
Schön ist das alles nicht. Aber in einer verwirrend faszinierenden Weise massiv da. Und effizient. Selbst der deutsche Transrapid darf in Shanghai längst fahren, ohne jede Diskussion mit etwelchen grünen Bedenkenträgern; und mit dem langen Atem eines unbeirrbar starken Willens – Kraft äußert sich in dieser Weltregion weniger als eruptiver Impuls denn als ausdauernde Beharrlichkeit – ist man drauf und dran, die Schlüsselindustrien zu erobern: Spitzentechnologie ist keine Domäne des Westens mehr, die globale Arbeitsteilung ist schon heute in Frage gestellt. Angeblich können die USA ihre wirtschaftliche Führungsrolle derzeit nur deshalb noch halten, weil 40 Prozent ihres High-Tech-Sektors von asiatischen Einwanderern betrieben werden; die PC-Produktion von IBM ist de facto bereits von der chinesischen Lenovo übernommen, die Fernsehsparte der Firmen Schneider und Thomson von TCL:[24] Vor wenigen Jahren hätte man derartige Meldungen als Aprilscherz abgetan.
Die Weltwirtschaftsordnung ist aus den Fugen geraten, die kulturelle wird es als nächstes tun, Stichwort chinesische Regisseure, chinesische Modemacher, chinesische Starlets, chinesische Bestsellerautor(inn)en. Während die deutschen Goethe-Institute weltweit auf dem Rückzug sind und in den vorhandenen bald keiner mehr eine Sprache lernen will, die sich in ihrer rasant betriebnen Selbstauflösung überflüssig gemacht hat, sind die chinesischen Konfuzius-Institute auf dem Vormarsch, das nächste seiner Art soll in Berlin entstehen.[25] Denn die fernöstliche Innovationsbegeisterung ist niemals abgekoppelt von einem kulturellen Sendungsbewußtsein zu denken: Im weltweiten Globalisierungswettlauf ist man nur deshalb so erfolgreich, weil man die Riesenschritte in die Zukunft aus einem intakten historischen Selbstverständnis heraus tut.[26] Ein lebendiges Erbe ist ja nicht zuletzt auch ein Fundus an gespeicherten Denk-, Struktur- und Verhaltensmöglichkeiten, ein Inspirationsquell für alle Art aktueller Aufgabenstellung.
Wohingegen wir in Mitteleuropa? drauf und dran sind, die letzten Reste unsres eignen Jahrtausenderbes – die Vielfalt der Sprachen und damit verknüpfter Identitäten – zugunsten einer grassierenden Pseudoamerikanisierung preiszugeben.[27] Und damit das, was sich in der Vernetzung kulturell höchst eigenständiger Einzelleistungen als unser Standort begreifen ließe, als unsre Spielart einer alteuropäischen Position, gegen ein haltloses Mitschwimmen im Strom der globalistischen Kulturindustrie einzutauschen: Zum schreckhaften Begreifen der eignen physischen beziehungsweise ökonomischen Schwäche bahnt sich als weitere Demütigung für Europa die kulturelle Ausrichtung auf eine neue Weltmacht an, die sich schon heute als selbstbewußter Global Player aktiv in den allgemeinen Weltkulturstrom einbringt.[28]
Bezeichnenderweise sieht man unser Defizit jedoch nicht von China aus am deutlichsten, sondern vom arabischen Raum – einer Weltgegend also, die de facto zwar vornehmlich Überbleibsel einstiger Hochkulturen vorzuweisen hat, dies freilich mit der Überzeugungskraft dessen, der sich seiner Superiorität trotz alledem sicher ist. Die zweifelsohne vorhandnen Kulturleistungen des Islam will ich nicht in Abrede stellen; aber mit der aktuellen Alltagswirklichkeit beispielsweise im Maghreb hat das Bild vom aufgeklärten Moslem herzlich wenig zu tun. Wo sonst in der Welt wird man so voller Verachtung gemustert, als Vertreter einer gottlosen Gesellschaft von Schlappschwänzen und Huren (wie man sie aus »schamlosen« Filmen und Videoclips zu kennen glaubt), wie in Marokko? Nun, in Jamaica kennt man in dieser Hinsicht auch keine falsche Zurückhaltung, die Rastas bezeichnen die gesamte westliche Welt unverblümt als »Babylon«. Wer, zurückgekehrt nach Deutschland, die Dokumentation unsrer Verkommenheit in ekelhaft liberal sich gebenden Postkarten-Moralsprüchen (»Wer ficken will, muß freundlich sein«)[29] in Betracht zieht, mag den Rastas sogar versuchsweise recht geben.
Doch zurück zum juvenilen Potenzgeprotze, das im arabischen Raum besonders ausgeprägt scheint; kaum eine Kultur der Welt gibt sich dermaßen phallisch, und natürlich will man als Europäer nicht mithalten, wenn enthemmt balzende Jungmänner an vorzugsweise blonden Touristinnen ihren Testosteronhaushalt auszugleichen suchen. Natürlich? Natürlich! Das eigentlich Bestürzende hinter diesem Phänomen ist nicht etwa, daß wir als postemanzipierte Mitteleuropäer – schon in Ost- und Südeuropa ist man in dieser Hinsicht wesentlich breitbeiniger aufgestellt – mittlerweile auch im heiklen Bereich der Zwischengeschlechtlichkeit zu den allerheimlichsten Erwägungen gezwungen sind. Wer sich angesichts des maghrebinischen Machismo zu nichts anderem als zur Würde eines altersgerechten Auftretens bekennt, wer sich in die Überlegenheit dessen flüchtet, der »das alles ja schließlich gar nicht nötig hat«, ist im Spiel der Evolution jedenfalls verloren.[30]
Das Bestürzende an solchen Reiseerlebnissen ist weniger die Scham angesichts einer ungebremst sich inszenierenden Virilität, sondern die kulturelle, besser: weltanschauliche Schwäche, die wir nebenbei bitter zu fühlen bekommen. Selbst aufgeklärte Moslems handeln aus einer kohärenten Weltanschauung heraus, haben die Wahrheit schon immer, die wir als Individualisten von Fall zu Fall erst suchen müssen: eine Hase-und-Igel-Konstellation, bei der wir von vornherein als tendenziell Irrende dastehen; und erfuhr man in derlei Gesprächen früher mitleidige Belehrung, so ist der Ton seit Bin Ladens hochemotionalisierter Kampfansage deutlich rauher, ja unversöhnlich geworden.[31] Toleranz? Aber man ist doch im Besitz der alleinseligmachenden Wahrheit! Aufklärerische Skepsis? Ist die Weltsicht von Weicheiern; man selber hat dagegen das ungebrochne Pathos eines Glaubens, der 600 Jahre jünger ist als der christliche und daher, was seine Entfaltung im Lauf der Zeit betrifft, noch auf dem Entwicklungsstand der Inquisition steht. Insofern wäre’s sogar als Zeichen eines islamischen Humanismus zu deuten, wenn man als touristischer Freigeist nicht mit Stockhieben, sondern nur mit Verachtung gestraft wird.[32]
Der Untergang des Weißen Mannes, wie er sich im »Kampf der Kulturen« abzeichnet,[33] hängt auf kategorielle Weise mit dem religiösen Vakuum zusammen, das wir zwar seit Feuerbach und Heine mit Ersatzreligionen anzufüllen verstanden, zum Beispiel mit»Kultur«, »Nation«, »Wiederaufbau«, deren letzte jedoch, die »Freiheit des Westens«, nach dem Zusammenbruch des Ostblocks eine Leerstelle zurückgelassen hat, die mit Spaßkultur nur vorübergehend zu besetzen war. Noch nie war unser Wertehorizont so leergewischt wie heute, noch nie waren wir als Vertreter einer spätdekadenten Zivilisationsstufe, von der man bereits in den USA kaum eine Ahnung, erst recht keinen Begriff hat – noch nie waren wir so hilflos angesichts außereuropäischer Herausforderungen wie heute. Bräuchte der islamische Raum vielleicht dringend eine kräftige Injektion kritischer Vernunft (wie man als Utopist grüner Provenienz sympathischerweise glaubt), oder brauchen, im Gegenteil, wir selber eine Reduktion derselben, um durch Vereinfachung einer allzu komplexen Weltsicht wieder an ihre vitalen Wurzeln zurückzukommen?[34]
Vielleicht kann man aus den Demütigungen, die man als Alter Europäer derzeit auf den verschiedensten Ebenen erlebt, vielleicht kann man von all jenen, die uns physisch, wirtschaftlich, kulturell und vor allem religiös herausfordern, eines lernen: die Herausforderung anzunehmen und ein gesamtgesellschaftlich getragenes Selbstverständnis zu entwickeln, das aus Verbrauchern wieder Menschen macht, Menschen, die ihr Glück jenseits von Renditeerwartung und Steuervorteil suchen. Und dies notfalls in einer Sprache zum Ausdruck bringen, die auch von Fundamentalisten verstanden wird; möglicherweise müssen wir sogar auf eine – ich kann’s nicht anders als im Paradoxon ausdrücken – antifundamentalistische Weise fundamentalistisch, nein: fundamental werden.
Worauf aber könnte ein mitteleuropäischer Fundamentalismus hinauslaufen,[35] wenn nicht auf ein robusteres Mandat für Freiheit, Toleranz und Höflichkeit im Umgang mit all den Unhöflichen dieser Welt?[36] Es klingt absurd, nachgerade pervers, dieser altersschwach gewordnen Grundtoleranz des Westens jetzt einen Schuß Intoleranz beizugeben, auf daß sie überleben möge im weltweiten Wettstreit juveniler Weltbilder, und man sollte es auf keinen Fall nach Art amerikanischer Imperatoren tun. Doch es gibt eben nicht nur eine Toleranz der Schwäche, die rückgratlos alles abnickt, was der Fall ist,[37] sondern auch die der Stärke, die aus einer bewußt eingenommenen Position heraus erwächst und dem Fremden gegenüber so lange couragiert Distanz hält, bis es zur wechselweisen Anerkennung kommt.
Welchen Wert eine restlos aufgeklärte, sprich: gottlose Gesellschaft der (partiell) unaufgeklärten entgegenzusetzen hat – das ist das Grundproblem, an dem viele Hochkulturen zugrunde gegangen sind. Nun geht als nächstes also auch die Mission des Weißen Mannes zu Ende, wie sie seit der beginnenden Neuzeit betrieben wurde, nicht zuletzt aufgrund ihrer zunehmenden Konzentration aufs Diesseitige: Nahezu niemand außerhalb der westlichen Welt will aufs Dach einer schützenden, sinnstiftenden Transzendenz verzichten, wenn er dafür nur die fragwürdigen Früchte des Nihilismus erhält; die jahrhundertelang betriebne Aufklärung der Unaufgeklärten erfährt nun selber, da sie zur reinen Lehre vom Konsum verkommen scheint, so etwas wie eine Gegenmissionierung.
Selbst am Ursprungsort dieser Aufklärung müssen wir, die wir unser Leben so behaglich in ironischer Distanz zu jedweder Position eingerichtet haben, allenthalben Zeichen einer Sehnsucht nach festen Standorten wahrnehmen, die auf eine sanfte Gegenaufklärung hinauslaufen: auf eine neue, zunächst eklektische Religiosität aus esoterischen Versatzstücken, die sich bereits jeder dritte nach Gusto zusammensetzt, als behelfsweisen Reflex auf eine Glaubensintensität, mit der wir seit ein paar Jahren so massiv von außen konfrontiert werden. Ja mehr noch, sind wir letzten Aufklärer mittlerweile nicht vielleicht selber unsrer freischwebenden Ungebundenheit satt, sehnen uns nach einer neuen Verwurzelung und sind bereit, den Hiatus zwischen alles zersetzender Vernunft und irrationaler Vision zu wagen?[38]
Oft habe ich mich während meiner karibischen Monate gefragt, warum ich, erschöpft von der Vitalität der anderen, ausgerechnet in afrokubanischen Kulten wieder zu Kräften kam, ausgerechnet eine Geborgenheit während der Ausübung geheimbündlerisch anmutender Rituale der Santería und des Palo Monte verspüren konnte, die sogar noch im Alltag eine Weile nachwirkte: Gerade deshalb, so mußte ich mir gegen meinen Willen immer wieder antworten, weil die Aufklärung nicht nur jede Menge gibt, sondern letztlich das Allerwichtigste nimmt, was uns das Leben leichter und das Glück erfahrbarer macht: Gewißheit jenseits des Wissens, Unerschütterlichkeit trotz aller Erschütterungen – und weil eben das von jedem praktizierenden Santero oder Palero glaubhaft vermittelt wird. Erst während ihrer stundenlangen Rituale habe ich wieder das kathartische Erschauern vor dem Jenseitigen verspürt, das sich insbesondre in der protestantischen Kirche zum Programm der Nächstenliebe verflüchtigt hat:[39] Wer will schon Brot und Wein, wenn er Blut und (Opfer-)Fleisch bekommen kann? Wer will schon einen gütigen Gott irgendwo im Abstrakten, der sich seiner eignen Schöpfung entzogen, dazu einen Oberhirten, der trotz Papst-Hype immer unsicher wirkt,[40] wenn er Priester haben kann, von denen er klare Anweisungen und Lebensgewißheit erhält, wenn er Tote haben kann, die mit ihm reden, wenn er Götter haben kann, die mit Wucht in ihre Jünger fahren, um mit ihnen zu tanzen, zu rauchen und zu trinken? Wer einmal miterlebt hat, mit welcher Ungebrochenheit in der Karibik noch geglaubt wird, mit welch afrikanischer Intensität, die immer auch Angst und Schrecken einschließt, Grauen und Entsetzen, bis hin zur Barbarei, der weiß, daß sich unsre gottlose Gesellschaft nicht auf Dauer mit individualistischer Privatesoterik dagegen rüsten kann.[41]
Denn was nützt uns all die »Freiheit wovon«, wenn wir sie nicht mehr als »Freiheit wozu« nützen können? Selbst das Projekt der Aufklärung, wie’s als philosophische Spitzenleistung des Alten Europa einen Siegeszug um die Welt gemacht hat, markiert ganz offensichtlich noch längst nicht das Ende der weltanschaulichen Evolution, außer für die »happy few« einer freidenkerischen Elite, die jede Gesellschaft braucht. Aufklärung oder Gegenaufklärung, das ist die anstehende »Schicksalswahl«, die ganz gewiß nicht auf demokratische Weise entschieden werden wird. Wirtschaftswachstum – Innere Sicherheit – Vollbeschäftigung? Nein, Glaube – Liebe – Hoffnung, darunter scheint’s auf Dauer auch bei uns nicht zu gehen; und eben das gilt es jetzt ohne Häme zu begreifen, selbst von überzeugten Atheisten, die das Zerschreddern unsrer vertrauten Welt im Mahlwerk des Globalismus unverdrossen mit rein politischen Mitteln verhindern oder gar betreiben wollen. Andernfalls sind wir schon morgen nichts als Nachwelt.
(2005)
Weißer Mann – was nun? – revisited
Unser Recht auf Ungläubigkeit
Ist Deutschland ein Übernahmekandidat? Man bedenke, daß der voangehende Essay im Spätsommer ’05 geschrieben wurde, zu einem Zeitpunkt, da Karikaturenstreit, Aufstand der Migranten in den Pariser Vorstädten, Foltermorde an Juden (ebenfalls in Frankreich), Wahlsieg der radikalpalästinensischen Hamas, ein weiterer Krieg zwischen Israel und seinen Nachbarn in weiter Ferne lagen – und mit ihm der ganze Themenbereich »Kampf der Religionen« bzw. eigentlich: der Weltanschauungen. Daher wurde er mit folgender Einleitung versehen:
Nun ist es plötzlich vorbei mit Abwarten-und-Jammern, die allgemeine Verzagtheit in Deutschland weicht zusehends einer unerwartet betriebsamen Aufbruchsstimmung. Eifrig werden Leitartikel geschrieben und Manifeste verfaßt, ja vor allem auch ersehnt, verlangt, mitunter gewaltsam herbeigezwungen, als ob man auf diese Weise wenigstens anderen schon mal die Entschlossenheit unterschieben könnte, die man selber noch nicht hat: Der schleichende Niedergang der Parteiendemokratie [Vgl. dazu »Jungs, nehmt den Finger aus’m Arsch, es gibt Arbeit«, S. 42ff] und »Weniger Demokratie wagen«, S. 55ff., wie wir ihn als Telekratie seit Jahren miterleben müssen – als Simulationsterror der Meinungsbarometer und Talkshows, die mit ihren Standardmoralkeulen fast jedes authentische Sprechen unmöglich machen –, hat ein gefährliches Machtuakuum bewirkt, das nicht etwa nur von »Frustrierten«, sondern vor allem von der intellektuellen Mitte unsrer Gesellschaft wieder neu gefüllt werden will.
Doch selbst wenn das gelänge (und nebenbei das Kunststück, aus einem hochverschuldeten Sanierungsfall ein florierendes Restart-up-Unternehmen BRD-II herauszulösen), stünde dahinter nach wie vor als weit größeres, zentraleuropäisches Problem: der drohende Abstieg des ehemaligen »Westens« als eines seit Generationen gepflegten Lebens- und Kulturprinzips, vergleichbar demjenigen der habsburgischen k.u.k. Monarchie nach dem Ersten Weltkrieg. Mit der Postmoderne und ihrem zersetzenden »Anything goes« haben wir das Ende der Aufklärung erreicht, ist die Skepsis der Freigeisterei so weit fortgeschritten, daß sie anstelle ernsthafter Visionen nurmehr eine müde Generalironie entwickelt, ein achselzuckendes Laissezfaire, Tarnvokabel »Toleranz«, gegenüber allem und jedem: Das entsprechende Erstarken inter- wie intranationaler »Ränder« wird uns eine Unzahl an Sub- und Parallelwelten bescheren, wird am Ende auf eine radikale Parzellierung der Gesellschaft hinauslaufen – nicht zuletzt aufgrund passiver Eliten, die dem Zerfall des Ganzen zur bloßen Summe seiner Teile nichts entgegenzusetzen haben und dies auch längst nicht mehr wollen.
Jenem uneuphorischen Auftakt zum Trotz: Hier schreibt kein resignierter Ex-Rot-Grüner, am allerwenigsten ein verkappter Rechter, der mit seiner These vom »Untergang des Weißen Mannes« erstsämtliche Frauen- und Multikultibeauftragten hinwegbeleidigen und anschließend eine krawattengeschnürt neokonservative Revolution ausrufen möchte. Im Gegenteil, das ist ja bereits Teil des Problems, die meisten, mit denen ich in letzter Zeit gesprochen habe, gehören – obwohl allesamt überzeugte Demokraten – einer viel zu lang schon schweigenden Mehrheit an, die unter ihren politischen Repräsentanten kaum noch einen ausmacht, uon dem sie sich angemessen repräsentiert fühlt: Deshalb kommt ja nun endlich, wo diese parteipolitisch entwurzelte, gefährlich hin und her schwankende Mitte zu einer neuen Sprache finden muß, eine Diskussion in Schwung, die ein verschärftes Aufmucken freischwebender Intellektueller jenseits des überkommenen Links-Rechts-Denkschemas erkennen läßt.
Damals, nach dem Scheitern von Rot-Grün und dem Vorziehen der nächsten Bundestagswahl auf den 18. September, standen Pro und Contra eines grundsätzlichen Kurswechsels deutscher Innenpolitik auf der intellektuellen Agenda; daß es in weiten Teilen der Welt gerade spürbar ungemütlicher wurde und man das nicht beliebig lange als atavistisches Getöse von Globalisierungsverlierern würde marginalisieren können, ließ sich im allgemeinen Aufbruchstaumel leicht als störende Panikmache beiseite schieben. Heute, ein ernüchterndes Jahr später, spricht jeder von der Rückkehr der Religionen, die man im Zeitalter der Digitalisierung gar nicht mehr, und schon gar nicht so heftig, erwartet hätte. Tut dies freilich auf solch kennerhaft selbstverständliche Weise, als hätte man’s insgeheim trotzdem schon immer gewußt, daß – ja, was denn? Daß wir uns seit dem 11. September 2001 im weltweiten Kampf der Kulturen befinden, einer geostrategischen Neuaufteilung der globalen Landkarte wie zu Zeiten des Kalten Krieges? Nur daß es jetzt ein Heiliger Krieg ist und also zukünftig auch kein Eiserner Vorhang, sondern ein Eiserner Schleier sein wird, der die Demarkationslinie zwischen »gläubigen« und »ungläubigen« Gebieten markiert? Wer könnte mittlerweile noch so tun, als sei dem nicht so; wer könnte’s noch wagen, die alte Zauberformel vom »Dialog der Kulturen« herunterzubeten, wenn die al-Quaida in der ihr eignen markigen Diktion »die ganze Welt als offenes Schlachtfeld« deklariert und »Muslime überall [auffordert], zu kämpfen und Märtyrer im Krieg gegen die Zionisten und die Kreuzfahrer zu werden« (Videobotschaft, zit. nach: SZ,28. 7. 2006)?
Denn natürlich meint das nicht nur Israelis und Amerikaner, das meint – und spätestens mit den Fernsehbildern von brennenden deutschen Fahnen (anläßlich einer im Grunde pazifistischen Äußerung des Papstes im September 2006) müßte das sogar hartgesottnen Multikultiträumern klargeworden sein –,[42] das meint auch uns, meint uns alle. Ein Großteil der islamischen Welt sucht die Konfrontation, und daß dieser Kampf der Weltanschauungen von einigen Feuilletonisten alter Schule stereotyp als »dumpf« etikettiert wird, trägt wenig zur Erhellung des komplexen Problems bei. Im Spätsommer ’05 jedoch schien das Thema in seiner ungeschminkt entsetzlichen Konsequenz – Ermordung des islamkritischen Filmemachers Theo van Gogh am 2. 11. 2004 incl. Bekennerschreiben, dem Sterbenden mit einem Messer in den Bauch gerammt – erst in den Niederlanden angekommen und also noch weit weg zu sein; entsprechend hoch schlugen die Wogen nach Veröffentlichung von »Weißer Mann – was nun?«. Daß sich die entzauberte Welt unsres spätkapitalistischen Turbo-Individualismus auf die Herausforderungen ganzheitlicher Lebensformen einzustellen habe (wie sie jede religiös strukturierte Gesellschaft anbietet), ging damals noch ans Eingemachte, rührte an ein Tabu, wie es in Zeiten transzendentaler Obdachlosigkeit anscheinend als ausgemacht gilt: »Alles Spirituelle ist suspekt«, so die stillschweigende Überzeugung unsrer mehrheitlich atheistischen Avantgarde, »und wer sich nicht zumindest ironisch damit auseinandersetzt, der ist es ebenfalls«. Typisch postmodern? Für die Unmengen an zustimmenden bis euphorischen Leserbriefschreibern – meist Menschen, die länger im Ausland gelebt hatten – war die Postmoderne zu diesem Zeitpunkt wohl noch nicht angebrochen oder schon wieder beendet.
So oder so, ein jahrzehntelang kaum ernsthaft hinterfragter Common sense der bundesrepublikanischen Gesellschaft war an einer empfindlichen Stelle getroffen; die Stellungnahmen, die man in Folge auf Diskussionspodien und in Rundfunksendungen von mir erwartete, waren entsprechend einseitig. Aber wie wären diese Erwartungen zu erfüllen gewesen? Wer Religion predigt, hat sie in der Regel verloren, das weiß man doch nicht erst seit gestern, ansonsten würde er sie schließlich praktizieren. Hat sie unwiederbringlich verloren; auch wenn ich mich als hartgesottener Atheist auf Kuba immerhin an die Vorstellung gewöhnen mußte, daß Gläubige mitnichten »simpler gestrickt« waren als Glaubenslose, daß sie sich durch ihre Ausrichtung auf ein Jenseits keinen Deut »unfreier« im Diesseits fühlten, daß sie sich trotz ihrer Offenheit gegenüber dem Mysterium keineswegs als »irrationale«, »unaufgeklärte« Vertreter einer niedrigeren Zivilisationsstufe abtun ließen. Und das, obwohl ich es nicht mit irgendeiner diffus gefühligen fernöstlichen Schweige- oder indianischen Schwitzhüttenreligiosität zu tun bekommen hatte, sondern mit ziemlich deftigem Hardcore, der hierzulande selbst in seiner Voodoo-Klischeeform ein unwohles Gruseln erzeugt.
Mit wie vielen Ausrufezeichen hatte ich mich in diese afrokubanischen Kulte hineinbegeben, in der Haltung des hochmütig-ethnologischen Beobachters, der alles, was er sehen und erleben würde, schon im vorhinein als Mumpitz rubriziert hatte; und mit wie vielen Fragezeichen war ich zurückgekehrt nach Deutschland, in die vertraute und doch mit einemmal merkwürdig öde Geheimnislosigkeit einer säkularen, im Grunde gottlos-hedonistischen Gesellschaft. Noch heute habe ich eher Fragezeichen als Ausrufezeichen zu diesem ganzen Themenkomplex anzubieten, betone aber gern auch an dieser Stelle, daß ich mich nach wie vor im Zweifelsfall, ohne eine Sekunde zu zögern, auf die Seite des Individualismus und des Rechts auf Ungläubigkeit schlagen würde. Gerade deshalb, weil ich ganz genau weiß, wo ich stehe, habe ich an den Fragen, wie ich sie im Jahre 2005 gestellt habe, auch jetzt kein einziges Wort zurückzunehmen.
Und gar im anstehenden Weltkonflikt! Der hat in seiner fundamentalistischen Grundierung nichts, aber auch gar nichts mit den Mysterien gemein, wie man sie in den polytheistischen Ritualen der Karibik erleben kann; gegen einen militanten Monotheismus (nicht etwa nur den islamischen) gibt es nur ein einziges Mittel: das robuste Mandat, wie es in meinem Essay ja benannt ist. Zunächst allerdings ist endlich zu begreifen, daß wir der transzendentalen Herausforderung nicht mit altgewohnter Blasiertheit Herr werden können:
Da verschickt ein 61jähriger aus dem Ruhrgebiet – und zwar mitten im Karikaturenstreit, überall auf der Welt brennen dänische (und verwechslungshalber auch Schweizer) Flaggen, gibt es Tote bei moslemischen Massenaufmärschen, werden von Fanatikern sogar vereinzelt Priester ermordet –, da verschickt einer Toilettenpapier mit dem Aufdruck »Der Heilige Koran« an Fernsehanstalten und islamische Einrichtungen, im Begleitschreiben bezeichnet er den Koran als »Kochbuch für Terroristen«. Selbstverständlich protestiert die iranische Regierung beim Auswärtigen Amt, gibt es Morddrohungen, muß der Mann untertauchen. (SZ,24. 2. 2006) Hallo, Titanic? Leider nein. Ein bißchen mehr Achtung vor den Wahrheiten und Werten einer Weltreligion stünde uns als den möglichen Verlierern der globalen Kräfteverschiebungen gut an.
»Jetzt zeigen sie so ’nen Quatsch schon am Nachmittag«
Vier Fragen nach dem Anschlag aufs World Trade Center
Erstens. Als meine 80jährige Mutter am Tag des Anschlags auf die amerikanischen Nationalsymbole beim nachmittäglichen Zappen ziemlich zeitnah mit den ersten Katastrophenbildern konfrontiert wurde, schaltete sie den Apparat erbost aus: »Jetzt zeigen sie so ’nen Quatsch schon am Nachmittag«, wetterte sie in der festen Überzeugung, an einen Science-fiction-Film geraten zu sein, und da sie derlei »absurde« Horrorszenarios nicht goutiert, war der Fernsehnachmittag gelaufen. – Auch ich dachte an jenem Dienstag, angesichts all der entsetzt gen Himmel staunenden Menschen in den Straßenschluchten von Manhattan (das World Trade Center stand zu diesem Zeitpunkt noch), an Science-fiction: an Roland Emmerichs 1996 gelaufnen Film »Independence Day«. Nur ist es darin kein normales Passagierflugzeug, sondern wenigstens ein riesiges UFO, das den Traum von der amerikanischen Unverwundbarkeit beendet. Allerdings nicht nur den! Ähnlich gigantische UFOs tauchen zeitgleich über London auf, über Paris, Berlin usw. – im Film, bloß im Film![43] Doch die Blicke der ungäubigen gen Himmel starrenden Menschen waren in realitas die gleichen. Nachdem sich die wirkliche Wirklichkeit angeschickt hat, die Visionen des Kinos einzuholen, bedarf es für künftige Schocker wahrscheinlich gar keiner UFOs mehr: Die nächste Welle an Hollywood-Produktionen wird uns präziser zeigen, wohin unser aller Horrortrip geht, als jeder Leitartikel, der zur Zeit geschrieben wird. Könnte’s sein, daß der Science-fiction-Film in puncto Welterkenntnis mittlerweile der Schulphilosophie und sogar der Talkshow den Rang abgelaufen hat?
Zweitens. Viel ist zur Zeit die Rede vom Ende des (seit Amtsantritt von Bush jr. im Januar 2001 wieder offen grassierenden) Antiamerikanismus, wie er insbesondre unter Intellektuellen angesagt gewesen und dem ich für meine Person nur entkommen war, indem ich seinen negativen Grundimpetus in einen positiven umzumünzen suchte: Bereits Ende der 90er fand ich’s erstrebenswert, eine neue Identität jenseits alter Nationalklischees zu gewinnen und mich als europäischer Schriftsteller zu begreifen, sprich, der amerikanischen Herausforderung auch im Bereich der Literatur mit einem dezidiert europäischen Gegenkonzept zur Seite zu treten.[44] Doch jetzt, wo mir’s selbst beim Dauerlauf rund um die Hamburger Alster die Kehle schnürt, nämlich dort, wo man an der blumengesäumten Absperrung des amerikanischen Konsulats vorbeiläuft,[45] jetzt ist auch einer wie ich gern bereit, sich probeweise als »Amerikaner« zu begreifen. Als Teil also der weltweit vernetzten westlichen Wertegemeinschaft, und tatsächlich verspüre ich sogar die Verlockung, die amerikanische Erschütterung als meine ureigne zu begreifen. Doch was wird auf diese große Sympathiewelle folgen, sobald Bush zum Gegenschlag ausgeholt hat? Wahrscheinlich zögert er nur deshalb noch, weil ihm partout kein passendes islamisches Symbol einfällt, das es im Gegenzug zu zerstören gälte – die einzig angemeßne Kaaba liegt nun mal nicht im Irak, sondern auf dem Territorium eines Bündnispartners. Womit sich der traditionelle Vorzug des amerikanischen Denkens, komplexe Probleme auf einfache reduzieren und ihnen ein Gesicht geben zu können, in einen strategischen Nachteil verwandelt hat: Die Hydrastruktur des aktuellen Gegners hat nun mal tausend Köpfe.[46] Steht damit aber nicht auch von vornherein fest, daß die USA – und die hektisch betriebene Beförderung Bin Ladens zum Märtyrer in spe wird ihre nächste Niederlage bewirken –, daß die USA, was immer sie auch zerbomben werden, in diesem Kampf der Symbole nicht gewinnen können?[47]
Drittens. Noch vor wenigen Jahren herrschte auf der Welt das Gleichgewicht des Schreckens, kein Mensch konnte sich vorstellen, daß ein Riesenreich wie die UdSSR einmal auf vergleichsweise friedliche Weise implodieren und die USA als alleinige Supermacht übrigbleiben würden. Seither kann (und will) sich niemand vorstellen, daß den USA ein ähnliches Schicksal bevorstehen könnte, unter den neuesten Auspizien freilich eher als unfriedliche Explosion. – Die neue Verwundbarkeit macht die USA zwar wieder sympathisch, doch eben auch besiegbar;[48] wäre sie’s nicht, könnte sie’s sich ja leisten, den Tag des Terroranschlags zum Nationaltrauertag zu erklären und die Welt zu verblüffen: indem sie auf Gegenterror verzichtet. Und statt dessen alle islamischen bzw. islamistischen Führer zum Gespräch nach Ground Zero einlädt – auf ebenjenen Schuttberg, der einmal World Trade Center hieß. Aber die USA haben ihre einstige Handlungssouveränität schlagartig eingebüßt, und indem sie jetzt so übereifrig das zentralasiatische Machtvakuum für sich entdecken wollen, zeigen sie vor allem, daß sie bereits während der kurzenPhase des selbstgewählten Isolationismus unter Bush von der Supermacht zur Großmacht geschrumpft sind. Wenn aber das 20