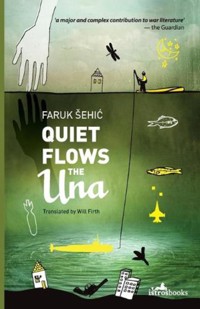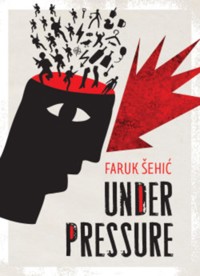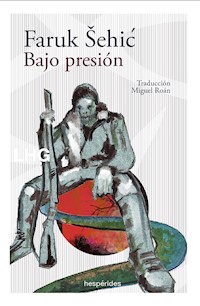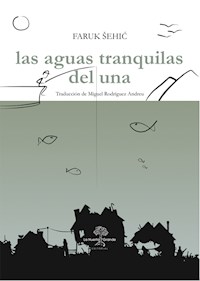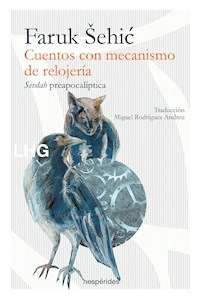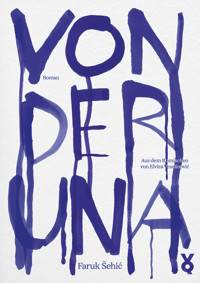
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Voland & Quist
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Von der Una" ist der gelungene Versuch, ein persönliches Kriegstrauma schreibend zu verarbeiten und zu überwinden. Wir folgen der Hauptfigur des Romans durch drei Zeitabschnitte: Kindheit und Jugend in Jugoslawien vor dem Krieg, Fronterfahrung während des Bosnienkrieges und schließlich der Versuch, nach dem Konflikt ein normales Leben zu führen. In seiner sehr lyrischen, meditativen Prosa rekonstruiert Faruk Šehić das Leben eines Mannes, der sowohl Kriegsveteran als auch Dichter ist. Der Historiker lehrt uns, was geschehen ist, der Dichter, was für gewaltige emotionale Spuren es hinterlassen hat und der Ästhet, wie man auch noch aus den schmerzhaftesten Erinnerungen den maximalen Genuss ziehen kann. Parallel zu dieser Geschichte nehmen die Passagen des Buches über die Stadt am Fluss Una mythische, traumgleiche und phantastische Dimensionen an.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 257
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sonar 40
Faruk Šehić, 1970 in Bihać geboren, ist ein Schriftsteller und Journalist, dessen literarisches Schaffen Lyrik, Prosa und Essays umfasst. Während des bosnischen Krieges war er Mitglied der Armee der Republik Bosnien und Herzegowina und wurde schwer verletzt. Die Literaturkritik betrachtet ihn als eine der führenden Stimmen der sogenannten überrannten Generation von Schriftstellern. Der vorliegende Roman wurde bereits in siebzehn Ländern veröffentlicht. Šehić schreibt regelmäßig für die Zeitung »Oslobođenje« und lebt derzeit in Sarajevo.
Elvira Veselinović, 1971 in Dessau geboren, verbrachte ihre Kindheit und Jugend in zwei Ländern, die es heute nicht mehr gibt – in der DDR und in Jugoslawien. Später studierte sie unter anderem Keltologie in Bonn und Galway, promovierte in Linguistik an der Universität Köln und lebt heute als Übersetzerin, Dolmetscherin und Dozentin in Berlin. Die Sprache, aus der sie übersetzt, heißt mittlerweile wahlweise Bosnisch, Kroatisch, Montenegrinisch oder Serbisch. Sie hat bereits viele Werke zeitgenössischer Autorinnen und Autoren aus den jeweiligen Ländern ins Deutsche übersetzt.
Faruk Šehić
Von der Una
Die Herausgabe dieses Werks wurde gefördert durch TRADUKI, ein literarisches Netzwerk, dem das Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten der Republik Österreich, das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland, die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia, die Interessengemeinschaft Übersetzerinnen Übersetzer (Literaturhaus Wien) im Auftrag des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport der Republik Österreich, das Goethe-Institut, die S. Fischer Stiftung, die Slowenische Buchagentur, das Ministerium für Kultur und Medien der Republik Kroatien, das Ministerium für Gesellschaft und Kultur des Fürstentums Liechtenstein, die Kulturstiftung Liechtenstein, das Ministerium für Kultur der Republik Albanien, das Ministerium für Kultur und Information der Republik Serbien, das Ministerium für Kultur Rumäniens, das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Sport von Montenegro, die Leipziger Buchmesse, das Ministerium für Kultur der Republik Nordmazedonien und das Ministerium für Kultur der Republik Bulgarien angehören.
Die Übersetzerin dankt dem Deutschen Übersetzerfonds für die Förderung in Form eines Exzellenzstipendiums.
Originaltitel: Knjiga o Uni
erschienen bei Buybook, Sarajevo 2011
© Faruk Šehić
Deutsche Erstausgabe
© Verlag Verlag Voland & Quist GmbH, Berlin und Dresden 2025
Lektorat: Leif Greinus
Korrektorat: Kristina Wengorz
Umschlaggestaltung: HawaiiF3
Satz: Fred Uhde
Druck und Bindung: BALTO print, Litauen
ISBN 978-3-86391-429-5
eISBN 978-3-86391-449-3
Verlag Voland & Quist GmbH // Gleditschstr. 66 // D-10781 Berlin
[email protected] // voland-quist.de
VON DER UNA
Denn das Vergessen ist eine der Formen der Erinnerung, sein vages Kellergelaß,die geheime Kehrseite der Münze.
Jorge Luis Borges
My mind forgets, but my body keeps the score.The body is bleeding history.
Geoffrey Hartman
Inhalt
HYPNOSE
Eins …
Zwei …
Drei …
Vier …
Fünf …
SEELEUTE DER GRÜNEN ARMEE
FISCHE BETRACHTEN
DIE WASSERREPUBLIK
DER HERBST IST EIN REITER AUS NÖRDLICHEM MOOS
ICH WACHSE MIT DEN PFLANZEN
OHNE AUFERSTEHUNG UND OHNE TOD
FISCHE FANGEN
UNA-PRINZ, DRACHEN, REKONSTRUKTION
FLUSSGÖTTER
WASSERKATHARSIS
OMA
DIE ENTSTEHUNG DER ART
ENDKAMPF
NÄCHTLICHE REISE
VON GARGANO UND ANDEREN DINGEN
Die Geschichte von Gargano
Ein Telegramm aus dunklen Gewässern
Traumameter
HELLE NÄCHTE
SCHWARZER TANZ
NUN SPÜRE ICH DIE SCHICHTEN DER ANGST IN MIR
ZWEITAUSENDSIEBEN NACH GARGANO
IRGENDWO IN DER ERDE
1992, DAS JAHR NULL
SCHLANGENKRAFT
EMIL
DAS HERZ
FRÜHLING
DAS MONSTER AUS DER SAFTEREI
PS:
DIE BALLADE VOM SCHWARZEN LOCH
FLÜCHTLINGE
ALTWEIBERSOMMER
FISCHERHYMNE
DER GERUCH DER STADT IN FLAMMEN
DIE BUCKLIGEN
IN DEN SPIEGEL EINTAUCHEN
GRÜNE FÄDEN
WASSERSIEGEL
WINTERUFER
RUINENLIEBE
BLINDE FLECKEN
DIE TOSHIBA-ELEGIE
DER ZENTAUR
SMITH DER ERNEUERER, AUCH BEKANNT ALS WOLKENDIRIGENT
DAS HAUS AN DEN ZWEI WASSERN
DER BEGINN DES BUCHSCHREIBENS
DAS HORRORKABINETT
Quellen:
HYPNOSE
Eins …
Ich, das bin manchmal nicht ich; ich, das ist Gargano. Dieser andere ist das wahre Ich. Der aus dem Schatten. Der aus dem Wasser. Blond, zerbrechlich, schwächlich. Frag mich nicht, wer ich bin, denn das macht mir Angst. Frag mich etwas anderes. Ich könnte dir von meiner Erinnerung erzählen. Wie die Feststoffwelt solide verdunstete und die Erinnerung zum letzten Angelpunkt meiner Persönlichkeit wurde, während auch diese bereits im Begriff war, sich als Dampfsäule zu verflüchtigen. Sollte ich in die Vergangenheit springen, werde ich das bei vollem Bewusstsein tun; ich möchte heil sein wie die meisten Menschen auf der Welt. Jetzt geht es mir schon besser, ich schaue geradeaus zum schnurgeraden weißen Mittelstreifen auf dem blauen Asphalt; er beruhigt mich; die Dunkelheit senkt sich schmerzlos herab, ich drehe mich nicht um, die Dunkelheit ist hinter mir, doch es ist, als wäre sie nicht da, als würde sie nicht die Straße, die Häuser und die Bäume verschlingen. Sie geht hinter mir, traut sich aber nicht näher an mich heran, denn sie weiß, dass ich den Schild aus Papier mit den Lichtworten gebrauchen würde. Woraufhin alles zur Hölle fahren würde. Und das wollen weder ich noch Gargano noch die Dunkelheit noch der andere, womit ich sozusagen mich selbst meine. Den Astronauten, Abenteurer, den Fluss- und Meeresforscher.
Meine Erinnerungen sind dreckig, widerlich. Ich verspüre Ekel, wenn ich über mein ehemaliges Land und den Kriegsbeginn reden muss. So riecht das Elend kleiner Jungs in der Umkleidekabine vor dem Sportunterricht. Nach Pisse. Sobald ich das Schulgebäude erblickte, war ich schweißgebadet unter meinem Pullover, der so drückte, dass ich umgehend Anfälle von Klaustrophobie bekam. Rettung vor dem Übermaß an militärischer Disziplin fanden wir im Schulklo, wo uns im beißenden Ammoniakgeruch die Luft wegblieb. Die Lehrer waren streng und steif, die Gänge blitzblank wie Gewehrläufe, die Tafel schwarz mit grauen Schlieren, wo der kreidegetränkte Schwamm sie gewischt hatte. In den Kloschüsseln schwammen Kippen und Kondome, die einzige Form des Aufstands gegen das starre System. Wir trugen alle die gleichen blauen Kittel. Die Luft im Flur roch nach Schulbroten, belegt mit billigstem Aufschnitt, der auf den prätentiösen Namen Lyoner hörte. Das Schulgebäude konnte im Kriegsfall im Nu zu einer Kaserne umfunktioniert werden, da alles voller Fenster war. Von diesen Fenstern aus konnten wir kleinen Soldaten mit Zwillen und Holzgewehren dem heimtückischen Feind, der in der Überzahl war, Widerstand leisten, indem wir in den Feuerpausen Partisanenlieder sangen, trotzig, mit verrußten Gesichtern.
Die fauligen Holzböden in den Gebäuden aus der Habsburgerzeit stinken nach abgestandenen Fäkalien und den Krankheiten ihrer Bewohner, des städtischen Lumpenproletariats. Aus der reifen bewaldeten Vagina ragt der Flaschenhals einer Bierflasche der Marke Karlovačko heraus, indes die Kellnerin der Kundschaft zeigt, was ihr Geschlechtsorgan so alles vermag. Während sie so mit gespreizten schneeweißen Schenkeln auf dem Tisch liegt und von ihrem Hinterkopf ein Pferdeschwanz üppig glänzender schwarzer Haare herabhängt, pulsiert an ihrem Hals eine fingerdicke Ader. Das Licht an der hohen Decke ist funzelig, die Kurzsichtigeren treten näher an ihre Knie heran, um sich zu vergewissern, dass ihre Vagina tatsächlich Dinge verschlingt. Nachdem sie die Performance beendet hat, sammelt sie das Geld ein, zieht ihren weißen Liebestöter an, strafft ihren kurzen Rock und schenkt den durstigen Schaulustigen einen Cognac ein. Hätten die mit schlechtem Weinbrand und Nikotin getränkten bystanders lateinische Bücher gelesen, wüssten sie, dass sie soeben das Glück hatten, in das speculum mundi, den Spiegel der Welt, zu schauen.
Die Erinnerungen sind derart schlimm, dass sie sich selbst verunmöglichen. Was immer mir einfällt, drängt mich, schleunigst wieder mit dem Zurückgehen in der Erzählung aufzuhören. Ich sehe dampfende Pferdeäpfel auf dem Asphalt der Titova ulica. Da ist das Klappern von Pferdehufen, der unermüdlich deprimierende Takt, der mich entmutigt. Regen, der tagelang synchron zum Rhythmus der Pferdehufe auf die Straße niederprasselt. Ich weiß, dass ich das Gefühl der Übelkeit überwinden und alles in schöneren Farben sehen kann, aber dann scheint es mir, als würde ich dem Wunsch nach einer kompromisslosen Rückschau in die Vergangenheit untreu.
Der Sarg mit dem Glasfenster, durch das der Kunstlehrer mich mit finsterer Miene und schwarz umrandeter Brille anschaut, taucht aus dem Gedächtnis auf. Als hätte diese schwarze Brillenfassung sein Gesicht schon Jahrzehnte, bevor er getötet werden würde, dem Format der Todesanzeige angepasst. Dann die endlosen Partisanenbegräbnisse, Trompeten und Posaunen im Blechblasorchester, diese klagenden Klänge; mir läuft der kalte Schweiß der Partisanenmärsche den Rücken hinab, die ich sonntagmorgens um halb zehn im staatlichen Fernsehen sah. Die ins weiße Leintuch gewickelte Leiche meiner Großtante, die am Hang des Hum hinabgelassen wird, von wo aus der Blick weit über die grünen Flussinseln reicht. Die Lüge, die wir wahrhaftig gelebt haben und die im Verlauf der vier Kriegsjahre in Gestalt von tausend Granaten zu uns zurückkehren würde. Mein Ekel kann religiöse Ausmaße annehmen, aber ich möchte mich nicht dem Hass hingeben, das wäre zu billig für meinen Geschmack.
In der Sonne ist es zu heiß, im Schatten eisig kalt und feucht. Es stinkt nach Urin, Kot und Schuhcreme. Das sind meine Erinnerungen an das vorige Leben, zumindest die, die mir als erste wieder vor die Augen kommen. Ich glaube nicht, dass ich mich jemals vom Ekel gegenüber sämtlichen Floskeln befreien kann, auf denen der ehemalige Staat beruhte. Mir wird schon bei der bloßen Erwähnung dieser Wörter schlecht. Zum Glück gibt es die indirekte Rede und Wörter mit verborgener Bedeutung. Zum Glück gibt es den Fluss Una.
Zwei …
Die journalistischen Polyhistoriker, die Fachleute, die alles wissen, sagen: Da ist höhere Gewalt im Spiel, gewisse tektonische Störungen der Geschichte, weiße Löcher in den Nebeln von Asterion und unterräumliche Schwankungen innerhalb der dunklen Materie, der Zusammenbruch der letzten Utopie des 20. Jahrhunderts und so weiter; die Berliner Mauer ist auf uns herabgestürzt, daher war es nur recht und billig, dass irgendwo zur Ader gelassen werden musste.
Allerdings war ich bei der Abrechnung der kosmischen Mächte nicht nur eine kleine Münze; als wahrhaftiger Mensch, als fertig geformte Persönlichkeit hatte ich eine private Aufgabe: das physische Überleben. Weshalb sollte ich jenen glauben, die den Gestank von Schießpulver, der sich mit keinem Waschmittel der Welt abwaschen lässt, nie am eigenen Leib kennengelernt hatten, wenn sie mir auch nicht glauben wollten? Wenn ich überhaupt irgendwas sollte, habe ich das auch getan, ich habe mein Schicksal in die Hand genommen und nicht etwa gewartet, bis jemand an meine Tür klopfte und mich schlaftrunken direkt in eine feuchte Grube schleppte, um mich zu erschießen. Für Passivität zahlte man stets mit dem eigenen Leben, und ich wollte leben. Damals hatte ich die Worte von Katica Cvetko nicht mehr im Kopf, meiner Vermieterin aus dem Zagreber Vorort Sveta Klara, einer voluminösen alten Frau aus dem Zagorje, die 1990 zu mir und meinem Mitbewohner sagte: »Die Särben werden euch in Bosnien alle abschlachten.« Was hätten wir damals auch großartig wissen sollen, wir Arbeiter mit den zarten Händen und der Liebe zu Film und Literatur?
Die Postskriptum-Analytiker verstehen den Überlebenskampf nicht so gut, denn sie verlieren sich gerne in unlesbaren Metaphern und der Deutung meines Schicksals mithilfe irgendwelcher bahnbrechender Ereignisse und Prozesse, falscher Geschehnisse, durch die sich die Naturkatastrophen niemals erklären lassen. Der Fluss des Blutes und der Unbarmherzigkeit, das Quietschen der Raupen des T-55-Panzers lässt das Blut noch zwei Kilometer entfernt gerinnen. Ich habe nicht die Absicht, die faszinierenden Bilder des Grauens aufzuzählen, deren Zeuge ich wurde, denn das würde ein doppelt so dickes Buch wie dieses erfordern, doch die Wirkung wäre gleich: Wer es nicht versteht, soll in der seligen Finsternis des Unwissens verharren.
Meine Biografie ist eine Abfolge von Zufällen, von denen ich viele tatsächlich selbst gewählt habe, andere wiederum wählten mich. Alles in allem würde ich mir, könnte ich mir mich selbst erklären, eine Grube graben und mich lebendig hineinlegen, denn das Leben hätte keinen Sinn mehr. Meine Biografie ist Fleisch und Blut, kein Entertainment. Irgendwo dazwischen bin ich. Ich bin einer, von uns gibt es Tausende. Unzerbrechliche und Gebrochene.
Leute, ich muss gestehen, ich habe einen Menschen getötet, nicht nur einen, sondern gleich mehrere. Beim Schießen ist man völlig unbelastet. Natürlich trifft längst nicht jede Kugel, aber manche gelangen mit Sicherheit ans Ziel. Beim Schießen ist man federleicht, vor lauter Vergnügen könnte man sich im selben Moment vom Boden lösen und davonschweben, doch man bleibt in der Deckung, wo man bäuchlings auf dem Erdhaufen liegt, dem platten Gras und dem feuchten Laub, denn das sagt einem der Instinkt. Wenn ich schieße, fühle ich mich wie Jesus, der Antichristus. Ich liefere nur das Gegenteil von Barmherzigkeit. Gewissensbisse existieren nicht, und niemand wird dir ins Ohr flüstern, auch der Feind sei ein menschliches Wesen. Auf dem Schlachtfeld sieht es ein wenig anders aus: Der Feind ist der Feind. Er kann kein menschliches Wesen sein. Der Feind muss ein schleimiger Hautflügler sein, mit Hörnern und Schweinehufen, daher solltest du schießen und dich nicht mit dem Blödsinn aufhalten, mit dem sich die Feiglinge und Philosophen befassen. Ich habe mehrere feindliche Individuen im Nahkampf getötet, daher meiden mich meine Mitbürger, und wenn ich die Straße entlanggehe, wechseln alle die Seite. Ich habe die Fähigkeit, ihre Angst zu wittern. Sie riecht nach Abscheu, nach Hegel-Kant, nach dem universellen Sinn des Lebens der Menschen im Weltall, der sogenannten menschlichen Güte, was meine komplette Verachtung verdient.
Drei Mann habe ich getötet, außerdem einen aus der Autonomen Provinz Westbosnien. Das ist wie eine Droge, die dich aus den Latschen haut und dann auf einmal mit Raketenantrieb in die Höhe schießt, und wenn sie das tut, glaubst du, auf dem Dach der Welt zu sein. Ich habe lebendige Körper in Schatten verwandelt. In Schatten von Nachtfaltern, also in nichts. Ich bin Dichter und Krieger, insgeheim auch Sufi-Mönch. Ein heiliger Mann nach Baudelaire. Ich tötete auf den Schlachtfeldern der vergessenen, unwichtigen Namen unter sämtlichen Witterungsbedingungen: Bei nassem Schnee ist das Blut so rot wie im Film Doktor Schiwago, weshalb man aus einem Blutstropfen und ein wenig Schnee mit dem Finger eine Gerbera zeichnen kann.
Früher fragte ich mich: wozu? Wozu töten? Jetzt kenne ich die Antwort, und es ist mir völlig egal. Mich plagt kein Gewissen wegen dieser Leute, die ich mir jetzt als gespenstische Porträtfotos vorstelle, bei denen jemand die Köpfe mit der Schere ausgeschnitten hat. Nicht mehr lange, und sie werden aus der Erinnerung in die Dunkelheit übergehen. Auf keinem Kriegsschauplatz, wirklich nirgendwo, habe ich Papst Wojtyła erblickt, obwohl die Flechten an den Bäumen den Altersflecken auf seinen Händen ähnelten. Im Krieg ist alles so einfach und so klar. Außer wenn das Blut unter die Fingernägel kriecht, denn es wird hart und lässt sich tagelang nicht auswaschen.
Ich tötete, weil ich das Chaos überdauern wollte. Und weil ich keine andere Art des Überlebens kannte, denn mein Stolz ließ nicht zu, dass ich den Krieg in irgendwelchen rückwärtigen Einheiten verbrachte. Es gab auch andere, solche, die Gott anflehten, man möge sie erschießen, obwohl sie voller Lebenskraft waren, und genau das lähmte sie: die Angst, dass sie so voller Energie überleben könnten. Sie wussten nicht, wohin damit. Deshalb stürmten sie mit offenen Augen und reinem Herzen nach vorn, sie hatten keine Angst vor dem, was sie erwartete. Sie mussten stürmen, denn was für ein Leben wäre das gewesen, erschreckend, größer als der Tod. Ich war ruhig, ich wusste, was ich tat. Niemals besoffen oder bekifft an der Frontlinie, stets fokussiert. Deshalb kann ich euch das hier jetzt auch erzählen. Wie ihr wisst, spricht ein toter Mund nicht. Ich bin nicht gefühllos, falls ihr das gedacht haben solltet, nur ehrlich. Ich bin ein bisschen wie ein Nazi: Ich höre gerne Bach, wenn er auf einer Stihl-Motorsäge gespielt wird. Black & Decker ist auch nicht zu verachten.
Drei …
Die Wälder waren türkisfarben, die Bäume wiegten sich sanft nach links und nach rechts wie die Fangarme einer Seeanemone. Da gab es diese Szene in der Ferne, am Rand des Horizonts, zu sehen durch eine beschlagene Fensterscheibe, durch einen Regenbogenfilter, denn ich trainierte meine Vorstellungskraft. Tatsächlich waren die Bäume kahl, aschgrau, mit Flechten übersät, hier und da ein paar Mistelkugeln, deren Grün in keinem Zusammenhang zum allgemeinen Mangel an Chlorophyll stand, weder in der Natur noch in der menschlichen Seele, denn Farben waren eingeschleuste Agenten der westlichen Welt, der Geruch von Luxus und Wohlstand, und als solche galt es, sie aus unserem Leben zu verbannen. Auf dieser Seite des Fensterglases war ich der eigentliche Herr des Raumes. Draußen auf der Straße galten andere Geschichten. Unten, unter dem Balkon, befand sich eine Stadt, die ich noch nicht als meine empfinden konnte, ich war zu jung für eine solche Liebe, eine weiche Stadt – wie warmes Erbrochenes in der Sonne. Zu dieser Zeit war das Land für mich eine ferne Sphäre aus dem Atlas der Himmelskörper. Später würde sie mir ans Herz wachsen, egal, wie sehr die übermenschlichen Bemühungen spürbar waren, alle Unterschiede zwischen uns zu überdecken, unter dem Einwand, wir seien doch Brüder, und bei uns sei doch alles perfekt, und ansonsten gediehen zu beiden Seiten der Berliner Mauer nur Elend, Fäulnis und Ausschweifung. Was für ein schönes Wort: Ausschweifung. In unserer Stadt fühlte ich mich seit dem Moment fremd, in dem ich begriffen hatte, dass wir keine Brüder waren. Nicht etwa, weil ich das nicht gewollt hätte, sondern, weil bei der Mehrheit der Einwohner beider Nationalitäten der gute Wille fehlte. Ganz zu schweigen davon, dass bei der Jugoslawischen Volksarmee sowohl Serben als auch Kroaten auf mich eingeredet hatten, mich als Muslim zu deklarieren, da es Jugoslawen nicht gäbe. Ich lebte eine Identität, die in einem Land, das den Namen seiner Identität trug, eine Minderheit war. Der größte Schock für mich war, dass die Zahl derer, die sich bei Volkszählungen als Jugoslawen bezeichneten, in Jugoslawien statistisch die kleinste von allen war. Als ich zur Armee ging, schärfte mir meine Mutter ein, zu sagen, ich sei Jugoslawe, da mich ihrer Meinung nach die anderen Soldaten auslachen würden, wenn ich sagte, ich sei Muslim. Beide Annahmen waren falsch, denn ich war verliebt in den Spanischen Bürgerkrieg. Ich fand es schade, dass ich nicht mit der Zeitmaschine nach Spanien zurückkehren und mein Leben für die Freiheit lassen konnte. Nur dort hatte es für eine kurze Zeit meine Nation gegeben.
»Für weeeee-heeeeen?«, brüllte die müde Kehle, die die Kolonnen von Jugendbrigaden unter meinem Balkon zum Subotnik hinter sich her schleift. So wie ein Taucher den Toten mit einem Seil aus dem angeschwollenen Fluss zerrte, so führte die Stimme alle anderen hinter sich her.
»Für Tiiiii-toooo!«, hallte es aus hundert Hälsen.
»Für weeeee-heeeeen?«
»Für das Vooooo-hoooolk!«
»Für weeeee-heeeeen?«
»Für die Partaaaa-heiiiii!«
Ich erkannte die Gesichter in den ersten Reihen und darin nichts als Automatismen und das Sabbern nach einer riesigen Portion Bohnensuppe aus der Armee-Gulaschkanone. Da endeten wohl bereits die hehren Ideale der permanenten Revolution. Die Stimme kletterte zur Stadt empor, zum Krankenhaus, um dann zu ersterben, eingeschüchtert von Autohupen und dem Gequieke besoffener Landstreicher, unter denen sich Jup der Jüngere hervortat, ein plumper, dicklicher Mensch, der aussah wie ein Krapfen, und wenn er kein Feuerwasser hatte, ähnelte er einem übellaunigen Nagetier mit fettigem Fell. Sein Vater, Jup der Ältere, klein und vogelartig gebaut, mit einem goldenen Siegelring und ständig nach Altherrensitte mit Brillantine zurückgekämmten Haaren, schmolz dahin, wie es sich für so einen Graf Alkohol gehörte, herrschaftlich und langsam. Der Angehörige der Kommunistenjugend formte mit dem Mund die Fragen zu den sehr vorhersehbaren Antworten. Auf seiner Wange, unterm Auge, war eine dunkelblaue Träne tätowiert. Ein Orden der Justizvollzugsanstalt Zenica.
Irgendwo zwischen Ekel und Charme befand sich auch der näselnde Gesang des blinden Mannes mit dem zerknautschten Gesicht und dem verklebten schwarzen Haar, immer montags auf dem zentralen Marktplatz, Ende der Achtzigerjahre, mitten in den nach Schweiß und frischem Kuhkäse stinkenden Menschenmassen.
»Eine milde Gabe, bitte, meine Tanten, Genossen, Jugendlichen, eine milde Gabe, möge Gott euch Gesuuundheit geben … Möge Gott eure Kinder beschüüüüützen …«
Da stand er wie angewurzelt am Straßenrand, der Homer des Volkes, und leierte sein Gebet herunter, in dem er den Kommunismus mit dem Islam versöhnte. Frühmorgens brachten ihn seine Verwandten an seinen Bettelplatz und ließen ihn dort arbeiten. Sobald der Markt zu Ende war, kamen sie ihn wieder abholen, sie führten ihn ab wie einen Sony-Roboter mit verrosteter Motorik. Kurz vor dem Krieg war Homer mit den Schwalben gen Süden gezogen. Ich könnte schwören, dass ich in den vier Jahren danach keine einzige Schwalbe sah.
Ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass der Teufel der Perversion von mir Besitz ergriffen hatte; dass mich das, was mich anekelte, gleichzeitig faszinierte. Da war dieses Gefühl, das man hat, wenn man vom Balkon starrt, fasziniert vom Abgrund, und dennoch nicht ganz entspannt als Selbstmörder in die Luft über dem Parkplatz treten kann. Wahrscheinlich haben Sie schon einmal über Ihren Bauch nachgedacht, während Sie ein langes Küchenmesser in der Hand hielten, nun, genau dieser perverse Teufel packt mich, wenn ich an das Leben im früheren Land und an dessen Zerfall denke.
Vier …
Vom Betrachten des Flusslaufes wird dir nicht schwindlig werden. Wenn du zu erzählen anfängst, wirst du schnell den Faden verlieren, denn das Wasser wird Besitz von dir ergreifen, von den Worten, die du sagen wolltest, und in deinen Ohren wird Enjoy the Silence von Depeche Mode laufen. Wir haben es genossen, der Una beim Vorbeifließen zuzuschauen, mal schneller, mal langsamer, ihrer unruhigen Oberfläche, die ringsumher Ruhe verbreitete.
Die offiziellen Jahresfeiern unserer Brigade mieden wir, denn uns interessierten die Festreden in der Manier des vorangegangenen Regimes nicht, das noch wie untot über uns schwebte, halb tot wie die Vorstadtfabriken, bei denen jemand bereits die Blechdächer abgedeckt hatte. Die Leichen der Fabriken und der serbischen Häuser galt es komplett auszuweiden, auszuplündern bis zur letzten Dachziegel. Wer erinnert sich schon noch an all diese bizarren Todesfälle, diese Menschen, die von Betonplatten einsamer Häuser zermalmt wurden, während die Ärmsten unter den Platten Ziegeln stemmten. Ab September 1995 waren monatelang, vielleicht ein ganzes Jahr lang, Karawanen von Traktoren, Lkw und Pferdegespannen voller geplündertem Hausrat aus den Dörfern unterm Grmeč tief ins Hinterland gefahren. Die Gier nach fremdem Besitz ist eine seltsame, aber massenhafte Seuche.
Am Tag unserer Brigade trafen wir uns, um eine Vielzahl von Dingen zu feiern, die wir nicht mit Worten benennen wollten. Wir prosteten uns mit fröhlichen Zen-Trinksprüchen zu, ohne anzustoßen und ohne überflüssige Ausrufe. Auf dem Weg durch die Zwischenstationen unserer Alkohol-Tournee mussten wir unweigerlich auch am Wohnwagen im Schatten japanischer Pflaumenbäume vorbei, die Beine trugen uns von allein zum Ziel. Der Schatten war perfekt, die Getränke ebenfalls, und die Geschichte führte uns weit weg von der Realität. Dann schlug jemand vor, ins frisch renovierte Kulturhaus zu gehen, da wir Gebäude liebten, die vom Feuer verschont geblieben waren. Wir konnten direkten Körperkontakt zu unserer Vergangenheit aufnehmen. Hinter die schweren Brokatvorhänge spähen, wo die filmischen Illusionen gezeigt wurden. Dort, wo King Kongs Trauer wegen der Unmöglichkeit der Liebe zu einer Frau fühlbar wurde in der von Seufzern und Tränen feuchten Luft.
Warum der Fakir von uns dreien ausgerechnet mich aussuchte – ich habe keine Ahnung; bis auf die Narbe, die mein Gesicht diagonal durchtrennte, wies ich keine besonderen Merkmale auf. Aber schon saß ich gemütlich zurückgelehnt im Ledersessel mitten im leeren Kinosaal des Kulturhauses.
Am Abend sollte die Show des Wanderzirkus Ramayana aus Indien stattfinden. Der Hypnotiseur hatte gerade Szenenprobe und brauchte ein Versuchskaninchen. Da kam ich ganz gelegen, als Möchtegern-Dichter und Veteran unseres lieben Krieges. Die klarsten Erinnerungen habe ich an die Gastspiele italienischer Zauberer Ende der Siebziger. Die Italiener dirigierten Kobras, durchbohrten eine Jungfrau im Holzkasten mit Säbeln, die dann fröhlich aus dem Kasten sprang, im Badeanzug, zur allgemeinen Begeisterung des gutgläubigen Publikums. Und sie vollbrachten viele weitere kleine und große Wunder. Wie die Massenhypnosen der Fakire, bei denen das Publikum glaubt, dass es einen Jungen an einem in der Luft hängenden Seil hochklettern sieht oder dass der Fakir den Jungen mit der Machete zerstückelt und seine Einzelteile in einen Korb steckt, aus dem er ihn dann aber unversehrt und putzmunter wieder herausholt.
Vor dem Krieg konnte der Saal siebenhundert Zuschauer auf Klappsesseln fassen, und wenn King Kong, Godzilla oder Bruce Lee gezeigt wurden, saßen die Leute sogar auf dem Boden. Ich konnte die zentrale Eingangstür ebenso wenig sehen wie die Bühne mit dem schweren Brokatvorhang. Die Sonne blieb draußen, mit dem Vogelgesang in den Pappeln und üppigen Kronen der Schwarznussbäume. Zwei Bekannte hatten mich hierhergelockt, unter dem Vorwand, mir den renovierten Kinosaal zeigen zu wollen. Doch eigentlich hofften sie auf Zirkustiere, besonders auf den Tanz betrunkener Affen.
»Vor Kurzem, wohl irgendwann nach dem Krieg, gab es in Banja Luka eine Zirkusvorstellung im Fußballstadion, hat mir jemand erzählt, der das gesehen hat. Er hat einen Mann gesehen, einen Zauberer mit einem jungen Affen an der Kette, einem Pavian oder Mandrill, das konnte er nicht mehr genau sagen, und dieser Zauberer wirbelte die Kette mit dem Affen herum, der Affe löste sich vom Boden und flog im Kreis über dem Kopf des Zauberers vor fünftausend Menschen, und weißt du, was der Affe gemacht hat?«
»Nein, was denn?«, fragte ich meinen Kumpel.
»Er packte die Kette ganz fest, als wäre er ein Mensch«, sagte er und lachte dabei sein Raucherlachen.
Wir betraten den Saal durch den Notausgang, mit Bierflaschen in den Händen, und stießen auf den Fakir, der eine Taschenlampe in der Hand hielt. Es war nicht besonders angenehm, auf einen bärtigen Mann im langen Kleid zu stoßen, der dastand und einen unverwandt anstarrte. Es wirkte, als hätte er uns erwartet, denn er war nicht überrascht. Es entwickelte sich ein höfliches Gespräch über die Authentizität von Massenhypnosen, nach dem der Fakir den Finger in meine Richtung ausstreckte, die Taschenlampe ausmachte und im Dunkel verschwand. Mein Herz begann, harmonisch zu pochen. Ungewöhnliche Herausforderungen hatte ich stets mit Genugtuung angenommen. Je verrückter, desto besser.
Das Licht floh mit bekannter Geschwindigkeit durch den schmalen Spalt in der Tür, durch den sich auch meine Begleiter verdünnisierten. Als ich meinen Sitz gefunden hatte, sackte ich einfach darauf zusammen, und der Bühnenscheinwerfer ging an. Die Bierflasche schob ich unter den Sitz. Wie ihr wisst, ist das Zeitband zwischen dem Vor- und dem Nachkriegsleben gerissen, diese Diskontinuität galt es zu überbrücken. Ich muss wohl zu einem Zeitreisenden werden und zurückkehren. Den Krieg überfliegen, obwohl das unmöglich ist; die eigene Übelkeit übersteigen. Das Zeitband finden und es mit diesem Moment in der Gegenwart verbinden. Denn ich will heil sein, und sei es nur in der Erinnerung. Ich war zufrieden mit der Art und Weise, in der ich die Situation ausnutzte. Utile et dulce, würde Horaz sagen. Wahrscheinlich zahlte es sich zum ersten Mal im Leben aus, dass ich eine Narbe im Gesicht hatte. Wenn ich auf wahnsinnige, neurotische Frauen sowie auf halb verrückte Männer anziehend wirkte, hieß das, dass ich selbst auch so war? Markiert mit einem gelähmten Schatten, gezeichnet mit dem Bruchstück eines finsteren Heiligenscheins über dem Kopf? Die Antwort war Ja. Ein solcher Magnetismus ist kein besonderes Glück, aber die Narbe war die Eintrittskarte, mit der ich für die Vorstellung bezahlt hatte.
Fünf …
Der Hypnotiseur betrat die Bühne mit einem Turban voller cooler zischender Schlangen, und in dem Moment stieg der Trockennebel an bis zu meinen Knien. Hinter seinem Rücken riss der Wind über der gefrorenen Ödnis alles mit sich, was ihm in dem Weg kam, dort über den übereinandergestapelten Lautsprechern. Ich hatte eine Vision vom Gebrüll elektrischer Plüsch-Elefanten, wie ich sie in der Hauptstadt gesehen hatte, wo irgendwelche Tunichtgute sie an vorbeieilende Passanten verkauften. »Unsere Zeit ist verschwunden«, schoss es mir durch den Kopf, während mein Blick von der Saaldecke auf die abblätternden Buchstaben fiel, mit denen über der Bühne heilige Parolen an der Wand prangten, über Tito, das Volk, die Partei und die allen versprochene Ewigkeit. Ich hatte keine Vorkriegsfotos mehr, wie sonst hätte ich also über meine Vergangenheit nachdenken sollen als über etwas, das es gar nicht gab? Ich schloss die Augen und spielte auf der Innenseite meiner Lider das schwarz-weiße Musikvideo Wonderful Life von Black ab. Und dieses Video füge ich bei, als letztgültigen Beweis, dass meine intime Welt aus der Vergangenheit dennoch existierte, auch wenn ich selbst manchmal glaubte, meine Erinnerungen erfunden zu haben. Die Klänge des Windes entfernten sich langsam, erstickt vom Knistern der Schallplatte, die hypnotisierend ein und denselben Ton wiederholte. Ich befand mich in einer fantasievollen Ermittlung.
No need to run and hide
It’s a wonderful, wonderful life …
Jedes Mal, wenn der Fakir eine Zahl sagte, organisierte ich die Gedanken-Tsunamis zu sinnvollen Einheiten und verwandelte sie in Beichtsätze. Ich hatte ja ein treues Publikum, dem ich stundenlang alles Mögliche erzählen konnte, doch das hier war eine andere Erfahrung. Ich bin wie der Schalter an einem Instrument zur Enträtselung von Menschenleben, man muss mich nur drücken; ich bin ein Instrument mit Fernglascharakter, Okular, Tubus und Vergrößerungsglas, gekreuzt mit einer langhalsigen Orchidee. Durch deren Trompete werde ich Geschichten ausstoßen.
Die Musikauswahl war ungewöhnlich, denn für die Hypnoseinduktion wird meist ein entspannender Klangteppich verwendet. Der weißbärtige Fakir stand im Lichtkreis der Reflektoren auf dem Podium, aufrecht wie eine Kerze. Seine Augen waren grau und eisig, das Gesicht unklar wie Schlamm. Als er mit dem Zählen fertig war, sagte er stockend, aber in unserer Sprache: »Jetzt du in konkretes Vergangenheit zurückkehren, childhood, okay? Kopf ist klar und kalt … Wie viel Jahr du bist?«
»Dreizehn«, antwortete ich.
»Sein du sicher?«
»Ja, ich bin dreizehn und will gerade Angeln gehen. Ich habe Gummistiefel an den Füßen, die Angelrute in der Hand und die Anglertasche über der Schulter. Das Schilfgras riecht nach Fischschleim. Es gibt so viel Fisch, dass man sich kaum daran sattsehen kann, das Gefühl ist vergleichbar mit dem des Reichen, der sein Gold streichelt, da er nie genug kriegen kann. Ich prüfe die Wasserkugel, die bis zur Hälfte mit Wasser gefüllt sein muss, die Kunstfliegen fette ich ein, damit sie an der Wasseroberfläche bleiben. Ich werfe die Angel weit aus, bis zum anderen Ufer, die Wasserkugel fällt auf den weichen, mit Wassergras bedeckten Sandboden. Das sieht aus, als hätte ich den Schwimmer auf ein grünes Kissen gelegt. Langsam ziehe ich mit der Schnur die Wasserkugel durchs Wasser, denn nur ein bis zwei Meter stromab befindet sich eine prächtige Forelle von etwa dreißig Zentimetern, und das Mindestmaß ist vierundzwanzig Zentimeter. Ich spüre, dass dies ein langer Kampf wird. Mit der Spitze der Rute ziehe ich die Schnur auseinander, an der die Fliegen festgebunden sind, und die letzte Fliege, die für Forellen bestimmt ist, positioniere ich so, dass sie über dem Maul des großen Fisches liegt. Ich betrachte die Fliege und halte die Luft an, der Fisch hebt sich blitzschnell zur Oberfläche, verfehlt die Fliege und bildet eine hutförmige Blase auf dem Wasser. Im selben Moment ziehe ich wie ein Revolverheld die Rute hoch, die ich griffbereit an der rechten Hüfte habe, und der Schwimmer mit den Fliegen landet direkt zu meinen Füßen im Gras. All das passierte so schnell, dass ich nur den weißen Bauch sah, während sie versuchte, mit dem Maul die Fliege zu fangen. Jetzt heißt es, sich zu beruhigen, wieder auszuholen und auf das grüne Kissen auszuwerfen, alles wieder von vorn. Ich bin so aufgeregt, dass ich die Leute am Ufer gar nicht bemerke, die mich und den Fisch anstarren …«