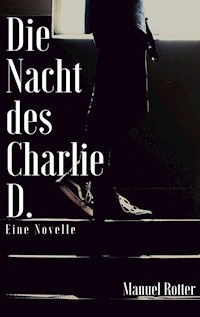Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
»Nichts im Leben ist jemals einfach, Tobi, nicht mal der Tod. Der kostet dir nämlich das Leben.« Tobias hat ein paar schwere Wochen hinter sich. Seit Evelyns Selbstmord verliert er zunehmend die Kontrolle über sein Leben. Aus diesem Grund schickt ihn seine Mutter aufs Land zu seinem Großvater, den er seit zehn Jahren nicht gesehen hat. Zoe hingegen hat ihren Bruder bei einem Autounfall verloren. Die Welt, die sie kannte, existiert nicht länger. Also flüchtet sie sich in das Balletttraining, das ihrem Körper und ihrer Seele schwer zusetzt. Als sich die Wege der beiden kreuzen, steht eines fest - das kann kein Zufall sein. Tobias und Zoe treffen eine folgenreiche Entscheidung. In der Hoffnung, das Leben wiederzufinden, das sie bereits verloren glaubten, stellen sie sich gemeinsam den Geistern der Vergangenheit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 256
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Euch,
die ihr zu früh gegangen seid,
für Euch,
die trotz allem geblieben sind.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 1: Von Dingen, die nicht gehen wollen
Kapitel 2: Von den Dingen, die wehtun
Kapitel 6
Kapitel 3: Wenn wir alleine sind
Kapitel 7
Kapitel 8: Warum manche Dinge so sind, wie sie nicht sein sollten
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
1.
Okay, machen wir's kurz. Ich heiße Tobias Gmeindner, bin fünfzehn Jahre alt und vor einer Woche bei den Abschlussprüfungen durchgefallen. Aus diesem Grund schickt mich meine Mutter aufs Land zu meinem Großvater, den ich eigentlich nicht kenne und den ich seit zehn Jahren nicht mehr gesehen habe. Meine Mutter und er haben sich bereits vor meiner Geburt zerstritten. Dass er mich danach überhaupt noch sehen durfte, lag an der vermittelnden Art meiner Großmutter. Nach ihrem Tod hat meine Mutter den Kontakt zu ihm vollkommen abgebrochen. Umso dümmer erscheint es mir, dass sie mich gerade jetzt, in dieser heiklen Phase, zu ihm schickt. Aber was soll ich dagegen schon tun?
So kommt es, dass ich jetzt, in der brütenden Hitze des Juli, in einem nicht klimatisierten Zug sitze, der ratternd über uralte Schienen rollt und der, nachdem wir Wien verlassen haben, in Stationen stehen bleibt, deren Namen sich kein Schwein merken kann.
Je weiter er mich von Zuhause fortträgt, desto wehmütiger wird mir zumute. Was habe ich eigentlich falsch gemacht? Na ja, kurz gesagt: Ich habe nicht nur die Prüfungen verhauen, sondern auch während des Schulballs einen Spind in Brand gesteckt, ein Klassenzimmer verwüstet, einen anderen Jungen krankenhausreif geschlagen und vielleicht – aber nur vielleicht – die Geldkassette gestohlen und sie einem Obdachlosen geschenkt (Letzteres sollte man mir eigentlich zugutehalten und nicht zur Last legen – man sieht, ich habe die Fachsprache bereits gelernt und zum Abruf vor Gericht einstudiert).
Weil man das aber nicht getan hat, war meine Mutter stinksauer, ist ausgerastet und hat meinen Großvater angerufen. Er muss zunächst vollkommen verwirrt gewesen sein, als mitten in der Nacht sein Telefon läutete und die Stimme meiner Mutter ihn aus dem Schlaf riss. Zehn Jahre hatten sie nicht miteinander gesprochen. Jetzt verlangte sie von ihm, mich, seinen Enkel, zu sich zu holen und solange bei sich zu behalten, bis ich wieder bei Verstand wäre. Denn das glaubt meine Mutter – dass ich den Verstand verloren habe. Aber so ist es nicht.
Vor einem halben Jahr starb meine Freundin – meine erste Freundin. Danach ging es mir mit jedem Tag schlechter, und je mehr Tage vergingen und umso schlechter es mir ging, desto mehr Scheiße habe ich gebaut. Der Abschlussball war wohl eine Nummer zu viel, das sehe ich schon ein, aber es ist noch lange kein Grund, mich einfach fortzuschicken, nur weil meine Mutter mit der Gesamtsituation überfordert ist, oder? Ja klar, ich bin schwer zu bedienen, wie ein altes Grammophon, aber so zu tun, als hätte ich keine Probleme (oder als wäre ich kein Problem) und alles zu leugnen, indem sie mich für einige Zeit aus ihrem Leben streicht, ist ja wohl auch keine Lösung. Ach, egal. Was soll ich sagen? Vielleicht tut es mir sogar gut.
Als der Zug in die Endstation (ein Kaff, das wahrscheinlich Affenhausen heißt) einfährt, werde ich umgehend vom Gegenteil überzeugt. Die Computerstimme aus dem Lautsprecher bittet alle Fahrgäste auszusteigen. Das tun wir, so wenige wir auch sind, und treten in die brennende Hitze hinaus. Der Bahnhof ist winzig, gerade mal vier Gleise. Das Bahnhofshaus ist dazu passend klein, sieht uralt aus und als würde es gleich in der nächsten Sekunde einstürzen. Der Unterstand gibt ein seltsames Geräusch von sich, als eine Horde Tauben darauf landet.
Ich schnalle den Rucksack enger, fasse meinen Koffer und folge dem Rest der panischen Meute (die peinlich darauf bedacht ist, so schnell wie möglich zum Aufzug zu gelangen. Fahren die echt mit dem Aufzug da runter!?)
Schleunigst mache ich mich aus dem Staub, die Stufen hinunter und durch das Bahnhofsgebäude hindurch in den Schatten zwischen Fahrradständer und Parkhaus (na immerhin haben die ein Parkhaus!). Wo ist mein Großvater? Eigentlich sollte er schon längst hier sein!
Ich warte eine halbe Stunde im Schatten und hole allenthalben mein Handy aus der Hose, um die Zeit zu checken – vielleicht habe ich mich ja vertan (habe ich nicht!). Er hat also auf mich vergessen. Meine Mutter hat ihm zwar gesagt, wann ich eintreffen würde, aber er hat wohl genauso wenig Lust, mich zu treffen, wie ich Lust habe, den Sommer bei ihm zu verbringen.
Schon wähle ich die Nummer meiner Mutter und keuche genervt, während das Piepen in meinem Ohr nicht endet. Meine Mutter hebt nicht ab. Verdammte Scheiße!
Auf den trockenen Asphalt unter meinen Füßen einstampfend mache ich am Absatz kehrt und suche nach einem Bahnangestellten. Als ich am Schalter ankomme, ist er geschlossen. Echt jetzt? Machen die um diese Uhrzeit schon Feierabend?
Zum Glück sehe ich einen Schaffner am Bahnsteig vier und eile sofort hinüber, bevor er in einem der wenigen Züge verschwinden kann, die in diesem Saustall Affenhausen halten.
»Wo willst du hin?«, fragt er mich verwirrt, während ich mich nur vage an den Namen der Ortschaft erinnere.
»Wukental?«
»Meinst wohl Weitersdorf!«
»Ja, wahrscheinlich«, bestätige ich knapp.
»Da fährt der nächste Zug in 'ner Stunde«, brummt er und kratzt sich am Hinterkopf.
»In einer Stunde?«
»Du hast es!«
Die Luft zwischen meinen Zähnen pfeifen lassend, schlurfe ich davon. Echt jetzt? Ich dachte immer, Großväter wären verlässlich. Ach, egal! Wieder krame ich mein Handy hervor und suche nach diesem Weitersdorf. Drei Kilometer, okay, das schaffe ich auch zu Fuß. In Wien laufe ich ständige zu Fuß von einem Ort zum anderen, weil ich dadurch schneller bin.
Allerdings führen mich die Wege in Wien nicht über kaputte Straßen und durch Feldwege hindurch zu einem Wäldchen, an dem ich scharf nach links abbiege und einem ausgetretenen Pfad durch die Bäume hindurch folge. Wenigstens ist es in dem Wald nicht so brütend heiß. Der Schatten unter den Kronen lässt mich endlich durchatmen und während ich meinen Koffer hinter mir herschleppe, überprüfe ich meine Mails. Welch Verwunderung, mir hat niemand geschrieben! Ich gehöre nicht gerade zur beliebten Sorte in der Schule, erst recht nicht, seit ich sie fast in Brand gesteckt habe. Mein SMS-Speicher ist ebenfalls leer. Evelyn war die einzige Freundin, die ich hatte. Seit ihrem Tod bleibt mein Handy stumm.
Ich verlasse den Wald und überquere (querfeldein) ein Weizenfeld. Dann komme ich endlich in einer kleinen Siedlung an. Auf dem Ortschild steht Weitersdorf (neben dem F klebt ein „Nazis raus aus dem Parlament“-Aufkleber). Die nächste Straße führt mich auch schon an mein Ziel.
Das Haus meines Großvaters ist das letzte an der Straße, die nach einem Vogel benannt ist. Die natürliche Geometrie der Grundstücksgrenzen schneidet das Haus meines Großvaters von den restlichen Häusern ab, sodass ich den Gartenzaun umrunde und das Gartentor öffne, das bei meiner Berührung übelst zusammenzuckt. Dann stehe ich vor der Tür, darüber nachdenkend, ob ich anläuten oder aber klopfen soll (einen Schlüssel habe ich ja nicht).
Die Fassade ist brüchig und an den Ecken bereits abgefallen. Das Holz der Fensterrahmen ist morsch und das Dach wahrscheinlich undicht. Alles in allem stehe ich vor einer Bruchbude.
Schlussendlich klopfe ich. Zunächst folgt keine Reaktion. Dann klopfe ich härter und höre plötzlich einen Mann fluchen. (Herrgott, i' komm' ja schon!) Die Tür wird nach innen aufgerissen und ich stehe vor meinem Großvater, den ich ausschließlich von alten Fotos kenne. Der runde Bauch versteckt sich unter einer Weste (mitten im Sommer) und das graue, kaum noch vorhandene Haar liegt klebrig auf der schuppigen Kopfhaut. Seine blassen, braunen Augen fixieren mich. Dann verzieht sich das faltige Gesicht zu einer schockierten Grimasse.
»Herrgott, hab' ich dich vergessen?«, brummt er mit tiefer Stimme. »Dachte, du kämst erst um zehn!«
»Es war zehn«, meine ich, »vor einer Stunde.«
»Verdammt«, er schlägt sich mit der flachen Hand gegen die Stirn, »das tut mir jetzt leid, das musst du mir glauben, Tobias!«
Mit einem kräftigen Ruck zieht er mich ins Haus. Sofort schlägt mir die abgestandene Luft ins Gesicht und ich rümpfe die Nase gegen den Gestank der Verwesung, der sich bereits durch alle Ecken der Bruchbude gefressen hat. Gleichzeitig rieche ich das frischgekochte Essen aus der Küche. Ich blicke das Treppenhaus hinauf und bemerke die wenigen Bilder an der Wand. Das Haus wirkt sehr düster, passend zu der niedergeschlagenen Miene meines dickbäuchigen Großvaters.
»Schon gut«, sage ich sofort, um seine Schuldgefühle zu zerschlagen. »War nicht leicht, die Hütte hier zu finden.«
»Bist du über die Felder gegangen?«, fragt er mich.
Ich folge ihm die Stufen hinauf in die Küche. Durch die beiden Fenster fällt gleich viel mehr Licht, was mich die Augen zukneifen lässt, da es einen schlimmen Kontrast zum Treppenhaus darstellt. Großvater kehrt an den Herd zurück und beginnt den Inhalt eines Topfes mit einem alten Holzlöffel umzurühren.
»Ja, durch den Wald und dann querfeldein«, sage ich. Ich stelle den Koffer neben dem Fenster ab und lege den Rucksack auf einen Sessel.
»Kommst passend zum Essen«, meint er. Ich denke daran, wie spät es eigentlich ist. Das bemerkt er sofort und fügt hinzu: »Ich esse immer früh. Alte Gewohnheit.«
»Was gibt's denn?«, frage ich, um den peinlichen Austausch an Floskeln am Laufen zu erhalten.
»Paprikahendl«, sagt er stolz. »Deine Mama meint, das magst du besonders!«
Da hat er allerdings recht. Auch Evelyn mochte es sehr!
»Kochst du immer selbst?«, will ich wissen. Er zeigt auf einen Sessel und ich setze mich.
»Bleibt mir ja nicht viel übrig«, sagt er.
Er füllt zwei Teller mit Huhn und Spätzle. Dann kommt er zum Tisch hinüber und reicht mir einen Teller. Es riecht köstlich. Schon beginnt sich mein erster Eindruck der heruntergekommenen Hütte zum Positiven zu verändern.
»Wie alt bist denn jetzt?«, fragt er mich, den aufsteigenden Dampf vom Löffeln pustend.
»Fünfzehn«, meine ich, » aber nächsten Monat werde ich sechszehn.«
»Sechszehn schon«, meint er. »Dann haben wir uns ja wirklich lange nicht gesehen.«
»Lag nicht an mir«, versetze ich ihm eine Spitze. Ich sehe sofort, dass ihn das schwer trifft.
»War nicht immer meine Schuld«, verteidigt er sich.
»Mama meint, du wolltest mich nicht sehen?«, hake ich sofort nach.
Ich weiß nicht viel über meinen Großvater und über seine Beziehung zu meiner Mutter, seiner Tochter, und weshalb sie sich nicht gut verstehen.
»Ich wollte das schon«, sagte er, »aber sie war nicht begeistert davon. Wir haben uns schon früh zerstritten, hab' paar Fehler gemacht, früher, die hat sie mir nie verziehen.« Nachdenklich löffelt er sein Paprikahuhn.
»Was ist passiert?«
»Hat sie dir das nicht erzählt?«, entgegnet er mit einer Gegenfrage, als wollte er nicht darüber sprechen. Ich schüttle den Kopf. »Wird es dir später erzählen. Und warum schickt sie dich hierher, zu mir? Muss schlimm sein, wenn sie dich mir anvertraut!«
Schlimm? Kommt wohl auf die Perspektive an.
»Bin suspendiert worden«, erkläre ich, »hab' paar Fehler gemacht!«
Meine Wortwahl gefällt ihm. Die restliche Zeit schweigen wir. Nach dem Essen waschen wir gemeinsam ab, dann zeigt er mir das Zimmer. Es ist relativ groß (größer als mein Zimmer in Wien zumindest) und ein großes Fenster lässt es hell erscheinen, obwohl die dunkelblauen Wände das Gegenteil behaupten wollen. Ich werfe den Rucksack auf das Bett, dann hieve ich den Koffer darauf.
»Später fahren wir in die Stadt rüber«, sagt mein Großvater. »Hast du einen Führerschein?«
»Ich bin fünfzehn!«, meine ich, eine Augenbraue hebend. Hört er mir überhaupt zu!?
»Fahren kannst du hoffentlich trotzdem. Bin ewig nicht gefahren und ich seh' nicht mehr so gut.«
»Meinst du das ernst?« Er antwortet nicht darauf.
»Und nenn' mich bitte Opa«, sagt er, »Großvater klingt so streng.«
Damit schlurft er davon und ich beginne damit den Koffer auszupacken. Weil es so stickig ist, öffne ich das Fenster und bemerke, dass der Garten riesig ist (zumindest für einen Stadtmenschen). An der Grundstücksgrenze führt eine Bahnstrecke vorbei, über die ich wohl gekommen wäre, hätte ich in Affenhausen auf den Zug gewartet.
Ich lasse mich auf das weiche Bett fallen und schließe die Augen. Was soll ich hier nur anfangen? Es scheint nicht viel zu tun zu geben und nach Wien fahre ich doch über zwei Stunden. Ich fürchte mich bereits jetzt vor den nächsten Wochen. Aber vielleicht ist es genau das, was ich gerade brauche.
2.
Opa (wie ich ihn nennen soll) zieht die Plane von dem Auto in der Garage. Es ist ein total heruntergekommener Wagen, über den ich meinen Blick wandern lasse. Ich verstehe nicht viel von Autos, es hat mich einfach nie interessiert, aber sogar ich weiß, dass das Teil wahrscheinlich überhaupt nicht mehr fahrtüchtig ist.
»Also, kannst du fahren?«, fragt er und wirft mir die Schlüssel zu, die ich aus der Luft heraus ungeschickt auffange. Ich würde ja zustimmen, aber ich starre ihn verwirrt an, und mir ist vollkommen klar, dass er es ernst meint. Obwohl er weiß, dass ich keinen Führerschein habe.
Ehe ich etwas sagen kann, steigt er auf der Beifahrerseite ein und bedeutet mir, dass ich mich beeilen soll. Also gehe ich um das Auto herum und steige ein. Es ist nicht das erste Mal, dass ich hinter dem Steuer sitze. Als Kind habe ich oft die Schlüssel meiner Mutter geholt und bin zum Auto hinaus. Nie habe ich den Motor gestartet oder auch nur versucht, die Handbremse zu lösen. Nun tue ich beides und bin vollends begeistert. Opa sieht mich von der Seite her an, ich erwidere seinen zufriedenen Blick.
»Ist ja nicht so schwer!«, sagt er.
»Soll ich wirklich fahren?«, meine ich zögerlich.
»Klar«, sagt er ernst, »ich bin ewig nicht mehr gefahren. Sehe mittlerweile zu schlecht und gesundheitlich sollte ich nicht einmal mehr die Stufen im Haus alleine in Angriff nehmen.«
»Und wenn wir aufgehalten werden?«, will ich wissen, gespannt auf seine Antwort.
»In der ganzen Gegend gibt es vier Polizisten, davon zwei in Gärendorf«, sagt er, »mich haben sie in sechzig Jahren nicht ein Mal aufgehalten, warum sollten sie jetzt damit anfangen?«
Das klingt zwar alles andere als logisch, aber ich gebe mich damit zufrieden. Langsam steige ich von der Kupplung und lasse den Wagen anrollen. Es ist ein tolles Gefühl, wenngleich mein Herz rast. Mich in alle Richtungen umsehend, ob wir eventuell doch in der nächsten Sekunde entdeckt werden könnten, beschleunige ich den Wagen, bis ich das Tempolimit erreiche.
»Das machst du gut, Tobi«, es sind die ersten lobenden Worte seit Monaten. Meine Mutter hatte in letzter Zeit kaum freundliche Worte für mich übrig (was ich total verstehe). Es tut gut, nicht immer angeschrien zu werden.
Der Weg nach Gärendorf war mir auf meinem Hinweg länger vorgekommen. Mit dem Auto brauchen wir nur fünf Minuten, bis wir über die Einkaufsstraße rollen (ich meine wirklich rollen, denn mehr als Schrittgeschwindigkeit ist hier nicht erlaubt).
»Park dich da vorne ein!«, weist Opa mich an.
Ich lenke ungeschickt in die Parklücke und zeige mich stolz, nirgends angefahren zu sein (und niemanden getötet zu haben, das vor allem).
»Und was machen wir jetzt?«
»Ich muss ein paar Sachen kaufen«, sagt er, während er sich bereits aus dem Auto hievt. Ich ziehe den Schlüssel ab und folge ihm. »Kannst du das besorgen?«
Er reicht mir eine Einkaufsliste. Opas Handschrift ist schnörkelig und kaum zu lesen. Ich sehe ihn hilfesuchend an. »Dort vorne!« Er zeigt in Richtung Markt.
»Wir treffen uns wieder hier!«
»Alles klar!«
Ich spaziere die Einkaufsstraße entlang. Zwei Leute, an denen ich vorüberkomme, grüßen mich, obwohl sie mich nicht kennen. Das bin ich aus Wien nicht gewohnt. Den Gruß freundlich erwidernd, sehe ich mich um. Gärendorf ist größer, als ich erwartet habe. Es sieht überhaupt nicht ländlich aus.
Am Markt herrscht reges Treiben. Die Verkäufer haben sich in perfekter Formation über den Platz verteilt und rufen sich wüste Beschimpfungen und Komplimente zu. Das scheint wohl eine Art Brauch zu sein. Ich versuche, das erste Wort auf der Einkaufsliste zu entziffern und sehe mich gleichzeitig nach einem Stand um, der mir nach Käsehändler aussieht. Schon entdecke ich ihn und gehe hinüber, um alles zu besorgen.
Es dauert fast eine halbe Stunde, bis ich die auf der Liste stehenden Dinge zusammen habe. Dann wird meine Aufmerksamkeit von einem Obsthändler in Beschlag genommen. Ich entdecke reife Pfirsiche und bin sofort zur Stelle, um sie zu inspizieren. Ich liebe Pfirsiche und lege umgehend vier von ihnen in meine Tasche. Als ich nach dem fünften greifen will, fasse ich ins Leere und erwische anstelle des Pfirsichs eine Mädchenhand. Erschrocken ziehe ich meine Hand zurück und blicke auf.
»Tut mir leid, ich wollte nicht …«, sagt das Mädchen. Sie sieht sehr jung aus, zwei oder vielleicht drei Jahre jünger als ich. Das lange schwarze Haar hat sie zu einem Pferdeschwanz gebunden und der Pony lässt ihr Gesicht winzig erscheinen. Der hagere Körper lässt mich beinahe zusammenzucken. Die kann kaum mehr als dreißig Kilo wiegen, denke ich still. Außerdem ist sie sehr blass. Aber ihr Lächeln ist bezaubernd. Sie erinnert mich ein wenig an Evelyn, bevor sie sich veränderte.
»Mir tut es leid. Ich habe nicht aufgepasst«, sage ich, um die peinliche Stille zu brechen.
»Schon gut, nimm du ihn!«, sagt sie und hält mir schon den Pfirsich hin.
»Danke«, ich stecke ihn in die Tasche zu den anderen.
»Du bist nicht von hier, oder?«, fragt sie schüchtern.
»Bin auf Besuch bei meinem Opa«, antworte ich, als müsste ich mich verteidigen.
»Das ist er«, Opa schlägt mir von hinten auf die Schulter. Obwohl er so alt ist, drückt er mich beinahe in den Boden. Ich stöhne leise unter der Last seiner Hand und versuche, mir nichts anmerken zu lassen.
»Herr Rabe«, grüßt sie Opa, »wie geht es Ihnen?«
»Gut, Zoe, dir?«
»Ganz gut«, meint sie. Sie vergräbt ihre Hände in den Taschen. Erst jetzt fällt mir auf, dass sie, trotz dieser brütenden Hitze, eine Jacke trägt.
»Wie geht es deinem Papa mit der Schulter?«, will Opa erfahren.
»Schon besser, danke«, meint sie, »aber Sie kennen ihn ja. Er kann kaum eine Sekunde stillhalten. Mama schimpft ständig mit ihm.«
»So war er schon immer.«
»Das stimmt«, sagt sie. »Ich muss jetzt los. Es war schön, Sie zu sehen, Herr Rabe.«
»Ja, ja«, ruft er ihr nach.
Zoe verschwindet in Richtung Einkaufsstraße. Ich sehe ihr kurz nach. Dann tritt mein Opa vor mich und grinst mich auf eine absurde Alteleuteart an.
»Was ist?«, will ich wissen.
»Sie gefällt dir!«, sagt er.
»Die ist doch viel zu jung für mich!«, meine ich, ohne ihm zu sagen, dass das für mich überhaupt keine Rolle spielt. Er scheint nichts von Evelyns Selbstmord vor einem halben Jahr zu wissen. Ich habe nicht vor, das zu ändern, denn ich kenne ihn in Wahrheit ja überhaupt nicht.
»Die ist so alt wie du!«
Mir fällt die Kinnlade herunter.
»Neeeein!«, raune ich. »Die sieht ja aus wie ein Kind!«
»Du bist ein Kind«, neckt er mich. Ich werfe ihm einen bösen Blick zu, aber er grinst einfach weiter.
»Können wir jetzt abhauen?«
»Du fährst!«
3.
Ich schlafe nur wenig bis gar nicht. Die Nächte seit Evelyns Tod machen es mir unmöglich. Schaffe ich es dann doch, suchen mich böse Träume heim, in denen ich darum bettle, bei ihr zu sein.
Deshalb bin ich am Morgen träge und schlage auf meinen Handywecker ein, als dieser um 9 Uhr ein höllisches Geheule von sich gibt. Es dauerte beinahe eine weitere volle Stunde, bis ich schlaftrunken am Küchentisch sitze und den herben Blick meines Opas erwidere.
»Siehst müde aus, Junge«, sagt er, während er die Zeitung umblättert.
Diese Bemerkung lasse ich unkommentiert und schiebe mir das Brot zwischen die Zähne. Es schmeckt fahl, wie alles, das ich in den letzten Monaten nahezu hinunterwürgen musste, weil mein Magen sich jeden Tag schon beim bloßen Gedanken an Essen zusammenzieht.
»Was kann man denn hier so unternehmen?«, frage ich, während ich das Geschirr abspüle. Er sieht nur kurz von der Zeitung auf, bevor er eine knappe Antwort gibt.
»Alles Mögliche!«
»Aha!«, ich stelle das Wasser ab und drehe mich um. Das zwingt ihn, die Zeitung zuzuschlagen und aufzustehen. Er legt die Zeitung auf den Stapel, der sich neben dem Papierkorb bereits türmt.
»Wandern kannst«, meint er, »da gibt es paar gute Wege in die Weinberge hinein, oder Rad fahren. Rad hab' ich allerdings keines mehr, zumindest finde ich es seit Jahren nicht mehr.«
Das lässt mich schmunzeln. Es ist ein weiteres Zeichen seines fortgeschrittenen Alters, das er mir gegenüber erwähnt. »Oder du liest. Ich hab' 'ne halbe Bibliothek im Wohnzimmer. Liest du gerne?«
»Früher schon.«
»Jetzt nicht mehr?«, fragt er.
Seit Evelyns Tod nicht mehr. Wir waren richtige Leseratten und haben uns ständig Bücher auf Flohmärkten oder an Bücherstationen gekauft. Sie liebte die deutschen Klassiker, ich die englischen. Gleichzeitig hatte sie einen Narren an Fantasyliteratur gefressen – ständig erzählte sie mir von Tolkien und seinen Elben. Ich las gerade Die Räuber, weil sie es mir aufgezwungen hatte, als sie … Seitdem habe ich jedenfalls keine Zeile mehr gelesen.
»Bin erwachsen geworden!«, sage ich knapp.
»Aha!«
»Was kann man noch so machen? Gibt es einen Skaterpark oder Sportplatz? Irgendetwas, wo Leute in meinem Alter sind?«
»Du kannst in den Wald gehen!«, sagt er, als hätte ich direkt ins Leere gefragt.
Damit lasse ich ihn stehen und verschwinde auf mein Zimmer. Das Mittagessen lasse ich aus, weil mir das Frühstück noch schwer im Magen liegt, dann haue ich ab.
Da der Wald direkt an Opas Haus grenzt, beschließe ich, es einfach mal zu versuchen. Mit Evelyn war ich nur selten im Wald, weil es in Wien (zumindest in dem Teil, in dem ich lebe) keine Wälder gibt. Und hinauszufahren war uns immer zu aufwendig. Deshalb haben wir uns, wenn überhaupt, auf der Donauinsel getroffen, waren schwimmen (auch wenn sie es hasste) oder lagen einfach nur in der Wiese. Weiter sind wir nie gekommen.
Wenigstens ist es im Wald kühler. Ich hasse die Hitze und wegen ihr wohl auch den Sommer. Zumindest habe ich den Herbst und den Winter lieber. Gegen die Kälte kann ich mich anziehen, gegen die Hitze aber nicht unbegrenzt ausziehen.
Das Sonnenlicht, das durch die Baumkronen fällt, lässt den Boden zu meinen Füßen tanzende Schatten bilden, und die milde Brise erzeugt in den Blättern das Geräusch einer leisen Melodie, die mir in den Ohren klingt. Sie erinnert mich an ein Lied von Poisel.
Ehe ich es bewusst realisiere, bin ich bereits eine Stunde unterwegs, als ich an einem Bach ankomme, der sich wie eine Schlange durch den Wald gräbt. Das Wasser plätschert durch ein tieferliegendes Bachbett. Winzige Äste ziehen an mir vorbei und bleiben an manchen Stellen im Matsch stecken. An den Rändern des Bachbetts erkenne ich, dass der Wasserstand schon einmal höher war.
Dennoch ziehe ich mir die Schuhe aus und steige hinein ins Wasser. Es ist ein wohltuendes Gefühl, wie das Wasser meine Knöchel umfließt. Für einen kurzen Moment schließe ich die müden Augen und lausche den Geräuschen der sich auflösenden Umgebung.
Evelyns Hand rutscht von der Seite in meine und ich öffne die Augen, um sie anzusehen. Die Tiefe ihrer Augen verschlingt mich und ihr natürlicher Körpergeruch versetzt mich in eine lustvolle Stimmung. Es ist nicht das erste Mal, seit sie ging, dass sie mich besucht. In Momenten wie diesem ist sie stets bei mir. Manchmal spreche ich sogar mit ihr, über nichts Wichtiges, ich will einfach nur ihre Stimme hören. So wie jetzt.
Sanft streife ich durch ihr schwarzes Haar und ziehe sie an mich. Unsere Lippen berühren einander und ich schmecke ihren Erdbeergeschmack. Dann schließe ich wieder die Augen, um diesen Moment für immer festzuhalten. Wie sehr ich doch hoffe, dass es real ist.
»Was machst du da?«, die Stimme eines Mädchens lässt mich aufschrecken und ich knalle mit der Nase voraus in den Bach.
»Verdammte Scheiße!«, brülle ich.
Zum Glück habe ich mein Handy in meinem Zimmer gelassen, sonst wäre es jetzt kaputt. Dennoch springe ich sofort auf und suche nach dem Mädchen … und blicke verwundert drein, als ich es unerwartet erkenne. Zoe, das Mädchen vom Markt, steht vor mir. Obwohl sie es könnte, schließlich biete ich einen nur allzu lächerlichen Anblick, wie ich da völlig durchnässt und zornig fluchend im Bach stehe, lacht sie nicht.
Ich kämpfe mich über die Böschung aus dem Bach hinaus und schüttle den Matsch ab. Meine Klamotten kann ich vergessen und aus meinem Haar muss ich sogar Äste zupfen. Meine Wut kocht sich immer weiter hoch.
»Tut mir leid«, sagt sie, so leise, dass ich sie beinahe nicht verstehe. »Ich wollte dich nicht erschrecken.«
»Was machst du hier?«
»Ich geh' hier oft spazieren«, erklärt sie.
Sie versteckt die Hände in den Taschen der Weste (die sie erneut trotz der Hitze des Sommertages trägt). Das Haar hat sie streng nach hinten gebunden, nur die Fransen ihres Ponys liegen zerzaust an der Stirn, und ihre Augen funkeln, als hätte sie gerade geweint. Diesmal fällt mir auf, dass sie nicht nur hager ist, sondern so dünn, dass ihre Beine nicht dicker erscheinen als meine Arme.
»Und du?«
»Ich hab' meinen Opa gefragt, was man hier so machen kann, und er meinte, ich könnte in den Wald gehen. Da bin ich, völlig durchnässt und voller Dreck!«
Die letzten Worte klingen härter, als sie es sollten. Sie weicht meinem Blick sofort aus und beginnt ihre Füße anzustarren, als wäre all das ihre Schuld. Dabei ist es meine. Was steige ich auch barfuß in einen Bach und gebe mich meinen Tagträumen über ein totes Mädchen und meine vergeblichen Hoffnungen hin?
»Dann ist Herr Rabe also dein Opa?«
»Ja.« Das weiß sie doch schon.
»Ich hab' dich hier noch nie gesehen«, meint sie.
»War nicht oft hier!«
»Wo kommst du her?«, fragt sie mich, während ich ungeschickt meine Socken und Schuhe wieder anziehe.
»Wien!«
»Dann muss dir unsere Gegend ja …«
»Wie das Mittelalter vorkommen?«, sage ich genervt. »Das tut sie!«
Damit lasse ich sie verstummen. Sofort bemerke ich die Niedergeschlagenheit in ihren Augen und versuche, die Situation zu entschärfen.
»Tut mir leid, ich wollte meinen Frust nicht an dir auslassen. Zoe? So heißt du doch, oder?« Sie nickt mir hoffnungsvoll zu. »Warum bist du allein hier im Wald?«
»Hab' nicht viele Freunde!«
»Willkommen im Klub!«, rufe ich aus.
Ich winde die Hose und das T-Shirt so gut es geht aus, dann streiche ich mein nasses Haar nach hinten. Ich muss wie ein Pinguin aussehen. Aber das scheint sie nicht zu stören.
»Willst du eine Runde drehen?«, fragt sie mich und zeigt an mir vorbei über den Bach.
»Klar«, in Gedanken füge ich hinzu, ich hätte ja sonst nicht viel zu tun.
Die ersten Meter legen wir schweigend zurück. Sie hält Abstand und ich folge ihr trittsicher, da sie sich in diesem Wald besser auskennt als ich. Mittlerweile wüsste ich nicht einmal mehr, woher ich eigentlich gekommen bin und würde den Weg zurück zu Opas Haus wohl nicht finden. In diesem Sinne bin ich sogar froh, dass Zoe mich begleitet und ich nicht alleine bin.
»Bist du oft hier im Wald?«, frage ich.
»Fast jeden Tag«, sagt sie.
Ihre Antworten bleiben weiterhin knapp, während ich einige Fragen über Gärendorf und die Umgebung stelle. Sie erzählt mir, dass es in der Nähe einen Abenteuerpark gäbe, der auch über einen Kletterpark verfüge. Wir beschließen, dass das nichts für uns beide ist.
Durch Zufall kommen wir auf das Thema Literatur, was sie aufblühen lässt (zumindest auf ihre stille Art). Sie erzählt mir von den Schriftstellern, die sie gerne hat, und davon, dass Zoes Oma ihr immer Bücher schenkt, weil sie so viele hat. Manchmal geht Zoe (da ihre Oma nur ein paar Straßen weiter entfernt wohnt) hinüber und sucht sich Bücher aus den Regalen aus. Die meiste Zeit verbringt sie also mit Lesen – da haben wir zumindest schon einmal etwas gemeinsam (von der Tatsache abgesehen, dass wir beide offenbar nicht viele Freunde haben).
»Die anderen in der Schule meiden mich, weil ich am Wochenende lieber lese als auf Partys zu gehen. Und weil ich tanze!«
»Du tanzt? Das würde doch genau auf Partys passen«, meine ich.
»Ballett«, sagt sie, »nicht gerade die Art Tanz, die man auf Partys erwartet.«
Das erklärt auch, weshalb sie mir so hager erscheint. Unter der Weste fallen mir nun auch die strammen Muskeln auf und wie elegant sie sich durch den Wald bewegt. Sie ist genau so, wie ich mir eine Balletttänzerin immer vorgestellt habe. Diszipliniert, verschlossen und gleichzeitig emotional, mit einer Tiefe in den Augen, die einen durchdringen möchte.
»Magst du Ballett?«, fragt sie.
»Hab' paar Vorstellungen gesehen.«
»Haben sie dir gefallen?«
»Konnte mir Schlimmeres vorstellen«, lüge ich, weil ich nicht zugeben möchte, dass mich Ballett sogar fasziniert. Ich bewundere, dass es den Tänzern gelingt, ohne Worte eine Geschichte zu erzählen, nur mit ihren Körpern, die sich perfekt zu der klassischen Musik bewegen, wahrhaftige Gefühle zu vermitteln, nur mit ihren Augen, ohne sich direkt an das Publikum zu wenden.
»Bist du an einer Akademie?«
»Noch nicht«, sagt sie, »ich nehme aber an einem Vortanzen Ende August teil.«
»Dann viel Glück!«
Wir verlassen den Wald und sind nicht weit von Opas Haus entfernt. Hier verabschieden wir uns und ich gehe zurück zum Haus.
Opa arbeitet gerade im Garten. Sein Alter macht es ihm offenbar schwer sich zu bücken, deshalb frage ich ihn, ob ich helfen kann. Er nimmt meine Hilfe an und wir machen uns daran, die neuen Blumen einzusetzen, die er wohl schon länger in der Garage stehen hat.
In Wien haben wir keinen Garten, weshalb ich die Arbeit mit den Händen sehr genieße. Dass ich mit bloßen Händen durch die Erde bohre, leert meinen Verstand, und ich schaffe es zum ersten Mal, die bösen Gedanken an Evelyn aus meinem Kopf zu verbannen.
»Warst lange weg«, sagt Opa nach einer Weile.
»Ich war im Wald und hab' dort Zoe getroffen.«
»Sie ist oft dort draußen«, sagt er, »das arme Mädchen.«
Ich halte in der Arbeit inne und stütze mich kniend auf die Oberschenkel. Opa versteht sofort und ich kann kaum fassen, was er mir da erzählt.
»Vor ein paar Monaten hat sie ihren Bruder verloren«, erklärt er mir traurig. »Autounfall. Er ist mit betrunkenen Freunden mitgefahren und dann … Er ist gestorben. Seitdem ist sie noch verschlossener geworden.«
Das kann ich verstehen. Mir geht es nicht anders – was Opa natürlich nicht weiß. Ich frage mich, ob Mama ihm von Evelyn und dem, was passiert ist, erzählt hat. Aber ich denke eher nicht, sonst würde er nicht so frei von Zoes traumatischem Erlebnis erzählen.
»Hast du ihn gekannt?«