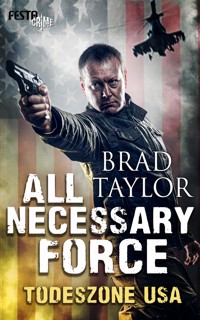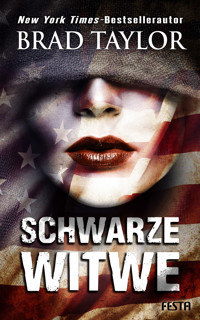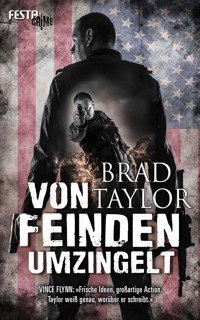
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Taskforce – von der US-Regierung gegründet, um außerhalb des US-Rechts im Geheimen agieren zu können. Ihre Existenz ist ebenso wichtig wie illegal. Pike Logan und seine Taskforce sollen für den Schutz eines US-Gesandten sorgen, der in Dubai an Friedensverhandlungen zwischen Israel und Palästina teilnimmt. Und tatsächlich gibt es einen ausgeklügelten Plan: Alle Teilnehmer sollen mitsamt den Burj Khalifa, einem der höchsten Wolkenkratzer der Welt, in die Luft gejagt werden … Pike und seine Partnerin Jennifer Cahill haben es aber nicht nur mit einer Terrororganisation aus dem Nahen Osten zu tun: Auftragskiller und Verbündete auf Abwegen nehmen auch die Taskforce ins Fadenkreuz. Non-Stop-Action an globalen Krisenherden John Lescroart: »Auf einem Level mit Jason Bourne, Jack Reacher und Jack Bauer.« Vince Flynn: »Frische Ideen, großartige Action. Taylor weiß genau, worüber er schreibt.« Booklist: »Es gibt viele Romane über die Special Forces, aber die von Taylor zählen eindeutig zu den besten.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 614
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Aus dem Amerikanischen von Alexander Amberg
Impressum
Die amerikanische Originalausgabe Enemy of Mine
erschien 2014 im Verlag Verlag Dutton.
Copyright © 2013 by Brad Taylor
Copyright © dieser Ausgabe 2017 by Festa Verlag, Leipzig
Veröffentlicht mit Erlaubnis von Dutton, ein Unternehmen der Penguin Publishing Group/Penguin Random House LLC.
Lektorat: Alexander Rösch
Titelbild: Clinton Lofthouse
Alle Rechte vorbehalten, auch die der vollständigen oder auszugsweisen Reproduktion, gleich welcher Form.
eISBN 978-3-86552-493-5
www.Festa-Verlag.de
www.Festa-Crime.de
Meiner Mutter und meinem Vater,
die mich die Kunst des Möglichen lehrten.
Es gibt keine Jagd, die vergleichbar ist mit einer Menschenjagd, und wer einen bewaffneten Mann lange genug gejagt hat und Gefallen daran fand, kümmert sich danach um nichts anderes mehr.
– Ernest Hemingway
Der Feind meines Feindes ist mein Freund.
– Arabisches Sprichwort
Prolog
Vor zwei Monaten
Der Moment, um die Aufzeichnung zu starten, kam und ging. Ich zögerte, suchte auf dem Bildschirm nach einem Grund für meine Zurückhaltung. Doch mir fiel nichts Außergewöhnliches auf – nichts, was ich nicht schon Hunderte Male zuvor gesehen hätte. Ein schlichter Raum, drei mal sechs Meter groß, in dem lediglich ein ramponierter Tisch und ein Stuhl standen. Nirgends ein Platz zum Verstecken. Keinerlei Waffen. Ein Zimmer wie gemalt für einen Zugriff. Und doch ließ mich ein dumpfes Unbehagen innehalten, ähnlich wie der flüchtige Gestank von etwas, das unter den Bodendielen vor sich hin fault. Ich ahnte, dass ich selbst meinem ärgsten Feind nicht wünschte, Zeuge der Szenen zu werden, die sich hier gleich abspielten.
Die Kamera war direkt über der einzigen Tür angebracht und gewährte ungehinderte Sicht über die gesamte Länge des Raums. Das Bild, das sie an den Monitor übermittelte, war körnig und kämpfte im schummrigen Licht der einsamen Leuchtstoffröhre um die Darstellung klarer Konturen. Die Ecken lagen im Schatten, doch der Tisch war hell erleuchtet. Das reichte, um den Zugriff zu befehlen, sobald es nötig wurde.
Ich nahm eine Bewegung wahr, sah die Oberkante der Tür aufschwingen. Hastig wählte ich eine Nummer, um das Team zu alarmieren. »Haltet euch bereit!«
Eine Gestalt trat in den Aufnahmebereich. Eine Frau. Nicht die Zielperson. Sie ging an den Tisch, dann drehte sie sich um, sodass sich ihr Gesicht deutlich erkennen ließ. Ich kannte sie.
Was zum Teufel macht sie hier? Warum ist sie nicht zu Hause geblieben?
»Wir haben eine Unschuldige an Punkt X«, erklärte ich. »Ich befehle den Abbruch.«
»Die Mission hat Priorität«, widersprach eine Stimme, die ich nicht kannte. »Abbruch abgelehnt.«
Ein kleines Mädchen erschien auf dem Monitor, es rannte zu der Frau.
»Jetzt sind es zwei Unschuldige, darunter ein Kind. Abbruch! Meine Entscheidung.«
»Die Entscheidung liegt nicht bei Ihnen, sondern bei der Taskforce. Die Mission hat Priorität.«
Das ergab keinen Sinn. Es warteten noch zahllose weitere Gelegenheiten, den Kerl zu schnappen. Die Anwesenheit von Zivilisten drohte die Mission zu einem Fiasko ausarten zu lassen.
Zumindest fiel es unter diesen Umständen schwer, zu verhindern, dass etwas über die Operation an die Öffentlichkeit durchdrang.
»Wer zum Teufel spricht da? Geben Sie mir den Teamchef!«
Das Einzige, was ich hörte, war »Die Mission hat Priorität«, dann das Klicken, mit dem jemand den Hörer auflegte. Ich stellte gerade die Verbindung neu her, da betrat eine dritte Gestalt das Zimmer. Ein Mann, allerdings nicht die Zielperson. Er drehte sich nicht um, trotzdem wusste ich, um wen es sich handelte. Auf dem Gesicht der Frau zeichnete sich Angst ab, das Kind huschte hinter ihren Rücken. Der Mann näherte sich den beiden. Ich sah, dass er einen Knüppel in der Hand hielt.
Das Telefon wurde abgenommen. Ich sagte: »Die Zivilisten stecken in Schwierigkeiten. Execute, execute, execute.«
»Werden sie von der Zielperson bedrängt?«, erkundigte sich die mechanische Stimme. »Ist die Zielperson anwesend?«
»Nein, es ist jemand anders, aber er hegt böse Absichten. Ich spüre es. Geht endlich rein!«
»Die Mission hat Priorität. Wir warten auf die Zielperson.«
Der Mann rammte der Frau den Knüppel in die Magengrube, als halte er ein Schwert in der Hand. Sie krümmte sich.
»Verdammt, schwingen Sie Ihren Arsch da rein, auf der Stelle!«
Die Leitung war tot.
Der Mann stieß den Knüppel schwungvoll nach oben und erwischte die Frau am Kinn. Blut spritzte, der Aufprall verschob ihren Kiefer und spaltete ihn. Grellweiß bohrte sich der Knochen durch das rote Fleisch der Wange.
Ich schrie die flimmernde Darstellung der Szene an, packte den Monitor an den Kanten und wünschte mir verzweifelt, vor Ort zu sein.
Die Frau stürzte rückwärts auf den Tisch, dadurch verlor das Mädchen seinen Schutz. Es duckte sich zu Füßen des Mannes. Tränen liefen ihr übers Gesicht, der Mund öffnete sich zu einem Schrei, den ich nicht hören konnte. Der Mann packte die Kleine am Kopf und hob sie hoch, schaukelte einmal kurz nach links und schwenkte mit voller Wucht nach rechts, um das Mädchen mehrmals mit dem Schädel gegen die Wand zu donnern. Unnatürlich verkrümmt sackte sie zusammen. Der Mann zog ein Messer aus der Jacke und hob es hoch, gut sichtbar für die Kamera. Damit ich es sah. Langsam drehte er sich in Richtung Objektiv …
… schweißgebadet und heftig um Atem ringend wachte ich auf. Im ersten Moment wusste ich gar nicht, wo ich mich befand. Schließlich konnte ich in dem schwachen Licht, das vom Parkplatz eindrang, vage Einzelheiten meines Hotelzimmers ausmachen. Ich bildete mir ein, den Nachhall meiner Stimme wahrzunehmen, und fragte mich, ob ich tatsächlich geschrien hatte. Sobald ich mich aufsetzte, setzte die Übelkeit ein. In der schummrigen Beleuchtung hastete ich zur Toilette und erreichte sie eine Sekunde, bevor mir alles hochkam, was ich in den vergangenen sechs Stunden gegessen hatte.
Als das Würgen nachließ, rollte ich mich neben der Kloschüssel zusammen, noch immer zitternd wegen der Nachwehen des Albtraums.
Der Mann war zurückgekehrt, und jetzt brachte er meine Familie mit.
Ich hätte mir die Aufzeichnung niemals ansehen dürfen.
Der Mord an meiner Frau und meiner Tochter lag inzwischen vier Jahre zurück, und nie hatte ich von dem Verbrechen geträumt. Von dem Mann dagegen oft. Er suchte mich heim wie Freddy Krueger, tauchte unter merkwürdigsten Umständen vor meinem geistigen Auge auf, aber nie zusammen mit meiner Familie. Nie. Ich durfte mich glücklich schätzen, ausschließlich angenehme Träume von ihnen zu haben. Träume, die nach dem Aufwachen zwar ein wehmütiges Gefühl zurückließen, aber mit positivem Unterton. Flüchtige Momente, an die ich mich angestrengt zu erinnern versuchte, die aber trotzdem verblassten wie Nebel in der Morgensonne. Ganz anders als nun dieser Traum. Keine Säure der Welt konnte auslöschen, was er mir in die Seele geätzt hatte, so viel stand fest.
Warum habe ich mir das Video nur angeschaut?
Ich war nach Fayetteville, North Carolina, zurückgekehrt, um in Erfahrung zu bringen, ob die Aufklärung des Verbrechens Fortschritte machte. Seit den Morden tat ich das ungefähr alle drei Monate. Als bewirke allein meine Gegenwart, dass etwas ans Licht kam. Doch das klappte nicht. Der Fall war so kalt wie die Leiche von Jimmy Hoffa, und mittlerweile duldeten die Polizisten meine Anwesenheit gerade noch so. Sie waren freundlich, klar, aber sie wussten, dass es nichts brachte, und begegneten mir zunehmend mit Mitleid.
Diesmal hatte ich beschlossen, mir die Fotos vom Tatort anzuschauen, um festzustellen, ob es einen Hinweis gab, den sie womöglich übersehen hatten. Ich ignorierte damit frühere Warnungen. Vor vier Jahren meinten die Beamten zu mir, die Bilder seien brutal, darum hatte ich bei keinem meiner bisherigen Besuche danach gefragt. Diesmal schon. Und sie behielten recht.
Vor allem hatten die Fotos den Kerl, der mich heimsuchte, zu meiner Familie geführt. Gestatteten ihm uneingeschränkt die Möglichkeit, mich jede Nacht wach zu halten oder im Schlaf zu quälen – eine gesichtslose Masse Bosheit, die mich wohl niemals in Frieden lassen würde.
In all meinen Träumen sah ich ihn immer nur von hinten. Nie drehte er sich um. Nie zeigte er mir sein wahres Ich. Stets begnügte er sich damit, mich zu verhöhnen, so wie heute Nacht mit dem Messer. Tief in meinem Innern bettelte ich darum, dass er sich zeigte. Ein entlegener Winkel der Seele voller Finsternis, die danach lechzte, endlich hervorzubrechen. Die sich nach Linderung sehnte. Ein Teil von mir, der glaubte, dass ich ihn auch töten könnte, wenn ich ihn nur zu Gesicht bekam.
Ein Teil von mir, der sich das verzweifelt wünschte.
1
Gegenwart
Die Ermittlungsbeamtin entdeckte ihren Koffer gleich als ersten auf dem Förderband. Ein Lächeln trat auf ihr Gesicht. Der Flug von Beirut hierher hatte lange gedauert, und jetzt wollte sie einfach nur nach Hause. Wäre ihr bewusst gewesen, wie wenig Zeit ihr noch blieb, hätte sie sich wahrscheinlich gewünscht, ihr Koffer wäre als letzter über das Band gelaufen – oder überhaupt nicht.
In der Nähe des Laufbands stand ein Mann, der ihre Mimik registrierte und angesichts dieser Ironie grinsen musste: Er wusste, dass der Kofferanhänger, der dazu beigetragen hatte, dass sie ihr Gepäck so früh bekam, letztlich für ihren Tod verantwortlich war. Er musste lediglich sicherstellen, dass sie das Teil nicht abriss und in den Müll warf, bevor sie den Flughafen verließ.
Konzentriert beobachtete er, wie sie mit ihrem Koffer im Schlepptau ins Freie ging, wo der verräterische Anhänger im Wind flatterte. In der rechten Hand hielt sie eine Aktentasche, und während ihr Arm vor- und zurückschwang, erhaschte der Mann einen flüchtigen Blick auf die Handschelle, mit der sie am Gelenk befestigt war. Auf diese Tasche hatte er es abgesehen. Und auf die in ihrem Gehirn abgespeicherten Informationen, die er vernichten musste.
Sie verließ das Terminal in Richtung Pendelbus, der die Passagiere zum Bahnhof von Rotterdam brachte, aber sie hätte sich ebenso gut einen Mietwagen nehmen können, um an ihr Ziel zu gelangen. Es war gleichgültig, denn er wusste, wohin sie wollte: nach Leidschendam, wo das Sondertribunal für den Libanon seinen Sitz hatte.
2009 ins Leben gerufen, war diese Institution mit der Untersuchung des Attentats auf den früheren libanesischen Ministerpräsidenten Rafiq Al-Hariri im Jahr 2005 betraut. Angesichts von Gerüchten, dass höchste syrische Regierungskreise und deren Terrorableger, die Hisbollah, bei dem Mord ihre Finger im Spiel hatten, erschütterten massive Proteste das Land und forderten den Abzug der syrischen Besatzungstruppen aus dem Libanon. Man fasste das Ganze unter dem Begriff Zedernrevolution zusammen. Noch im selben Jahr führte sie zum Rückzug der syrischen Besatzungsmacht. Man hätte es dabei bewenden lassen können – Abzug der Syrer und ein paar vage Gerüchte. Doch nun führte das Tribunal eine ausgiebige Untersuchung durch und steckte die Nase in Sachen hinein, die niemanden etwas angingen. Vier Fußsoldaten der Hisbollah standen bereits vor dem Kriegsgericht, und die Ermittlungen weiteten sich zunehmend auf die Führungskreise aus.
Die Frau ermittelte für den Ankläger, und nach langer Vorarbeit war es ihr gelungen, jemanden in gehobener Position zu finden, der reden wollte: einen unzufriedenen, ehemaligen syrischen Geheimagenten, der über Insiderwissen verfügte und noch ein Hühnchen mit jemandem rupfen wollte. Er hatte anderthalb Stunden mit der Ermittlerin gesprochen. Die Hisbollah tat im Vorfeld alles in ihrer Macht Stehende, um das Treffen zu verhindern, allerdings ohne Erfolg. Erst hinterher hatten sie den Mann geschnappt und an ihm ein Exempel statuiert, um andere von dieser Idee abzubringen, die ebenfalls planten, den Mund aufzumachen.
Die Informationen, die die Ermittlerin erhalten hatte, waren äußerst brisant. Da sie wusste, wie weit der Arm der Hisbollah reichte, hatte sie sich dagegen entschieden, den Bericht online zu übermitteln, und ganz bestimmt erörterte sie die Angelegenheit auch nicht über ein Telefonnetz, das von jenen Terroristen betrieben wurde, gegen die sie ermittelte. Von Beirut aus flog sie daher auf direktem Weg zurück zur Geschäftsstelle des Tribunals in den Niederlanden, um persönlich Bericht zu erstatten. Und hier kam der Mann, der sie verfolgte, ins Spiel.
Im Libanon ließ sich ohne Weiteres ein Blutbad unter libanesischen Zivilisten anrichten. Bei der Ermittlerin hingegen musste man behutsam vorgehen. Auf keinen Fall durfte jemand eine Verbindung zwischen ihrem Tod und ihrer Arbeit herstellen. Es musste harmlos wirken.
Anfangs hatte der Mann geplant, sie einfach zu überfallen und ihr die Aktentasche abzunehmen, damit es aussah wie ein zufälliger Raubüberfall. Nachdem er die Gegend erkundet hatte, wurde ihm klar, dass dies nicht funktionierte. Anders als in seiner Heimatstadt Chicago gab es in den Niederlanden nicht so viele Gewaltverbrechen, schon gar nicht mitten am Tag in Leidschendam. Ganz zu schweigen davon, dass er ihr wahrscheinlich die Hand abschneiden musste, um an den Inhalt des Aktenkoffers zu gelangen, was zwangsläufig Fragen aufwarf. Nein, er musste subtiler vorgehen.
Nachdem er der Ermittlerin genug Zeit eingeräumt hatte, um das Flughafengelände zu verlassen, verließ er die Gepäckausgabe und kehrte zurück zu seinem Wagen. Er musste nicht unbedingt vor ihr in ihrer Wohnung in Leidschendam eintreffen – den Empfang hatte er bereits vorbereitet. Aber er wollte das Resultat live miterleben. Üblicherweise nahm sie die Bahn und ging anschließend die Strecke von der Station nach Hause zu Fuß. Das bedeutete, dass sie in drei Etappen reiste: mit dem Flughafenbus zum Bahnhof Rotterdam, per Zug zum Bahnhof Leidschendam, danach blieben noch etwa 400 Meter bis zu ihrer Wohnung. Folgte sie dem normalen Muster, nahm sie sich für den letzten Abschnitt kein Taxi. Er würde früh genug dort sein, um die Früchte seines Werks zu genießen.
Er war ziemlich stolz auf seinen Plan und wünschte sich oft, mit anderen in seinem Metier Erfahrungen austauschen zu können. Sofern es solche Leute überhaupt gab. Bisher war ihm noch niemand über den Weg gelaufen, der seine professionellen Qualitäten teilte. Bloß arrogante Möchtegerns. Er hatte erst vier Missionen durchgeführt, die eine Tötung vorsahen, fand jedoch, dass er ein Händchen dafür besaß. Drei der Aufträge waren tadellos über die Bühne gegangen. Einer hatte in einem absoluten Fiasko geendet, das ihn zwang, den Vereinigten Staaten für immer den Rücken zu kehren. Daraufhin war er beim syrischen Geheimdienst gelandet. Beziehungsweise bei der Hisbollah. Seit Syrien infolge des Arabischen Frühlings von Protesten erschüttert wurde, war er sich nicht mehr so sicher, wer die Rechnungen beglich.
Er plante im Vorfeld alles akribisch, was wesentlich zum Erfolg in seinem neuen Tätigkeitsbereich beitrug, nicht anders als damals bei den United States Navy SEALs, mit denen er im Irak und in Afghanistan gekämpft hatte, was ihm auch die nötigen Vorkenntnisse verschaffte.
In den Niederlanden mochte es kaum Straßenkriminalität geben, dafür besaßen sie jedoch eins im Überfluss: Erdgas. Das Land war der zweitgrößte Exporteur in der EU. So gut wie jedes Haus war ans örtliche Versorgungsnetz angeschlossen.
Es war ein Leichtes gewesen, die Wohnung während der Abwesenheit der Ermittlerin zu präparieren. Die Schwierigkeit bestand darin, den richtigen Zeitpunkt zum Auslösen zu finden. Er musste sicher sein, dass sie zu Hause war, und schnell genug handeln, damit sie die Falle nicht entdeckte, die er vorbereitet hatte. An dieser Stelle kam üblicherweise ein Überwachungsteam ins Spiel.
Auf keinen Fall hatte er jedoch Dritte in die Operation einbeziehen wollen, schon gar keine dunkelhäutigen Hisbollah-Killer, die in dieser Gegend auffielen wie ein bunter Hund. Da er blond und hellhäutig war, konnte er sich quasi unsichtbar überall bewegen, nur verfügte er über keine hiesigen Kontakte, von denen er dasselbe behaupten konnte. Niemanden, der sich unauffällig unter die Leute mischen konnte. Allerdings war ihm ebenso klar, dass eine Observation, die man allein durchzog, zum Scheitern verurteilt war. Damit steckte er gewissermaßen in einer Zwickmühle. Bis er unerwartet auf die Idee mit dem Gepäckanhänger gekommen war.
Die Airline, mit der sie flog, hatte für die Gepäckkontrolle in Radiofrequenz-Identifikation investiert, kurz: RFID. In den Gepäckanhänger, den man beim Einchecken bekam, war ein kleiner Transponder eingebettet. Im Gegensatz zu einem Strichcode musste man ihn nicht extra einscannen. Er ließ sich auch auf wesentlich größere Entfernungen auslesen. Diese Identifizierung per Funk war mittlerweile gängige Praxis in zahlreichen Sparten, von Supermärkten bis zum US-Verteidigungsministerium, denn es handelte sich um eine ebenso simple wie zuverlässige Methode, Waren und Endprodukte zu verfolgen. Mittlerweile setzten zahlreiche Airlines die RFID-Technologie ein, um das Gepäck der Passagiere zu identifizieren und so die gewaltigen Kosten für die Wiederbeschaffung und nachträgliche Kurierauslieferung verloren gegangenen Gepäcks zu minimieren.
Der Anhänger übertrug lediglich den Namen des Besitzers und den Bestimmungsort des Gepäcks. Rings um die Gepäckkontrolle des Flughafens waren an strategischen Stellen entsprechende Lesegeräte positioniert. Als Bedrohung für die Privatsphäre konnte man das beim besten Willen nicht bezeichnen. Es ging lediglich darum, jeden einzelnen Koffer eindeutig seinem Besitzer zuzuordnen. Über RFID konnte man nur die Informationen sammeln, die ohnehin für jeden sichtbar auf dem Anhänger aufgedruckt waren. Wollte man allerdings eine Explosion zu exakt jenem Zeitpunkt auslösen, an dem eine bestimmte Person eine Todeszone betrat, erwies sich ein solcher Anhänger als geradezu ideal. Man benötigte bloß einen leicht abgewandelten Funkempfänger. Das Hauptrisiko bestand darin, dass jemand anderes das Gepäckstück trug. Glücklicherweise reiste die Ermittlerin jedoch allein.
Über seine Hisbollah-Kontakte hatte er herausbekommen, welche RFID-Signatur die Airline der Ermittlerin in Beirut zugewiesen hatte. Diese gab er in ein Lesegerät ein, das er in ihrer Wohnung versteckte, und koppelte es mit dem Zünder. Nun brauchte er sie nicht länger im Auge zu behalten. Früher oder später betrat sie mit ihrem Gepäck das Wohnzimmer – und verbrannte zusammen mit dem kompromittierenden Inhalt ihrer Aktentasche.
Von Rotterdam aus nahm er die A13. 20 Minuten später fuhr er am Sydwendepark in Voorburg vorbei, der direkt an Leidschendam grenzenden Stadt, passierte einen Kreisverkehr, bog links ab und bremste auf einem Parkplatz, der zu einem modernen Wohnkomplex gehörte. Mit einem kurzen Blick in den Rückspiegel vergewisserte er sich, dass er das niedrige eingeschossige Haus der Ermittlerin in der Parallelstraße sehen konnte, jenseits von Grasflächen und Gehwegen. Er machte es sich bequem und wartete.
Nach 30 Minuten wurde er langsam nervös und begann sich zu fragen, ob er nicht vielleicht doch besser für ihre Beschattung gesorgt hätte. Im schlimmsten Fall hatte sie direkt das Tribunal aufgesucht, ohne vorher zu Hause ihr Gepäck abzustellen. Sie umzubringen, nachdem sie ihren Bericht abgeliefert hatte, wäre nutzlos.
Mittlerweile müsste sie längst hier sein.
Er wägte die Alternativen gegeneinander ab, während er mit einem Kühlschrankmagneten spielte, der ein Bild der Ermittlerin mit einem Mann zeigte. Von jeder Mission nahm er sich ein Andenken mit. Diesen Magneten hatte er beim Präparieren der Falle eingesteckt. Er hielt das keineswegs für ungewöhnlich; schließlich war er ja kein Serienmörder oder Hannibal Lecter. Außerdem sollten ihn die Gegenstände nicht an Personen erinnern, sondern schlicht und ergreifend an die jeweilige Mission – ähnlich wie beim Platoon Sergeant in Der Soldat James Ryan, der nach jedem Landungsunternehmen Sand des umkämpften Strandes in eine Dose scharrte. Zumindest redete er sich das ein. Prinzipiell handelte es sich natürlich bei jedem seiner Souvenirs um einen persönlichen Gegenstand des späteren Opfers. Er spähte die Straße in der Hoffnung entlang, einen Blick auf seine Beute zu erhaschen, und wurde mit dem Anblick einer Person belohnt, die etwa 300 Meter entfernt ihr Gepäck über den Bürgersteig schleppte. Er konnte nicht eindeutig sagen, ob es die Zielperson war, aber die Chance, dass sich hier um diese Zeit gleich zwei Leute mit Gepäck abschleppten, hielt er für ziemlich gering. Er lehnte sich im Sitz zurück und wartete. Dabei schielte er erneut in den Rückspiegel, um das Haus im Auge zu behalten, und zuckte zusammen.
Ein Mann war im Begriff, etwas über der Haustür zu befestigen. Der Mann auf dem Kühlschrankmagneten.
Was soll das?
Er blickte aus dem Fenster und sah die Ermittlerin näher kommen. Nur noch eine Frage von ein, zwei Minuten, bis sie den Eingang erreichte.
Er drehte sich vollständig in Richtung Haus um. Der Mann brachte eine Art Transparent über der Tür an, so ähnlich wie die Happy Birthday!-Banner, die es im Supermarkt zu kaufen gab. Die Aufschrift war niederländisch, trotzdem ahnte er, was darauf stand: Willkommen zu Hause.
Shit! Sie hat ihn angerufen, damit er herkommt.
Während der ganzen Zeit, in der er das Anwesen observierte, hatte er nie jemanden zu Gesicht bekommen, der sich um das Haus kümmerte, was nun natürlich einleuchtete, da die Ermittlerin sich ja in Beirut aufgehalten hatte. Er verfluchte sich für seine Dummheit.
Ihr Freund schloss die Tür auf und betrat das Haus. Wenn er ihn weitergehen ließ, würde der andere zwangsläufig auf die Falle stoßen, die er gestellt hatte, und schlug Alarm – bevor der Funkanhänger die Explosion auslöste.
Ohne zu überlegen, stieg der Mörder aus dem Wagen und stürmte zur Tür. Ganz in der Nähe entdeckte er die Zielperson, mittlerweile dicht genug, um Einzelheiten ihres Gesichts zu erkennen. Ihm blieb höchstens eine halbe Minute. Vielleicht eine Minute, wenn er die Tür hinter sich abschloss. Eine Minute, um den Mann umzubringen und durch die Hintertür zu verschwinden, bevor die Ermittlerin sie ungewollt alle in die Luft jagte.
Er trat ein, schlug die Tür zu und schloss ab. Der Freund der Ermittlerin stand vor der Küchentheke am RFID-Empfänger, in der einen Hand einen Beutel voller Rosenblüten, in der anderen eine Flasche Wein. Ihr Freund rief etwas auf Niederländisch, deutete auf den Funkempfänger und sagte erneut etwas. Der Mörder rückte näher, packte ihn am Hinterkopf und schmetterte sein Gesicht mit solcher Wucht auf die Arbeitsplatte, dass der Aufprall ihn eigentlich auf der Stelle hätte umbringen müssen. Zumindest hätte er jede Gegenwehr ersticken müssen. Wie durch ein Wunder kam der Mann jedoch wieder hoch. Das viele Blut in seinem Gesicht nahm ihm zwar die visuelle Orientierung, hielt ihn aber nicht davon ab, aus voller Kehle loszubrüllen und wild um sich zu schlagen.
Der Mörder tänzelte außer Reichweite und schnappte sich eine Vase, während er draußen bereits die Ermittlerin hörte. Mit aller Gewalt schleuderte er sie dem Freund an den Kopf. Da der Gute nichts sah, konnte er das Geschoss auch nicht abwehren. Die Vase zersplitterte auf seinem Nasenrücken und ließ ihn wie einen nassen Sack zu Boden gehen.
Der Mörder vernahm weiteres Geschrei. Als er sich umwandte, stand die Ermittlerin in der Diele. Sie hob ihr Gepäck mit beiden Händen wie eine Waffe, während die Aktentasche an ihrem Handgelenk baumelte. Der Mörder reagierte mit einer instinktiven Abwehrbewegung. Im selben Augenblick registrierte er, welches Schicksal ihm drohte.
Sie wird uns alle umbringen.
Er hatte keine Vorstellung von der genauen Reichweite des Funkempfängers. Jedenfalls schien sie sich nicht bis in die Diele zu erstrecken, immerhin war er ja noch am Leben. Das änderte jedoch nichts daran, dass ihr Gepäck sich in eine weitaus gefährlichere Waffe verwandelte, als von ihr geplant, sobald sie es nach ihm warf.
Er sah, wie sie entschlossen Luft holte und den Koffer anheben wollte. Im selben Sekundenbruchteil spurtete er los. Beim Blick über die Schulter sah er das Gepäckstück wie in Zeitlupe durch die Luft segeln. Der RFID-Anhänger baumelte am Griff. In vollem Lauf knallte er gegen die Glasfront am anderen Ende des Raums, spürte den Schmerz jedoch gar nicht und brach durch die Scheibe. Draußen, im Schutz der Backsteinmauern, schlug er hart auf den Boden. Er hörte die Zündung, die seine so schlau angelegte Todeszone initiierte, ein leises Wump!, gefolgt von einer Feuerfontäne, die durchs Fenster schoss wie die Stichflamme aus einem Gasgrill.
Im ersten Moment wälzte er sich über den Asphalt, um sicherzugehen, dass er nicht in Flammen stand. Anschließend stand er auf und begutachtete den angerichteten Schaden. Die Mauern des Hauses hatten die Explosion abgefangen, in der Wohnung jedoch tobte das reinste Inferno, wie ihm ein Blick durchs Fenster verriet.
Kein Gerichtsmediziner der Welt wird da noch verwertbare Spuren finden.
In weitem Bogen kehrte er zum Wagen zurück, mischte sich unter die zahllosen Schaulustigen, die sich eingefunden hatten, um zu helfen oder bloß zu gaffen. In gemächlichem Tempo ließ er das Viertel hinter sich und fuhr fast zehn Kilometer ziellos durch die Gegend, ehe er anhielt und sein Handy aus der Tasche zog.
»Hier Infidel. Es ist vollbracht.«
2
Colonel Kurt Hale beendete sein Briefing. Er wusste, dass die detaillierten Informationen beinahe zu viel des Guten waren. Die Zielperson, der sie den Spitznamen ›Crusty‹ verpasst hatten, weil die Haare jeden an Krusty, den Clown aus den Simpsons, erinnerten, war schon bei zwei früheren Anlässen auf Omega-Status eingestuft worden. Seither hatte sich nichts daran geändert. Kurts Berichte rieten weiterhin, ihn aus dem Verkehr zu ziehen. Genau genommen war Crusty noch tiefer als bisher in die Finanzierung von Terroranschlägen verstrickt – womöglich nahm er inzwischen sogar eine operative Funktion ein. Das Einzige, was sich nach der Präsidentschaftswahl geändert hatte, war die Zusammensetzung der Aufsichtskommission. Zwar handelte es sich um keinen kompletten Austausch, aber fünf der 13 Mitglieder waren neu. Eigentlich dürfte das keine Rolle spielen – die Information sollte für sich sprechen –, aber Kurt hatte auf die harte Tour gelernt, dass sich in der Hauptstadt viele komplizierte Persönlichkeiten tummelten.
Als Commander der Taskforce – einer Anti-Terror-Organisation, die sich aus den besten Agenten der Spezialeinheiten von Verteidigungsministerium und National Clandestine Service der CIA zusammensetzte – besaß Kurt kein Stimmrecht in der Kommission. Da die Taskforce außerhalb des US-Rechts agierte, waren ihre Einsätze über die Maßen heikel, und seine Position wurde von vielen als Interessenkonflikt aufgefasst. Er war ebenfalls dieser Ansicht, doch in diesem Fall fürchtete er, die Kommission werde ihre Zustimmung verweigern, schlicht aus dem Grund, dass die neuen Gremiumsmitglieder ihrer Sache noch nicht sicher waren. Na ja, weil sie neu waren und aufgrund der Tatsache, dass der letzte Taskforce-Einsatz auf US-Boden stattgefunden hatte, was einem direkten Verstoß gegen ihre Satzung entsprach. Dass die Sache auf den Titelseiten der Zeitungen landete, ließ sich gerade noch verhindern. In diesem Fall hätten sich alle Mitglieder der Kommission im Knast wiedergefunden, die Existenz jedes Einzelnen wäre vernichtet gewesen.
Kurt merkte ihnen an, dass sie sich scheuten, ihm Omega-Freigabe zu erteilen. Zu frisch war noch die Erinnerung an den knappen Ausgang der letzten Mission. Zum Glück hatte Präsident Warren sich entschlossen, an der Sitzung teilzunehmen. Theoretisch besaß seine Stimme nicht mehr Gewicht als die jedes anderen, praktisch dagegen schon. Das wusste jeder, nicht zuletzt, weil er sie alle in die Kommission berufen hatte.
Er weiß, um was es bei dieser Abstimmung geht. Ich lege ihnen eine einfache Sache zur Entscheidung vor. Falls sie hier Nein sagen, können wir den Verein gleich auflösen. Beim nächsten Mal wird es nämlich um deutlich heiklere Angelegenheiten gehen.
Kurt wartete auf die erste Frage. Sie kam von Präsident Warren, der damit die Richtung vorgab. »Es handelt sich also um denselben Kerl, den wir schon vor zwei Jahren gejagt haben, bevor alles nach Bosnien umgeleitet wurde? Um den Mann, der das Geld beschafft?«
»Ja, Sir. Sein operatives Profil ist unverändert. Er hält sich nach wie vor in Tunesien auf und macht weiterhin krumme Geschäfte. Der einzige Unterschied besteht darin, dass er von Tunis nach Sousse umgezogen ist. Das liegt etwas weiter unten an der Küste.«
»Gibt es Änderungen bei unserem Operationsplan?«
»Nein, Sir! Seit drei Jahren stehen wir jetzt auf Sigma. Daran hat sich nichts geändert. Dieselbe Tarnorganisation, identisches Planungsprozedere.«
Die Taskforce bezeichnete jede Phase einer Operation mit unterschiedlichen griechischen Buchstaben, angefangen bei Alpha für die erstmalige Einführung der Einsatzkräfte. Sigma war die letzte Stufe vor Omega – der Freigabe für den Zugriff. Das Ende für einen Terroristen.
»Wie können Sie behaupten, es habe sich nichts geändert? In Tunesien gab es vor zwei Jahren einen Umsturz. Die Regierung wurde entmachtet und durch eine andere ersetzt. So etwas wirkt sich doch bestimmt aus.«
Im ersten Moment war Kurt bestürzt über diesen verbalen Vorstoß. Immerhin hatte er auf die Rückendeckung des Präsidenten gesetzt. Doch dann begriff er, dass der Präsident ihm damit eine perfekte Gelegenheit bot, jeden Grund zur Ablehnung auszuräumen, den die Gremiumsmitglieder eventuell vorbringen konnten.
»Nun ja, das sollte man in Betracht ziehen. Aber um ehrlich zu sein, hat der Regierungswechsel es eher einfacher gemacht, nicht komplizierter. Neben der Schwierigkeit, die Zielperson aufzuspüren, besteht das größte Problem beim Operieren in einem souveränen Staat darin, den Sicherheitsapparat jenes Staates zu unterwandern. In diesem Fall ist er in Auflösung begriffen. Das Volk misstraut allen Angehörigen der früheren Geheimdienste.«
Zaghaft wie ein Grundschüler hob der neue Außenminister, Jonathan Billings, die Hand. Er hatte noch nie an einer Sitzung der Aufsichtskommission teilgenommen, und Kurt sah ihm an, wie eingeschüchtert er war. Wahrscheinlich wünschte er sich, niemals die Verschwiegenheitserklärung unterzeichnet und damit sein Schicksal besiegelt zu haben, falls etwas schiefging. Nach den Differenzen, die Kurt mit dem alten Außenminister gehabt hatte, fürchtete er sich insgeheim auch davor, was der neue gleich von sich gab.
»John«, meinte Präsident Warren, »Sie brauchen nicht die Hand zu heben. Was gibt es?«
»Äh … ich weiß, ich bin neu im Oversight Council, aber mir ist nicht klar, weshalb wir so viel Zeit darauf verschwenden. Die Entscheidung scheint mir doch ziemlich einfach. Es sei denn, ich habe etwas falsch verstanden. Nach allem, was ich eben hörte, ist das doch ein perfektes Einsatzprofil. Oder habe ich etwas falsch verstanden?«
Kurt zwang sich, einen neutralen Gesichtsausdruck zu wahren, wartete darauf, dass jemand aus der Kommission sich dieser Einschätzung anschloss beziehungsweise ihr widersprach. Der Einwand kam vom Verteidigungsminister, einem Mann, der jede jemals durchgeführte Omega-Operation begleitet hatte. Er war kein Gegner, lediglich jemand, der um die Konsequenzen wusste.
»Moment mal«, meinte er. »Ja, es ist das perfekte Profil, aber dasselbe gilt für die Verhaftung ungefähr 1000 anderer Leute. Wir können den Einsatz durchführen, das stelle ich nicht infrage. Aber ist dieser Kerl die Mühe überhaupt noch wert? Nachdem bin Laden tot ist und die alte Führungsspitze der Al-Qaida-Hierarchie ebenfalls? Ist er denn noch Teil des Spiels, oder soll die Taskforce bloß eine alte Rechnung begleichen, weil Sie es nie geschafft haben, ihn zu schnappen?«
»Doch«, entgegnete Kurt, »er ist die Mühe wert. Abgesehen davon, dass er dafür sorgt, dass weiterhin Geld für diverse Terrororganisationen fließt, liegen uns Hinweise vor, wonach er nun auch operativ involviert ist. Wir können es nicht mit Sicherheit sagen, aber anscheinend tritt er als Geldgeber für ein Attentat im Libanon auf, lehnt es jedoch ab, das Geld zu besorgen, solange er nicht selbst das Ziel auswählen darf. Das stellt zwar keine direkte Bedrohung von US-Interessen dar, aber in Anbetracht der Unruhen da drüben kann es nur von Vorteil sein, ihn zeitnah hochzunehmen.«
»Wie verlässlich ist diese Information?«, wollte der CIA-Direktor wissen. »Nach allem, was ich höre, besteht ungefähr die Hälfte unserer Daten bloß aus Mutmaßungen darüber, was aktuell im Nahen Osten vorgeht.«
»Wenn ich ehrlich bin, verhält es sich noch schlimmer«, antwortete Kurt. »Wir haben einen Führungsoffizier im Libanon, der … ich will Ihnen nicht zu nahe treten … über weitaus größere Einblicke verfügt als Ihre Agenten. Trotzdem sind seine Informationen nicht 100-prozentig gesichert. In den nächsten Tagen schicken wir ein Team nach Syrien, um festzustellen, ob wir die Lage dort wieder in den Griff bekommen, aber das stellt in diesem Fall keinen entscheidenden Faktor dar. Vergessen Sie, dass ich das Attentat im Libanon erwähnt habe. Wir müssen Crusty trotzdem loswerden. Er stellt eine Bedrohung für unsere nationalen Interessen dar. Tat er schon immer.«
Der Verteidigungsminister und der CIA-Direktor lehnten sich befriedigt zurück. Präsident Warren ließ abstimmen, und ehe Kurt sich’s versah, war es vorbei. Omega-Freigabe! Für eine Zielperson, der die Taskforce seit ihren Anfängen an den Fersen hing.
Er wollte sich seine Empfindungen nicht vorzeitig anmerken lassen, um die Abstimmung nicht zu beeinflussen, verspürte jedoch eine tiefe persönliche Befriedigung.
Endlich! Am liebsten wäre er auf der Stelle aus dem Saal gerannt, um dem Team unverzüglich Bescheid zu geben.
Präsident Warren unterbrach seine Gedanken. »Okay, kommen wir zum nächsten Punkt. Wer geht nach Syrien, und wann?«
Kurt lächelte. »Pike. Na ja, Pikes Firma.«
»Ich dachte, seine … Mitarbeiter hielten sich in Tunesien auf? Um Crusty hochzunehmen?«
»Ja, das tun sie. Eigentlich hätte es fünf Monate gedauert, ein Visum für Syrien zu bekommen, aber die syrische Regierung drückte es vorzeitig durch. Pike wird nach Syrien gehen, mit Jennifer. Sein Team kommt später nach. Wir dürfen die Gelegenheit nicht verstreichen lassen. Wir haben keine Ahnung, wann die Regierung die Grenzen für uns dichtmacht. Niemand sonst aus den USA kommt da rein, aber bei Pikes Tarnfirma funktioniert es bestens. Die Regierung selbst ist uns also dabei behilflich, ins Land einzudringen.«
»Wann wird er aufbrechen?«
»Äh … so bald wie möglich. Wir haben die Visa erst heute erhalten. Er weiß noch nicht, dass wir ihn losschicken.«
3
Ich hörte die Eingangstür zu unserem Büro. Jennifer! Hastig drückte ich die Tasten, verzweifelt bemüht, den Ego-Shooter zu schließen, den ich gerade spielte, und die langweilige archäologische Forschungsarbeit aufzurufen, mit der ich mich eigentlich beschäftigen sollte. Ich reagierte nicht schnell genug, genau wie vorher schon beim Spielen.
Erst lasse ich mich von einem Haufen 13-Jähriger abziehen, und jetzt tritt mir auch noch Jennifer in den Arsch.
»Was treibst du da? Ist das schon wieder dieses dämliche Ballerspiel?«
Tu ganz unschuldig … sie hat keine Beweise … bloß nichts zugeben.
»Was? Was meinst du? Ich lese. Seit du vorhin weggegangen bist.«
Kopfschüttelnd lehnte Jennifer sich gegen den Türrahmen und musterte mich missbilligend mit ihrer Oberlehrer-Miene. Ich durfte es ihr niemals verraten, weil sie es sonst eiskalt ausnutzte, aber der Blick funktionierte tatsächlich. Ich schämte mich jetzt schon ein bisschen, bevor sie überhaupt den Mund aufmachte.
»Pike, komm schon! Das ist unsere große Chance, an einer richtigen archäologischen Expedition teilzunehmen. Du musst dich mit diesem Zeug auskennen. Da draußen gibt es keine Taskforce, die sich um uns kümmert. Bei dieser Grabung musst du so aussehen und dich so anhören, als wüsstest du genau, was du tust.«
Gemeinsam mit Jennifer betrieb ich eine Tarnfirma, die sich Grolier Recovery Services nannte und als Deckmantel für Taskforce-Aktionen diente. Vordergründig waren wir auf die weltweite Unterstützung archäologischer Ausgrabungen spezialisiert. In Wirklichkeit jedoch verschaffte uns das Unternehmen Zugang zu Gebieten, zu denen wir sonst keinen Zugang gehabt hätten, damit wir uns einen Terroristen schnappen und seinen Kopf auf einen Pfahl spießen konnten. Bislang hatte die Tarnung prima funktioniert. Sie lieferte uns einen glaubhaften Grund, an jeden beliebigen Ort zu reisen, der von historischer Bedeutung war – also so gut wie überallhin auf diesem Planeten, wo man festen Boden unter den Füßen hatte, mitunter sogar unter Wasser.
Der Unterschied bestand darin, dass man uns für diesen Job tatsächlich engagiert hatte. Diesmal kam der Scheck nicht von der Taskforce, auch wenn die Taskforce den Kontakt zum Projekt hergestellt hatte. Jennifer freute sich auf den Trip und konnte es kaum erwarten. Denn tief im Innern war sie eine kleine Stubenhockerin, eine Wissenschaftlerin, hin- und hergerissen zwischen ihrem Dasein als Pflanzen- und Fleischfresserin.
»Jennifer«, sagte ich, »es dauert noch mindestens drei Monate, bis wir fliegen. Die Syrer werden unsere Visa erst genehmigen, wenn sie sich vergewissert haben, dass wir keine geheime James-Bond-Organisation sind. Ich hab noch massig Zeit, mir diesen langweiligen Krempel reinzuziehen.«
Ich sah, wie ihr Blick sich verdüsterte, und mir wurde klar, dass ich mich verplappert hatte.
»Warte … warte … das hab ich ungeschickt formuliert …«
»Langweiliger Krempel? So siehst du das also? Wie wär’s, wenn du es zur Abwechslung einfach mal tust, weil ich dich darum gebeten habe? Ich habe für die Taskforce alles getan, was du von mir verlangt hast. Versau mir das bloß nicht! Alles, was ich von dir verlange, ist, dir einen Text durchzulesen. Es wird dich sogar interessieren, das versprech ich dir. Jede Menge Tote und Blutvergießen. Genau das Richtige für dich.«
Eine amerikanische Universität hatte uns bei der Wiederaufnahme archäologischer Arbeiten an einem Ort namens Hamoukar in Nordsyrien um Unterstützung gebeten, unmittelbar an der Grenze zum Irak. Die Ausgrabungsstätte war 1999 entdeckt worden, seither hatten jedes Jahr Grabungen stattgefunden. Aufgrund der Unruhen in Syrien hatte man 2011 die Arbeit eingestellt. Nun wollte die Universität weitermachen und hatte uns angeheuert, um alles zu organisieren und für die Sicherheit vor Ort zu sorgen.
Bei dem Fund handelte es sich anscheinend um eine der ältesten jemals entdeckten Städte – ein wahres Sammelbecken historischer Artefakte. Mir lief es bei dem Gedanken heiß und kalt über den Rücken. Ich konnte es kaum erwarten, endlich einen Haufen zerbrochener Tonscherben und alter Ziegelsteine zu inspizieren. Okay, ich schätze, das kommt nicht besonders überzeugend rüber. Aber etwas Cooles hat diese uralte Stadt schon an sich. Immerhin schien sie im ersten überlieferten Krieg der Geschichte zerstört worden zu sein.
Ich breitete die Hände aus, bemüht, den Abend zu retten. »Okay, okay! Ich werd’s lesen, versprochen! Ich versteh ja, dass es wichtig ist. Gehen wir heute Abend trotzdem aus? Oder habe ich jetzt Hausarrest?«
Für einen Moment kniff sie die Augen zusammen. »Vielleicht sollte ich dich einem Test unterziehen. Wenn du ihn bestehst, gehen wir aus.«
Ich lächelte. »Schieß los! Ich weiß mehr, als du glaubst.«
»Oh, bitte. Du denkst dir doch bloß wieder was aus und behauptest dann, ich wüsste es nicht. Also gut, gehen wir! Wohin willst du?«
Heute war der erste Jahrestag unserer Firmengründung. Wir hatten eine Münze geworfen, um zu entscheiden, wer das Lokal aussuchen durfte. Ich hatte gewonnen. Das hieß, wir gingen auf keinen Fall in ein Weinlokal.
»Blind Tiger. In der Broad Street.«
»Haben die auch was anderes als Hamburger?«
»Klar. Es wird dir gefallen. Versprochen!«
4
Ich setzte Jennifer vor dem Pub ab und fand anderthalb Blocks entfernt in der Church Street einen Parkplatz. Das Wetter in Charleston war perfekt. Eine warme Brise trug den schwachen Geruch nach Schlick mit sich, den man eher ahnte, als ihn wirklich wahrzunehmen. Ich kam an einer Hochzeitsgesellschaft vorbei, und mein kurzer Fußmarsch wurde von einer Gruppe Halbstarker vermiest, die sich von den Feiernden löste und mir die Broad Street entlang folgte. Wie der Zufall es wollte, betraten sie den Laden direkt hinter mir. Anscheinend machte es ihnen mehr Spaß, für Alkohol zu bezahlen, als umsonst zu trinken.
Ich ließ meinen Blick durch den Schankraum schweifen, entdeckte jedoch keine Spur von Jennifer. Also ging ich raus in den Biergarten. An einem Tisch im rückwärtigen Bereich der Terrasse entdeckte ich sie, vor sich zwei frisch gezapfte Guinness. Daran hatte ich nichts auszusetzen.
Ich rückte mir einen Stuhl zurecht. »Das Bier hast du schon mal gut ausgesucht. Sitz ich am richtigen Tisch?«
Sie grinste. »Ich halte mein Wort. Du hast die Wette gewonnen, also ist das Bier für dich.«
Langsam schob sie ihre Hand über den Tisch. »Wie war letzte Nacht?«
Mir war klar, weshalb sie fragte. Es machte mich ein bisschen verlegen, dass sie nachhakte.
»Gut. Er ist nicht gekommen.«
Jennifer wusste genau, wen ich meinte. Sie wusste, was meiner Familie zugestoßen war, und bei meiner Rückkehr nach Charleston vor zwei Monaten hatte ich ihr wegen meines Traums das Herz ausgeschüttet. Seither war mir der Kerl, der mich in meinen Albträumen heimsuchte, ein paarmal erschienen, aber nur ein einziges Mal zusammen mit meiner Familie. Jennifer lag mir jeden Tag in den Ohren deshalb, und ich war mir sicher, dass sie mir eine von diesen Psychogeschwätz-Therapien empfehlen wollte, falls es noch mal passierte. Sie musterte mich, als wollte sie mein Bewusstsein nach einer Lüge abscannen. Anscheinend hielt sie mich für eine Pussy, die ihre Gefühle in einer Selbsthilfegruppe auskotzen musste. Das machte mich stinksauer.
»Lass das Thema. Du verdirbst uns sonst noch den Abend. Können wir über was anderes reden?«
Sie betrachtete mich einen Moment mit zusammengekniffenen Augen. Ich hielt ihrem Blick stand, bis sie den Kopf schüttelte. Sie hielt ihr Handy hoch. »Unsere Kontaktperson an der Uni hat angerufen.« Mit anderen Worten: jemand von der Taskforce. »Man hat unsere Visa kurzfristig genehmigt. Wir können aufbrechen, sobald wir bereit sind.«
Ehe ich etwas erwidern konnte, knallte einer der betrunkenen Halbstarken von der Hochzeitsfeier gegen meine Stuhllehne und stieß mich nach vorn. Ich wirbelte herum und sah ihn mit erhobenen Händen vor mir stehen.
»Schuldigung. Wollt ich nicht.«
Seine vier Kumpels und die beiden Frauen, die bei ihnen standen, lachten sich halb tot, während sie aus für die Hochzeitsfeier dekorierten Plastikbechern tranken. Ich spürte, wie Jennifer mich am Handgelenk packte, um meine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken.
»Lass es. Die machen doch bloß Spaß.«
Ich sagte dem Typen, es sei kein Problem, und lehnte mich entspannt zurück. »Was wollte Kurt?«
»Wie es aussieht, ist die syrische Regierung ganz wild darauf, dass die Grabungen fortgesetzt werden. Das soll der ganzen Welt beweisen, dass sie wieder zur Normalität zurückkehren. Das Kulturministerium hat die Visa durchgedrückt. Die Universität ist zwar noch nicht so weit, jemanden loszuschicken, aber sie wollen, dass wir rüberfliegen und die Ausgrabungsstätte in Augenschein nehmen. Wenn wir sagen, es ist okay, rücken sie ebenfalls an.«
Eine Erkundung. Ganz recht. Die Feiglinge haben Angst. Kurt muss sich über die syrische Regierung doch kaputtlachen, dass sie die Taskforce auch noch dabei unterstützt, in ihr Land einzudringen.
»Was ist mit Knuckles und den Männern? Sie sollten uns doch begleiten.«
Bevor sie mir eine Antwort geben konnte, tauchte ein weiterer betrunkener Halbstarker leicht schwankend vor unserem Tisch auf.
»Hey, ich möchte mich für meinen Freund hier entschuldigen. Ich geb euch ein Bier aus.«
»Schon gut«, lächelte ich ihn an. »Alles in Ordnung. Danke.«
»Aber ich will euch einen ausgeben. Wirklich!« Damit beugte er sich vor und verschüttete das Bier aus seinem lächerlichen rosa Becher auf unseren Tisch.
Ich stand auf. »Ich sagte, es ist alles in Ordnung. Bitte lass uns in Ruhe.«
Mein Ton war freundlich, mein wütender Blick dagegen nicht. Jennifer begriff, dass ich ihn damit herausforderte, und trat zwischen uns. Sie blickte mich eindringlich an.
»Lass uns woandershin gehen.«
Warum, zum Teufel, sollen wir jetzt verschwinden? Ich dachte darüber nach. Über den Ärger, der sich sonst entwickelte. Über unsere Reise, die auf einmal Beachtung finden würde, über die ungewollte Aufmerksamkeit, die ich auf uns lenkte, wenn ich den Boden mit diesen fünf Arschlöchern hier aufwischte. Und darüber, dass Jennifer mich gebeten hatte, ruhig zu bleiben – was weitaus mehr zählte als alles andere zusammen.
»In Ordnung. Diesmal wählst du das Lokal aus, aber es muss in der Nähe sein.«
Sie nahm meine Hand und lotste mich durch die Gruppe der betrunkenen Hochzeitsgäste, die sich um uns scharten. Wir hatten sie gerade hinter uns gelassen, da streckte einer der Männer den Arm aus, kniff Jennifer in den Hintern und zog sich kichernd in den Schutz der Horde zurück.
Was für eine Unverschämtheit! Ich konnte es nicht fassen. Jennifer und ich wussten immer noch nicht recht, woran wir miteinander waren. Bloß Geschäftspartner, Freunde oder doch mehr? Eins jedoch stand fest: Unsere Beziehung war zu weit fortgeschritten, als dass ich es zuließ, dass jemand so mit ihr umsprang. Ich bahnte mir einen Weg durch die Menge, schnappte den Kerl am Kragen und bereitete mich darauf vor, ihn in Stücke zu reißen. Bevor ich dazu kam, war Jennifer bei uns.
»Pike! Nicht! Das ist es nicht wert. Lass gut sein. Er ist betrunken.«
Ich blickte dem Kerl ins Gesicht. »Du hast verdammtes Glück. Wenn du dich jetzt entschuldigst, kannst du heute Abend noch jede Menge Spaß haben.«
Seine Freunde drängten sich um uns. Jennifer hatte bereits mitbekommen, wohin derartige Situationen führten. Sie zog mich hinter sich her. »Ich brauch keine Entschuldigung. Komm schon. Lass uns gehen!«
Ich zögerte, dann stieß ich den Kerl zurück, unterdrückte meine Wut und die Scham darüber, einfach so wegzulaufen. Sicher glaubten sie jetzt, ich hätte Angst vor ihnen, weil sie so viele waren. Sie glaubten, sie hätten gewonnen. Ohne ein Wort zu verlieren, wandte ich mich ab und ging. Abermals nahm Jennifer meine Hand. »Danke«, grinste sie. »Du wirst immer besser darin, dich bei solchen Idioten im Griff zu behalten.«
Ihr Lächeln nahm meiner Demütigung den Stachel. Ich setzte gerade zu einer Antwort an, als schon wieder einer der Betrunkenen nach Jennifers Hintern grapschte. Das Resultat war nicht ganz das, was er erwartet hatte. Ehe er seinen Arm zurückziehen und den Rückzug antreten konnte, nahm Jennifer ihn in einen Hebelgriff, sodass er ihr ausgeliefert war. Sie fegte ihm die Beine weg, und er knallte hart auf den Boden, prellte sich dabei den Schädel. Sie folgte seiner Bewegung, drehte sich und überdehnte dabei den Arm des Gegners, ihre Beine über seinen Körper gestreckt. Vor Schmerz fing er an zu plärren wie ein kleines Kind.
Wer von uns muss sich jetzt beherrschen?
Ich hörte die Brautjungfern kreischen, als sie sahen, was Jennifer veranstaltete. Wahrscheinlich fragten sie sich, ob sie so etwas auch lernen konnten. Eine von ihnen holte das Handy heraus und wählte eine Nummer.
Das Problem bei Jennifers Haltegriff bestand darin, dass sie sich nicht mehr wehren konnte, ohne den Kerl am Boden loszulassen. Allerdings wusste sie auch, dass das gar nicht nötig war.
»Pike!«, rief sie, als einer der Kerle sie an den Haaren ziehen wollte. Er erwischte eine Strähne, ehe ich einen perfekten Aufwärtshaken platzierte. Seine Hüfte war leicht nach vorn gebeugt, das Kinn vorgestreckt. Ich spürte, wie sein Kiefer zuklappte, während der Kopf zurückgeschleudert wurde. Bewusstlos sackte er zusammen.
Ich wirbelte herum und stierte den Rest der Versammlung an. In meinem Rücken mühte sich Jennifer mit ihrem Gegner ab.
»Will’s noch einer von euch probieren?«
Die Frauen standen mit offenem Mund da. Aber die Männer merkten, dass sie sich besser nicht mit uns angelegt hätten, das sah man. Selbst im Suff begriffen sie, dass ihnen mächtig Ärger drohte. Allesamt beäugten sie etwas Interessantes auf dem Boden oder in der Luft. Sie blickten überallhin, nur nicht zu mir.
Aus dem Augenwinkel sah ich Blaulicht aufblitzen. Anscheinend hatte die Brautjungfer die Bullen alarmiert. Wir müssen weg.
Ich klatschte Jennifer ab und rief: »Zeit, zu verschwinden!«
Sie ließ den Arm ihres Opfers los, und ich zog sie mit einem Ruck auf die Beine. »Vorn können wir nicht raus.«
Jennifer blickte zu der drei Meter hohen Backsteinmauer, die den Biergarten am hinteren Ende abschloss, und spurtete los.
Großartig … jetzt muss ich klettern wie ein Äffchen, damit die Cops mich nicht kriegen. Total würdelos.
Ich sprintete hinter ihr her, und gleichzeitig erreichten wir die Mauer. Während ich mich von einem Tisch abstieß, rannte sie einfach die Wand hoch. Wir landeten auf dem dahinter liegenden Parkplatz und hasteten weiter. Dabei lachte Jennifer wie ein Kind, wenn es Autos mit Wasserbomben bewirft.
Als wir über die Ravenel Bridge zurück nach Mount Pleasant fuhren, meinte ich: »Du sagst dauernd, ich soll aufpassen, dass ich nicht die Kontrolle verliere. Aber was zum Teufel war das bei dir gerade?«
Erst wirkte sie ein bisschen verlegen, dann brauste sie auf: »Was zu viel ist, ist zu viel. Ich hab versucht, ihm nicht wehzutun. Hättest du es getan, würd er jetzt im Krankenhaus liegen.«
Sie strengte sich an, ein ernstes Gesicht zu machen, konnte sich ein Grinsen jedoch nicht verkneifen.
»Hm, und was hattest du vor, nachdem du ihn in deinem Hebelgriff hattest? Mit all den anderen Kerlen, die noch dabei waren?«
Sie erwiderte nichts darauf, weil wir beide die Antwort kannten. Sie hatte gewusst, dass ich eingriff.
»Hör zu, für mich ist es okay. Diese Pisser hatten es verdient. Aber ich hoffe, du hast deine Lektion gelernt. Solche Sachen darfst du nicht veranstalten.«
»Was? Genau das predige ich doch dir andauernd.«
»Nein, nein, ich mein es anders. Nicht weil ich es für falsch halte, sondern weil du eine Frau bist. Ich kann den ganzen Tag rumlaufen und Leuten in den Hintern treten, ohne dass es jemanden wundert.«
Ich merkte, dass sie das auf die Palme brachte, und redete rasch weiter: »Es mag chauvinistisch klingen, aber so ist es nun mal. Sollte diese kleine Rauferei sich rumsprechen, werden die Leute sich fragen, wie es kommt, dass eine schmächtige Anthropologin jemanden in die Knie zwingt, der doppelt so groß ist wie sie. Du kannst das, klar, aber du musst es geheim halten, sonst ahnt jemand, dass hinter unserer harmlosen Fassade mehr steckt. Tut mir leid, aber so ist es nun mal.«
Ich rechnete damit, dass sie gleich explodierte. Stattdessen dachte sie darüber nach, was ich gerade gesagt hatte.
Ich beschloss, sie in Ruhe zu lassen.
»Hey, letzten Endes bin ich froh, dass du dir nicht alles gefallen lässt und auch mal in die Luft gehst. Ich hab mich schon gefragt, ob man dir erst eine Knarre an den Kopf halten muss, bevor du anfängst, dich zu wehren.«
Ihr Grinsen kehrte zurück und ich wusste, dass das Thema damit erledigt war. Sie war um eine Erfahrung reicher.
»Du wolltest mir vorhin noch etwas über Knuckles sagen. Kommt er jetzt mit oder nicht?«
»Nein. Wie’s aussieht, hat er alle Hände voll zu tun.«
5
Wie ein Backofen reflektierte der Asphalt die Hitze. Knuckles rann der Schweiß in Strömen übers Gesicht. Alle paar Sekunden musste er sich die Nase abwischen, damit die salzigen Tropfen nicht auf das Display in seinem Schoß fielen. So langsam fing er an, sich zu fragen, wie lange die empfindliche Ausrüstung diese Bullenhitze überhaupt mitmachte. Immerhin handelte es sich überwiegend um Spezialanfertigungen – ohne die militärischen Spezifikationen, die solche Geräte, nun ja, militärisch aussehen ließen.
Die Taskforce gibt zig Millionen für Equipment aus, und ich sitz hier in einem Lieferwagen ohne Klimaanlage. Nicht aufzufallen ist eine Sache, aber das hier ist lächerlich. Das zahl ich Johnny heim.
Johnny war der Chef der Einsatzkräfte, die Knuckles ablöste, darum koordinierte er auch alle Aktivposten vor Ort. Nicht dass Knuckles diese Aufgabe nicht im Schlaf erledigen konnte. Seit fast acht Jahren hielt er sich sporadisch in Tunesien auf, um Jagd auf Crusty zu machen, und wartete ungeduldig auf die Omega-Freigabe. Wenn er ehrlich zu sich selbst war, langweilten ihn die turnusmäßigen Einsätze längst. Nur ein einziges Mal kam ein Hauch von Abenteuer auf, bei Crustys Umzug von der Hauptstadt Tunis nach Sousse, weiter unten an der Küste. Er entschloss sich infolge der Unruhen dazu, die während der anfänglichen Protestserie des Arabischen Frühlings zum Sturz der Regierung führten. Crusty wusste zwar nichts davon, aber sein Ortswechsel kam der Taskforce für ihre Tarnung sehr gelegen. Mit seinen Bemühungen, für die neue Regierung anonym zu bleiben, ganz gleich, wer die Macht übernahm, spielte er ihnen ungewollt in die Hände.
Vor ein paar Jahren hatte Knuckles tatsächlich mal Omega-Befugnis erhalten – auf der Stelle auszuführen, alles war bereit –, doch dann wurde er für eine andere Mission angefordert und musste den Terroristen einmal mehr davonkommen lassen. So langsam begann er zu glauben, dass sie Crusty niemals kriegen würden. Dass er wohl einen Glücksbringer habe, der ihm half, durch das Netz zu schlüpfen, das die Vereinigten Staaten auswarfen, selbst wenn er vor aller Augen herumspazierte. Vor drei Tagen war Knuckles mit seinem Team nach Sousse verlegt worden, und noch während er mit Johnnys Team die Übergabe regelte und sich auf einen weiteren Einsatz vorbereitete, um den Kerl einzukassieren, hatte sie Colonel Hales legendärer Omega-Anruf erreicht.
Der Bluetooth-Kopfhörer in seinem Ohr piepste, eine aufgrund der Audiokomprimierung steril klingende Stimme meldete sich: »Knuckles, hier ist Decoy. Wir sind drin.«
»Na, dann los … Break, Break, Johnny, behaltet ihr Crusty im Auge?«
»Er ist nach wie vor im Büro. Keine Probleme.«
Lieutenant Colonel Blaine Alexander, Einsatzleiter der Omega-Operationen, hatte beschlossen, dass erst noch weitere Informationen gesammelt werden sollten, ehe sie Crusty hochnahmen. Knuckles war dagegen gewesen. Er wollte die Mission hinter sich bringen und dann zusehen, dass er aus Tunesien rauskam. Doch es gab Gerüchte über einen Mordanschlag. Zwar könnte ein Verhör unschätzbare Informationen zutage fördern, aber es gab auch die Option, Crusty einfach noch ein paar Tage lang zu beobachten. Abzuwarten, was er sagte, mit wem er sprach. Also fiel die Entscheidung, einige versteckte Kameras in seiner Wohnung zu platzieren, ein Back-up seiner Festplatte am Rechner zu ziehen und alles zu verwanzen. Sollte nichts dabei herauskommen, konnten sie ihn immer noch verhaften.
Knuckles fand an Blaines Logik nichts auszusetzen, zumal Crusty ihnen seit fast zehn Jahren ständig durch die Lappen ging. Vernehmungen waren schön und gut, Crusty würde in den Genuss einer ganzen Reihe davon kommen. Aber man konnte nie wissen, ob der Verdächtige einen nicht einfach an der Nase herumführte oder einem glatte Lügen zum Selbstschutz auftischte. Was hatte Blaine noch gleich über die Kameras gesagt? »Einauge lügt nicht.«
Noch ein paar Tage werden nicht schaden … falls ich vorher nicht schmelze vor lauter Hitze.
Er blickte auf die Armbanduhr und funkte Johnny erneut an, weil er sich wunderte, weshalb Crusty ausgerechnet heute sein gewohntes Muster durchbrach.
»Johnny, Knuckles hier, wie steht’s mit ihm? Er hätte doch vor zehn Minuten aus dem Büro kommen müssen.«
»Immer mit der Ruhe! Ich hab das Gebäude abgeriegelt, und er hat einen Peilsender am Moped. Er ist noch drin. Sobald sich was tut, meld ich mich.«
Knuckles stockte einen Moment. Am liebsten hätte er Johnny daran erinnert, wer hier draußen vor Ort das Sagen hatte. Doch er hielt sich an die Vorschriften.
»Roger. Ich bleib auf Empfang.«
Johnnys Ausspruch ärgerte ihn. Den leisen Vorwurf, der in »Immer mit der Ruhe« mitschwang, empfand er als Schlag ins Gesicht. Er wog umso schwerer, weil jeder im Funknetz wusste, dass er sich in den letzten acht Monaten einer Physiotherapie hatte unterziehen müssen – und zwar aufgrund einer furchtbaren Verletzung, die er bei einem ganz ähnlichen Einsatz erlitten hatte. Dahinter stand die unausgesprochene Frage, ob er überhaupt noch einsatztauglich war.
Als würd ich plötzlich ’ne Panikattacke oder so was kriegen.
Eigentlich sollte Johnnys Team schon auf dem Weg nach Hause sein, doch da Blaine die ursprüngliche Mission erweitert hatte, waren sie länger geblieben. Ihre einzige Aufgabe bestand darin, Crusty im Auge zu behalten, während Knuckles’ Team den Einbruch erledigte. Es leuchtete ein, immerhin waren Johnnys Männer mit den jüngsten Verhaltensmustern der Zielperson vertraut, trotzdem nagte der Spruch an ihm.
Ein Knistern im Headset holte ihn wieder zum Einsatz zurück. »Kameras und Mikros sind installiert. Erstelle jetzt ein Abbild der Festplatte.«
»Roger. Bei der Zielperson tut sich nichts. Ihr habt massig Zeit.«
»Crusty ist unterwegs«, fiel Johnny ihm ins Wort. »Ich bekomm ein Signal vom Moped.«
Was?
»Sag das noch mal! Das Moped bewegt sich? Wer sollte im Büro Bescheid geben? Wurde er beim Verlassen des Gebäudes eindeutig identifiziert?«
»Äh … nein. Keine eindeutige Identifikation. Aber das Moped fährt gerade los. Ich hab das Peilsignal. Ich setz jemanden darauf an. Wir werden bald Sichtkontakt haben.«
»Wie konnte er rauskommen, ohne dass du Alarm ausgelöst hast?«
Knuckles erhielt keine Antwort. Ihm war klar, dass jemand Mist gebaut hatte, er sah allerdings keinen Grund, weiter darauf herumzuhacken, sondern wartete einfach ab. Von seiner Position aus konnte er eingreifen, sofern es nötig wurde.
Immer noch Zeit genug. Lass es einfach laufen.
Knuckles funkte Blaine in der Einsatzzentrale an, brachte ihn auf den neuesten Stand und teilte mit, dass sie in Bewegung waren.
Retro, der Agent, der ihn begleitete, analysierte die Spur des Peilsenders. »Er folgt seinem üblichen Bewegungsmuster. Damit gibt es keinerlei Probleme, aber wie zum Teufel ist er aus dem Gebäude gekommen, ohne dass Johnny es gemerkt hat? Da ist was nicht ganz koscher.«
»Ich habe keine Ahnung, und diesem technischen Überwachungskram trau ich nicht. Alles, was wir wissen, ist, dass sein Moped in Bewegung ist. Keine Ahnung, ob er draufsitzt oder nicht.« Knuckles überlegte kurz. »Wir sind trotzdem noch im Zeitplan. Er ist entweder im Gebäude oder sitzt auf seinem Moped. Wir haben eine Ortung, demnach braucht er noch 20 Minuten, bis er zu Hause ist.«
Knuckles war im Begriff, Decoy anzufunken, als dieser ihm zuvorkam. »Wir haben einen Eindringling. Ich wiederhole: Wir haben einen Eindringling.«
Was zur Hölle …? In der ganzen Zeit, in der sie Crusty beschattet hatten, hatte er seine Wohnung stets allein aufgesucht.
»Sag das noch mal!«
Decoys Atem ging stoßweise, während er irgendwohin rannte – wohin, wusste Knuckles nicht. »Seine Freundin hat gerade das Haus betreten. Wir sind unterwegs aufs Dach. Die Kameras sind über WLAN einsatzbereit. Sie ist unten im Erdgeschoss und sucht etwas. Ich hab keine Ahnung, was. Hoffentlich nicht uns.«
»Lasst euch bloß nicht entdecken. Verschwindet!«
Wenige Sekunden später meldete Decoy sich erneut. Sein Atem hatte sich ein wenig beruhigt. »Sie packt. Sie hat ein paar Taschen dabei und stopft Sachen rein.«
»Was soll das heißen? Packt sie seine Klamotten? Wie verhält sie sich? Packt sie für einen Wochenendausflug mit ihrem Freund oder flieht sie vor dem Gesetz?«
»Es ist eindeutig eine Flucht. Sie stopft das Zeug rein, als ob gleich jemand die Tür eintritt. Ausschließlich seine Sachen. Da ist kein Weiberkram dabei. Jetzt ist sie im ersten Stock und reißt den Laptop aus der Dockingstation.«
Knuckles dachte an den Auftrag. »Hast du die Festplatte kopiert?«
»Keine Zeit! Sie kam rein, bevor wir fertig waren.«
Es dauerte einen Augenblick, bis Knuckles begriff, was das bedeutete. Er weiß, dass wir ihm auf den Fersen sind. Er haut ab.
Er schaltete zu Blaine, gab einen Lagebericht durch und erhielt die Freigabe für einen Notzugriff auf eine flüchtige Zielperson. Es war riskant, weil sie nicht alles genauestens vorbereitet hatten. Aber immerhin kannten sie die Strecke, die er für gewöhnlich benutzte.
Falls notwendig, konnte Knuckles von seinem Standort aus eingreifen. Das einzige Problem bestand darin, dass nun Crusty die Zone für den Zugriff bestimmte. Keineswegs optimal.
Retro übermittelte Knuckles die Position des Peilsenders. Er war nur ein paar Blocks entfernt, auf einer Straße, die zum Highway P12 führte. Immer noch innerhalb des Wohngebiets, in dem die Straßen kaum mehr als Gassen waren; schmale Bänder, die sich zwischen Häuserwänden ziellos hinzogen.
Wir müssen ihn schnappen, bevor er die Durchgangsstraße erreicht.
Knuckles trat aufs Gaspedal und riss in der engen Straße das Lenkrad des Vans herum, ohne auf das Hupen des Wagens hinter sich zu achten. Er ließ das Gefährt über die Bordsteinkante holpern, um zu wenden.
»Retro, gib mir seine genaue Position durch!«
»Zwei Blocks hinter uns, im Moment auf einer einspurigen Straße. Wenn du links abbiegst, kommst du direkt hinter ihm raus. Was hast du vor?«
Knuckles überlegte einen Augenblick, während er wie ein Verrückter weiterraste. »Ich werd ihm mit dem Van das Hinterteil anstupsen. Sollte jemand auf der Straße sein, lassen wir ihn ziehen.«
»Die Autos sind nicht unsere einzige Gefahr. Man kann nicht wissen, wer von den Häusern aus zusieht. Bist du sicher?«
»Nein. Aber er ist auf der Flucht. Das bedeutet, wir sind aufgeflogen. Allein schon dafür müssen wir ihn am Arsch kriegen.«
Sie bogen nach links ab und fanden sich in einer engen Einbahnstraße wieder, gerade breit genug für den Van. Auf dem holprigen Kopfsteinpflaster wurden sie so stark durchgerüttelt, dass Knuckles die Zähne aufeinanderschlugen. Vor ihnen befand sich das Moped. Der Fahrer hatte eine Stirnglatze, einen zerzausten Haarkranz, der im Wind flatterte, und ein Bluetooth-Headset im Ohr.
Crusty.
Knuckles blickte die Straße entlang und sah nichts als hin und wieder eine Mülltonne. Weder Fahrzeuge noch Fußgänger. Langsam bewegte er den Van vorwärts. »Pass nach hinten auf! Ist da irgendwas?«
»Nichts, was ich sehen könnte«, gab Retro zurück. »Aber das muss nichts heißen.«
»Na ja, für den Job wird es reichen.«
Knuckles trat das Gaspedal durch, kam dem Moped immer näher. Er brachte die Schnauze des Vans neben das Hinterrad, schwenkte behutsam seitwärts, gerade fest genug, um den Reifen mit der Stoßstange sacht zu berühren. Bei dem Kontakt geriet Crusty in Panik und riss in einer Überreaktion den Lenker herum. Das Moped holperte über einen Müllhaufen. Crusty zog die Bremse, so fest er konnte, und das Vorderrad blockierte. Das Moped rutschte seitlich weg, der Terrorist wurde aus dem Sattel geschleudert. Mitsamt Maschine schlitterte er die Straße entlang und kam gut zehn Meter vor dem Van zum Stillstand.
Retro war, den Taser im Anschlag, bereits draußen, ehe das Kleinkraftrad zum Stillstand gelangte. Er erreichte den Kerl in dem Augenblick, als Knuckles mit offener Schiebetür neben ihm anhielt und wartete.
Retro schleuderte den Kerl in den Lieferwagen, warf die Tür hinter sich ins Schloss und bedachte Knuckles mit einem verblüfften Blick. Dieser trat aufs Gas. Er wollte einfach bloß weg von hier. Ihm war richtig schlecht.
Er kontaktierte Blaine in der Einsatzzentrale.
»Wir haben uns das Moped geschnappt. Aber der Fahrer ist nicht Crusty.«
6
Sein richtiger Name lautete Abdul Rahman, doch seit Jahren hatte den niemand mehr in den Mund genommen. Manchmal, wenn er von Dunkelheit umgeben, die eine einsame Kerze nur dürftig erhellte, direkt neben den Überresten des Flüchtlingslagers Nahr Al-Bared auf der harten Pritsche lag, sprach er ihn wieder und wieder laut aus, wie um sich zu beweisen, dass er noch existierte.
Man kannte ihn unter vielen Namen. So vielen, dass es selbst ihm schwerfiel, sich zu merken, welchen er für den jeweiligen Auftrag benutzte. Besonderes Vergnügen bereitete es ihm, dass die libanesischen Behörden und die zionistischen Hunde in Israel glaubten, sie seien vier oder fünf unterschiedlichen Männern auf der Spur.
Zu einer anderen Zeit, an einem anderen Ort, wäre aus ihm ein gebildeter Mann geworden. Ein Gelehrter vielleicht. Oder ein Ingenieur. Auf jeden Fall erweckte er äußerlich diesen Eindruck. Er war nur 1,63 groß, schmächtig gebaut und sah so schlecht, dass man seine Augen durch die dicken Brillengläser nur verzerrt wahrnahm, wenn man ihn von vorn betrachtete.