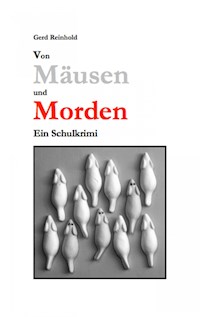
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Ein Mitglied der Hamburger Schulinspektion wird brutal ermordet. An der Aufklärung dieser Tat beteiligt sich neben der Hamburger Mordkommission ein Studienrat, der das Opfer kannte und dessen Sohn unterrichtet. Zudem ist er mit einer Kriminalhauptkommissarin der Mordkommission verheiratet, so dass es zu gegenseitigem Informationsaustausch sowie zur Unterstützung und Hilfestellung kommt. Die Polizei geht aufgrund bestimmter Indizien zunächst von einem Raubüberfall mit Todesfolge aus, wohingegen der ermittelnde Lehrer sehr bald als Motiv für den Mord den Umstand voraussetzt, dass das Opfer sowohl beruflich als auch familiär außergewöhnlich verhasst war und nur in den sogenannten besseren Kreisen der Hansestadt Anerkennung und Rückhalt gefunden hatte. Als Leserin oder Leser verfolgt man parallel zu dem typischen Alltag des Lehrers ("dem alltäglichen Wahnsinn") dessen Bemühungen zur Aufklärung des Mordes, denen jedoch anfänglich trotz der Zusammenarbeit mit der Mordkommission kaum Erfolg beschieden ist. Doch es bleibt nicht bei dem einen Mord, sondern weitere folgen, während sich das Netz der Ermittlungen immer enger knüpft und auch der "Kommissar Zufall" noch eine wichtige Rolle spielt. Ein Roman über einen außergewöhnlichen Kriminalfall und über das Leben dessen, der versucht ihn aufzuklären. Hin und her geworfen zwischen seinen beruflichen Zumutungen, banalen Schwierigkeiten des Alltags und den Auswirkungen politischer Entscheidungen und gesellschaftlicher Entwicklungen hört ein Lehrer im Hamburger Schuldienst nicht mehr damit auf, Licht in die Ab- und Hintergründe der "Schulmorde" bringen zu wollen, bis er sie schließlich kennt: die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. In dieser Geschichte liegen menschliche Tragödie und unfreiwillige Komik ebenso wie scharfe Kritik und spöttische Ironie nie weit auseinander, und die geneigte Leserin erhält ebenso wie der geneigte Leser nebenbei einige intime Einblicke in das System Schule.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 520
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gerd Reinhold
Von
Mäusen
und
Morden
Ein Schulkrimi
Der Autor, Jahrgang 1951, war fünfunddreißigeinhalb Jahre lang in Hamburg an einer Stadtteilschule, zwei Gesamtschulen und zwei Gymnasien als Lehrer tätig.
Er unterrichtete in den Fächern Deutsch, Geschichte, PGW (Politik-Gesellschaft-Wirtschaft), Gemeinschaftskunde, Sozialkunde, Gesellschaft sowie in Ethik, Philosophie, Darstellendes Spiel und Medienkunde.
Zudem war er zeitweise Fachleiter für Deutsch und für PGW und zuletzt Koordinator für die gymnasiale Oberstufe.
Er musste erst den Ruhestand erreicht haben, um diesen Roman als ein erstes Resümee seiner Erfahrungen schreiben zu können. Weitere können folgen.
Impressum
Texte, Graphik und Umschlaggestaltung:
© Copyright by Gerd Reinhold 2018
Verlag: Gerd Reinhold
Bebelallee 61a
22297 Hamburg
Druck: epubli - ein Service der neopubli GmbH,
Berlin
Die vorliegende Handlung ist ebenso fiktiv, wie die darin handelnden Personen es sind. Jede Ähnlichkeit mit realen Geschehnissen und Personen wäre also rein zufällig.
Für Ähnlichkeiten mit realen Institutionen und Verhältnissen kann jedoch keine Zufälligkeit garantiert werden.
Wo fängt Kriminalität an?
Erst, wenn ein Mensch einer Sache, seiner körperlichen oder seelischen Unversehrtheit oder gar seines Lebens beraubt wird?
Oder auch schon, wenn ein Mensch sinnlos großer Anteile seiner Zeit beraubt wird?
Prolog
Als er die Tiefgarage betrat, lag ein Lächeln auf seinem Gesicht. Man hätte es vielleicht auch eher ein schiefes Grinsen nennen können, aber auf jeden Fall zeugte sein Gesichtsausdruck von einer satten guten Laune, und natürlich käme für ihn dafür die Bezeichnung »Grinsen« gar nicht in Frage; das war etwas für andere Menschen, für Proleten etwa oder anderes Gesocks, mit dem er sich nicht abgab. Sein Lächeln entsprach nur der üblichen Tatsache, dass er wie immer alles im Griff hatte. Möglicherweise oder vielleicht nur eventuell hätte es ja Dr. Peter Mausmann ein wenig die gute Laune verdorben, wenn ihm jemand gesagt hätte, dass er nicht mehr lange zu leben hatte. Aber bekanntlich erfährt man die wirklich wichtigen Dinge nur auf Nachfrage, wenn überhaupt. Jedoch weder auf dem Weg aus seiner Wohnung hier herunter in die Tiefgarage noch hier unten selbst traf er jemanden an, den er hätte fragen können, wenn er hätte wissen können, dass es eine solch wichtige Frage überhaupt zu stellen gab. Abgesehen davon, dass er sich keinesfalls die Blöße gegeben hätte, eine solche Frage zu stellen, natürlich.
Wie üblich zuckte er nur kurz zusammen, als hinter ihm die Stahltür ins Schloss schepperte, während er über den grauen Beton zum Stellplatz seines Wagens schritt. Die Tür sanft hinter sich zu schließen, so dass sie nicht einen solchen Lärm veranstalten konnte, der die ganze hallenartige Garage durchdröhnte, wäre natürlich für ihn, Dr. Peter Mausmann, als Studiendirektor im Dienst der Hamburger Schulbehörde das vermeintlich führende Mitglied eines tatsächlich und wirklich gefürchteten Schulinspektionsteams, auch überhaupt nicht in Frage gekommen. Das war doch was für Weicheier, aber nicht für ihn!
Zielorientiert wie immer schritt Mausmann auf seinen Wagen zu, einen schwarzen Porsche Cayenne. Es war ihm einfach unmöglich zu bemerken, dass sich ein Schatten hinter einer der Säulen, die die Tiefgarage abstützen, löste und ihm folgte. Leise und unhörbar für jemanden wie ihn, der ohnehin selbstzufrieden in sich ruhte und andere Menschen nur dann wahrnahm, wenn er sich bewusst auf sie fokussierte. Der Schatten war kleiner als Mausmann, so dass er sich für diesen auch nicht im hochglanzpolierten Lack des Wagens spiegelte, weil er in gerader Linie hinter Mausmann blieb.
Dieser hatte gerade erst seine Reisetasche hinten in dem Kofferraum des Porsche verstaut, daneben seine schicke Laptoptasche gelegt, hatte die Heckklappe wieder zufallen lassen und war an der linken Seite des Wagens zur Fahrertür gegangen, als ihm der erste Schuss aus der schweren Walther P38 mit donnerndem Getöse die rechte Schulter durchschlug und ihn wider Willen herumwirbelte, seinem Angreifer frontal direkt gegenüber. Der jedoch war völlig vermummt, und die Pistole hatte schon eine ganze Weile durchgeladen und entsichert in seiner Hand gelegen, bereits als er noch als Schatten hinter der Säule lauerte, bis Mausmann endlich die Tiefgarage betrat.
So unvermittelt und unerwartet sich dieser auch mit seiner klaffenden Wunde in der Schulter dem angreifenden Schatten gegenüber sah, blieb ihm dennoch keine Zeit sich zu wundern, als schon der zweite Schuss auf ihn abgefeuert wurde. Diesmal waren seine Weichteile oder jedenfalls der untere Bauchbereich das Ziel, was ihm nun die Beine wegriss, so dass er vor seinem glänzenden SUV eine absolut ungewollte, weil doch irgendwie unterwürfige Sitzhaltung einnehmen musste. Doch lange konnte er sich nicht über diese ungewohnte Ignoranz gegenüber seinem Willen ärgern, weil ihn Schuss Nummer drei nun in die andere Schulter traf.
Eigentlich hätte ihm ja klar sein müssen, dass die in ihm jetzt aufkeimende Angst um die Unversehrtheit seines Wagens hinter ihm ob dieses Beschusses irgendwie nicht völlig rational sein konnte, aber noch bevor ihm diese Einsicht dämmerte, traf ihn schon der vierte Schuss ins rechte Knie, so dass von diesem Gelenk wegen der Kürze der Entfernung, aus der gefeuert wurde, verbunden mit der ihm eigenen Wucht eines Parabellum-Geschosses im Kaliber neun Millimeter, nicht viel übrig blieb.
Nun aber wurde es Mausmann doch zuviel und ihm blieb gar nichts anderes übrig, als endlich bewusstlos zu werden. Aber bevor er solcher Art ins Dunkle gelangte, ohne daraus jemals wieder hinaus zu kommen, und bevor die restlichen Schüsse Nummer fünf bis acht der Walther die Sache endgültig karmachten, konnte sich Mausmann mit bereits erheblich getrübtem Blick noch über eine Beobachtung betreffend seinen Mörder wundern:
Mann, was hat der denn für kleine Füße ...!
Nur kurze Zeit, nachdem Mausmann neben seinem doch erheblich beschädigten Statussymbol ungefragt sein Leben hatte aufgeben müssen, und als nach dem Verhallen des letzten der acht Schüsse wieder eine friedliche Ruhe in der Garage eingekehrt war, verließ ein blauer Mini Cooper in recht hohem Tempo den Ort des Geschehens. Die Harman Kardon-Hifi-Lautsprecher in ihm gaben dabei Born under a bad sign von CREAM in hoher Qualität und Lautstärke wieder. Anschließend wurde es wieder sehr still in der Garage, so als wäre gar nichts gewesen. So, wie es war, bevor Mausmann sie laut mit der Stahltür scheppernd betreten hatte.
1. Kapitel
Montag, 11. April
Noch 100 Tage bis zu den Sommerferien
1.
Wie jede Schulwoche in diesem Schuljahr begann auch diese schon mit Stress, denn wenn man montags erst zur zweiten Stunde kam, konnte das nur stressig werden. Erst zur zweiten Stunde kommen zu müssen, verhieß zwar, etwas länger schlafen zu können am Montag, einem Tag, an dem das wertvoller war als an jedem anderen Tag der Woche, aber dieses Quantum Antistress wurde doch zumeist gleich wieder aufgefressen durch die Notwendigkeit, einen Parkplatz zu finden.
Die Peter-Ustinov-Schule im »Wilden Osten« Hamburgs war im vergangenen Jahrzehnt kontinuierlich vergrößert und erweitert worden, nur ihr Parkplatz nicht. Das hatten die Planer entweder schlicht vergessen, dass eine vergrößerte Schule auch mehr Parkplätze benötigt, oder sie hatten es kalt lächelnd ignoriert und sich über die dadurch entstehenden Einsparungen im Kostenrahmen gefreut. Vielleicht war es sogar der grassierenden politischen Formel von der »Fahrradstadt Hamburg« geschuldet, dass die Schule jetzt nicht genügend Parkplätze für ihr aus allen möglichen Stadtteilen anreisendes Personal bot. Konnte es denn tatsächlich jemanden geben, der die Vorstellung pflegte, dass es Menschen geben kann, die sich morgens früh aufs Rad schwingen, durch die ganze Stadt radeln und sich anschließend dem Energieverlust durch Horden unerzogener Kinder wildfremder Leute aussetzen, um am Nachmittag, am Spätnachmittag unter Umständen, wieder mit dem Rad nach Hause zu fahren? Und das nicht nur an einem Tag der Woche, sondern montags bis freitags jeden Tag? In welchem Wolkenkuckucksheim musste man leben, um so etwas für realistisch halten zu können, und war in diesem Heim vielleicht noch ein Plätzchen frei?
In den allermeisten Hamburger Schulen beginnt der Unterricht morgens um acht Uhr mit der ersten Stunde. Genauso auch an der Peter-Ustinov-Schule. Manche Unterrichtsstunden begannen aber auch schon kurz nach sieben Uhr am Morgen und nannten sich dann auch »Nullte Stunde«. Nomen est Omen, was den durchschnittlichen Lehr- und Lernerfolg solcher Stunden anbelangt, aber um alle vorgeschriebenen Unterrichtsstunden in eine Schulwoche quetschen zu können, musste es eben solche »Frühstunden«, wie sie auch genannt wurden, ebenso geben wie solche am späten Nachmittag einiger Tage.
Am Montag gab es diese »Frühstunden« an der Peter-Ustinov-Schule jedoch nicht, so dass an diesem Wochentag niemand das Glück hatte, garantiert einen der wenigen Parkplätze vor allen anderen als Belohnung dafür zu bekommen, dass man sich im Dienste der allgemeinen Volksbildung praktisch die Nacht um die Ohren geschlagen hatte. Aber gegen acht Uhr füllte sich der Parkplatz rasant, denn die meisten der anreisenden Lehrerinnen und Lehrer hatten ihren Dienst mit der ersten Stunde zu beginnen. Wer dann erst später zu kommen brauchte, zur zweiten Stunde oder noch später, hatte praktisch keine Chance mehr auf einen schuleigenen Parkplatz. Erst wenn man ganz spät mit dem zu beginnen hatte, was mit dem Euphemismus »Unterricht« bezeichnet wurde, zur vierten oder fünften Stunde etwa, entspannte sich die Parksituation wieder etwas, weil dann manche der früher Gekommenen für diesen Tag ihre Unterrichtsverpflichtung bereits schon wieder hinter sich hatten und zu ihren heimischen Arbeitsplätzen strebten, so dass einzelne Parkplätze von ihnen frei gemacht wurden.
Hieronymus Bosch aber hatte beinahe so etwas wie Glück am heutigen Morgen, denn er fand einen freien Platz für seinen Wagen nur etwa dreihundert Meter vom Schuleingang entfernt in der Straße, die vorbeiführte.
Mit seinem fünfhundert Jahre alten Namensvetter verband Hieronymus Bosch so etwas wie eine Hassliebe. Einerseits mochte er dessen Kunst, vor allem die apokalyptischen Massenszenen, andererseits verurteilte er ihn als üblen Usurpator seines Namens. Er bestand nämlich darauf, dass er, der Fünfundertjährige, ihm, dem im zwanzigsten Jahrhundert Geborenen, den Namen gestohlen hatte. Ob und inwieweit diese Einschätzung logisch war oder überhaupt nur sinnvoll, interessierte ihn schlicht nicht. An diesem Punkt hatte die Logik Pause und nichts zu suchen. Deshalb, wegen der Namensgleichheit, begann er jede namentliche Vorstellung seiner Person für gewöhnlich mit dem entsprechenden Hinweis auf den diebischen Charakter seines berühmten Namensvetters für den Fall, dass sein Gegenüber, dem er sich namentlich vorstellte, über das entsprechende Maß an abendländischer Bildung verfügte, um den namensgleichen Künstler kennen zu können. Meist war das nicht der Fall, und Schülern gegenüber konnte Hieronymus Bosch bereits seit einigen Jahren auf die Erläuterung zu seinem Namen verzichten.
Aus ganz ähnlichen Gründen schallte ihm aus der Schülerschaft auch schon seit Langem seines beruflichen Kürzels »HB« wegen der Spruch nicht mehr entgegen:
»Greif´ lieber zum HB, dann geht alles wie von selbst!«
Früher hingegen kam das schon gelegentlich vor, dass man ihn mit diesem geringfügig angepassten Zitat aus einer Zigarettenwerbung hochzunehmen versuchte, was dann immer anders als bei dem dabei als Vorbild dienenden »Hb-Männchen« der Trickfilmwerbung dazu führte, dass Hieronymus Bosch erst richtig »in die Luft« ging, aber inzwischen hatte sich der Spaß erledigt. Wer kannte denn noch das »Hb-Männchen«?
Jedenfalls mussten seine Eltern bei der Entscheidung für seinen Vornamen damals gehörig einen in der Krone gehabt haben, glaubte Hieronymus Bosch, auch wenn sie vielleicht die Kunst des Namensusurpators verehrt hatten. Für ihn gehörte sein Vorname in die Kiste mit der Aufschrift:
Was ich meinen Eltern nie verzeihen kann.
Zumal sie ihm auch keinen zweiten Vornamen gegönnt hatten, auf dessen Verwendung er sonst standardmäßig hätte ausweichen können. Zum Glück für ihn las er überhaupt keine Kriminalromane, nicht nur, weil er sie schlicht für »überkandidelt« hielt, also zu realitätsfern, sondern vor allem, weil er fand, dass das Leben auch so genug Aufregungen für ihn bereithielt. Anderenfalls hätte er sich bestimmt deutlich darüber aufregen müssen, dass ein US-amerikanischer Krimiautor ihm ebenfalls seinen Namen »geklaut« hatte für seinen polizeilichen Ermittler Hieronymus »Harry« Bosch.
Jetzt, da wir unseren Hieronymus Bosch schon ein wenig kennen gelernt haben und zuversichtlich sein dürfen, ihn noch besser kennen zu lernen oder sogar vertraut mit ihm zu werden, dürfen wir uns darauf beschränken, ihn nur noch mit seinem so ungeliebten Vornamen zu nennen, wie das ja auch andere tun, die niemals so vertraut mit ihm sein werden wie wir.
Nachdem Hieronymus seinen Wagen in die Parklücke bugsiert hatte, natürlich vorwärts mit zügigem Überrollen des Bordsteins, schließlich war sein Auto ja eigentlich geländegängig, stieg er aber nicht sofort aus, sondern hörte sich erst noch Once In Your Life von IDLEWILD zu Ende an:
»Life waits over the hill, over the hill ...«
Soviel Zeit musste einfach noch sein, denn unterwegs auf der Fahrt hörte man des Lärms wegen, den der Wagen verursachte, ja kaum etwas von der Musik.
Hieronymus hörte trotzdem unterwegs immer nur Musik vom Band, niemals Radio, denn für den allgemeinen »Dudelfunk« hatte er nichts übrig. Musik soll ja das Schmerzempfinden dämpfen, hatte Hieronymus einmal gehört. Er hielt sie deswegen für ideal für Leute seines Berufsstandes und war der Meinung, dass es sie auf Rezept geben sollte. Das ihn tagsüber ständig begleitende Gebrüll, Geschrei und Gekreische durchdrang die Wände, brachte sie zum Zittern, es drang ein in jeden Gedanken und vergiftete ihn genausoso wie jedes im Raum gesprochene Wort.
Bei Hieronymus` geländegängigem Wagen handelte es sich um einen Lada Niva, der aber nicht wie der in Wolfgang Herrndorfs Roman »tschick« eine hübsche hellblaue Farbe hatte, sondern seiner war in einem aufheiternden Grau. Ob aschgrau, steingrau, mausgrau, bleigrau oder sonst ein Grau ließ sich jedoch nicht genau bestimmen. Hieronymus Bosch hatte das Fahrzeug gebraucht von der Witwe des Vorbesitzers erworben, welcher ihn wegen seines Suizids nicht mehr verwendete. Ob bei dessen Depressionen, die letztlich zu seinem Selbstmord geführt hatten, das aufmunternde Grau des Lada eine Rolle gespielt hatte, ließ sich ebenfalls nicht mehr wirklich genau bestimmen. Da es sich um einen Psychotherapeuten gehandelt hatte, konnte es sein, dass die Wagenfarbe die therapeutischen Fähigkeiten seines Besitzers überstrapaziert haben mochte.
Natürlich wollte Hieronymus wegen der immerhin möglichen Rolle des Autos in der unglücklichen Biografie seines Vorbesitzers dieses eigentlich längst umlackieren lassen, in ein heiteres Schwarz zum Beispiel. Außerdem hatte er den bei abendlichem Herbstnebel in einer ihm unbekannten Gegend abgestellten Wagen schon zweimal erst bei Tageslicht am nächsten Tag wiederfinden können. Aber bisher hatte er es schon jahrelang bei der Absicht belassen, und derzeit war ja auch gerade Frühling und mit herbstlichem Nebel nicht unbedingt zu rechnen. Stattdessen hatte er dem Wagen ein Cassettenradio samt einer ordentlichen Lautsprecheranlage verpassen lassen. Nur literarisch interessierte Schüler oder solche, die sich zwangsweise im Deutschunterricht einmal mit dem Herrndorf-Roman hatten beschäftigen müssen, sprachen Hieronymus gelegentlich auf sein Auto an. Meist mit der Frage, ob das denn auch wirklich ein Lada Niva sei, denn natürlich konnten sie sich ein solches Auto nur in hellblau vorstellen.
Aber auch Hieronymus´ Haupthaar war bereits deutlich angegraut, und obwohl er glaubte, mitten im Leben zu stehen, hatte er doch bereits das Alter erreicht, bei dem sich junge Referendarinnen schwer taten mit dem kollegialen Du.
2.
Hieronymus verließ schließlich seinen Wagen, schloss ihn sorgfältig ab und strebte dem Eingang der Schule zu. Es wurde jetzt auch höchste Zeit, denn wie immer musste er vor seinem Unterricht das Eine oder Andere als Klassensatz kopieren, was er am letzten Wochenende ausgebrütet hatte. Zum Glück lief er jetzt, kurz vor der Zweiten Stunde, nicht mehr so sehr Gefahr, unter die Räder der zahlreichen »Hubschrauber-Eltern« zu geraten, die ihre »Premium-Kids« die wenigen Meter von zuhause bis zur Schule fahren mussten. Hier, im »Wilden Osten« Hamburgs, verhielten sich die Eltern da nicht anders als in anderen Stadtteilen, nur dass hier als rollendes Statussymbol nicht allradgetriebene Kleinpanzer dienten, sondern möglichst luxuriöse Limousinen der Mittel- oder Oberklasse. Vor der ersten Stunde konnte das fußläufige Erreichen des Schuleingangs zu einem Überlebenstraining ausarten, da war man auch auf dem Bürgersteig nicht sicher, zumal dort die Fahrräder der Schüler zahlreich ihren Weg suchten.
Hieronymus trug heute sein dunkelblaues, nicht mehr so neu aussehendes Cord-Jackett mit einem gemusterten Hemd darunter zu Jeans unbekannter Provenienz und schwarzen, ledernen Halbschuhen. Aber was heißt »heute«? Wer ihn kannte, konnte sich nur schwer vorstellen, ihn selbst an einem Strand in Südeuropa oder in der Karibik anders gekleidet zu sehen als in einem dunkelblauen, nicht mehr so neu aussehenden Cord-Jackett mit einem gemusterten Hemd darunter zu Jeans unbekannter Provenienz und schwarzen, ledernen Halbschuhen, auch wenn der Rest der Menschheit dort gerade in dürftigster Badebekleidung unterwegs sein sollte.
Hieronymus unterrichtete gefühlt schon seit einigen Jahrhunderten an der Peter-Ustinov-Schule, die sich selbst verharmlosend als PUS abkürzte, weshalb sich irgendwann vor Urzeiten einmal die Schüler den noch viel mehr verharmlosenden und vielleicht gerade deshalb immer wieder von einer Schülergeneration zur nächsten tradierten Kosenamen »Pussies« gegeben hatten, die Fächer »Deutsch, also auch Geschichte«, wie er selbst bei Gelegenheit immer wieder gern einen seiner Lieblingsautoren, nämlich Günter Grass, zu zitieren pflegte. Hinzu kamen noch die Fächer PGW und Gesellschaft.
Nicht Eingeweihte werden sich zwar unter den beiden erstgenannten Fächern Deutsch und Geschichte etwas vorstellen können, auch wenn das mit größer werdendem Abstand zur eigenen Schulzeit immer weniger dem entspricht, was es in der Gegenwart bedeutete, aber vielleicht nicht bei den beiden letztgenannten Fächern. PGW stand für das Unterrichtsfach »Politik, Gesellschaft, Wirtschaft« und existierte an einer Stadtteilschule, um welche es sich bei der Peter-Ustinov-Schule ja handelte, nur in der gymnasialen Oberstufe. Es bezeichnete nach aktueller Nomenklatura lediglich das genauer, was früher unter dem Begriff »Gemeinschaftskunde« firmieren durfte, von manchen auch gehässig »Gemeinplatzkunde« oder, schon zutreffender, »Gemeinheitskunde« genannt.
Das Fach Gesellschaft erfreute stattdessen die Schüler zuvor in der Mittelstufe und war ein Konglomerat aus den Disziplinen Geschichte, Politik, Soziologie und Geografie. Ein staatlich organisierter Dilettantismus, denn es gab praktisch keine Unterrichtskraft, die in all diesen vier Wissenschaften gleichermaßen ausgebildet war, weshalb immer eine bis mehrere davon entweder vernachlässigt oder lediglich autodidaktisch unterrichtet wurden. Böse Geister vermochten hinter diesem geplanten Dilettantismus sogar politische Absicht zu vermuten, weil damit zwar formal umfassende politisch-sozial-ökonomische Bildung angeboten wurde, diese aber nur halb gebildete und deshalb relativ bequem politisch steuerbare Staatsbürger hervorbrachte. Aber natürlich dachten nur wenige und nur politisch Verwirrte so.
Der heutige Stundenplan versprach Hieronymus fünf Unterrichtsstunden Arbeitsfreude, von der Zweiten bis zur Sechsten Stunde. Anschließend würde er seinen Fluchtinstinkt aber noch eine Zeitlang unterdrücken müssen, denn dann musste er noch Zensuren und Fehlzeiten für einen seiner beiden Oberstufenkurse in einen Schulcomputer abladen, weil am folgenden Tag der »Eintragungsschluss« dafür bis »High Noon«, zwölf Uhr mittags, angesetzt war, er das dann deshalb nicht mehr nach Unterrichtsschluss erledigen konnte und nicht in den Pausen mit den »Last-Minute-Kollegen« um einen Platz an den Rechnern konkurrieren mochte.
Das Lehrerzimmer, das er anstrebte, war eines von zweien, über die die Peter-Ustinov-Schule verfügte, eins im alten Gebäude an der Straße und eins im Neubau genau gegenüber über den Innenhof hinweg. Dieses Gegenüber hatte den Vorteil, dass man von dem einen Lehrerzimmer aus nicht unbedingt immer in dem anderen anrufen musste, um zu erfahren, ob sich dort jemand Bestimmtes aufhielt, sondern oft konnte man es über den Hof hinweg auch einfach schon sehen. Neben dem alten Lehrerzimmer, mit diesem durch eine für gewöhnlich offen stehende Doppeltür verbunden, befand sich ein Arbeitsraum mit Computern und den beiden großen Druckern, wo Hieronymus noch rasch seine Materialien für den kommenden Unterricht vervielfältigen wollte.
Als er die Treppe in den ersten Stock hinter sich gebracht hatte, die bereits mit einigem Müll verziert war, stand er nun vor der geschlossenen Tür zum Lehrerzimmer. Diese wies weder eine Klinke noch einen Knauf oder ein Schloss auf, um sie öffnen zu können, sondern nur einen drehbaren Metallzylinder von etwa drei Zentimetern Durchmesser und ungefähr fünf Zentimetern Länge. Er war Bestandteil eines elektronischen Schließsystems und wurde mit einem »Pieper« bedient, das heißt entsperrt, welchen jede Lehrkraft in Form eines kleinen Diskus im Miniformat aus Plastik mit sich führte. Und wehe, wenn sie das nicht tat, die Lehrkraft, weil sie das Dings zum Beispiel zuhause vergessen hatte! Dann erst wurde ihr richtig klargemacht, wie viele Türen in der Schule ihr verschlossen sein konnten und auch blieben, sofern nicht zufällig gerade jemand in der Nähe war, der schließtechnisch aushelfen konnte. Nicht auszudenken, was passierte, wenn die Batterie in dem Gerät einmal leer sein würde! Auch ein Besuch der Toilette war dann nur noch mit Begleitung möglich.
Drückte man jedoch den »Pieper« im Normalfall des Vorhandenseins auf seinen gummiüberzogenen Schaltknopf in der Mitte und hielt ihn in die Nähe von besagtem Metallzylinder, so gab dieser ein kaum oder in Gegenwart von mehr als zwei Schülern schon nicht mehr hörbares Piepen von sich - daher der Name - und zeigte damit dem Benutzer an, dass das jeweilige Türschloss nun für einige Sekunden entsperrt sei, und man die Gelegenheit nutzen könne, die jeweilige Tür mittels eines mehr oder weniger beherzten Drehens des Metallzylinders zu öffnen. Natürlich durfte man es sich auch anders überlegen und das Drehen bleiben lassen, worauf nach den genannten Sekunden ein erneutes Piepen des Zylinders zum Ausdruck brachte:
Gut, dann eben nicht.
Zudem zeigte das neuerliche Piepen an, dass der vorherige Zustand wiederhergestellt war, als wäre nichts geschehen, als hätte sich niemand der Tür jemals genähert, als wäre man gar nicht da gewesen. Es handelte sich also um einen echten technischen Fortschritt, denn ein rein mechanisches Schloss muss man ja erst wieder abschließen beziehungsweise das Drehen eines Schlüssels rechtzeitig abbrechen, wenn man das Betreten eines Raumes oder das Verlassen eines solchen spurlos abbrechen möchte.
Leider war der Metallzylinder, welcher sich nicht nur in der Peter-Ustinov-Schule, sondern auch in anderen Schulen Hamburgs an den Türen epidemisch verbreitet hatte wie Grippeviren, aber sehr glatt, weil er keinerlei den Fingergriff unterstützende Beschichtung oder Strukturierung aufwies, so dass es bei Türen, deren Schließmechanismus aufgrund physikalischer Veränderungen etwas schwergängig war - einem der Temperatur geschuldeten, aber nicht sichtbaren geringfügigen Verziehen des Türblatts zum Beispiel - zu Öffnungsschwierigkeiten der Tür kommen konnte.
Und eine ebensolche Tür hatte Hieronymus mit der des Lehrerzimmers nun vor sich, und seine Finger rutschten mehrfach ab von dem glatten Metall, so dass er die Tür innerhalb der Sekundenspanne, die ihm die Technik gönnte, zunächst und auf Anhieb nicht aufbekam. Das Phänomen der Schwergängigkeit dieser Tür war natürlich nicht neu, sondern schon länger bekannt, aber schulische Mühlen mahlen noch etwas langsamer als andere lahme Mühlen, so dass der Herr Hausmeister leider noch keine Zeit hatte finden können, an diesem Missstand etwas zu ändern.
Hieronymus piepte und drehte mehrfach ohne Erfolg, was sogleich zu einem kleinen Stau vor der Tür führte, denn natürlich war er nicht der Einzige, der gerade jetzt das Lehrerzimmer betreten wollte. Die Erste Stunde war vorüber oder jedenfalls großzügig betrachtet so gut wie, und Kollegen kamen aus den Klassen, um vor der zweiten Stunde in einem anderen Fach und einer anderen Lerngruppe ihre Materialien auszutauschen, kurz auf den Vertretungsplan zu blicken, jemandem kurz eine dringende Information zukommen zu lassen wie zum Beispiel:
»Du, der Dings ist heute wieder nicht da.«
Vielleicht auch nur, um die Mails und SMS zu checken, die zwischenzeitlich eingetroffen sein konnten, oder sich kurz an einer Stelle zu kratzen, an der zu kratzen man sich vor der letzten Lerngruppe nicht getraut hatte, und so weiter und so fort.
Es waren zwei Kollegen, die die Türöffnungsversuche von Hieronymus interessiert, aber ungeduldig hinter seinem gebeugten Rücken verfolgten, der Kollege Moritz von Richtofen, »beinahe verwandt oder verschwägert« mit dem berühmten Fliegerass aus dem Ersten Weltkrieg, wie er bei passender Gelegenheit beiläufig gern erwähnte, und vielleicht auch des Namens wegen schon länger befreundet mit Hieronymus, sowie die Kollegin Ella Schmitt, eine Mittelblonde mittleren Alters in mittlerer Größe und auch mit mittlerer Attraktivität, die erst seit wenigen Jahren in den Fächern Deutsch und Religion an der Peter-Ustinov-Schule tätig war. Bei jeder sich bietenden und passenden oder auch unpassenden Gelegenheit pflegte sie zu betonen, dass ihr Name mit »Doppel-T« geschrieben werde (also nicht so wie gewöhnlich).
Der Kollege von Richtofen hatte das Aufsuchen des Lehrerzimmers für SMS, Mails und ähnliches nicht nötig (vielleicht aber für das Kratzen), denn als digitaler Nerd, der er war, hatte er keinerlei Hemmungen, seine diversen »digital devices« auch während des Unterrichts vor den Augen der Schüler zu benutzen, wobei ihm sein Unterrichtsfach Informatik ein schwaches Alibi lieferte, und war deshalb immer, also zu jeder Zeit und überall, allerbestens informiert über jegliches Geschehen in der Welt, sofern es sich in Twitter, Facebook, WhatsApp und so weiter oder in irgendwelchen Newsfeeds wiederfinden ließ. Und so schallte es in dieser Türöffnungssituation aus ihm heraus:
»Hab´s grad´ erst gelesen, endlich hat jemand `mal dem Mausmann das Licht ausgeblasen, ihn abgemurkst - und aus die Maus!«
Diese knappe und zu der gegebenen Situation wenig passende Bemerkung zeigte nicht nur, dass der Sprecher offenbar kaum Sympathie für das genannte Opfer aufbrachte, sondern setzte auch gewissermaßen eine sofortige Art von Kettenreaktion in Gang. Der Kollegin Schmitt fielen plötzlich alle Gegenstände, die sie in Händen hielt, aus denselben, so dass etliche Arbeitsblätter, zwei Lehrbücher und eine kleine Tasche ihren Weg nach unten fanden und den Fußboden schmückten, der noch relativ sauber am Montagmorgen, aber sonst von der üblichen zweckmäßigen Hässlichkeit war. Und während der Kollege von Richtofen sich der Kollegin hilfreich sich bückend und aufsammelnd zur Seite hockte, gelang es Hieronymus endlich, die Tür zum Lehrerzimmer zu öffnen, so als ob die Mitteilung des Kollegen einem »Sesam öffne dich!« gleich gewirkt hätte.
Dadurch konnten auch die anderen beiden Kollegen anschließend nach ihm endlich ins Lehrerzimmer gelangen. Der Kollege von Richtofen mit leicht errötetem Gesicht, vermutlich, weil eine solche Betätigung wie die von eben den Gipfel dessen darstellte, was er an Sport sich zuzumuten bereit war, und die Kollegin Schmitt erkennbar blasser als sonst im Gesicht unter ihrem mittelblonden Scheitel, vermutlich, weil ihr das doch eigentlich grundlose Versagen der Kräfte in den Händen peinlich war.
Doch davon bekam Hieronymus schon nichts mehr mit, als er zielstrebig in den Nebenraum mit den Druckern eilte, und so blieb die frische Information des Kollegen von Richtofen zunächst ohne Nachfragen und wurde in hintere Regionen des Hirns abgelegt, um sie später bei passender Gelegenheit wieder hervorkramen zu können.
3.
Diese Gelegenheit, sich an die Neuigkeiten zu erinnern, ergab sich rascher als gedacht, nämlich schon in der nun folgenden Unterrichtsstunde Deutsch in einem Kurs aus Zehntklässlern. Nachdem man »oben« die organisatorische Differenzierung des Unterrichts nach zwei Leistungsniveaus wenigstens in den sogenannten Kernfächern vor einigen Jahren abgeschafft hatte, hatte man »unten« alsbald merken müssen, dass es weniger Schüler wurden, die am Ende von Klasse Zehn höhere Leistungsniveaus erreichten und deswegen den Weg zum Abitur in der Oberstufe antreten durften.
Da hatte wohl irgendetwas mit der sogenannten Binnendifferenzierung im Unterricht nicht so funktioniert, wie man sich das an den Schreibtischen und in den Konferenzräumen der Schulbehörde vorgestellt hatte. Wie denn auch, wenn von dort keine brauchbaren Hilfen kamen für den Anspruch, zwischen dem Leistungsniveau und Arbeitswillen von absoluten Dumpfbacken und denen von begabten und strebsamen Jugendlichen in demselben Unterricht derselben Unterrichtsstunde als Unterrichtender differenzierend aktiv sein zu können? Mit noch einigen Zwischenstufen nötiger Differenzierung, versteht sich. Klar, es gab mittlerweile Lehr- und Lernwerke mit jeweils drei Anspruchs- und Leistungsniveaus pro Aufgabenstellung für einige Fächer, aber deren Differenzierung bildete die Realität so gut und genau ab und wurde ihr damit ebenso gerecht, wie das Foto einer Schule von außen das offenbaren konnte, was in ihr vorging.
Einige Hamburger Schulen hatten deshalb die äußere Leistungsdifferenzierung in den sogenannten Kernfächern bei ihrer Organisation von Lerngruppen klammheimlich wieder eingeführt. Die Namensgebung solcher Kurse, rekrutiert aus mehreren Klassen, war noch nicht abgeschlossen, sondern eine noch offene Frage, aber für den Deutschkurs von Hieronymus hatte sich der irreführende Name »Turbokurs« eingebürgert, weil in ihm alle diejenigen Schülerinnen und Schüler aus allen Klassen des Jahrgangs lernten, die am Ende der neunten Klasse die offizielle Prognose schriftlich erhalten hatten, dass sie bei gleich bleibender Entwicklung am Ende der Klasse Zehn voraussichtlich den MSA, den »Mittleren Schulabschluss« erreichen könnten. Einen früher so bezeichneten »Realschulabschluss« oder die »Mittlere Reife« gab es offiziell nicht mehr - zur aktuellen Bildungspolitik gehörte ja auch, die Hoheit über die Sprache zu behalten. Irreführend war die Bezeichnung »Turbokurs« deshalb, weil man dann ja ebenso gut von »Turbo« sprechen könnte, wenn man bei einem Kleinwagen während der Fahrt die angezogene Handbremse löst, denn er bleibt ja trotzdem ein Kleinwagen.
Nachdem die Schüler in Hieronymus´ Kurs bereits ihre schriftlichen Prüfungen für den MSA mit mehr oder weniger Erfolg hinter sich gebracht hatten, standen ihnen zum Erreichen dieses Ziels noch die ergänzenden mündlichen Prüfungen in den drei sogenannten Kernfächern Deutsch, Englisch und Mathematik bevor. Auf die Deutschprüfungen hatte Hieronymus seine Schüler derzeit vorzubereiten. Thema der Prüfungen sollte der Roman »Das Feuerschiff« von Siegfried Lenz sein.
Drei der Schüler hatten Hieronymus zu Beginn der Doppelstunde mitgeteilt, dass sie seinen Unterricht sofort verlassen müssten, weil sie bei der Kollegin Sittmann, der Abteilungsleiterin der Mittelstufe, noch eine Klassenarbeit nachzuschreiben hätten. Weil Hieronymus diesbezüglich nicht vorab informiert worden war, hatte er versucht, die Aussage der Schüler bestätigt zu bekommen, bevor er sie entließ, aber Anke Sittmann hatte er in ihrem Büro nicht vorgefunden, und niemand, den er getroffen hatte, hatte ihm sagen können, wo sie abgeblieben war. Demnach war ihm nichts anderes übrig geblieben, als den drei Schülern zu vertrauen und darauf, die entsprechende Information der Kollegin wenigstens im Nachhinein zu bekommen (was tatsächlich eintreten würde).
Nachdem die Schüler etwa zehn Minuten nach Beginn des Unterrichts bereits zur Ruhe gekommen waren - es gab ja immer so viel, was man sich noch zu sagen oder zu fragen oder zu kommentieren hatte, waren dann schließlich die meisten von ihnen mit den Arbeitsmaterialien zu dem Roman beschäftigt, die ihnen Hieronymus in der vorangegangenen Woche gegeben hatte. Einige lasen aber offensichtlich noch die Erzählung selbst, obwohl das bereits Aufgabe über die Märzferien gewesen war. Andere wiederum waren mit den Arbeitsmaterialien bereits fertig, für diese vor allem hatte Hieronymus vor der Stunde ergänzendes Material erstellt. Er hoffte, in den folgenden Stunden dann mit möglichst allen Schülern deren Ergebnisse zu den Materialien besprechen zu können. Insoweit »business as usual« für Hieronymus.
Was ihn jedoch plötzlich innerlich zusammenfahren ließ, war die jetzt erst registrierte Tatsache, dass Max anwesend war. Dessen notorische Verspätungen beschränkten sich zwar inzwischen zumeist auf die erste Stunde eines Tages und kamen nicht mehr so oft noch in der zweiten oder einer noch späteren Stunde vor, aber dennoch erstaunte seine heutige Anwesenheit Hieronymus. Max wurde von den meisten so genannt, auch von Hieronymus, einige Freunde nannten ihn auch Leo nach seinem zweiten Vornamen und andere, die ihn aus Gewohnheit mobbten oder einfach nur nicht leiden konnten, nannten ihn »Mäuschen«, denn er hieß mit vollem Namen Maximilian Leonard Mausmann und war der Sohn aus zweiter Ehe dessen, von dessen Ableben Hieronymus soeben zwischen Tür und Angel erfahren hatte. Max sah mindestens zwei Jahre älter aus als seine Mitschüler im Jahrgang, war aber in Wirklichkeit nur ein gutes Jahr älter als der Durchschnitt und hatte bereits eine bewegte Schulkarriere hinter sich. Da Hieronymus sein Klassenlehrer in der 10e war, wusste er davon.
Eigentlich hatte Hieronymus nach der chaotischen Todesbotschaft von kurz zuvor annehmen dürfen, dass der Sohn des Ermordeten nicht gerade heute das Bedürfnis verspüren könnte, am Unterricht teilzunehmen. Andererseits wusste Hieronymus aber auch, dass Max nicht mehr zuhause, sondern in einer betreuten Wohngemeinschaft lebte. Konnte es daher sein, dass Max vom Tod seines Vaters noch gar nicht erfahren hatte? Sollte Hieronymus ihn darauf ansprechen, ihm kondulieren oder lieber noch nicht? Wie würde Max hier in der Unterrichtssituation auf die Nachricht reagieren, wie würde sich Hieronymus richtig verhalten können im Falle, dass Max es noch nicht wusste bisher? Er war vielleicht heute ein bisschen blasser im Gesicht als sonst ohnehin immer, aber das konnte ja auch Folge eines exzessiven Wochenendes sein.
Hieronymus vermochte es aber im Moment nicht, seine Überlegungen länger fortzusetzen oder ihnen sogar eine Entscheidung für sein Verhalten abzuringen, denn plötzlich ging die Tür zum Klassenraum auf und Lukas Lee Lennox, genannt Luke, betrat die Arena. Für diesen war das Anklopfen an eine Tür von außen vor dem Betreten eines Raumes eine völlig fremde Verhaltensform und so setzte er seinen Weg durch die Klasse zu einem Regal an der hinteren Wand auch zielstrebig, aber ohne Eile und wortlos fort, wie es ihm als einem »Jedi-Ritter« ja auch gebührte. Er fand auf seinem lässigen Gang durch den Raum sogar noch die Zeit, sich kurz im Schritt seiner hellgrauen Jogginghose zu kratzen, obwohl ihn die mittig unter dem Bauch hängende Gürteltasche dabei etwas behinderte. Eigentlich überflüssig zu ergänzen, dass er jegliches Klischee noch zusätzlich damit bediente, dass seinen Kopf über dem T-Shirt mit einer schwer zu entziffernden Textbotschaft eine Baseballkappe mit dem Schirm im Nacken zierte.
Es war auffallend still geworden in der Klasse, nur die leise vor sich hin quietschenden Gummisohlen von Lukes Converse-Ersatz-Latschen ergaben das beinahe einzige Geräusch. Einige Schüler sahen Hieronymus erwartungsvoll an, aber der dachte an:
»There are many here among us who feel that life is but a joke« von BOB DYLAN in All Along the Watchtower.
Ihm war ohnehin schon klar, dass wieder einmal ein NvG, ein »Normen verdeutlichendes Gespräch«, mit Luke fällig war. Glücklicherweise gehörte Luke ja nicht in Hieronymus´ Klasse 10e, und auch deshalb beschloss dieser in diesem Moment, besagtes Gespräch nicht gerade jetzt unmittelbar anzustreben, sondern später bei einer anderen Gelegenheit, zum Beispiel bei der nachfolgenden Pausenaufsicht im Hof. Außerdem versprach sich Hieronymus von diesem NvG nicht wirklich viel. Luke würde ihm aufmerksam zuhören, jedenfalls die ersten zehn Sekunden lang, danach würde sein Blick abschweifen, seine Augen, in denen nichts an Ausdruck zu finden sein würde, würden sich ein interessanteres Ziel suchen, an das sie sich heften konnten. Abschließend würde er in seiner reduzierten Sprache beteuern, dass er es künftig besser machen wolle, um bereits nach wenigen Schritten, die er sich danach würde entfernen dürfen, das Vorgefallene und das soeben erst Versprochene wieder zu vergessen.
Nachdem Luke den Klassenraum mit seinen Sachen aus dem Regal, die zu holen er entweder beschlossen hatte oder von einer anderen Lehrkraft beauftragt worden war, ebenso stringent wie unantastbar als »Jedi-Ritter«, der gerne auch wirklich »Skywalker« anstatt nur Kollinghoff heißen würde, wieder verlassen hatte, blieb von der Unterrichtsstunde sowohl zeitlich als auch von der Arbeitsdisziplin her nicht mehr viel übrig. Allerdings hatte Hieronymus, der durch den Klassenraum pendelte, um den Schülern bei ihren Aufgaben zu helfen, aber auch um sie in ihrem Tun zu kontrollieren, mit Mina, einer Schülerin »mit Migrationshintergrund«, wie es inzwischen politisch korrekt hieß, dabei war sie eigentlich lediglich in Afghanistan geboren worden, noch ein sehr erfreuliches Gespräch über Doktor Caspari, einen der Protagonisten aus dem »Feuerschiff«. Mina fand dessen Charakter in seiner verzweifelten Widersprüchlichkeit, wie sie es nannte, viel authentischer und damit überzeugender als Kapitän Freytag, dessen gradlinige Prinzipientreue sie »Sturheit« nannte. Hieronymus versprach sich daher eine interessante Fortsetzung ihres Gesprächs in der mündlichen Prüfung in einigen Wochen und das sagte er Mina auch, die daraufhin strahlte, als könne sie sich auf diese Prüfung jetzt sogar ein bisschen freuen.
4.
Bei seiner Pausenaufsicht in der folgenden Zweiten Großen Pause im Innenhof der Schule ergab sich für Hieronymus doch keine Gelegenheit, mit Luke zu sprechen. Der mochte vielleicht nicht der intelligenteste sein, hatte aber wohl doch genug Instinkt, sich nach seinem Auftritt von eben erst einmal nicht bei Hieronymus blicken zu lassen. Auch Max war nirgendwo zu sehen, so dass sich für Hieronymus zunächst die Frage erledigte, ob und wie er ihn auf den Tod seines Vaters ansprechen sollte.
Der Innenhof der Schule, auf dem Hieronymus jetzt als Aufsicht patrouillierte, wurde im Süden von dem alten dreistöckigen Schulgebäude mit dem Haupteingang begrenzt, dem Gebäude, in dem das »alte« Lehrerzimmer lag und der Klassenraum der zehnten Klasse, in dem Hieronymus zuvor seine heutige erste Unterrichtsstunde hatte. Im Norden des Hofs, dem alten Schulhaus genau gegenüber, stand der Neubau - mit ebenfalls drei Stockwerken und in etwa gleicher Grundfläche der architektonische Gegenpart zum alten Gebäude, in welchem die Jahrgänge Zehn bis Dreizehn bespaßt wurden, während im Neubau, der wie der Altbau auch Fachräume und ein Lehrerzimmer beherbergte, die Jahrgänge Sieben bis Neun aufbewahrt wurden. Im Westen der gesamten Anlage schloss sich zunächst südlich am Altbau eine kleine ebenerdige Halle an, die sowohl als Aula für Veranstaltungen als auch als Aufenthaltsraum für die Schülerschaft bei »Regenpausen« oder am Nachmittag genutzt wurde. Nördlich davon auf der Westseite des Geländes befanden sich parallel zueinander die beiden erdgeschossigen Reihen von miteinander verbundenen Klassenräumen mitsamt eigenen Gruppenräumen und Sanitärräumen für die Jahrgänge Fünf und Sechs.
Wiederum nördlich davon und somit westlich vom Neubau hatte man zwei doppelgeschossige Container mit insgesamt vier Unterrichtsräumen für die IVK, die »Internationalen Vorbereitungsklassen«, aufgestellt. Ursprünglich war dort ein Areal mit Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten für die fünften und sechsten Klassen, aber das musste eben (natürlich) »nur vorübergehend und für eine kurze Dauer« dafür weichen, dass man die Flüchtlingskinder auf den Regelschulbesuch vorzubereiten hatte. Das Schulsprecherteam hatte das sofort eingesehen, denn das bestand nur aus Schülern der Oberstufe, und im Schülerrat war der Protest der Vertreter aus der »Orientierungsstufe«, der fünften und sechsten Klassen also, wieder einmal nur ziemlich unbeeindruckend verhallt. Somit hatte es neuerlich eine frühzeitige politische Orientierung für die »Orientierungsstufe« gegeben.
Provisorien wie die Unterrichtscontainer pflegten in Hamburg allerdings meist länger Bestand zu haben als ursprünglich geplant, und so werden vielleicht Archäologen in der Nachbarschaft der noch immer betriebenen Container dereinst einmal die Reste der übrigen Schule ausgraben.
Im Osten wurde das Schulgelände nördlich von der dominanten Sporthalle abgeschlossen, welche für normale Menschen auch als Bezirkssporthalle fungierte, weshalb es für diese Außenstehenden besonders praktisch war, dass sich südlich von ihr gleich der erwähnte unterdimensionierte Schulparkplatz anschloss, zu dem die Zufahrt schlauchartig an dem kleinen Wohnhaus samt Gärtchen des Hausmeisters vorbei in der südöstlichen Ecke führte. Umhegt wurde das gesamte Schulgelände von einem soliden, jedoch an einigen Stellen schon seit Langem beschädigten und damit durchlässig gemachten Maschendrahtzaun, der im Süden an die Straße grenzte und im Westen dafür sorgen sollte, dass die kleineren Schüler nicht in das vorbei plätschernde Bächlein stürzen und ertrinken konnten, hinter dem ein Siedlungsgebiet der Stadt wucherte. Im Norden und im Osten trennte der Zaun das Schulgelände hingegen vorläufig noch von einem mit Kleingärten.
Sportanlagen für Freiluftsport besaß die Schule nicht, für diesen musste man ungefähr zwei Kilometer zum nächst gelegenen Sportplatz hinter sich bringen, was sich für Einzelstunden Sport aber nicht lohnte.
Die Hofaufsicht in den beiden Großen Pausen hatte jeweils nur eine einzige Lehrperson zu bewältigen, was den Schülern natürlich die willkommene Gelegenheit gab, sich bei Bedarf irgendwohin zu verkrümeln, zum Beispiel zwischen die beiden Klassenraumschläuche der »Orientierungsstufe«. Hieronymus hätte, so gesehen, also während seiner Aufsicht recht gut über die Mitteilung des Kollegen Richtofen nachdenken können, aber das funktionierte trotzdem wieder nicht, weil es noch genügend Schüler gab, die sich nicht irgendwohin verkrümelten, um Unsinn oder Verbotenes zu tun, sondern die sich in aller Öffentlichkeit und damit für Hieronymus unübersehbar stritten, jagten, prügelten oder etwas von ihm wollten, und sei es auch nur, weil sie sich gerade langweilten. Oder eben etwas Verbotenes taten wie etwa gegen die Hausordnung zu verstoßen.
Ganz besonders beliebt als Verstoß gegen diese war da natürlich das Verbot der Handynutzung. Zwar war die Nutzung von Handys durch Schüler am Schulvormittag mittlerweile nicht mehr pauschal verboten, so viel hatte man ja inzwischen schon dazugelernt als Schule, aber ziemlich einschränkend und dezidiert geregelt war sie schon. Viele Schüler hielten sich nicht an diese Regeln, weil sie sie entweder ihrer Komplexität wegen noch nicht verstanden hatten oder weil sie sie schlicht nicht interessierten. Regeln? Das ist doch höchstens ein Vorschlag, und damit bin doch nicht ich gemeint, oder? Und so kam es, dass Hieronymus im Laufe dieser Pausenaufsicht fünf Handys einkassierte und in den Taschen seines Jacketts verstauen musste. Eigentlich hätte er insgesamt sogar dreizehn dieser Geräte konfiszieren können, aber zum einen hat man als Pausenaufsicht ja auch noch etwas anderes zu tun und zum anderen vermochte er nicht so viele Apparate in seiner Kleidung unterzubringen. Vielleicht sollte er nächstens die Aufsicht mit einer Art Einkaufskorb antreten?
Von einigen der Delinquenten, die meinten ungeschoren davonkommen zu können, machte er aber mehr oder weniger heimlich und unauffällig Fotos mit seiner Taschenknipse, einer legendären Olympus XA, die er eigentlich immer in der Tasche mit sich herumtrug, um die Betreffenden in den nächsten Tagen, wenn der Film voll und entwickelt worden war, identifizieren zu lassen, indem er die Fotos in den Lehrerzimmern auslegte. Schließlich konnte man ja unmöglich alle Schüler einer Schule dieser Größenordnung kennen. Diese fotografische Safari war für Hieronymus das, was ihm Spaß machte am Aufsichtführen, der Nervenkitzel, ob es ihm wieder einmal gelingen würde, ein brauchbares Foto eines Jugendlichen zu schießen, mit dem dieser notfalls identifiziert werden konnte. Eine Fotosafari in der afrikanischen Savanne konnte da nicht aufregender sein.
Er fotografierte offen und natürlich ebenso »nur für den Dienstgebrauch« auch diejenigen, denen er zuvor das Handy abgenommen hatte. Die bekamen dann von Hieronymus das Duplikat eines Vordrucks, von denen man als Pausenaufsicht tunlichst immer etliche bei sich trug, auf dem der Name des Schülers, seine Klasse, der Typ des Handys sowie das Kürzel des Aufsicht Führenden, Datum und Zeit vermerkt wurden. Mit diesem Zettel - und ausschließlich im Besitz von diesem - konnte der jeweilige Schüler dann frühestens zwei Tage später sein geliebtes Spielzeug im Sekretariat der Schule wieder abholen. Offenbar waren aber nicht alle Geräte so geliebt, denn im Laufe der letzten Jahre hatte sich bereits eine kleine Sammlung nicht abgeholter Geräte gebildet.
Wer bei dieser Prozedur Hieronymus gegenüber einen falschen Namen angab, hatte bei der Abholung, wenn der Schülerausweis mit Foto vorgelegt werden sollte, ebenso schlechte Karten wie derjenige Regelverstoßer, der sich der Aufsicht gegenüber geweigert hatte, seinen Namen zu nennen oder sogar so eigensinnig gewesen war, nicht nur seinen Namen nicht zu verraten, sondern sogar sein Gerät nicht auszuhändigen. Hatte Hieronymus dann bereits ein Foto von ihm gemacht, folgte in einigen Tagen nach der erfolgreichen Identifizierung unweigerlich der disziplinarische Hammer, der eigentlich den Wunsch in ihm wecken sollte, das Handy doch rechtzeitig abgegeben zu haben.
Dann nämlich, wenn die Erziehungsberechtigten des Delinquenten auch mitspielten. Was sie aber oft nicht taten, waren sie doch mehrheitlich der Meinung, dass die Nutzung eines Handys jederzeit und an jedem Ort durch ihren Nachwuchs nicht nur für die Ausbildung von dessen Medienkompetenz für das spätere Berufsleben unerlässlich sei. Wobei sie natürlich tunlichst vergaßen, dass eben diese Berufsausbildung bei einer solch eigenständigen Auslegung geltender Regeln des Betriebs zu einem unvermutet plötzlichen Ende gelangen kann. Außerdem handele es sich bei dem Phänomen angeblich geradezu um ein Grund- oder Menschenrecht, und die Schule habe daher gar nicht das Recht, in die Verwirklichung der Grund- und Menschenrechte ihrer Sprösslinge einschränkend einzugreifen, meinten viele der angeblich Erziehenden. Kein Wunder also, dass der Kampf der Schule gegen die grassierende Handy-Seuche ein ewiger und nicht gewinnbarer blieb.
Die Haltung besagter Eltern bezüglich der unbedingten Handy-Freiheit ihrer Kinder übertrug sich oft derart auf diese, dass sie in den Großen Pausen gerne auf einer der Bänke unter den beiden großen Linden im Schulhof saßen und ihren Blick auf die Displays ihrer Geräte klebten, wodurch sie dann zur sehr leichten Beute eines Aufsicht führenden Lehrers wurden, der dann zu ihrer Enttäuschung nicht gewillt war, die Einstellung ihrer Eltern in der Sache freudig zu teilen oder wenigstens mit ihnen zu diskutieren. Aber leider war eben der Platz zur Aufnahme der Handys für Hieronymus begrenzt, jedoch war das nur ein logistisches Problem, das man lösen konnte.
Nach der Pause schaffte es Hieronymus nur noch, die eingesammelten Geräte samt der dazugehörigen Formulare im Sekretariat bei der Sekretärin Beate Niedenhaus abzugeben, im Lehrerzimmer vergeblich nach dem Kollegen Richtofen Ausschau zu halten, um ihm vielleicht noch ein paar ergänzende Worte zu dem allzu knapp gemeldeten Todesfall zu entlocken, und auf dem Vertretungsplan zu entdecken, dass Schulleiter Dr. Zürn neuerdings für die Erste Große Pause am folgenden Tag eine Vollversammlung der Schule in der auch als Aula genutzten Mehrzweckhalle anberaumt hatte. Dieser Vertretungsplan war seit Kurzem in dem »Digitalen Dienstbuch« integriert, welches sich Hieronymus im Lehrerzimmer auf einem Flachbildschirm präsentierte. Diesem konnte er außerdem in aller Eile noch die wichtige Information entnehmen, dass »... neue Zangen für die SuS zum Aufsammeln von Müll angeschafft worden ...« seien (»SuS« war die gängige Abkürzung für Schülerinnen und Schüler, denn »SS« ging ja nun aus offensichtlichen Gründen gar nicht. Aber zu denken, »LuL« stünde für Lehrerinnen und Lehrer, wäre irrig; dafür benutzte man »KuK« und meinte Kolleginnen und Kollegen).
Dann musste Hieronymus schleunigst in den nächsten Unterricht. Mit PGW im zweiten Semester, also Schülern der 12. Klasse, erwarteten ihn zwei relativ entspannte Stunden. Sogenannte Disziplinprobleme in Form von störenden Verhaltensweisen standen da nur selten noch auf der Tagesordnung, wenn man davon absehen konnte, dass auch in diesem Jahrgang noch ein gewisser Hang zur Geschwätzigkeit herrschte. Wäre der Autor Neil Postman nicht zu früh verstorben, hätte er vielleicht noch ein Buch verfasst mit dem Titel: »Wir quatschen uns zu Tode«.
Auch wenn nicht zu erwarten war, dass alle Schülerinnen und Schüler in diesem Kurs bis zu den Abiturprüfungen durchhalten würden, dass alle zu den Prüfungen zugelassen werden würden und dass alle, die soweit gekommen sein würden, auch die Prüfungen bestehen würden, so waren doch solche »Knallschoten« wie Luke aus dem Jahrgang Zehn schon nicht mehr dabei in der Oberstufe. Probleme, die es hier natürlich auch gab, waren subtiler. Hohe und zudem unentschuldigte Fehlzeiten etwa oder zu viele Kursteilnehmer, die unvorbereitet in den Unterricht kamen, so dass man erst einmal das vorliegende Material zum Thema gemeinsam, womöglich mit lautem Vorlesen, zur Kenntnis nehmen musste, bevor man sich damit auseinandersetzen konnte. Das sorgte dann für Zeitdruck, denn die Themen und Inhalte wurden ja behördlich im Rahmen des Zentralabiturs vorgegeben, und das ließ ohnehin wenig Zeit und Raum für eine eigene Schwerpunktsetzung des Kurses oder für thematische Exkurse.
Nach dieser recht entspannenden, aber heute auch nicht so wirklich interessanten und anregenden Doppelstunde wollte Hieronymus erneut versuchen, mit dem Kollegen Moritz von Richtofen über dessen Botschaft zu sprechen, um Genaueres zu erfahren, denn schließlich war ihm der Kollege Mausmann nicht nur als Schulinspekteur durchaus bekannt, aber wiederum vermochte er Moritz nicht aufzufinden. Der Stundenplan von Richtofens, der wie der von allen Unterrichtenden für jedermann jederzeit einsehbar in beiden Lehrerzimmern aushing, verriet aber nichts über dessen aktuellen Aufenthalt, denn eigentlich folgten für ihn ebenfalls noch zwei Stunden Unterricht.
Hieronymus begann langsam damit, sich mit dem Umstand abzufinden, dass er von seinem Freund Moritz heute nichts Näheres mehr erfahren konnte. So schlimm war das aber trotz aller Neugier nicht, denn Hieronymus verfügte ja noch über eine viel bessere und verlässliche Quelle. Nur eben nicht hier in der Schule.
5.
»Lasst, die Ihr eintretet, alle Hoffnung fahren!« Diese Aufforderung des italienischen Philosophen und Dichters Dante Alighieri in seiner »Göttlichen Komödie« lässt den irrtümlichen Eindruck entstehen, dass er bereits gewusst hat, was Unterricht in einer achten Klasse einer Hamburger Stadtteilschule bedeutet. Aber wenn dem tatsächlich so gewesen wäre, dann hätte er diesem Phänomen in seiner Schilderung des »Inferno« sicher einen ganzen Höllenkreis gewidmet. Hieronymus aber hatte das Phänomen kennen lernen dürfen und befand die übrigen Kreise der Hölle in Dantes »Inferno« seitdem als recht gemütliche Orte. Er hatte den Auftrag, die 8a im Fach Gesellschaft zu unterrichten, was aber nur bedeutete, die vier Wochenstunden einigermaßen heil an Körper und Seele zu überleben. Da fiel eine vorübergehende Taubheit seines Gehörs nach einer Doppelstunde überhaupt nicht ins Gewicht.
Eigentlich waren die Unterrichtsthemen, festgelegt durch den sogenannten Rahmenplan, welcher zur Zeit ein »Verfallsdatum« von knapp einem Jahr aufwies, ja unter anderem die ökonomischen, sozialen und politischen Entwicklungen des Neunzehnten Jahrhunderts in Deutschland, aber das sahen die lieben, voll pubertierenden Schülerinnen und Schüler ganz anders als der Rahmenplan und ihr Lehrer, denn sie waren vor allem an ihrer eigenen ökonomischen und sozialen Entwicklung in gelegentlicher und lockerer politischer Kooperation mit Mitschülern, aber meist eher in Konkurrenz zueinander interessiert.
Zum zweiten Mal heute fiel Hieronymus eine Zeile aus BOB DYLANs All Along the Watchtower ein:
»There must be some way out of here!«
Ansonsten versprach er sich nur das Schlimmstmögliche von der bald anstehenden Klassenarbeit. Er würde seine Benotungsansprüche wieder einmal in den Keller bringen müssen, denn da eine Klassenarbeit, bei der mehr als ein Drittel der Ergebnisse »unter dem Strich« lagen, von der Schulleitung genehmigt werden musste, würde eine Beibehaltung seines geplanten und ohnehin schon niedrigst angesetzten Bewertungsmaßstabes zur Folge haben können, dass die Arbeit eben nicht genehmigt werden würde und daraufhin zu wiederholen sei. Hieronymus vermochte aber keinen Grund für die Annahme zu sehen, dass eine Wiederholung außer zu mehr Arbeit für ihn und zu einem Proteststurm der Klasse zu einem besseren Ergebnis führen würde.
Die Schüler wussten nichts, kannten nichts und konnten nichts. Natürlich nur bezogen auf die Unterrichtsinhalte, bezogen auf aktuelle Serien und die Werbung im Privat- und Bezahlfernsehen oder im Netz, auf Themen und Meinungen in den sozialen Netzwerken und überhaupt jeden öffentlichen Klatsch und Tratsch, waren sie dagegen hochinformiert und topfit.
Doch Hieronymus überlebte den »Winter« dieser fünften und sechsten Stunde in der 8a am Montag wie üblich auch diesmal. Er durfte sogar Alfredo begrüßen, der kurz einmal hereinschaute, aber sich nach einer Viertelstunde wieder trollte, nachdem er die Klasse nach Kräften »aufgemischt« hatte. Angeblich ging er zu einer besonderen Maßnahme der Schule zur Betreuung für Schüler wie ihn, was Hieronymus aber aktuell nicht überprüfen konnte, weil er nicht über eine Teilnahme Alfredos an dieser Maßnahme informiert worden war, die Maßnahme sowieso nur vom Hörensagen kannte und deswegen auch nicht wusste, wen er wo und wann deswegen nach dem Unterricht darauf hätte ansprechen können.
Den »Pieper« für die Schülertoilette behielt Hieronymus tunlichst in der Hosentasche und rückte ihn nur heraus, nachdem sich ein Schüler, der die Toilette während der Unterrichtszeit aufsuchen wollte, einigermaßen ordentlich in die dafür zur Dokumentation ausliegende Liste eingetragen hatte. Anderenfalls wäre der »Pieper« am Anfang der Stunde bereits verschwunden gewesen und die ganze Unterrichtszeit von Hand zu Hand gegangen, wenn die Schüler zu zweit oder in größeren Gruppen das Bedürfnis nach einem ausführlichen Plausch auf der heimeligen Toilette verspürt hätten. Aber auch so musste Hieronymus zwischendurch eine Gruppe von
Schülern, die sich im Treppenhaus vor dem Klassenraum versammelt hatten, ziemlich energisch wieder zum Unterricht in den Klassenraum komplimentieren.
Natürlich gab es auch einige Schüler, die heute keinen Tag zum »Austicken« hatten, sondern nahezu die ganze Zeit konzentriert arbeiteten, Hieronymus gelegentlich um Hilfe bei ihren Aufgaben baten und nur kurz und vorübergehend in ein Gesprächsgeplänkel mit anderen abglitten. Andere aber verspürten das plötzliche, ununterdrückbare Bedürfnis laut zu singen oder sich bei Mitschülern auf den Tisch zu setzen. Hier im Neubau gab es keinen eigenen Gruppenraum als abgegrenztes Territorium einer Klasse mehr, so dass sich lernwillige Schüler ebensowenig darin vom Rest der Klasse absondern konnten wie solche, die möglichst unbeobachtet vom Lehrer ihren unterrichtsfremden Beschäftigungen nachgehen wollten. Der einzige Differenzierungsraum der ganzen Etage war für Wochen schon ausgebucht.
Es war auch wieder kaum zu glauben, was sich alles nach Meinung der Lieben als Wurfgeschoss eignete; da konnte schon mal eine Schere quer durchs Klassenzimmer fliegen. Der immer wieder aufs Neue anschwellende Lärmpegel in der Klasse machte zwar anscheinend den Schülern nichts aus, sorgte aber wieder dafür, dass Hieronymus für einige anschließende Stunden in seiner Hörfähigkeit eingeschränkt war. Dass der Hausmeister während der Unterrichtszeit den Rasenmäher direkt unterhalb des Klassenzimmers knattern lassen musste, weil es natürlich nicht möglich war, solche Arbeiten am späteren Nachmittag nach Unterrichtsschluss zu erledigen, spielte eigentlich auch keine Rolle mehr.
Beinahe hätte Hieronymus sein Vorhaben vergessen, nach dem Unterricht des Tages noch die Noten für seinen Viertsemesterkurs der Oberstufe abzugeben, denn er hatte bereits den Schuleingang hinter sich gelassen und den Weg zu seinem Wagen eingeschlagen, als es ihm glücklicherweise doch wieder einfiel und er kehrt machte, um es noch zu erledigen.
Auf diese Weise kam Hieronymus an diesem Tag zum zweiten Mal an dem Motto der Schule vorbei, einem Zitat des Namensgebers, welches in Bronze gegossen neben der Eingangstür hing und schon mehrfach Opfer eines Farbattentats geworden war:
»Die Akzeptanz der Unterschiede ist Voraussetzung für die Überraschung von Gemeinsamkeiten.«
Noch niemals überrascht war Hieronymus davon gewesen, dass die Schüler generell ebenso über Unterrichtsausfall erfreut waren wie er, trotz aller Unterschiede zwischen ihnen und ihm, akzeptiert oder nicht.
Pures Glück war es dann ebenfalls, dass einer der Rechner, in die er seine Zensuren eingeben konnte, nicht besetzt war und ihm nach den zwei Stunden 8a-Inferno sogar das erforderliche Passwort für die Eingabe wieder einfiel. Allerdings hatte sich das Passwort seit fünf Jahren auch noch nie geändert. Die Noteneingabe selbst bewältigte Hieronymus mit zitternden Fingern auch noch relativ problemlos, aber der Drucker wollte ihm partout nicht die Liste ausspucken. Dabei hätte er gerne in Ruhe zuhause die Eingaben in den Rechner mit seinen Eintragungen in dem gelben Kursheft noch einmal verglichen, anstatt dies erst bei der Zeugniskonferenz am Mittwochnachmittag tun zu können.
6.
Am Nachmittag im Garten konnte sich Hieronymus partout nicht auf seine Lektüre konzentrieren. Eigentlich wollte er einen Text für seinen Philosophie-Unterricht der zehnten Klasse lesen, aber er musste schließlich widerwillig zur Kenntnis nehmen, dass er zwar immer wieder den aufgeschlagenen Text anstarrte, aber überhaupt nicht las, nicht auffasste, was da stand, sondern seinen Gedanken nachhing, die überhaupt nichts mit dem Text zu tun hatten. Dabei waren die äußeren Bedingungen um ihn herum doch eigentlich ideal, um sich in die Gedankenwelt von Richard David Precht zu vertiefen, denn es war ruhig, wenn man von den gelegentlich unweit im Landeanflug oder beim Start befindlichen Flugzeugen absah, und auch von den Temperaturen her vielleicht zum ersten Mal in diesem Jahr so, dass man es gut draußen auf der Gartenbank aushalten konnte, wenn man sich eine Wolldecke umgelegt hatte.
Aber Hieronymus saß auf der weißen Holzbank unter dem großen Apfelbaum, der gerade zaghaft begann auszutreiben, im Garten der Boschs und konnte sich nicht für Prechts Gedanken interessieren, weil er immer wieder aufs Neue in eigene Gedanken abglitt und seine Augen gleichsam wie Brenngläser bereits Löcher in den Text zu brennen schienen. Als er nicht nur deswegen einmal aufsah, bemerkte er, dass Molly unmittelbar vor ihm stand und ihn ebenso geistesabwesend anstarrte wie er eben noch die Zeilen und Buchstaben auf dem weißen Papier und dabei wie meistens mit ihren Kiefern vor sich hin malmte.
Schafe sind Widerkäuer und Molly war ein Schaf, insofern waren ihre geduldig andauernden Kieferbewegungen nichts Ungewöhnliches, aber dass sie Hieronymus dabei so anstarrte, war schon ungewöhnlich. So, als wollte sie ihm sagen:
»Lass´ es, das wird ja doch nichts!«.
Als ob sie sich ertappt fühlte, sah Molly auch gleich weg, als ihr Blick von Hieronymus erwidert wurde und wandte sich wieder ihrer Haupt- und Lieblingsbeschäftigung zu, dem Grasfressen. Genau deswegen bewohnte Molly ja auch das Anwesen der Boschs im Narzissenstieg der Gartenstadt in Hamburg-Alsterdorf. Sie hielt den Rasen kurz, der den größten Teil des Grundstücks um das kleine Backsteinhaus ausmachte, und ersparte so einen lärmenden und vielleicht auch stinkenden Rasenmäher und vor allem die Mühe, diesen regelmäßig zu benutzen.
Vor einiger Zeit hatten Nachbarn Molly angetroffen, wie sie die nähere Gegend erkundet hatte, indem sie ein Stück die Straße hinunter gegangen war. Das hatte die Boschs zu zwei Konsequenzen bewogen. Zunächst war die bisherige Schwachstelle in der Umzäunung des Grundstücks beseitigt worden, indem auch der Zugang zur Haustür von der kleinen Pforte an der Straße aus zu beiden Seiten mit einem niedrigen Zaun flankiert worden war, so dass Mollys Neugierde Grenzen gesetzt waren. Zum Anderen hatte sie Gesellschaft in Form eines zweiten Schafs bekommen, allerdings keines echten, man hatte sich ja nicht auf die Schafzucht verlegen wollen, sondern in Form eines blauen Holzschafs ins Lebensgröße. Molly schien diesen Partner zu akzeptieren, auch wenn die Möglichkeiten der Interaktion wohl begrenzt waren, jedenfalls fand das blaue Schaf eine gewisse interessierte Duldung bei ihr.
Natürlich hatte diese Methode der Gartenpflege mittels eines lebenden Tieres auch seine Nachteile. So konnte man im Garten nicht nur überall sehen, wo das abgefressene Gras in veränderter Gestalt abgeblieben war, sondern man roch es auch. Zudem setzte so ein Schaf ja auch Wolle an und musste deshalb regelmäßig unter die Schere. Dafür konnte man es aber nicht bei den eigenen Frisör-Terminen einfach so mitnehmen, und so kam zu diesem Zweck zu vereinbarten Terminen ein befreundeter Schafzüchter aus der Wedeler Elbmarsch mit seiner Ausrüstung bei den Boschs vorbei, der Molly auch Kost und Logis für die kalte Jahreszeit und für die Sommerferien bot.
Zu den Boschs gehörten neben Molly und Hieronymus auch seine Frau Helene. Denkt man bei diesem Namen aber vielleicht an eine blonde Schlagersängerin, so liegt man sowas von falsch, denn Helene Bosch war in ihrer Haarfarbe dunkelkupferrot und in ihrer politischen Gesinnung sogar hellknallrot. Und beides sogar, obwohl sie Polizistin in Hamburg war. Dieses war auch der Grund, warum an der Haustür der Boschs kein übliches Namensschild hing, sondern nur eines mit dem dezenten Hinweis, dass hier »H.B. & H.B.« zuhause seien. Denn während Hieronymus´ Klientel aus dem »Wilden Osten« Hamburgs sich eher selten nach Hamburg-Alsterdorf in die Gartenstadt verirrte - genau genommen nie, da war sogar Helgoland schon naheliegender - traf dasselbe für die »Klienten« von Helene schon weniger zuverlässig zu. Verwunderlich in diesem Zusammenhang war aber, dass es zwar in der Nachbarschaft zunehmend Einbrüche gab, die Boschs aber in all den Jahren trotz des anonymisierten Namensschildes noch nie solchen »Besuch« gehabt hatten.
Zyniker sprachen bezüglich Helenes roter Haarpracht von einem »letzten Aufflammen« und Zyniker gab es bei der Polizei reichlich, aber Helene erreichte der Zynismus ihrer Kollegen schon lange nicht mehr.
Kinder hatten die Boschs nicht und eigentlich auch nicht vermisst bisher, denn Hieronymus als Lehrer pflegte bei dem Thema immer zu sagen:
»Was, keine Kinder - ich habe hunderte!«
Und Helene glaubte einfach, dass ihr Beruf als Mitglied der Hamburger Mordkommission mit seinen speziellen hohen Ansprüchen, erschütternden Erlebnissen und unregelmäßigen Arbeitszeiten ihr nicht die Chance gäbe, eigenen Kindern gerecht werden zu können. Deshalb gab es im Haushalt der Boschs außer ihnen und Molly kein weiteres Lebewesen, und man meinte, dass das auch gut so sei und man es auch mittlerweile, wo man damit begonnen hatte, in die reiferen Jahre zu kommen, nicht zu bereuen brauche. Obwohl ...?
Aber was war es denn eigentlich, was Hieronymus immer wieder und so nachhaltig vom Studium der zweifellos wertvollen Gedanken des prominenten und telegenen Philosophen abhielt? Zwar hatte er inzwischen erfolgreich sein Grübeln bezüglich des gewaltsamen Todes des Schulinspektors Mausmann zügeln können, nicht aber seine Erinnerungen an jenen Mann selbst. Mausmann hatte mehrfach das Leben beziehungsweise die berufliche Tätigkeit von Hieronymus tangiert und zwar mit einer stringenten und nachhaltigen Note des Unangenehmen. Vielleicht konnte man es sogar Bösartigkeit nennen. Zwar wusste Hieronymus, dass sich sein Chef, Schulleiter Dr. Zürn, zu den Freunden Mausmanns zählte, aber wegen seiner eigenen Begegnungen und Erfahrungen mit dem Mann fiel es ihm einfach schwer, sich vorstellen zu können, dass der viele Freunde in seinem Leben gehabt haben könnte.
Einmal, im vergangenen Schuljahr bei der jüngsten Inspektion der Peter-Ustinov-Schule, hatten sich Mausmann und er gegenüber gestanden und Hieronymus selbst hatte damals das nur knapp bezwingbare Bedürfnis verspürt, seinem Gegenüber an die Gurgel zu springen. Im Rahmen jener Inspektion war Mausmann unangekündigt in Hieronymus´ Unterricht gekommen und hatte verblüfft zur Kenntnis genommen, dass dieser mit nur drei Schülerinnen im Raum anzutreffen war anstatt mit einem ganzen Seminar-Kurs von vierundzwanzig im vierten Semester. Hieronymus hatte ihm dann erläutert, dass die anderen Kursteilnehmer gerade in ihren jeweiligen Arbeitsgruppen dabei wären, ihre Seminararbeit irgendwo in der Schule oder zuhause bei einem Mitglied der Gruppe zu bearbeiten. Oder dass sie irgendwo in der Stadt ein Interview führten, Erkundigungen beziehungsweise Messungen durchführten oder Fotos und Videos zu diesem Zweck erstellten.
»Wie beaufsichtigen Sie denn die Ihnen anvertrauten Schülerinnen und Schüler, wenn Sie noch nicht ´mal wissen, wo sie sich aufhalten?«, hatte Mausmann von Hieronymus wissen wollen, nachdem er ihn vor den Klassenraum gebeten hatte, um die anwesenden Schülerinnen nicht an dem Gespräch teilhaben zu lassen.
»Ich habe eine Liste von allen mit den Telefonnummern und Handynummern«, hatte Hieronymus erwidert. »Ich kann sie jederzeit anrufen, wenn es nötig sein sollte.«
»Schön und gut, dass Sie das können, aber das ersetzt doch keine Beaufsichtigung«, hatte Mausmann sofort begonnen Hieronymus anzugiften. »Sie haben eine Aufsichtspflicht, Herr Kollege!«
»Natürlich können mich die Schüler von unterwegs ebenfalls anrufen, wenn sie eine Frage haben oder wenn es ein plötzliches Problem gibt«, hatte Hieronymus versucht zu beschwichtigen, aber Mausmann hatte ihn kaum ausreden lassen, bevor er süffisant fortgefahren war:
»Ach ja, und bei einem Problem verlassen Sie dann womöglich während der Dienstzeit die Schule und eilen irgendwo hin in der Hoffnung, dass der Anrufer in der Zwischenzeit nicht unter die Räder gekommen ist?«
»Na ja, selbstständiges Lernen, die Erziehung zur Selbstständigkeit überhaupt, erfordert doch ein gewisses Loslassen ...«, hatte Hieronymus gerade noch ausstoßen können, bevor Mausmanns nächste donnernde Salve auf ihn niedergegangen war:





























