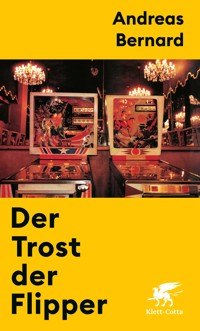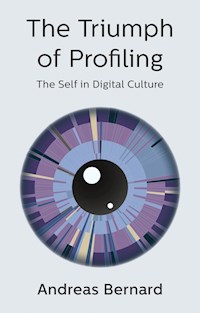Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
München, Mitte der 1990er Jahre: Tobias Lehnert hat gerade sein Studium beendet. Doch nun? Wie wird sein Leben weitergehen, zwischen Konzerten von Punkbands, dem Job in einem Flüchtlingsheim und der vagen Aussicht auf eine Doktorarbeit? Seine Rituale und Sehnsüchte findet Tobias in den Artikeln in der Zeitschrift Vorn wieder, der Jugendbeilage einer großen Tageszeitung. Nach einigem Zögern schreibt er einen Beitrag über die Magie des Flipperspielens - und ist wenig später fester Autor des Magazins. Seine Freundin Emily, am Anfang noch angetan von Tobias' Eintritt in die Redaktion, beobachtet immer argwöhnischer, wie ihn seine Begeisterung für das Heft mitreißt. Spätestens als er sich in der Redaktion in Sarah verliebt, beginnt Tobias zu begreifen, dass er in eine völlig neue Welt geraten ist - eine Welt, deren Schauplätze und Freundeskreise mit den alten nichts mehr zu tun haben. Ein Riss tut sich auf zwischen seinem früheren und seinem jetzigen Leben. Ein brillanter, federleicht geschriebener Roman über das Jugendmagazin einer großen deutschen Zeitung und das Lebensgefühl in den neunziger Jahren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreas Bernard
Vorn
Roman
Impressum
ISBN 978-3-8412-0001-3
Aufbau Digital,veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, Februar 2010© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2010
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.
Umschlaggestaltung Tom Ising für HERBURG WEILAND, München
E-Book Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, www.le-tex.de
www.aufbau-verlag.de
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Informationen zum Autor
Impressum
Inhaltsübersicht
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
In dem Sommer, als Tobias Lehnert zum Vorn-Magazin kam, lag sein Abschluss an der Universität ein halbes Jahr zurück. Die vier oder fünf Leute, mit denen er gemeinsam die Seminare besucht und die Mittagspausen verbracht hatte, beschäftigten sich schon längst mit der Vorbereitung ihrer Doktorarbeit. Tobias dagegen wollte erst einmal nichts mehr mit Büchern zu tun haben; er hatte seit der letzten Prüfung im Januar nicht einmal die Kraft gehabt, die Papierstöße mit Kopien und Exzerpten wegzuräumen, die sich die ganze Examenszeit über neben seinem Schreibtisch aufgetürmt hatten. Natürlich hätte auch er mit einer Doktorarbeit beginnen können, doch beim Gedanken an die Universität spürte Tobias weiterhin nichts als Überdruss. Er bemerkte das vor allem, wenn er seine Freunde, die schon wieder jeden Vormittag in der Bibliothek saßen, wie früher in der Cafeteria der Kunstakademie zum Mittagessen traf. Sobald Tobias sich von der breiten Ludwigsstraße aus dem Universitätsviertel näherte, stellte sich ein leises Verlorenheitsgefühl in ihm ein. Die Luft schien drückender zu werden, so als würde er einen Durchgang passieren, eine unsichtbare Verengung, bevor er das belebte Karree zwischen Schelling-, Türken- und Adalbertstraße betrat. In dem anfangs so freundlichen Ensemble aus Universitätsgebäuden, Buchantiquariaten und Cafés fielen ihm jetzt nur noch die Risse auf, die befremdlichen, ins Endlose verlängerten Studentenexistenzen etwa, Obdachlose des akademischen Milieus, die draußen an den Tischen ihre verlässlichen Stammplätze einnahmen. Und wenn sein Blick im Gehen die Schaufenster der Antiquariate streifte, so automatisch wie in den Jahren zuvor, sah er, dass die alten Gesamtausgaben immer noch unberührt an derselben Stelle standen.
In dieser Zeit nahm Tobias lieber so viele Schichten wie möglich in der Flüchtlingsunterkunft an, in der er schon seit Jahren als Betreuer arbeitete. Der Studentenjob war gut bezahlt, und meistens tat er ohnehin nichts anderes, als stundenlang mit den bosnischen und vietnamesischen Kindern Fußball oder Tischtennis zu spielen. So oft es ging, war er in den Monaten nach seinem Abschluss auch unterwegs. An vielen Wochenenden begleitete er die Band Undone im Tourbus zu Konzerten, die in München und Umgebung gerade für Aufsehen sorgte mit ihrem brachialen Hardcore und einem an Wagner-Opern geschulten Sänger. Und mit seiner Freundin Emily unternahm er immer wieder längere Reisen: Sie fuhren in ein Fischerdorf auf den Kanarischen Inseln, wo sie die Stunden vor dem Abendessen immer in einem Spielsalon auf der Hauptstraße verbrachten, an den schlecht funktionierenden, abgespielten Flippern mit ihren schon ausgeblichenen Spielfeldern, deren Zustand sie an ihr eigenes Körpergefühl nach einem Tag am Strand erinnerte, an die trockene, von Sandkörnern bedeckte Haut. Sie reisten auf den Spuren seiner Familie durch Böhmen, wo sie aber die meisten Orte nicht finden konnten, weil Tobias’ Vater ihnen vor der Abfahrt wie selbstverständlich nur die deutschen Namen der Dörfer gesagt hatte, in denen den Großeltern vor dem Krieg ein paar Gaststätten gehörten. (In dem böhmischen Landstrich war dann niemand aufzutreiben, der noch die alten Namen kannte.) Und sie verbrachten, nun schon zum dritten Mal, ein paar Wochen gemeinsam in Amerika, die erste Hälfte in New York, die zweite in Kalifornien bei Tobias’ Verwandten.
Tobias wusste genau, dass er auf keinen Fall wie viele seiner älteren Teamkollegen in der Unterkunft enden wollte, die den bequemen Arbeitsbedingungen dort erlegen waren und sich in dem Job auf Dauer eingerichtet hatten. Doch spätestens nach der Rückkehr aus Amerika steigerten sich langsam die Zweifel in ihm: Er hatte jetzt vier, fünf Monate nur in dem Heim gearbeitet oder Urlaub gemacht, und seine anhaltende Gelassenheit, wie es nach der Universität weitergehen würde, wich einem immer größeren Unbehagen. Es häuften sich die Stunden, an denen er ratlos in der kleinen Küche seines Ein-Zimmer-Apartments saß, an dem ovalen Marmortisch, den er von Tag zu Tag hässlicher fand. Aus Langeweile begann er irgendwann damit, sein altes, um unzählige lose Zettel ergänztes Telefonbuch in einen neuen Notizblock zu übertragen: eine Arbeit, die ihn tatsächlich längere Zeit beschäftigte. Das bloße Abschreiben erschien ihm dabei wie ein Sinnbild seiner Stagnation. Er spielte jetzt manchmal mit dem Gedanken, sich für ein Praktikum bei einer Zeitung oder einem Magazin zu bewerben, und als er beim Erneuern des Büchleins, schon ganz gegen Ende, auf die Nummer seiner alten Bekannten Uta stieß, fiel ihm ein, dass er ihren Namen gelegentlich in der Tageszeitung las, auf der Seite mit den lokalen Kulturberichten. Er rief sie sofort an, redete ein paar unverbindliche Sätze zur Begrüßung, da sie sich schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen hatten, und sagte dann: »Du, ich habe mir gedacht, vielleicht könntest du mir weiterhelfen. Du arbeitest doch bei der Zeitung, und da ich gerade überlege …« Doch weiter kam er nicht, denn Uta fragte mit verwunderter Stimme: »Ich, bei der Zeitung? Wie kommst du denn darauf?« Und als Tobias sagte: »Na ja, Uta Weber, so verbreitet ist der Name doch auch nicht«, antwortete sie befremdet: »Ich heiße aber Schuster, erinnerst du dich, Uta Schuster.« Nach der Pause, die durch diesen Satz eintrat, war das Gespräch nicht mehr fortzuführen; Tobias legte schließlich mit einer verlegenen Entschuldigung den Hörer auf. Er war von der Peinlichkeit des Telefonats eine Zeitlang noch so eingenommen, dass die Praktikums-Idee wieder in den Hintergrund trat.
Die Tage drohten ihm nun endgültig auszufransen. An einem Vormittag im Juli fand er in der Post einen Brief seines alten Professors, dessen Oberseminar er noch gelegentlich besuchte. Er schrieb ihm, dass er Tobias an einen Berliner Kollegen weiterempfohlen habe, der gerade ein neues Forschungsprojekt aufbaue. Ohne jede persönliche Einladung fuhr Tobias nur ein paar Tage später nach Berlin, um sich das Institut anzusehen, und der leicht überstürzte Aufbruch war wie ein Ausdruck seiner Beunruhigung: Er wollte, wenn sich schon nichts anderes ergab, zumindest diese vage Gelegenheit ergreifen, um wieder an die Universität zurückzukehren. In dem Gespräch mit einem Mitarbeiter des Instituts, an einem Freitagvormittag in dem kurz vor Semesterende fast menschenleeren Universitätsgebäude, stellte sich aber sofort heraus, dass längst jemand anderes für den Posten vorgesehen war.
Ernüchtert saß Tobias nun vor einem Stapel Zeitungen im ICE zurück nach München, nachdem er sich mitten in der Nacht noch den von Christo verhüllten Reichstag angesehen hatte. Es war ein Montag, der Tag, an dem das Vorn herauskam. (Hieß es »das« Vorn, »die« Vorn? Der Artikel der Zeitschrift war unklar. Es schien, dass sich der Gebrauch nach Geschlechtszugehörigkeit unterschied. Die männlichen Leser verwendeten überwiegend die neutrale, distanziertere Form; von Mädchen in seinem Bekanntenkreis hatte Tobias aber schon häufiger gehört, dass sie etwas »in der neuen Vorn« gelesen hätten.) Das Magazin, das einmal in der Woche als Beilage einer großen Tageszeitung erschien, hatte es zu diesem Zeitpunkt vielleicht zwei Jahre gegeben. Bei seinem Leserstamm, der, entgegen der offiziellen Bezeichnung als »Jugendbeilage«, hauptsächlich aus Abiturienten und Studenten bestand, wurde es wie kaum eine andere Zeitschrift verehrt. In einem aktuellen Kinofilm hatte die Hauptfigur, ein 17-jähriges Mädchen aus einer bayerischen Kleinstadt, ihr gesamtes Jugendzimmer mit Seiten aus dem Vorn-Magazin beklebt, und man konnte sich gut vorstellen, dass es in vielen Zimmern tatsächlich so aussah. Tobias hatte die Zeitschrift jeden Montag beim Frühstück durchgeblättert, immer mit zwiespältigem Gefühl: Die Schreibweise der Artikel, gerade in den jüngsten Ausgaben, übte zwar einen bestimmten Reiz auf ihn aus, doch gleichzeitig war ihm die oft selbstverliebte Haltung der Autoren, der Ehrgeiz, in Fragen der Pop-Musik oder Mode den Ton anzugeben, nicht ganz geheuer. In seinem Bekanntenkreis gab es eine Fotografin, die gelegentlich für das Vorn-Magazinarbeitete, und wenn zwischen ihr und Tobias die Rede auf das Heft kam, gab er meistens ein paar gehässige Bemerkungen darüber ab.
An diesem Montag aber, auf der Rückfahrt nach München, war es anders. Die Vorn-Ausgabe, die er zwischen den Werbebeilagen in der Tageszeitung fand, war ein Sonderheft über das Thema Liebe, und schon bei der ersten Geschichte, die er las, spürte Tobias, dass dieses Heft etwas Außergewöhnliches war. Er hatte den Eindruck, dass hier sein eigenes Leben beschrieben wurde, Rituale und Sehnsüchte, die er von sich selbst allzu gut kannte. In einem Artikel ging es um die verschiedenen Erfolgsmomente oder Pannen, zu denen es beim ersten Telefongespräch mit einem Mädchen kommen kann, in einem anderen über die besondere Sprache von Liebespaaren, über Zeichen und Worte, die kein anderer außer den beiden versteht. Der Autor erzählte von einem Paar, das den Satz »Ich liebe dich« nie wirklich aussprach, sondern den Rhythmus der vier Silben nur von Zeit zu Zeit mit den Fingern auf die Schulter des anderen tippte.
In der Titelgeschichte des Heftes war von der Hingabe die Rede, mit der ein Junge Musikkassetten für ein Mädchen aufnimmt. Der Artikel beschrieb mit großer Eindringlichkeit, dass es bei solchen Mixtapes nicht einfach um eine Aneinanderreihung von Lieblingsliedern geht, sondern um eine komplexe innere Logik, um eine Dramaturgie von laut und leise, schnell und langsam, populär und unbekannt, die dabei mithelfen soll, ein Mädchen für sich zu begeistern. In der Geschichte wurde auch über die Katastrophe berichtet, dass man ganz am Ende einer Kassettenseite, beim vor- oder drittletzten Lied, plötzlich erkannte, dass der Aufbau von Anfang an falsch gewesen war. Das Gebilde musste also komplett wieder aufgetrennt und neu zusammengefügt werden.
Tobias hatte das Gefühl, ein solches Heft, eine solche Ansammlung von Artikeln noch nie gelesen zu haben. Es wurde nicht, wie sonst in Zeitschriften, über eine unzugängliche Phantasiewelt berichtet, über prominente Menschen und weit entfernte Orte, die nichts mit der eigenen Existenz zu tun hatten. Im Vorn – und das fiel ihm jetzt zum ersten Mal richtig auf – ging es tatsächlich um das alltägliche Leben der Redakteure und ihrer Leser. Tobias war verblüfft, wie viel in diesem Heft von seinen eigenen Erlebnissen steckte. Nahm er nicht auch seit Jahren Mixtapes für Emily auf? Er wusste, wie sehr der Verfasser dieses Artikels recht hatte. Tobias erinnerte sich an die Kassette, die er für Emily zusammenstellte, kurz nachdem sie sich kennengelernt hatten. Als er sie zum ersten Mal in ihrer Wohnung besuchte, lief gerade eine Platte von Fugazi aus Washington DC, einer der wichtigsten Bands für ihn damals. Er wusste also, dass sie einen ähnlichen Musikgeschmack hatten, dass Emily, was bei Mädchen nicht so häufig vorkam, auch laute Gitarrenmusik mochte. Auf der Neunzig-Minuten-Kassette, die er ihr dann ein paar Tage später schenkte, versammelte er seine ganzen Lieblingsbands, hauptsächlich aus dem Umkreis des Dischord-Plattenlabels, das der eine Sänger und Gitarrist von Fugazi betrieb. Tobias verbrachte ganze Abende mit der Ermittlung der richtigen Reihenfolge, nahm einerseits besonders eingängige Stücke auf, dann aber auch eine Reihe von Raritäten, unveröffentlichte Songs von einem Tape mit Fugazi-Aufnahmen etwa, das er in San Francisco einmal von dem Redakteur eines Punk-Magazins geschenkt bekommen hatte. Doch ansonsten hielt sich Tobias mit solchem Expertentum zurück, weil er wusste, dass Mädchen das meistens egal war. Er überreichte Emily die sorgfältig beschriftete Kassette, mit einem Titel versehen, dessen genau berechnete Kombination aus Originalität und Beiläufigkeit ihn Stunden gekostet hatte.
Noch im Zug nahm sich Tobias vor, auch einmal etwas für das Vorn zu schreiben. Als er mit Emily ein paar Tage später »Before Sunrise« von Richard Linklater im Kino sah, wusste er auch, wovon sein erster Artikel handeln würde. In dem Film gab es eine Szene, in der Ethan Hawke und Julie Delpy in einer Wiener Bar Flipper spielten, und Tobias stellte wieder einmal fest, wie unrealistisch in Filmen geflippert wurde. Ethan Hawke bediente die Schläger unkonzentriert, sah kaum auf die Kugel und unterhielt sich beim Spielen sogar mit seiner französischen Zufallsbekanntschaft. Am Ende dieser Szene – und das war das Unglaubwürdigste – drehte er sich mitten im Spiel von dem Apparat weg, schlug vor, noch irgendwo anders hinzugehen, und die herrenlose Flipperkugel fiel rasch ins Aus. Tobias wäre im Kino am liebsten ins Bild gesprungen, um die herabstürzende Kugel mit den Schlägern aufzufangen, wie einen Gegenstand, der zu zerbrechen droht. Kein Mensch, dessen war sich Tobias sicher, würde in Wahrheit so spielen, am wenigsten in Gegenwart eines Mädchens, das einem gefällt. Er wusste, wovon er sprach, denn seine erste richtige Verabredung mit Emily, der Abend vor viereinhalb Jahren, an dem sie zusammengekommen waren, hatte am Flipper in einer Münchner Kneipe angefangen.
Kurz nach dem Kinobesuch begann Tobias mit einer Geschichte über die Gesetzmäßigkeiten des Flipperspielens, und als er sie beendet hatte, saß er mindestens eine Viertelstunde vor seinem Telefon, neben sich die aufgeschlagene Impressums-Seite des Vorn-Magazins, und versuchte sich zu überwinden, in der Redaktion anzurufen. Er hatte unter den Namen im Impressum auch entdeckt, dass er eine der Redakteurinnen, Susanne Buchner, aus Erzählungen kannte; sie war auf derselben Schule wie Marius, der Sänger von Undone, gewesen. Irgendwann fand Tobias den Mut und wählte die Nummer des Sekretariats, der einzigen Durchwahl, die im Heft angegeben war. Die Leitung war besetzt, was ihn noch nervöser machte. Denn der lange regelmäßige Ton des Freizeichens hätte ihm vielleicht noch einmal Gelegenheit gegeben, seine Aufregung in den Griff zu bekommen, seinen Atem dem ruhigen Takt des Zeichens anzugleichen. Der Besetztton dagegen pochte nur hämisch zurück wie ein Echo seiner Nervosität. Nach ein paar Versuchen kam er schließlich durch, und Tobias ließ sich von der Vorn-Sekretärin mit Susanne Buchner verbinden. Er stellte sich kurz vor, erwähnte ihren gemeinsamen Bekannten, an den sich Susanne aber nicht erinnern konnte, und fragte sie, ob sie vielleicht an einem Artikel über das Flippern interessiert sei. Ihre Frage, ob er denn als freier Journalist arbeite, bejahte er einfach und war erleichtert, als sie nichts weiter wissen wollte. Tobias hatte Glück. Susanne Buchner betreute im Vorn genau die Rubrik mit dem Titel »Details«, für die er den Artikel gedacht hatte, und sie sagte ihm, er solle ihr das Manuskript einfach zuschicken.
Zwei Wochen später, an einem Nachmittag im August, besuchte Tobias zum ersten Mal die Redaktion. Er hatte noch einmal angerufen und sich erkundigt, ob das Manuskript auch tatsächlich angekommen war, und am Ende des kurzen Gesprächs hatte ihn Susanne in die Büroräume in der Innenstadt eingeladen. Als Tobias das Foyer der Tageszeitung betrat, zu der das Vorn-Magazin gehörte, ging er zum Pförtner und fragte nach dem Büro der Redakteurin. Die umständlichen Vorkehrungen, die nötig waren, um den Besucher nach oben zu lassen, verwunderten ihn nicht; sie entsprachen seiner eigenen Scheu, die Schwelle zum Vorn-Kosmos zu überschreiten. »Einen Moment«, sagte der Pförtner, ohne seinen Kopf zu heben, suchte in einem Schnellhefter eine Telefonnummer heraus, offenbar Susanne Buchners Durchwahl, und griff zum Hörer. »Da ist jemand für Sie hier unten«, sagte er, »ein Herr …« – er bat Tobias, seinen Namen zu nennen –, »ein Herr Lehnert.« Dann nickte er kurz, legte auf und schob Tobias ein Besucherformular hin, das er ausfüllen und beim Verlassen des Gebäudes von der Redakteurin unterschrieben abgeben musste. Erst jetzt öffnete sich eine niedrige Glastür, und der Pförtner erklärte ihm mit wenigen Worten den Weg in die Vorn-Redaktion.
Mit dem Fahrstuhl fuhr Tobias in den ersten Stock hinauf und stand in einem länglichen, durch Stellwände abgeteilten Großraumbüro, das sich auf den ersten Blick nicht von einer Versicherung oder einer Verwaltungsbehörde unterschied. Nur mit Verzögerung registrierte er die ganzen Plakate und Fotos, die über den Schreibtischen hingen und das Büro als Zeitschriftenredaktion kenntlich machten. Tatsächlich war das Vorn im Verwaltungsgebäude der Tageszeitung untergebracht (eigentlich eine provisorische Lösung, die aber schon seit zwei Jahren andauerte), und die Poster bildeten eine feine Trennlinie zwischen den fließend ineinander übergehenden Bereichen auf dem Stockwerk. Ein paar Meter links und rechts von der kleinen Vorn-Abteilung sah man bereits die notorischen Witzschilder des Bürobetriebs an den Pinnwänden, »Ich bin auf der Arbeit, nicht auf der Flucht«, oder »Unmögliches erledigen wir sofort, Wunder dauern etwas länger«. Über den Arbeitsplätzen der Vorn-Mitarbeiter hingen dagegen vergrößerte Titelbilder des Magazins, Konzertplakate von Massive Attack und Oasis oder ein Mannschaftsfoto des FC Bayern München, und statt der üblichen Büro-Kaffeebecher mit nicht mehr vollständig zu tilgenden Rändern an der Innenseite standen große Mineralwasser-Flaschen der Marke Volvic auf den Schreibtischen. Tobias fragte ein Mädchen, das an ihm vorbeilief, nach dem Platz von Susanne Buchner. Sie hatte offenbar gerade etwas in der Grafikabteilung zu besprechen; das Mädchen deutete aber mit einer Handbewegung auf den Schreibtisch der Kollegin und bot ihm an, sich auf einen Stuhl zu setzen, so dass er Gelegenheit hatte, sich in Ruhe umzusehen.
In der Redaktion arbeiteten vielleicht fünfzehn Leute, fast alle zwischen Anfang und Ende zwanzig; sie telefonierten, standen am Kopierer, besprachen miteinander ein paar gerade fertiggestellte Heftseiten. Es war aufregend für Tobias, jetzt zum ersten Mal all die Gesichter zu den bekannten Namenszügen am Ende der Texte zu sehen. Er versuchte unter den Redakteuren, die vor ihren Computern saßen oder in Gruppen zusammenstanden, diejenigen zu identifizieren, deren Geschichten ihn am meisten begeisterten, sich zu überlegen, welches Gesicht zu welchem Namen passen könnte. Es gab einen, Felix Mertens, dessen Artikel ihm besonders imponierten. Von ihm stammte die Geschichte über die Liebesrituale in dem Sonderheft ein paar Wochen zuvor, und auch sonst waren Tobias in der letzten Zeit eine ganze Reihe von Felix’ Artikeln aufgefallen, in einer betont lakonischen Art geschrieben, meistens in der Ich-Form. Er war der Autor, der den Tonfall im Vorn am stärksten prägte, der das Heft vor allen anderen Mitarbeitern von den etwas unbeholfenen, stadtzeitungshaften Ausgaben der Anfangstage in dieses so beliebte Magazin verwandelt hatte. Aus dem Impressum wusste Tobias, dass Felix Mertens kein festes Mitglied der Redaktion war, sondern ein freier Autor (auch in der Tageszeitung selbst tauchte sein Name manchmal auf). An einem Schreibtisch sah er jetzt zwei Leute stehen, die sich miteinander unterhielten. In dem einen, mit weit über die Ohren gekämmtem Britpop-Haarschnitt und einem englischen Fußballtrikot zur beigen Cordhose, glaubte er den Pop-Redakteur des Heftes zu erkennen, Robert Veith, dessen Foto hin und wieder in Musikmagazinen abgedruckt war. Der andere, der an Roberts Schreibtisch lehnte, sah sehr lässig aus; er hatte schwarze lockige Haare und wirkte fast ein bisschen südländisch. Tobias war sich plötzlich sicher, dass das Felix Mertens sein müsse; ja, das Gesicht, das ganze Auftreten schien genau die Souveränität, das Wissen um die Welt auszustrahlen, das in seinen Artikeln immer so faszinierte. Die beiden redeten aufeinander ein, lachten viel, womöglich kamen sie gerade auf die Idee zu einem jener gemeinsamen Artikel, die sie im Vorn regelmäßig veröffentlichten. Erst kürzlich hatten die beiden einen Text über Band-T-Shirts geschrieben, und es war die Rede von einem alten, ausgeblichenen Pink-Floyd-Shirt gewesen, das Mertens auf einer Party getragen und damit für Furore gesorgt hatte. Jetzt konnte sich Tobias also ein Gesicht dazu vorstellen. (Ein paar Monate später, als er schon regelmäßiger freier Autor beim Vorn-Magazin war, sah Tobias auf der Einweihungsfeier der neuen Redaktionsräume einen Gast in einer Ecke stehen, alleine, mit einem Glas Sekt in der Hand. Er war ziemlich klein, hatte kurzes, schütteres Haar und trug eine Brille, und unter den ganzen sorgfältig zurechtgemachten Party-Besuchern fiel er durch seine abseitige Kleidung auf, ein leuchtend rotes Jackett aus rauem Stoff und darunter ein »König der Löwen«- T-Shirt. Tobias fragte Robert im Vorbeigehen, wer das denn sei, und er sagte: »Ach, das ist Felix Mertens, habt ihr euch echt noch nie kennengelernt?« Den dunklen, lockigen Typen von damals sah er in all den Jahren kein einziges Mal mehr, und als er Robert später einmal darauf ansprach, welcher Autor oder Fotograf das gewesen sein könnte, wusste der nicht einmal, von wem Tobias sprach.)
An diesem Nachmittag in der Redaktion wurde Tobias Mitarbeiter des Vorn-Magazins. Als Susanne Buchner zurück an ihren Platz kam und ihn begrüßte, sagte sie gleich, dass sie seinen Flipper-Artikel gut fände und ihn fast unverändert im Heft abdrucken würde, »schon in der 42«: eine Zählweise, die Tobias nichts sagte, da er als Leser nie auf die fortlaufende Nummerierung der wöchentlichen Ausgaben achtete; in der Redaktion selbst war diese Nummerierung dagegen das allgemeine Orientierungssystem. Susanne führte den neuen Autor anschließend von Schreibtisch zu Schreibtisch, stellte ihn allen Kollegen vor und erzählte ihm, für welche Teile des Heftes die anderen Mitarbeiter jeweils zuständig waren. Jede Vorn-Ausgabe bestand fast ausschließlich aus festen, wöchentlich wiederkehrenden Rubriken, von denen die Redakteure jeweils eine oder zwei betreuten. Eine dieser Rubriken setzte sich aus einer Reihe von Kurzporträts junger Menschen zusammen, die in der Erscheinungswoche der Ausgabe etwas Besonderes zu tun haben würden. Als die Redakteurin, die diese Seiten koordinierte, ein schwarzhaariges Mädchen namens Carla, ihn aufforderte, er könne jederzeit mit Ideen zu ihr kommen, sagte Tobias – er hatte insgeheim gehofft, dass es ein solches Angebot geben würde –, dass er sogar einen Vorschlag habe, einen jungen Skateboarder aus dem Jugendzentrum, in dem Emily seit kurzem arbeitete. Zu seiner Überraschung willigte Carla, die von den meisten in der Redaktion nur mit ihrem Nachnamen »Bertoni« angeredet wurde, sofort ein. »Klar, mach das doch«, sagte sie, »ich weiß ja von Susanne, dass du schreiben kannst.« Dann meinte sie noch, er solle bis nächste Woche »1500 Zeichen« abgeben: ein Ausdruck, der ihm als Längeneinheit von Texten noch nicht vertraut war.
Als Tobias das Vorn-Magazin nach vielleicht einer dreiviertel Stunde verließ, seinen Besucherschein abgab (er hatte in der Aufregung zuerst vergessen, ihn unterschreiben zu lassen, und musste noch einmal zu Susanne hinauf) und wieder nach draußen auf die Straße kam, war er in überschwänglicher Stimmung. Es hatte tatsächlich funktioniert! Er war jetzt Autor beim Vorn! Schnell ging er zum Marienplatz, der nur zwei Minuten von der Redaktion entfernt lag, und rief von einem der Münztelefone im U-Bahn-Geschoss Emily in ihrem Jugendzentrum an. Er erzählte ihr atemlos von den Redakteuren, von der reibungslosen Art, wie sich alles ergeben hatte, und von der unglaublichen Aussicht, jetzt schon mit einer bereits fest eingeplanten Geschichte über die Flipper – »in Heft 42, weißt du, also so in einem Monat« – und einer verabredeten in der kleinen Anfangs-Rubrik dabei zu sein. Diese begeisterten Berichte an Emily wiederholten sich in den darauffolgenden Wochen noch einige Male, denn immer wenn Tobias in die Vorn-Redaktion kam, um Texte abzugeben (er hatte kein Fax, und E-Mail wurde zu der Zeit noch nicht benutzt), kehrte er mit neuen Aufträgen zurück, durfte weitere Artikel schreiben, zumeist auf den Seiten von Carla, aber auch in der »Details«-Rubrik mit längeren Texten, die Susanne betreute. In diesem Bild – wie er Emily am Telefon im U-Bahn-Geschoss mit euphorischer Stimme die neuesten Ergebnisse seiner Besuche durchgab – war seine Erinnerung an die Anfangszeit beim Vorn noch Jahre später eingefasst.
2
Tobias und Emily hatten sich im Betreuerteam des Flüchtlingsheims kennengelernt. Die Unterkunft, ein notdürftig umgebautes Bürogebäude in einem Industriegebiet, wurde von einer Gruppe von fünfzehn bis zwanzig Studenten geleitet, die bei der Stadtverwaltung angestellt waren; es gab keine professionelle Heimleitung. Emily war eine Art Sprecherin des Teams und erstellte alle vierzehn Tage den Schichtplan. Tobias imponierte ihr Auftreten und die bestimmte Art, mit der sie die Konferenzen leitete und den Kontakt zu den behäbigen Sachbearbeitern vom Amt hielt, auch wenn diese Resolutheit auf den ersten Blick gar nicht zu ihrem fast zierlichen Aussehen passte. Aber obwohl Emily erst dreiundzwanzig war, schien sie seit langem mitten im Leben zu stehen, hatte schon ein Pädagogik-Studium abgeschlossen (das ihr verhasst war, wie er bald erfuhr) und mehrere Jahre in dieser Unterkunft gearbeitet. Von einem Kollegen aus dem Team hörte Tobias bei einer seiner ersten Schichten, dass Emilys früherer Freund ein bekannter Autonomer in München gewesen sei und mit ihr zusammen politische Veranstaltungen wie den »Volxtanz« organisiert habe. Man sah das ihrer Kleidung auch ein wenig an, dem schwarzen Halstuch und der Lederjacke, die sie meistens anhatte, und Tobias gefiel der Kontrast zwischen der Strenge, die von diesen Zeichen ausging, und der warmen Ausstrahlung ihrer Augen.
Näher kamen sie sich zum ersten Mal ein paar Wochen später, als sie gemeinsam den Einkauf für die große Weihnachtsfeier in der Unterkunft übernahmen. Tobias holte Emily an einem Tag Mitte Dezember in ihrer Wohnung im Glockenbachviertel ab. Als sie damals die Tür öffnete, bemerkte er sofort, wie schön ihre Wohnung eingerichtet war. Das Haus, im zweiten Hinterhof gelegen, war zwar alt und ziemlich heruntergekommen; ihr Bad befand sich sogar im Treppenhaus. Doch in Emilys Zimmern sah man im ersten Moment, dass darin jemand lebte, der mit viel Sorgfalt das meiste selbst gebaut und renoviert hatte. Tobias fielen auch die unzähligen Pflanzen auf den Fensterbrettern auf; er selbst hatte in seiner Wohnung nur einen einzigen Farn, dessen Blätter ständig abfielen und einen bräunlichen Ring um den Blumentopf bildeten, egal, wie oft er ihn goss.
In dem nur für Händler zugänglichen Großmarkt, in dem sie dank der Kundenkarte ihres Vaters einkaufen konnten, entdeckte Tobias in einem Regal die durchsichtigen Süßigkeitsbehälter mit rotem Deckel, die früher im Lebensmittelladen seines Wohnblocks an der Kasse gestanden hatten. Als Kind waren ihm die mit Gummischnullern oder Zuckererdbeeren gefüllten Dosen so riesig vorgekommen, als würden sie ein Vermögen kosten und niemals zur Neige gehen. Jetzt, im Großhandel, waren sie zu Dutzenden übereinandergeschichtet, und Tobias sah auch, dass sie überraschend wenig kosteten. Emily und er überlegten kurz, ob sie zwei, drei Dosen mit Brausetabletten als kleines Weihnachtsgeschenk für ihr Büro mitbringen sollten, doch sie wollten die alte Kindheitsvorstellung von der geheimnisvollen, unerschwinglichen Herkunft der Behälter nicht so ohne weiteres aufgeben und ließen es bleiben. Auch Emily konnte sich in ihrem alten Wohnviertel an einen solchen Laden erinnern, und während sie durch die langen Gänge des Großmarkts liefen, Unmengen von Glühwein, Plätzchen, Obst und Chips in die Einkaufswagen stapelten, kamen sie auf ihre Lieblingsplätze in der Kindheit zu sprechen. Tobias sagte irgendwann, er müsse zugeben, mit dreizehn, vierzehn einen beträchtlichen Teil der Zeit auch in zwielichtigen Wirtshäusern und Stehausschänken verbracht zu haben, weil er ein paar Jahre lang versessen aufs Flipperspielen gewesen sei. Und mit Erstaunen hörte er, dass Emily eine ähnliche Phase hatte, dass sie eine Zeitlang sogar für flippersüchtig gehalten wurde. In ihrer Wohnsiedlung gab es offenbar eine Bowlingbahn, in der sie sich nach der Schule immer mit Freunden zum Flipperspielen verabredete, bis Emilys Eltern ihr eines Nachmittags auf die Schliche kamen und sie mit einem Monat Hausarrest bestraften. Tobias konnte das nicht glauben, einen ganzen Monat, doch Emily sagte, das stimme wirklich, ihre Eltern seien oft sehr streng gewesen.
Sie gingen an diesem Abend noch etwas essen, in ein mexikanisches Restaurant nahe der Donnersberger Brücke. In München machten gerade etliche solcher Lokale auf, Tacos und Margaritas galten als die neueste Entdeckung, und Tobias ging gerne dorthin, weil er mexikanisches Essen schon lange kannte, von den Ferien bei seinen Verwandten in Kalifornien. Die Lokale hier waren aber eher Bars statt Restaurants, und das Publikum bestand zum Großteil aus unangenehmen Studentenrunden, die alle halbe Stunden neue Pitcher voller Erdbeer-Daiquiri bestellten. Tobias erzählte Emily von Los Angeles, wo er als Kind fast jedes Jahr den Sommerurlaub verbracht hatte, und auch sie begann irgendwann über ihre Familie zu reden, über ihre drei älteren Schwestern und ihre Rolle als Nesthäkchen, das vollkommen aus der Art geschlagen war. Die anderen – alle mehr als zehn Jahre älter als sie – hatten bereits mit Anfang zwanzig geheiratet und wohnten jetzt mit ihren zwei oder drei Kindern allesamt unter einem Dach, in dem großen Einfamilienhaus ihrer Eltern. Emily dagegen hatte schon früh ein völlig eigenständiges Leben geführt, war noch zu Schulzeiten mit ihrem ersten Freund in ein Wohnmobil gezogen und ein paar Monate später in die erste eigene Wohnung. Nach dem Essen fuhr sie Tobias in ihrer weinroten Ente nach Hause, und als sie sich verabschiedeten, zeigte sie ihm noch den neuen Schichtplan, der auf der Rückbank lag. »Schau mal, Tobi«, sagte Emily, »kurz nach Weihnachten haben wir zusammen Nachtschicht. Wollen wir uns davor noch irgendwo treffen? Die Schicht geht ja erst um halb zwölf los.« Tobias hoffte, dass Emily das absichtlich so gelegt hatte, und er kam plötzlich auf die Idee, dass sie doch zusammen flippern gehen könnten. Er schlug also das Atzinger vor, eine an sich indiskutable Studentenkneipe in Schwabing, in der seit Jahrzehnten die gleichen hängengebliebenen Altstudenten vor ihrem Weißbier saßen und der ewige Käsegeruch von überbackenen Nudeln in der Luft hing. Doch in dieser Kneipe, in einer uneinsehbaren Nische, stand ein guter Flipper, der einwandfrei funktionierte und fast nie besetzt war.
Emily flipperte erstaunlich gut. Alle Mädchen, mit denen Tobias bislang gespielt hatte, ließen sich gar nicht auf den Apparat ein, gaben sich von Anfang an keine Mühe. Sie drückten die Knöpfe nur halbherzig, so als wollten sie sich die Finger nicht schmutzig machen, und wenn die Kugel ins Aus ging, wendeten sie sich sofort ab, mit einer Geste, die bedeuten sollte: Schau, ich hab’s doch gesagt, dass ich’s nicht kann! Mädchen standen auch immer viel zu nah am Flippergerät, so dass sie von vornherein keine richtige Übersicht über das Spielfeld und keinen Bewegungsspielraum hatten; man hätte höchstens denken können, dass sie den Flipper umarmen und damit zu ihren Gunsten beeinflussen wollten. Bei Emily – das sah Tobias an diesem Abend sofort – war das ganz anders. Sie hielt ein wenig Abstand zu dem Gerät, ein Bein vor das andere gestellt, und als die Flipperkugel im Spiel war, bemerkte er auch, dass sie nicht den typischen Anfängerfehler beging und beide Schläger gleichzeitig drückte. Nach einer Weile drohte die Kugel ins Seitenaus zu gehen, und da geschah etwas, das er bei einem Mädchen noch nie gesehen hatte: Emily schüttelte den Flipper, fast bis zum Tilt, um die Kugel im Spiel zu halten. Tobias war fasziniert von ihrer Spielweise, ärgerte sich aber über seine eigenen Ergebnisse. Er hatte diese Studentenkneipe ja vor allem deshalb vorgeschlagen, weil darin der »Taxi« stand, ein Flipper, den er schon seit langem kannte. Auch wenn es eigentlich kindisch war: Er wollte mit Emily nicht an einem Gerät spielen, das ihm selbst nicht vertraut war, wollte sie natürlich ein bisschen beeindrucken, indem er – was bei diesem Gerät über kurz über lang meistens geschah – ein Freispiel machte. Jetzt sah Tobias seiner Arbeitskollegin zu, wie sie die Kugel minutenlang im Spiel hielt, schon kurz vor dem Beleuchten des Jackpots stand, und er selbst kam nicht über eine ziemlich peinliche Punktzahl hinaus. An ihrem Lächeln erkannte er, dass Emily seine Gedanken genau erraten hatte. Bei den nächsten Spielen konnte sich Tobias dann noch ein wenig rehabilitieren, und um viertel nach elf fuhren sie los, um die Abendschicht abzulösen. Emilys Ente hatte eine merkwürdige waagrechte Gangschaltung in Höhe des Kassettenrekorders, und Tobias bewunderte sie ein wenig dafür, dass sie das Schalten so gut hinbekam. In der Unterkunft unterhielten sie sich dann noch eine Zeitlang mit den beiden Kollegen, tranken von dem übriggebliebenen Weihnachts-Glühwein, und als die anderen gegangen waren, holten sie sich – die Gespräche und Bewegungen immer zögerlicher, erwartungsvoller – die Matratzen aus dem Lager, um sich für ein paar Stunden im Büro hinzulegen. In dieser Nacht wurden sie ein Paar.
Tobias hatte in der ersten Zeit mit Emily den Eindruck, dass sein Leben einrastete, dass es plötzlich in der richtigen Spur war. Als er sie kennenlernte, hatte er keinerlei Zutrauen mehr zu seinem Gefühl. Denn jedes Mal, wenn er in den zwei, drei Jahren davor mit einem Mädchen zusammengekommen war, hatte er die Wahrhaftigkeit seines Verliebtseins so lange in Frage gestellt, bis es wieder verschwunden war. Seitdem er sich, noch zu Schulzeiten, von seiner ersten richtigen Freundin getrennt hatte, konnte sich Tobias nicht mehr auf sein Empfinden verlassen. Wenn ihm ein Mädchen gefiel, musste er sich ständig ihr Gesicht vorstellen, sobald er alleine war; er zerlöcherte sein Gefühl regelrecht. Das Verliebtsein war auch von Anfang an so instabil, so flüchtig, dass es von der geringsten Veränderung, von einer einzigen falschen Bewegung des Mädchens aus dem Gleichgewicht gebracht werden konnte. Einmal hatte Tobias in einem Seminar eine Mitstudentin kennengelernt. Doch dann ging sie nach ihrer ersten gemeinsamen Nacht zum Friseur, hatte statt ihrer schulterlangen Haare einen gewellten Kurzhaarschnitt, und als er sie am Nachmittag darauf sah, auf der Terrasse der Germanistik-Cafeteria, wusste Tobias schlagartig, dass es vorbei war.
In dem Winter, als er in dem Betreuerteam zu arbeiten begann, hatte er sich schon fast mit dieser Eigenart abgefunden, nahm sie hin wie eine irreparable Beschädigung. Und in den ersten Tagen mit Emily dann wartete er fast stündlich darauf, dass seine gewohnten Zweifel einsetzen würden. Doch es war wie ein Wunder: Auf Emily schien die ständige Befragungsmanie in ihm nicht zu reagieren. Tobias suchte anfangs sogar nach Gründen, die gegen sie sprachen, überlegte manchmal, ob er sie vielleicht nicht doch zu unscheinbar fand. Doch ihre sichere Art beruhigte ihn jedes Mal, und die fast spöttischen Sätze, mit denen sie seine Stimmungsschwankungen kommentierte, sorgten dafür, dass seine Unsicherheit nach und nach völlig verschwand. Emily gab ihm auch von Anfang an zu verstehen, ihr selbständiges Leben auf jeden Fall weiterzuführen, und die Häufigkeit der Treffen wurde eigentlich von ihr dirigiert. Sie wollte etwa nicht, dass sie ständig beieinander übernachteten, verbrachte mindestens jeden zweiten Abend alleine, und dieses vorsichtige Haushalten, diese Dosierung ihres Zusammenseins tat ihm gut; es unterschied sich auch komplett von der fast verzweifelten Art, wie seine kurzen, schon nach wenigen Wochen oder sogar Tagen zu Ende gegangenen Liebesbeziehungen in den Jahren davor abgelaufen waren. In diesen Begegnungen hatte es kein Haushalten gegeben, und gerade die Unsicherheit, die sie damals spürten, war der Grund dafür gewesen, dass sie sich pausenlos sahen, so als hätte die ständige Gegenwart des anderen ihre Zweifel beseitigen können.
Als Tobias mit Emily zusammenkam, war er erst ein paar Wochen lang von zu Hause ausgezogen, in das Apartment im Erdgeschoss eines Sechziger-Jahre-Wohnblocks. Die wenigen Möbel darin stammten alle noch aus seinem alten Zimmer: der Schreibtisch, das ausgeleierte beige-braun gemusterte Schlafsofa, der Kleiderschrank im Flur. Das Geschirr in der Küche, in der anfangs nur ein Plastiktisch aus dem Keller seiner Eltern stand, stapelte sich auf dem Nachtspeicherofen neben dem Spülbecken. Und einen Teppich hatte er allein für das große Zimmer besorgt; in der Küche, im Flur und im Bad lag nichts als ein körniger, gelbbrauner PVC-Belag. (Noch immer hinterließen seine Schritte ein hohles Echo in den Räumen, als sei er eben erst eingezogen.) In den ersten Monaten mit Emily dann verschönerten sie mit großer Ausdauer Tobias’ Wohnung. Emily war im Münchner Norden aufgewachsen, gleich an der Endhaltestelle der U6, und sie kannte die ganzen Einrichtungsgeschäfte, die sich dort an den Ausfallstraßen aneinanderreihten, »Teppich Domäne«, »Hin &