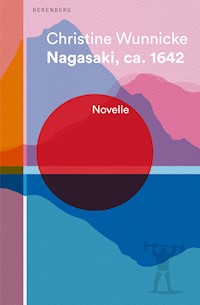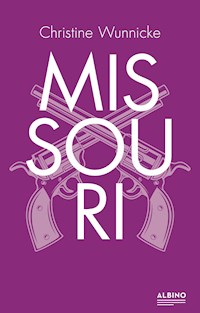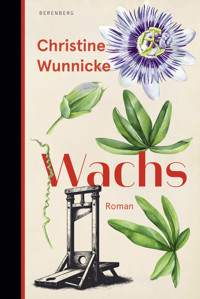
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Berenberg Verlag GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Liebesgeschichte, so schön, so verwegen, so gewitzt, wie nur Christine Wunnicke sie schreibt. Schauplatz ist Paris im 18. Jahrhundert, das vorrevolutionäre und das überaus revolutionäre, wo die Köpfe rollen wie abgeschlagene Blüten. Es lieben sich zwei Frauen, die verschiedener nicht sein könnten: Marie Biheron, die schon im zarten Alter Leichen seziert, um deren Innenleben aus Wachs zu modellieren; und Madeleine Basseporte, die zeichnend die Anatomie von Blumen aufs Papier zaubert, weil Menschen eher stören und meist keine Ahnung haben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 210
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Christine Wunnicke
Wachs
Roman
Berenberg
Es geht die Rede
Das Cembalo
Das Fastentuch
Arbeit
Gips
Der Geist der Revolution
Vom Irrtum
Vom glücklichen Leben
Grenadille Passiflora
Im Garten
Über die Autorin
Es geht die Rede
An einem Abend im November 1733, lange nach Einbruch der Dunkelheit, stapfte eine kleine Person durch die Wiese, welche die Rue des Filles Angloises von der Kaserne der Schwarzen Musketiere trennte. Nach tagelangem Regen war alles ein Morast. Die Schuhe der Wanderin versanken im Schlamm, und ihr Umhang, der ihr zu lang war, verfing sich in aufgeworfenen Erdklumpen und schlug ihr um die Beine. Unbeirrt strebte sie zur rückwärtigen Pforte der Kaserne, wo es zum Rosshof ging. Sie trug ein Licht, hatte es aber nur einen Spaltbreit geöffnet und sah kaum die Hand vor Augen. Ohne innezuhalten, in gleichförmigem Ton, als zählte sie ihre Schritte, betete sie leise vor sich hin: Verleihe, Herr, meinem Herzen wahre Buße, meinen Augen einen Wasserquell, meine Sünde stets zu beweinen. Und immer wieder von vorne.
Es roch nach Pferden. Der Untergrund wurde fester, und irgendwo war ein wenig Licht. Nach kurzem Zögern und einem tiefen Atemzug löschte sie das ihre. Sie presste die Lippen zusammen, um sich am Beten zu hindern, dann stand sie vor der Mauer und dann vor dem Tor. Es war ein großes Tor, wodurch wohl zwei Pferde passten, mit einer kleinen Schlupftür darin. Ihre rechte Hand arbeitete sich unter dem Umhang hervor. Mit großer Vorsicht, als wollte sie etwas Empfindliches prüfen, streckte sie einen schwarzbehandschuhten Zeigefinger aus und tupfte gegen das Holz. Es gab nach. Die Schlupftür war in der Tat nicht verschlossen. Nichts und niemand hinderte die Fremde daran, in den Rosshof der Schwarzen Musketiere einzudringen. Sie schlich an den Ställen entlang, an einem gewaltigen Misthaufen vorbei, der sich hier nicht an seinem vorschriftsmäßigen Platz befand, längs einer markierten Reitbahn, an einem Brunnen, einigen Pferdeschranken, der Werkstatt des Geschirrmeisters und der Wohnung des Büchsenmeisters vorbei, bis sie die Mitte der Anlage erreichte und den Durchgang zum Mittelbau und zum vorderen Hof.
Hier gab die Pforte nicht nach, als sie den Finger dagegen drückte. Sie wollte die Klinke fassen, da begann drinnen etwas zu wimmern. Es war ein miserables Gewimmer, ein helles, näselndes Klagen mit viel Luft dabei, das immer wieder abriss und mit großem Eifer neu anhob. Sie lauschte, erstarrt. Was aus den Stuben der Musketiere, die sich hoffentlich hinter dieser Pforte befanden, nachts so kläglich ertönte, erschloss sich ihr nicht. Es war wohl nicht bedrohlich genug, um deswegen umzukehren. Sie hielt die Luft an und drückte die Klinke, dann stand sie im Mittelbau.
Es wimmerte zu ihrer Rechten. Dort war eine Tür, daneben eine Luke, dahinter ein zaghaftes Flackern. Die Tür stand halb offen. Sie schlüpfte hindurch. Es ging eine Treppe hinauf und eine Treppe hinunter, und einiges Zeug war untergestellt, Gartengerät, ein Handkarren, allerlei, was wohl zu Pferden gehörte, und jemandes schmutzige Stiefel. Das Wimmern kam aus der Tiefe. Sie stieg langsam die Stufen hinab und erreichte ein niedriges Kellergewölbe. Einer stand da, von einem Talgstumpf beleuchtet, kehrte ihr den Rücken zu und war so in sein Tun versunken, dass er sie nicht bemerkte.
Es war ein großer, vierschrötiger Kadett in Hemdsärmeln, der auf der Oboe übte. Das tat er hier jede Nacht. Es klang nicht gut und wurde nie besser. Ein Schauspiel der Verzweiflung ging hier immer wieder vonstatten. Der Kadett stammte aus der Normandie, wohin er sich sehnte. Immer lachte man ihn aus und bestrafte ihn, weil er auf der Oboe so stümperte, deshalb versuchte er, heimlich besser zu werden, dass man über seine Fortschritte staune; doch wurde er nicht besser und erstaunte niemanden. Einer seiner Ahnen hatte einst in der königlichen Garde die Oboe geblasen, oder was sonst man damals zu blasen beliebte, und deshalb sollte sein Nachfahr auch blasen. Einst war er ein fröhlicher Junge gewesen. Ohne Sattel, wild wie ein Räuber, war er rund um die Burg galoppiert, worin seine Familie nicht in Reichtum lebte, und hatte zuweilen auf einem Grashalm gepfiffen. Die Mägde hatten ihn liebgehabt und die Vögel für ihn gesungen. Dann hatte ihm sein Vater alles gekauft, was ein Schwarzer Musketier brauchte, den Rappen, die Uniform, den Degen und leider auch eine Oboe. Seine Finger waren dafür zu dick und seine Lippen nicht richtig gewachsen. Man behandelte ihn schlecht. Man gab ihm gehässige Namen und ließ ihn gemeine Dienste verrichten. Der Kadett wäre gerne in den Krieg gezogen, um darin zu fallen. Jetzt spielte er eine Tonleiter. Seit zwei Stunden. Sie bestand aus fünf Tönen, und alle waren falsch, und je mehr er die Backen aufblies, desto falscher wurden sie. Eben versuchte er, der Leiter einen sechsten Ton hinzuzufügen. Er war viel zu hoch und maunzte wie ein Kätzchen, das man der Mutter entreißt.
»Entschuldigen Sie bitte die Störung«, zirpte jemand in seinem Rücken. Der Kadett fuhr herum. Sein Mund klappte auf. Die ganze Luft, die in die Oboe gesollt hatte, strömte hinaus. Ein düsterer Zwerg stand hinter ihm. Er hatte weder Gesicht noch Beine. Wie ein pechschwarzes Dreieck stand er reglos im Schatten, wo die Treppe endete, und in einer kleinen schwarzen Hand hielt er ein ausgelöschtes Licht vor sich hin wie die Vergänglichkeit auf den Gemälden.
»Oh Gott«, entfuhr es dem Kadetten. Dann entfuhr ihm ein Fluch. Dann rief er: »Geh weg!«
»Ich bedauere aufrichtig, dass ich hier eindringe, wenn Sie doch Musik spielen wollen, aber bitte schicken Sie mich nicht fort.« Der Zwerg hatte eine kleine Stimme. Er strich seine Kapuze vom Kopf. Darunter kam ein Kind zum Vorschein, weiblich und blass und wohl kaum älter als zwölf. Unter der Kapuze trug es eine enganliegende schwarze Haube, und an deren linker Seite hatte sich eine fahle Haarsträhne befreit, die zur Seite hin abstand wie der Fühler eines Insekts.
»Ich bitte darum, mit jemandem sprechen zu dürfen, der zuständig ist«, sagte das Mädchen, und seine Stimme wurde fester, »in einer wichtigen Angelegenheit, weshalb ich rücklings mir hier Einlass verschaffte, damit man mich vorne nicht wegschickt.«
Sie betrachtete mit gewissem Interesse und, so schien es dem Kadetten, einigem Ekel die Oboe in seinen Händen.
»Ich glaube nicht, dass Sie der Zuständige sind.« Nun knickste sie und neigte den Kopf. »Einen gesegneten Abend, und danke, dass Sie mir helfen!«
»Ich habe dich nicht hereingelassen!«, rief der Kadett.
»Ich weiß. Und ich werde es jedem sagen. Sie trifft keine Schuld. Führen Sie mich zu jemandem, der die Verantwortung trägt … der Bescheid weiß in diesem …« – sie suchte nach einem Wort und setzte unentschlossen hinzu: »Unternehmen?«
»Nein!«, rief der Kadett.
»Ich wäre leiser.«
»Pardon?«
»Ich würde, wäre ich Sie, mich etwas leiser gebärden, damit nicht das ganze Haus aufwacht.«
Im Kopf des Oboisten braute sich ein Bild zusammen: ein Kadett der Schwarzen Musketiere, der nachts ein Mädchen in den Keller des Mittelbaus einschleust und hierbei ertappt wird.
»Ich habe Sie in eine missliche Lage gebracht.« In ihrer Stimme lag kein Bedauern. Sie hatte den Umhang ausgezogen und sich ordentlich über den Unterarm gelegt. »Und ich schleppe Ihnen hier all den Matsch herein.«
Sie trug ein schlichtes grauwollenes Kleid und darüber eine dunkle Hemdschürze. Um ihren Hals lag ein altmodischer weißer Kragen. Der Kadett hatte Mühe, ihren Stand zu raten. War das ein flüchtiges Nönnchen? Hatte sie den Schleier vom Kopf gerissen, als sie dem Kloster entsprang, und nur diese Haube aufbehalten? Trugen sie solche unter den Schleiern? Was passierte mit einem Kadetten, der sich nachts im Keller mit Nonnen besprach?
»Gehen wir?«, fragte das Mädchen.
»Wohin denn!« Schon wieder wurde er laut.
»Ich kann es Ihnen leider nicht sagen« – nun schwang endlich ein wenig Erbarmen mit –, »weil ich nicht weiß, wie Ihre Truppe sich gliedert. Haben Sie einen Stabsmedicus? Einen Kanzellisten? Schatzmeister? Sekretär? Einen für die Lagerbestände, für Kehricht vielleicht, oder einen Priester? Am besten wäre wohl der Generalfeldmarschall, falls Sie ihn wecken dürfen.«
»Wer?«
»Der Kapitän? Der Generalmajor? Ich weiß nicht, wie man ihn nennt. Ich meine: den Chef.« Sie lächelte. Der Kadett starrte sie an. Es war, als hätte sich die bleiche Gestalt plötzlich verwandelt. Ihr Lächeln war unschuldig, warm, ein klein wenig spöttisch; das entzückendste Lächeln der Welt.
»Wir haben hier nur einen Rossarzt«, stammelte der Kadett. »Sind Sie krank? Darf ich Sie in die Stadt begleiten?«
»Nein, danke. Möchten Sie mich nur gütigst zu jemandem bringen, der ein wenig älter ist als Sie?«
Der Oboist zog seinen Rock an und strich sich die Haare zurück. In seiner Not mit der Oboe hatten sie sich nach allen Seiten gesträubt. Er zerlegte das Instrument und sortierte die Teile in den Kasten. Dann verkündete er laut, »Gehen wir!«, und konnte es kaum glauben.
Er führte das Mädchen aus dem Keller und hinauf in den ersten Stock. Dort begann er zu schreien: »Ich bringe ein Kind daher! Es benötigt Hilfe! Ich habe es aufgelesen! Ich weiß nicht, wem es gehört!« Es schien ihm ratsam, zu schreien, um nicht den Anschein von Heimlichkeit zu erwecken. »Kind!«, schrie er weiter. »Hilfe! Weiß nicht! Hilfe!« Durch jemandes Tür drang ein Fluchen. Der Kadett rannte los, und das Mädchen rannte mit ihm. Es war eine große Kaserne. Es war ein langer Flur. Er führte zum Billardsaal. Dort stieß der Kadett die Tür auf und stürzte hinein. Hinter ihm kam das Mädchen.
Fünf Mann waren hier noch zugange. Sie hingen auf Sesseln, tranken Bier und schwiegen sich an. Drei rauchten. Einer spielte mit einem Queue. Der Kadett machte zwei Offiziere aus. Es waren nicht die freundlichsten Offiziere, doch auch nicht die schlimmsten. Selten hatte sich der Kadett so sehr über den Anblick von Offizieren gefreut. Er rief »Bitte schön!«, als habe jemand ein Mädchen bestellt und er liefere es nun ab. Er setzte leise hinzu: »Seien Sie gut zu ihr.«
»Was?«, fragte ein Offizier.
»Guten Abend«, sagte das Mädchen.
Der Kadett, der nun hinter ihr stand, wedelte mit den Händen, um sie zu einem Sessel zu schieben, ohne sie anzufassen. Er fand, dass Frauenspersonen sitzen mussten und nicht ständig nur stehen. Einer der Raucher nannte ihn bei einem hässlichen Namen, der seine Blödheit mit der Normandie verband. Der zweite Offizier wiederholte das »Was?« des ersten. Das Mädchen trat einen Schritt vor.
»Ich bin die Tochter des Apothekers Biheron, Gott habe ihn selig, aus der Rue Saint-Paul gleich hinter dem Stadttor«, sagte sie her. »Ich entschuldige mich für meinen unzeitigen Besuch und danke ergebenst, dass Sie mich trotzdem empfangen. Ist es recht, wenn ich eine Frage stelle, auch wenn sie womöglich zunächst befremden mag, falls Sie nicht der Zuständige sind?« Sie wandte sich an den älteren Offizier und starrte ihn an, mit einem fast drohenden Blick.
»Setzen Sie sich doch!«, rief der Kadett. Von den übrigen Herren kam nicht viel mehr als »Was?«. Sie waren nicht gänzlich nüchtern. Das Mädchen knickste, dann reichte sie dem Kadetten ihren schmutzigen Umhang und setzte sich. Sie hatte Schlammspuren auf dem Teppich hinterlassen. Der Kadett stand mit dem Mantel hinter ihr wie ein Lakai.
»Die Apotheke der Biherons kenne ich«, sagte ein Musketier.
Die Augen des Mädchens hafteten nur an dem älteren Offizier. Er war aufgestanden. Mit gerunzelten Brauen stand er wortlos über ihr. Sie legte den Kopf in den Nacken, schluckte und hielt eine Rede.
»Ich möchte bitte eine Leiche kaufen, so Sie eine für mich haben. Das Geld trage ich bei mir, ich kann gleich bezahlen, so es denn nicht allzu teuer ist, und meine Mutter heißt es gut. Ich würde auch gerne, falls das möglich und erschwinglich ist, eine Subskription anmelden, für den ganzen Herbst und Winter und die ganze Zeit, bis es wieder warm wird. Ich würde die erste morgen abholen lassen. Falls Sie mehrere lagern, hätte ich lieber die einer Frau oder eines Kindes, weil ich ein Mädchen bin, wie Sie sehen, aber ich darf nicht wählerisch sein. Sie müssten mir alle Formalien erklären, die Bestattung besonders, und wer wofür aufkommt und welcherart ich sie zurückgeben soll, wenn ich fertig bin, denn ich weiß das leider nicht.«
Schweres Schweigen breitete sich über den Billardsaal. Die meisten hatten sich erhoben, einer nach dem anderen, und standen nun, in gebührendem Abstand, um ihren Sessel. Nur der Kadett war weit zurückgewichen.
»Sie sieht nachher aus wie vorher, ich gelobe es«, setzte Mademoiselle Biheron hinzu. »Ich nehme nichts fort. Ich lege alles zurück, für die Bestattung und die Auferstehung des Fleisches.«
Der ältere Offizier musste aufstoßen. Er presste die Lippen zusammen, aber man hörte es trotzdem. Dann wiederholte er, als kenne er kein anderes Wort: »Was?«
»Sie möchte eine Leiche kaufen«, erklärte der Musketier, der die Apotheke der Biherons kannte.
»Subskription?«, fragte der Musketier mit dem Queue.
»Sie möchten was?«, fragte der jüngere Offizier.
»Den Körper einer verblichenen Person«, sagte Mademoiselle Biheron, »zum Zweck der Anatomie. Sie werden dies doch nicht zum ersten Mal gefragt. Sonst sind es wohl eher Männer von der Universität. Meine Jugend mag Sie erstaunen, aber …«
»Wir wurden dies soeben zum ersten Mal gefragt!«, schrie der ältere Offizier.
»Das Kind möchte eine Leiche für die Anatomie«, erklärte der Musketier, der in der Apotheke zuweilen etwas für seinen Magen kaufte. Madame Biheron führte diese allein, seit ihr der Mann gestorben war. Die Apothekerin Biheron war eine unfreundliche Frau und ihr Magenmittel zu teuer.
»Leichen kauft man beim Militär«, konstatierte das Mädchen.
»Wie bitte?«, schrie der ältere Offizier.
»Woher haben wir Leichen?«, fragte der jüngere Offizier.
»Ich weiß es nicht. Aus dem Krieg?«
»Es ist kein Krieg«, sagte der mit dem Queue.
»Fällt einer im Krieg, wird er mit größten Ehren bestattet!«, rief der Kadett aus der Ferne.
»Ich weiß es nicht«, wiederholte die Apothekertochter. »Es geht in Paris die Rede: Leichen gibt es beim Militär. Und ich kenne keine andere Stelle, an der so viel Militär versammelt ist wie bei Ihnen. Zuweilen mag man Soldaten in den Straßen sehen, die wohl privatim einquartiert sind, aber ich kann sie nun schlecht ansprechen und fragen, wenn sie vielleicht nicht im Dienst sind. Und im Quartier dürfen sie gewiss auch gar nichts haben, das nicht so recht einfach zu verwahren ist. Also dachte ich, gehe ich besser in eine Kaserne. Die Ihrige ist sehr groß und beeindruckend, und ich wohne ja in der Nähe. So dachte ich, frage ich am besten Sie. Bitte schicken Sie mich nicht fort. Meine große Schwester nahm vor kurzem den Schleier. Nun will auch ich etwas beitragen. Ich habe eine Begabung dafür. Ich habe alles gelernt. Sie können mich prüfen, wollen Sie sichergehen. Ich habe auch eine Eröffnung bereits ansehen und ein wenig dabei auch leisten dürfen. Ich bin noch Schülerin, doch Anfängerin nicht. Aber ich brauche die Anschauung. Mit Büchern allein ist es nicht zu verstehen. Und es eilt. Der Winter vergeht wie im Flug, und im Frühling wird es zu warm.«
»Etwas beitragen wozu?«, fragte einer der Raucher, dessen Pfeife inzwischen erloschen war.
»Zum Lobpreis Gottes und zum Unterhalt der Familie.«
»Gottes«, echote der jüngere Offizier. Seine Stimme klang etwas beschlagen. Er trat einen Schritt zurück. Alle taten es ihm nach. Der ältere Offizier, den Mademoiselle Biheron noch immer fixierte, entfernte sich am weitesten.
»Es geht die Rede«, wiederholte sie störrisch.
»Die Apothekerin aus der Rue Saint-Paul hat uns ihre Tochter geschickt, um ein paar Leichen zu kaufen«, erklärte der, der gerne erklärte, »aber wir wissen noch immer nicht, warum, und allmählich wird uns bange.«
»Mir wird nicht bange!«, tönte der Kadett aus der Ferne.
Vom Rosshof herauf drang plötzlich Lärm. Der Kadett, der am nächsten stand, lief zu einem Fenster. Da liefen sie alle zu den Fenstern, nur das Mädchen rührte sich nicht. Aus den Ställen war ein Pferd losgekommen und tobte über den Hof. Es rannte im Kreis und fast gegen die Mauer und dann immer weiter im Kreis in immer größerem Schrecken. Ein Stallknecht, der geschlafen hatte, rannte ihm fuchtelnd hinterdrein und erschreckte es immer noch mehr. Es stieg und verdrehte den Hals. Ein spitzes, endloses Wiehern drang zu den Fenstern herauf.
»Es mag sein, dass ich einem Missverständnis aufgesessen bin«, hauchte Mademoiselle Biheron ungehört.
»Er wird es schon fangen«, sagte der ältere Offizier. Er prägte sich den Stallknecht ein und trat vom Fenster zurück. Alle traten vom Fenster zurück. Der Kadett schlug heimlich ein Kreuz. Dabei merkte er, der Umhang war fort. Das Mädchen war fort, mitsamt ihrem Umhang. Sie hatte ihn von seinem Arm gezogen, und er hatte es nicht gespürt.
Alle starrten den Sessel an, worin sie gesessen hatte. Dann rannten sie in den Flur, doch dort war sie auch nicht. Sie rannten bis zur Treppe und fanden sie nicht. Sie zu fangen und zur Rede zu stellen, bis alles aufgeklärt wäre, erschien den Musketieren plötzlich das Wichtigste von der Welt. Sie weckten die ganze Kaserne auf mit ihrem Gerenne. Doch das Mädchen blieb verschwunden.
Marie Biheron war längst in der Rue de Charenton angelangt. Sie war an der Conciergerie der Kaserne vorbeigeschlüpft wie ein Geist. Auch in fremden Gebäuden, hatte sie festgestellt, fand sie mit Leichtigkeit ihren Weg. Dies war ihr angeboren: Sie konnte Teile eines Ganzen sich schnell zusammenreimen und ins Verhältnis setzen und zog daraus viel Genuss. In ihrer Kindheit hatte dies zuweilen seltsame Blüten getrieben, und sie hatte Dinge, derer sie habhaft werden konnte, etwa Werkzeuge des Apothekerberufs, in ihre Einzelteile zerlegen müssen und sich dabei in eine Art Rausch hineingesteigert und sich wütend gewehrt, wenn man ihr halbzerlegte Dinge fortnehmen oder sie gar wieder zusammensetzen wollte. Es war etwas Eigentümliches um Mademoiselle Biherons Kopf.
Jetzt stand sie in der Nacht und kämpfte mit den Tränen. Es war alles so fürchterlich und so neu. Noch nie war sie nachts aus dem Haus gewesen. Noch nie, kein einziges Mal, vor den Toren von Paris. Sie marschierte blind in Richtung der Porte Saint-Antoine. Finge sie jemand ein, wie sie hier liefe, dachte Marie, wohl brächte er sie an einen schlimmen Ort, an den man entlaufene Mädchen bringt, um sie dort zu befragen und zu quälen. In drei Tagen würde sie vierzehn. Bis dahin hätte sie gerne eine Leiche gehabt, doch schien das nun in weite Ferne gerückt und all ihre Hoffnung zerschlagen. Noch immer fiel es ihr schwer, den Musketieren ihre Verwirrung zu glauben. Vielleicht müsste sie nur einen Mann schicken, dachte sie, und die Leichenkammer täte sich auf. Sie bewegte in ihrem Kopf allerlei Männer ihrer Bekanntschaft, ob sie geeignet wären für eine solche Mission. Der Bäcker fiel ihr ein, ein Nachbarsjunge, leider erst elf, und ihr Bruder. Der hatte aber das Weite gesucht, und niemand wusste, wo er war. Sie hatte schon fast die Stadtmauer erreicht. Die Bastille sah nachts so grässlich aus, dass einem die Worte fehlten. Auch in dieser, wusste Marie, würde sie sich zurechtfinden können, falls sie denn einmal müsste. Sie überlegte, ob man entlaufene Mädchen wohl in die Bastille brächte, und ärgerte sich, dass sie es nicht wusste. Jedem Mädchen, fand Marie, stünden einige Lehren zu, wie man sicher durchs Leben kommt. Vieles konnte man sich selbst beibringen, doch oft fehlten die Fakten.
Bei der Porte Saint-Antoine hielt sie jemand an. Auch hierauf war sie nicht vorbereitet. War es ein Soldat, ein Zöllner, ein Räuber? Woran erkennt man, worum es sich handelt, wenn einen jemand am Stadttor belästigt?
»Ich bin die Tochter des Apothekers Biheron aus der Rue Saint-Paul, Gott habe ihn selig«, haspelte sie, bevor der Mann mehr als »Halt« sagen konnte, »mein Licht ist ausgegangen, und es eilt mir, und ich fürchte mich und muss jetzt sofort nach Hause.«
Er ließ sie passieren. Plötzlich fühlte sie sich von der Bastille beschützt. Niemand und nichts, dachte Marie, könne ihr etwas anhaben, solange dieses Bauwerk nur immer ihren Lebensweg beschirmte, der gewaltige Klotz mit den gewaltigen Türmen. Kniff man die Augen zusammen, konnte man meinen, er sei eine Kirche. Tags, und besonders nachts. Man konnte meinen, Gott wohne darin. Gott hat auch keine Fenster an seiner Wohnstatt, dachte Marie, denn sein Ratschluss ist unergründlich. Ein Hochgefühl stieg auf in dem enttäuschten Mädchen, das mit Gott nichts zu tun hatte. Die Nacht, die Welt, Paris gehörte ihr, und käme Zeit, käme Rat, und früher oder später, wenn man genügend beharrte, käme gewiss auch eine Leiche. Sie lief an der Kirche der Visitantinnen vorbei und bis zu den Jesuiten, und da war sie auch schon zu Hause. Sie schloss auf mit dem entwendeten Schlüssel und hängte ihn hin, wo er hingehörte, dann zog sie die Schuhe aus und schlich hinauf in ihr Zimmer. Sie steckte den schmutzigen Umhang unters Bett und fiel davor auf die Knie, sprach ein Dankgebet für ihre Errettung und ein Bittgebet mit einigem Vorwurf darin, dann etwas Langes aus dem Augustinus. Schon fast im Halbschlaf kroch sie ins Bett. Sie träumte, dass sie lauter Männer anheuerte, den Bäcker, den Nachbarsjungen und ein Dutzend Musketiere, ihnen Schaufeln gab und sie anwies, um die Bastille überall den Boden aufzugraben, um zu sehen, was sich darunter befand. Sie wachte auf und wunderte sich, dann schlief sie traumlos bis zum Morgen.
»Muss es denn wirklich sein?«, fragte Madame Biheron. Sie mischte, vorne im Laden, Medizin für den Magen. Marie sprach durch den Türspalt hindurch. Sie sollte in der Apotheke nicht sein, falls Kundschaft käme, denn das schickte sich nicht.
»Ja, bitte«, sagte Marie. »Und zwar bald, denn wenn der Frühling kommt …«
»Du musst nicht arbeiten«, unterbrach sie ihre Mutter. »Du musst keinen Beruf erlernen. Es ist weder nötig noch üblich.«
»Doch«, sagte Marie, »und zwar diesen.«
»Ich verstehe es nicht. Du sprichst von nichts anderem. Ich verstehe es noch immer nicht.«
»Es ist mir in die Wiege gelegt, und Gott hat es mir gegeben!«
»Nur weil ich das einmal sagte, musst du nicht ständig darauf beharren.«
»Doch!«, rief Marie.
Ein Kunde kam. Marie zog die Tür zu. Sie lauschte. Der Kunde redete umständlich. Es war einer der Wundärzte, der nur zum Reden kam und nichts kaufte. Mutter ließ ihn reden, bis er fertig geredet hatte, und wünschte dann einen guten Tag. Marie stieß die Tür auf.
»Würden Sie mir bitte einen Mann besorgen, der für mich zum Militär geht? Mutter! Bitte! Ich flehe Sie an!«
»Militär?«
»Die haben die Leichen! Ich weiß mir nicht anders zu helfen!«
Mutter schüttelte Muskatsalz in Wermut. Sie lächelte schwach. »Es ist nur ein Ausdruck, Kind. Es ist nicht wörtlich gemeint.«
»Was?«, rief Marie.
»Rufe nicht ›was‹. Du bist nicht drei Jahre alt. Es spricht der Anatom: Die Leiche, die ich eröffne, die kam vom Militär. Das bedeutet: Ich will nicht sagen, woher diese Leiche kam. Es bedeutet nicht: Ich lief zum Militär und holte mir eine. Woher sollte das Militär denn Leichen haben, die keiner beansprucht?«
»Aus dem Krieg!«, jammerte Marie.
»Leichen«, sagte Madame Biheron, »Gott steh mir bei, kauft man beim Totengräber. Man kauft sie bei Männern, die über Friedhofsmauern steigen und sie stehlen. Man kauft sie bei den Katharinenschwestern. Man kauft sie im Hôtel de Dieu. Die Anatomen haben ihre Mittel und Wege. Arme Studenten ziehen zuweilen auch welche aus dem Rechen von Saint-Cloud.«
»Was ist das?«, fragte Marie. Sie kräuselte die Lippen.
»Wasserleichen aus der Seine. Amüsiert dich das?«
»Nein! Nein! Ich … ich dachte kurz … ans Militär, ich …«
»Ich, ich«, rügte ihre Mutter.
»Ich will aus dem Rechen keine haben«, sagte Marie.
»Du bist auch kein armer Student, und Student wirst du niemals werden.«
»Ich weiß. Darum brauche ich Leichen!«
»Ich kann mir kaum vorstellen, wie ein Beruf daraus erwachsen soll, der dir Ehre macht, Geld abwirft und Gott gefällt.«
»Warten Sie nur ab! Ich schwöre …«
»Du sollst nicht schwören.« Madame Biheron hatte das Muskatsalz zu Schanden geschüttelt, das Gemisch flockte aus, die Tinktur war verdorben.
Marie starrte sie an. Sie trugen die gleichen Kittel, das gleiche grauwollene Kleid. Auch bei Mutter kam zuweilen eine Strähne unter der Haube hervor, eine graue. Ihr Gesicht war mager. Zuweilen fasste sich Marie an die Wangen und versuchte zu raten, ob sie Mutter glich. Doch ihre Wangen waren weich und rund. Man hatte in diesem Haus keine Spiegel.
»Es gibt Berufe«, sagte Madame Biheron nach einer Weile, »die ein Mädchen erlernen kann. Gott gab dir Talent zum Zeichnen. Du könntest nach der Natur zeichnen lernen. Das wirft einiges ab.«
»Ich muss die Natur erst zerschneiden«, sagte Marie.
Sie schwiegen.
»Ich nehme auch eine, die im Rechen hing«, flüsterte Marie nach einer Weile.
Die Apothekerin Biheron schüttete die verdorbene Tinktur in den Krug mit Verdorbenem und holte neues Muskatsalz. Sie seufzte. »Du tust es in deinem eigenen Zimmer.«
»Ja! Gewiss! Ich schwöre es! Ich werde … ich …«
»Ich, ich«, sagte Madame Biheron. »Gott schütze dich.«
Drei Tage nach ihrem vierzehnten Geburtstag bekam Marie Biheron ihre erste Leiche. Es war ein kleines Mädchen, etwa drei Jahre alt, verhungert. Sie kam nachts, in ein schmutziges Laken gewickelt, in einem Karren ohne Licht. Marie und ihre Mutter legten sie auf den großen Arbeitstisch in der Apotheke, stellten eine Kerze dazu und beteten für ihre Seele. Marie weinte leise, dann begann sie laut zu schluchzen. Schließlich hob sie das Kind auf und trug es behutsam hinauf in ihr Zimmer.