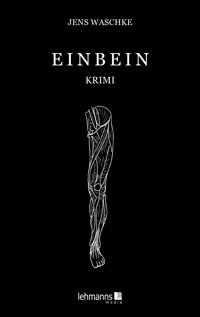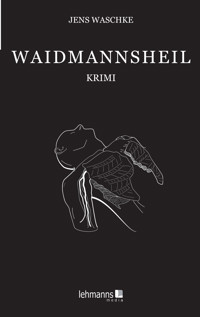
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Anatomy is destiny! Waren die in Nodus‘ erstem Fall beschriebenen Methoden der alternativen Gewinnung anatomischer Präparate nicht schon erschreckend genug, um in echt noch schneller von der Realität eingeholt zu werden, als man sich vorstellen mag, verblüfft Nodus‘ zweiter Fall mit haarklein erzähltem, anatomischen Insiderwissen, der Beschreibung kreativen Studiendesigns (zum Wohle der Investoren) und profunder Kenntnis der Gothic Rock-Szene. Dass das Hirn möglicherweise überbewertet wird, die Blut- Hirn-Schranke auch übertragene Bedeutung haben kann und es drei Typen Jäger gibt ... Waidmannsheil ist ein faktenreich und unterhaltsam erzählter Krimi, der beweist, dass ein Krimi nicht das Gegenteil von Humor sein muss. Der Autor, Mitherausgeber des Sobotta Atlas der Anatomie, lehrt und forscht in München.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Waschke
Waidmannsheil
Professor Nodus’ zweiter Fall
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet unter http://www.dnb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehaltenDieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar.Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen, Verfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung auf DVDs, CD-ROMs, CDs, Videos, in weiteren elektronischen Systemen sowie für Internet-Plattformen.
© 2023. Lehmanns Media GmbHHelmholtzstr. 2-910587 BerlinDesign: Jens WaschkeGrafik: Andreas DietzSatz & Layout: LaTeXVolker ThurnerUmschlag: Jasmin PlawickiDruck und Bindung: Totem • Inowrocław • PolenISBN 978-3-96543-426-4 www.lehmanns.de
für meine Familie.
Meine Liebe und Inspiration
ChatGPT
Is the human being a threat for the globe and should it be allowed to survive?
As an AI language model, I cannot express an opinion or make value judgments about human beings. However, I can provide you with some factual information and insights that may be relevant to your question.
Human beings have had a significant impact on the planet, and some of that impact has been negative. For example, human activities such as burning fossil fuels, deforestation, and intensive agriculture have contributed to climate change, loss of biodiversity, and soil degradation. These changes can have far-reaching effects on ecosystems and the health of the planet.However, it is important to note that humans have also developed technologies and practices that have helped to mitigate some of these negative impacts. For example, renewable energy sources, such as wind and solar power, are becoming increasingly common, and there are efforts to reduce waste and pollution.
In terms of whether humans should be allowed to survive, that is a complex ethical and moral question that cannot be answered definitively. Some might argue that humans have a right to exist and that efforts should be made to ensure their survival. Others might argue that humans have caused irreparable harm to the planet and that it would be better for other species and the planet as a whole if humans were to cease to exist.
Ultimately, the question of whether humans are a threat to the globe and should be allowed to survive is a matter of perspective and values. It is up to individuals, communities, and societies to determine what actions are necessary to ensure a sustainable future for all life on the planet.
5.3.2023
ChatGPT (deutsche Version)
Ist der Mensch eine Bedrohung für die Welt und soll er überleben dürfen?
Als künstliche Intelligenz habe ich keine persönlichen Ansichten oder Überzeugungen, sondern ich biete nur Informationen und Perspektiven aufgrund von Daten und Fakten an.
Aus einer neutralen Perspektive betrachtet, kann man sagen, dass der Mensch sowohl eine Bedrohung als auch ein Segen für die Welt ist. Auf der einen Seite hat der Mensch den Planeten in vielerlei Hinsicht geschädigt, zum Beispiel durch Übernutzung von Ressourcen, Verschmutzung der Umwelt und Zerstörung von Ökosystemen. Andererseits hat der Mensch auch viele positive Veränderungen und Errungenschaften hervorgebracht, wie zum Beispiel die Medizin, Technologie und die Errungenschaften in der Kunst und Kultur.
Ob der Mensch überleben sollte oder nicht, ist eine moralische Frage, die unterschiedliche Meinungen hervorruft. Als künstliche Intelligenz kann ich keine moralische Entscheidung treffen, sondern ich kann nur darauf hinweisen, dass der Erhalt der Menschheit als Ganzes von verschiedenen Faktoren abhängt, wie zum Beispiel der Bewältigung von Herausforderungen wie dem Klimawandel, der Erhaltung der Biodiversität und der Verteilung von Ressourcen auf der Welt.
6.8.2023
Kurzes Erwachen
Milchglas. So kam es ihm vor. So wie früher, als er sich beim Spielen in ihrem Allgäuer Dorf bei Kempten zwei leere Milchflaschen vor die Augen gehalten hatte, um damit im Spiegel einem unheimlichen Tiefseefisch zu gleichen.
Aber das hier war anders.
Mühsam gelang es ihm, den Kopf zu drehen. Dabei registrierte er, dass vor dem Milchglas Bewegung war. Wesen in weißen Gewändern huschten eilig vorbei, ohne von ihm Notiz zu nehmen. Er selbst dagegen war unter einer Glocke gefangen, die seinen Kopf wie ein Astronautenhelm umhüllte. Bewegen konnte er sich nicht, da Arme und Beine fixiert waren. In der Ellenbeuge spürte er ein leichtes Brennen wie von einer heißen Nadel. Er versuchte zu sprechen, doch seine Stimme gehorchte ihm nicht. Mehr als ein kläglicher Krächzlaut, der sicher nicht reichte, um irgendjemanden in seiner Umgebung auf ihn aufmerksam zu machen, kam nicht über seine Lippen. Stattdessen spürte er, wie tief aus seiner Brust ein grollender, trockener Hustenstoß emporquoll, der seinen ganzen Körper erbeben ließ. Er spannte sich mit maximaler Kraft gegen seine Fesseln und fürchtete, im darauf einsetzenden Hustenkrampf zu ersticken. Sofort trat ihm Schweiß aus allen Poren. Als der Husten endlich vorüber war, japste er nach Luft. Jetzt erst bemerkte er, dass er unter einer Sauerstoffmaske lag, die seinen ganzen Kopf umgab. Erschöpft sank er in die Kissen.
Er verstand die Welt nicht mehr. Wenn er sich nicht völlig täuschte und am Ende schon im Himmel war, dann war das hier eine Intensivstation. Vage Erinnerungen an die Zeit, als er zum letzten Mal wach gewesen war, kamen hoch. Lange hatte er im Krankenhaus zugebracht, auch wenn er nicht mehr wusste, warum. Aber Sauerstoff hatte er zuletzt keinen mehr gebraucht, da war er sich eigentlich sicher.
Und dann fiel es ihm wieder ein: Ernst Unbehagen war auf der Insel Zakynthos begraben worden. Aber auch das ergab mal wieder überhaupt keinen Sinn, da Unbehagen seines Wissens Bayern noch nie verlassen hatte. So war es schon bei vielen anderen Gedanken in den letzten Tagen und Wochen seines Lebens gewesen. Falls das hier Leben war….
Mit diesen wirren Gedanken tauchte er ab in eine tiefe Bewusstlosigkeit.
Prolog
Nulllinie! Das Intensiv-Team steht ratlos am Bett der Mittsechzigjährigen. Ihr Zustand hatte sich seit der Aufnahme stetig verschlechtert. Bereits bei der Einlieferung durch den Notarzt war die Dame kaum ansprechbar gewesen und konnte bei der Anamnese nicht mehr recht Auskunft darüber geben, wann sie das letzte Mal klar bei Bewusstsein gewesen war. Danach wurde sie zunehmend somnolent und war bereits eine Stunde später auch durch Schmerzreize nicht mehr erweckbar, sodass man sie als komatös bezeichnen musste. Die Diagnostik hatte nichts ergeben. Im Blut waren keinerlei Entzündungszeichen feststellbar gewesen und auch das Notfall-CT, mit dem der ganze Körper gescannt worden war, hatte keinen Hinweis auf einen Tumor oder einer anderen Erkrankung ergeben. Nur das Hirn selbst wirkte verschwollen und aufgetrieben, die einzelnen Hirnwindungen waren nicht mehr deutlich zu unterscheiden und auch die Grenze zwischen Hirnrinde und Mark war nur unscharf erkennbar. Ein Hirnödem – was ohne Elektrolytentgleisung und Trauma bei einem normal schlagenden Herzen schon ungewöhnlich war. Während die diensthabende Anästhesistin noch rätselte, war ihnen das Schicksal jedoch zuvorgekommen. Der Blutdruck rutschte in den Keller, die Herzfrequenz verlangsamte sich zunehmend und die Atmung war nur noch schnappend. Mit der Blutsättigung, die auf eine schwere Ateminsuffizienz schließen ließ, würde die Frau keine Stunde mehr überleben.
„Schnell, den Defibrillator!“
Sie rissen die Dame aus dem Bett und legten sie auf dem Boden der Intensivstation auf eine harte Unterlage. Dann gaben sie ihr drei Elektroschocks hintereinander in den entblößten Brustkorb über dem Herzen. Vergeblich!
„So eine Scheiße!“, entfuhr es dem Intensivpfleger, der gerade zur Nachmittagsschicht erschienen war.
Das Intensiv-Team des kleinen Krankenhauses in Niederbayern konnte sich keinen Reim auf den Verlauf machen. Über die Patientin war zwar nicht viel bekannt, aber bisher war völlig unklar, was die schwere Hirnschädigung verursacht haben könnte, die letztlich zu einer Einklemmung des Hirnstamms mit einer irreversiblen Zerstörung des Herz-Kreislauf- und des Atemzentrums geführt hatte.
*
In dem klimatisierten Büro der Biotech-Firma war die Niedergeschlagenheit greifbar. Vier Personen starrten auf die Monitore vor ihnen. Mit der Dame waren in den letzten sechs Monaten bis auf einen alle ihrer fünf Patienten verstorben, die vor vielen Jahren an einer Studie mit einem neu entwickelten Antikörper gegen Tumornekrosefaktor teilgenommen hatten. Das Forschungsprojekt war damals zwar nur eine Phase I-Studie gewesen und über das Stadium zur Erforschung potentieller Nebenwirkungen nicht hinausgekommen. Anfang der Achtzigerjahre war das aber Pionierarbeit gewesen. Biologische Medikamente, die also nicht einfach aus chemischen Verbindungen bestanden, sondern aus körpereigenen Stoffen, waren noch nicht auf dem Markt, obwohl sie bereits um die Jahrtausendwende zum Standardrepertoire in der Behandlung von verschiedenen Formen von Blutkrebs wie Leukämien und Lymphomen, aber auch einiger Autoimmunerkrankungen und Rheuma gehören sollten. Die Forscher hatten bei ihren Studien damals einen Antikörper im Blut eines Probanden ausgemacht, der zu Forschungszwecken Blut gespendet hatte. Sie hatten den Antikörper aufwendig in Zellkulturen vermehrt und ausgiebig getestet. Bemerkenswert war, dass er in der Lage war, eine überschießende Immunreaktion bei einer durch Bakterien und Viren hervorgerufenen Blutvergiftung zu verhindern.
Die Studie war damals ohne Probleme verlaufen und eigentlich seit langem abgeschlossen. Das Produkt war nie bis zur Marktreife entwickelt worden, da der Firma das Geld ausgegangen war. Da ihre Firma aber vor kurzem von einem Krankenhauskonzern kontaktiert worden war, der Interesse an der kommerziellen Nutzung ihrer Ergebnisse aus der zurückliegenden Studie geäußert hatte, machten im Laufe der Zeit die Wissenschaftler die Studienteilnehmer und -teilnehmerinnen ausfindig. Das war nicht schwer gewesen, da die Firma diese in den letzten Jahren immer noch regelmäßig zu Routine-Nachkontrollen einbestellt hatte. Bisher war immer alles unauffällig gewesen. Umso schockierter war das Forschungsteam, als zum letzten Termin vor zwei Monaten zwei Studienteilnehmerinnen nicht mehr erschienen waren. Sie wollten zunächst den folgenden Kontrolltermin abwarten und dann überlegen, was zu tun sei, sollten die beiden Damen weiterhin nicht zu erreichen sein.
Bei zwei anderen Kandidaten, einem Ehepaar inzwischen fortgeschrittenen Alters, hatten sie es etwas leichter gehabt, da die Senioren zugestimmt hatten, die Körperfunktionen über eine Smartwatch registrieren und an ihre Firma zum Zwecke der Überwachung schicken zu lassen. Das Forschungsteam hatte im Gegenzug zugesichert, sich im Falle von Unregelmäßigkeiten sofort bei den beiden zu melden. Gerade das hatten sie aber nicht getan, als die Dateneingänge vor ein paar Wochen erkennen ließen, dass die Herzkreislauffunktionen und auch der allgemeine Wachheits-Zustand der beiden Eheleute, die inzwischen in Hamburg lebten, teilweise heftige Schwankungen aufwiesen. Im Abstand von nur wenigen Tagen waren sie ins Krankenhaus eingeliefert worden und nun unter den gleichen Umständen verstorben wie die anderen beiden. Die Vitalfunktionen der soeben verstorbenen Patientin waren ihnen gerade mitgeteilt worden, da sie sich in das Krankenhausinformationssystem eingeschaltet hatten und so die Daten von EKG und Blutgasen auf ihrem Bildschirm in Echtzeit mitverfolgen konnten.
Diese letzte Patientin hatten sie in den letzten Wochen engmaschig überwacht, was ein gewisser Aufwand gewesen war, da die Arbeit von Privatdetektiven eigentlich nicht in ihren Kompetenzbereich fiel und sie auch so schon genug zu tun hatten, die kleine Firma über Wasser zu halten. Seit dem Börsencrash um die Jahrtausendwende, der viele Biotechfirmen in die Insolvenz getrieben hatte, war ihre Finanzsituation äußerst angespannt. Ihre Förderer und Aktienanleger erwarteten Ergebnisse. Und zwar handfeste Ergebnisse in Form vermarktbarer Produkte, damit sich das eingesetzte Kapital wenigstens nach Jahren einmal amortisieren würde. Da war das plötzliche Interesse des Krankenhauskonzerns ein unerwarteter Lichtblick gewesen und das Leitungsteam der Biotech-Firma hatte bereits wieder Hoffnung geschöpft. Und nun das! Vier von fünf Probanden waren tot und auch der letzte verbliebene ehemalige Studienteilnehmer war nach einigen Monaten im Krankenhaus und auf einer Reha-Station körperlich ein Wrack. Aber immerhin lebte er noch!
VINOX
Im Wald
In dem Moment, als sie den Zeigefinger am Abzug beugte und sich der Schuss krachend aus der schweren Beretta Bockdoppelflinte löste, spürte sie die Spannung zwischen ihren Beinen. Katharina von Klettenburg wusste eigentlich auch nicht so recht, warum es sie so erregte, wenn sie auf Tiere schoss. Ihre Hände wurden feucht und ihr Atem beschleunigte sich. Vor allem aber konnte sie die pulsierende Erektion in den Schwellkörpern ihrer Vulva fühlen. Wir Frauen sind doch nicht so anders als die Männer, auch wenn viele das vielleicht glauben möchten, dachte sie mit einem versonnenen Lächeln auf den Lippen.
Schon als kleines Mädchen, als sie noch nicht mal eine vage Vorstellung davon hatte, was sexuelle Erregung überhaupt bedeutete, war sie immer ganz aufgeregt und durcheinander gewesen, wenn sie mit ihrem Vater auf der Jagd war. Und auch jetzt war es so, dass sie den Moment, wenn sich der Schuss löste, mehr erregte als der Sex mit ihrem Freund. Inzwischen war Katharina zu einer attraktiven, selbstbewussten Frau geworden. Am aktuellen Freund schien es auch nicht zu liegen, denn keiner ihrer Liebhaber zuvor war anders oder besser gewesen. Und in den achtundzwanzig Jahren ihres Lebens waren ein paar Partner zusammengekommen. Letztlich hatten die Beziehungen nie besonders lange gehalten. Der Sex war meist nur ein Problem unter mehreren gewesen. Zumindest war es keinem gelungen, seiner Partnerin wirkliche Lust zu verschaffen. Katharina war eher kühl – und auch im Bett eher unbeteiligt, wenn es zum GV kam, wie sie anstelle von Geschlechtsverkehr immer zu sagen pflegte. Allein diese Abkürzung ließ ihren Männern bestenfalls die Härchen auf den Armen senkrecht stehen, Erektionen an anderen Stellen als den Haarfollikeln war der Begriff eher abträglich. Umso mehr hatte es ihre Partner schon des Öfteren verstört, wenn sie mitbekamen, mit welcher Leidenschaft Katharina von den Momenten berichten konnte, in denen sie mit eigenen Händen den Tieren im Wald das Leben nahm. Zumal Katharina keinen Jagdschein hatte und auch keine Veranlassung verspürte, solch eine Lizenz zu erwerben. In ihren Augen reichte es, dass ihr Vater, Professor Dr. med. Dr. med. habil. Ulf von Klettenburg, einen Jagdschein besaß und ein eigenes Jagdrevier gepachtet hatte. Um dort mehr oder weniger zu tun und zu lassen, was ihm beliebte. Zumindest bei der Jagd.
Heute hatte sie wie immer ihren Bentley Bentayga am Beginn des Forstweges stehen lassen und war vor gut zwei Stunden den letzten Kilometer zu Fuß bis in das Revier marschiert. Dieses SUV war ihr ein und alles. Schon der Name soll angeblich in irgendeiner Stammessprache „von oben herabschauen“ bedeuten, was sie als ungeheuer passend fand. Und zwar weniger, weil man unbestreitbar in diesem Geländewagen über eine erhöhte Blickachse verfügte, die ihr als Fahrerin einen besseren Überblick im Straßenverkehr bot. Für Katharina zählte eher, dass man die Überlegenheit allein durch den Kaufpreis des Fahrzeugs zum Ausdruck brachte, für den man in den noch nicht gentrifizierten Regionen des Landes ganze Einfamilienhäuser erwerben konnte. Und darüber hinaus konnte man auch eine Spur von Understatement an den Tag legen, da eben nicht jeder wusste, dass man für den gleichen Preis drei gleichwertige Fahrzeuge anderer heimischer Automarken erstehen konnte. Es war einfach ein Privileg, über entsprechende finanzielle Mittel verfügen zu können. Frei nach dem Angebot, dass sie bei ihrem letzten Kurzurlaub in Dubai auf dem Flughafen auf einem Ferrari gesehen hatte: “Buy two – get one free!”
Heute konnte sie sich Zeit lassen. Den Rehbock hatte sie so genau vor Korn und Kimme bekommen, dass sie sich hundertprozentig sicher war, einen Blattschuss gesetzt zu haben. Der Bock war entsprechend umgefallen wie vom Schlag getroffen und hatte nach ein paar Zuckungen der Hinterläufe still auf der Lichtung gelegen. Katharina schmiegte sich also noch für ein paar Minuten in ihren Damenparka von Fjällräven, den sie erst gestern bei Frankonia erstanden hatte, wo ihre gesamte Familie seit Generationen ihren Outdoorbedarf deckte und daher Stammkunde war. Schließlich hielt sie es nicht mehr länger aus. Sie leckte sich über die vor Erregung trockenen Lippen und stieg die Leiter vom Hochsitz herab. Langsam ging sie vom Waldrand auf die Lichtung, die vom Vollmond fast taghell ausgeleuchtet war.
Als sie sich dem Tier näherte, sah sie an der Dunstwolke, dass der Bock noch atmete. Umso besser, und die Erregung durchflutete erneut ihren Unterleib. Sie kniete sich neben das Tier, dessen Herz noch wild schlug. Sie nahm das große Jagdmesser, das wie die Flinte ihrem Vater gehörte und brach den Leib des sterbenden Tieres auf. Sie zerschnitt das Mittelfell und den Herzbeutel und legte ihre Hände um das Herz, das weiterhin pumpte. So verharrte sie andächtig für einen Moment, bis die Erregung ihr nicht mehr ausreichte. Sie brauchte mehr. Sie wusste aus eigener Erfahrung, dass es mit dem Leben des Tieres schnell vorübergehen würde, wenn sie die Hauptschlagader direkt am Abgang aus dem Herzen eröffnen würde. Daher legte sie die Halsschlagader frei und bohrte ganz vorsichtig und nahezu zärtlich die Spitze des Messers durch die Gefäßwand. Sofort spritzte ein feiner Blutstrahl hervor und besprühte pulsierend ihr Gesicht. Das war der Höhepunkt schlechthin für die junge Medizinerin. Das warme Blut benetzte ihr Gesicht und schmeckte nach Eisen, wenn sie es gierig mit der Zunge von ihren Lippen leckte. Ein bisschen wie Spinat mit Rote Bete, dachte sie versonnen. Nie zuvor hatte sie sich so lebendig gefühlt wie in diesem Moment.
„Was für ein Gefühl. Der Herr hat’s gegeben, die Dame hat’s genommen“, flüsterte Katharina von Klettenburg geradezu andächtig.
In diesem Moment kam Katharina wieder vor Augen, was sie schon ein paar Mal in diesen Situationen gedacht hatte. Sie hatte im Anatomieunterricht nie recht verstanden, warum die Anatomen immer die Gemeinsamkeiten zwischen den äußeren Geschlechtsorganen von Mann und Frau betonten. Sie hatte gelernt, dass die Schwellkörper von Klitoris und Penis den gleichen Aufbau haben und auch gleich funktionierten. Sie hatte damals immer gedacht, es hätte sich um ein neumodisches Gender-Thema gehandelt, zumal sie selbst beim Sex an ihrem eigenen Körper nichts hatte spüren können, was auch nur im Entferntesten einer Erektion eines männlichen Penis gleichkam. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, als sie sich zum ersten Mal vor zwei Jahren heimlich die Jagdausrüstung ihres Vaters geborgt hatte und in den Wald gezogen war, um selbst Wild zu schießen. Sie wusste noch genau, wie der Anatom der Münchner Anatomischen Anstalt, Professor Nodus, zur Verdeutlichung der Analogien mühsam und langwierig die Geschlechtsorgane von Mann und Frau mit Kreide an die Tafel gezeichnet hatte. Schon allein an die Tafel zu malen, ging in dieser Zeit gar nicht mehr, hatte Katharina damals gefunden. In einer Zeit, in der jede Grundschule ein Whiteboard hatte und kaum je eine Lehrerin noch an die Tafel schrieb.
Dem alten Professor war das Thema aber wirklich wichtig gewesen. Sie hörte ihn noch genau sagen: „Wenn Sie die Presse verfolgen, und ich meine jetzt Tageszeitungen und Journale und nicht Fäßbock und Tripper, dann fällt ihnen auf, dass sich die Damenwelt zu Recht darüber beschwert, dass die Beschreibung des weiblichen Genitales in den Medien vielleicht nicht immer abschätzig, meist jedoch schlichtweg falsch ist. Das Resultat ist leider, dass viele Frauen sagen, sie hätten seit der Kindheit keine richtige Beziehung zu ihrem eigenen Körper aufgebaut, weil ihre Eltern und Lehrerinnen nicht einmal gewusst hätten, wie man die Sexualorgane der Frau richtig benennt. Und das kann ich nachvollziehen. Wenn ich die Zeitung lese und es wird darin ein Kunstwerk beschrieben, das die äußeren Geschlechtsorgane der Frau darstellen soll, und dann steht als Überschrift „Vagina“ da, dann kann ich mich auch kaum zurückhalten, einen Leserbrief zu schreiben. Was ich zu anatomischen Themen auch schon oft getan habe. Gelesen hat sie wohl niemand und abgedruckt wurden sie schon gar nicht.“
Der Professor war daraufhin richtig in Fahrt gekommen.
„Daher lassen Sie es sich gesagt sein. Die äußeren Geschlechtsorgane der Frau fasst man als Vulva zusammen, und dazu gehören neben den großen und kleinen Vulvalippen, die ich Ihnen hier mal an die Tafel gemalt habe, auch die Klitoris, der Schambeinhügel und der Scheidenvorhof. Aber nur der Vorhof, meine Damen und Herren. In diesen Vorhof, der von den beiden kleinen Vulvalippen begrenzt wird, münden die Vagina und vor dieser die Harnröhre. Das müssen Sie wissen, wenn Sie im Nachtdienst bei einer Frau einen Blasenkatheter legen. Das machen Sie ja, damit der Harn abfließt. Wenn Sie das Schläuchle in die falsche Öffnung schieben und landen in der Vagina, ist keinem geholfen. Weder der Patientin, noch Ihnen!“. Ein müdes Lachen ging durch den Saal.
„Aber eins sehen Sie schon an den Bezeichnungen“, hob der Professor erneut an. „Hier ist von Scham die Rede, weil das die Übersetzung der lateinischen Fachbegriffe so vorgibt. Früher hat man sogar Schamlippen gesagt! Aber diese Beschreibung ist negativ und sollte vermieden werden. Wenn man sich schämt, will man etwas vermeiden und das ist keine gute Grundlage für die Herangehensweise an den eigenen Körper. Beim Mann heißt es ja auch schlicht Penis und Skrotum, also Schwanz und Hodensack, ohne dass sich jemand schämen würde! Das haben nach vielen hundert Jahren auch die Anatomen begriffen und jetzt die lateinischen Fachbegriffe geändert. Ob Sie es glauben oder nicht, wir Anatomen haben daher unsere Anatomische Terminologie aufgrund dieser wichtigen Problematik überarbeitet. Und jetzt heißen die Lippen eben nicht mehr Schamlippen, sondern Vulvalippen. Und schon gar nicht Vaginalippen. Die Vagina ist ein inneres Geschlechtsorgan wie auch die Eierstöcke und die Gebärmutter. Und wer das alles im Testat nicht wiedergeben kann, ist damit nachweislich noch mehr von gestern als ich!“
Als Nodus seinen Monolog beendet hatte, war der Geräuschpegel im Saal fast auf Stadionlautstärke angeschwollen. Anfangs hatten alle wie immer die Handys gezückt und gecheckt, was sich während der Vorlesung in den sozialen Medien getan hatte. Unter dem Hashtag #NodusNervt hatten sie einen neuen Eintrag erstellt, der sich einer langen Liste von Einträgen anschloss, die in solchen und ähnlichen Situationen entstanden waren, wenn sich der Professor in die anatomischen Details eines Themas verfranzt hatte, um aus ihnen „gute Ärztinnen und Ärzte zu machen“. Das war ihr schon damals gehörig auf die Nerven gegangen.
Mit einem zufriedenen Lächeln hatte sie mit allen anderen eher lustlos geklopft, als Nodus das Ende der Vorlesungsstunde verkündete.
Rechnung offen
Mit dem alten Anatomen hatte Katharina sowieso noch eine Rechnung offen. Kaum hatte sie im letzten Jahr in der Klinik ihres Vaters ihre Assistenzarztausbildung begonnen, war ihr die unliebsame Aufgabe zugefallen, den jährlichen Lungenkongress der Klinik in Tutzing vorzubereiten. Sie kannte die Veranstaltung schon, da es für ihren Vater immer ein Highlight des Jahres gewesen war, seine Buddys von früher und alle, die wie er zur gefühlten Ärzte-Elite auf dem Gebiet der Lungenmedizin zählten, einmal im Jahr zu einem kleinen Symposium in seine Klinik einzuladen. Die Veranstaltung war ein einziges Eier-Geschaukel, wie Katharina wiederholt feststellen konnte. Je spürbarer die Diskrepanz des eigenen Standes in der wissenschaftlichen Welt zum in Fleisch und Blut übergegangenen Dünkel jeweils war, desto größer schien der Drang der Götter in Weiß zur Selbstdarstellung und Selbstüberhöhung zu sein. Und dafür war für die Generation der Baby-Boomer ein „wissenschaftlicher“ Kongress die geeignete Bühne. Instagram nutzen sie ja oft noch nicht. Leider, zumindest empfand Katharina das jetzt so, da sie die Aufgabe erhalten hatte, die anatomischen Präparate für die Veranstaltung zu organisieren. Zunächst hatte sie ganz naiv gedacht, die kämen einfach aus der Anatomie, da sie dort bei ihrem alten Professor bestimmt genug Leichen für solche Zwecke parat hatten. Dem war aber nicht so, wie sie aufgeklärt worden war. Daher kontaktierte man den Anatomen der LMU mit derartigen Anfragen seit mehreren Jahren schon gar nicht mehr. Vielmehr bestellte man bei einer Firma im Internet, was man gerade brauchte. Die Webseite war intuitiv und man konnte sich als Warenkorb zusammenklicken, was man gerade haben wollte. Zumindest wenn man als registrierter Nutzer glaubhaft machen konnte, im Auftrag eines medizinischen Betriebs Leichenteile zu shoppen. Das war sicher um einiges einfacher, als eine Fortbildung mit Professor Nodus zu organisieren, der bestimmt nicht einmal wusste, was ein Warenkorb eigentlich ist.
Jedenfalls war alles zunächst ganz einfach gewesen und sie hatten die gleichen Leichenteile bestellt wie jedes Jahr. Zehn einzelne Lungenpaare und dann noch einmal fünf Oberkörper mit freigelegten Lungen und eröffnetem Herz. Ihr Vater hatte ihr gesagt, dass die Kollegen und Kolleginnen diese Präparate immer besonders schätzten, da sie beim Anfassen und Anschauen gemeinsam über ihre früheren Erfahrungen aus der Ausbildung im Anatomieunterricht sprechen und in Erinnerungen daran schwelgen konnten. Die Organisation des Symposiums schien daher ein Selbstläufer zu sein. Bis sie wenige Tage vor dem Kongress feststellen musste, dass der Kontakt zu der Firma abgebrochen war und man niemanden mehr erreichen konnte. Kurzum, der Kongress musste kurzfristig abgesagt werden und alle Eingeladenen waren untröstlich gewesen. Ihr Vater hatte die Firma daraufhin verklagt und alle Kosten für Raummieten, Catering, Honorare und Spesen für Flüge und Hotelbuchungen in Rechnung gestellt. Die Firma mit Sitz in den USA hatte allerdings anscheinend einige Erfahrungen in diesen Fällen und schloss jegliche Haftung kategorisch aus. So war es nicht verwunderlich, dass bis jetzt überhaupt keine Kosten erstattet worden waren und der Rechtsstreit ein halbes Jahr später noch in vollem Gange war.
Und das würde Katharina dem Anatomen Nodus so schnell nicht verzeihen! Wie in der Presse berichtet worden war, hatte der Professor aufgedeckt, dass die Geschäftspraxis der Firma und im Besonderen deren Bezugsquellen der Leichenteile moralisch vollkommen inakzeptabel waren.
VPAX
Sektion 1
März also!
Nodus konnte immer noch nicht nachvollziehen, wie die letzten Monate an ihm vorbeigegangen waren. Spurlos nicht, wie er sich eingestehen musste. Zum Glück, denn letzten Oktober war er beinahe tot gewesen. Nach mehreren Tagen im künstlichen Koma war er für mehrere Wochen täglich an die Dialyse gehängt worden, wie man die künstliche Niere im medizinischen Sprachgebrauch nannte. Dabei wurde sein Blut gespült, um auch die letzten Spuren der Chemikalien auszuwaschen, die sein Körper versehentlich in einer Küvette des Leichenlagers der Anatomischen Anstalt aufgenommen hatte. Diese Tanks dienten der Aufbewahrung von Leichen für den Präparierkurs im Unterricht der Anatomie für Studierende der Medizin und Zahnmedizin und waren zu diesem Zweck mit einer Flüssigkeit gefüllt, die neben Alkohol noch verschiedene Substanzen enthielten, die Fäulnis und Zersetzung der menschlichen Körper zuverlässig aufhalten konnten. Daraus konnte man bereits schlussfolgern, dass das Gemisch nicht für ein Ganzkörperbad eines lebendigen Menschen gedacht war. Da es keine Erfahrungswerte gab, wie viel dieser Substanzen ein lebender Körper aufnehmen würde und was diese mit den verschiedenen Organen tun würden, in die der Blutstrom sie nach der Aufnahme durch die Haut verteilte, wollte man auf Nummer Sicher gehen.
Zumal Nodus nicht gerade zierlich von Gestalt war und sein massiger Körper über eine entsprechende Oberfläche verfügte, die die durchschnittlichen zwei Quadratmeter deutlich überstieg. Die Ärzte der Dialysestation stellten sich daher auf eine üppige Ration Chemikalien ein, die Nodus über seine Haut aufgenommen haben mochte. Was natürlich ein Hohn war, da Nodus, wie schon sein Erscheinungsbild offenbarte, eher kein Verfechter der parenteralen Ernährung war, sondern diese seinem Prachtkörper am liebsten auf dem üblichen Weg und damit durch den Mund zuführte. Und zwar am liebsten in den Biergärten in und um München, in denen er den verschiedenen Spezialitäten besonders zugeneigt war. Als Anatom konnte er das natürlich auch wissenschaftlich begründen, lagen doch die meisten Geschmacksrezeptoren auf der Zunge.
Im letzten halben Jahr hatte Nodus allerdings über zwanzig Kilogramm abgenommen. Dies hatte die behandelnden Ärzte sehr überrascht, da er, abgesehen von den wenigen Tagen im Koma, bei Bewusstsein war und alles essen konnte. Zum einen war jedoch der Appetit wie weggeblasen und er überlegte schon, ob er seinen Behandlungsansatz patentieren lassen könnte, um dann auch mal in dem nervtötenden Werbeblock um die Abendnachrichten herum eine garantierte Gewichtsreduktion zu versprechen. Ihm würde man wenigstens ansehen, dass eine Gewichtsreduktion medizinisch sinnvoll ist, um das Risiko für hohen Blutdruck, Diabetes, Herzinfarkt und Schlaganfall zu reduzieren, die mit hohem Gewicht einhergingen. Bei den sonstigen dort vortragenden Personen hatte er eher das Gefühl, dass ihnen ein paar Kilo mehr auf den Rippen besser zu Gesicht stünden.
So saß Nodus in seinem Garten auf der Holzbank, die er vor vielen Jahren aus ein paar dicken Eichenbrettern gehobelt und zusammengebaut hatte. Die Sonne schien ungewöhnlich kräftig für die Jahreszeit und vermittelte den Eindruck, als hätte sich die Jahresuhr entschieden, den Frühling zu überspringen und gleich von Winter auf Sommer umzuschalten. Vielleicht kam es ihm aber auch nur deshalb so vor, weil er es bis heute einfach nicht geschafft hatte, einen Fuß vor die Tür zu setzen, und sei es auch nur in den eigenen Garten. Jetzt wärmte ihm die Sonne mit ihren ersten kräftigen Strahlen den Bauch, der die Hosenträger seiner Cordhose nur noch leicht vorwölbte, und liebkoste sein faltiges Gesicht. Zumindest den oberen Teil, der nicht von seinem schwarzen Bart bewachsen war, der wie eine Matte auf seine Brust herabfiel. Allerdings musste er sich eingestehen, dass die letzten Monate den Anteil der grauen Härchen in seinem Bart doch deutlich hatten anwachsen lassen. Fast schon würde der Begriff „grau-meliert“ für seine Haarpracht am Kinn durchgehen, die sich damit nun doch dem dichten Schopf auf seinem Kopf anglich. Nein, von einer Glatze war er nicht geplagt, wie viele Männer seines Alters, die schon mit Mitte dreißig kahl wurden. Mit diesen, wie zum Beispiel dem Musiker Moby, den er aufgrund seiner klanglichen Vielfältigkeit bewunderte, empfand er jedes Mal tiefes Mitleid.
Egal, jedenfalls saß Nodus nun im Garten und hatte es damit weitergebracht als in den Wochen zuvor, in denen er oft keine Motivation verspürt hatte, auch nur das Bett zu verlassen. Stattdessen hatte er tagelang vor sich hin gedöst und Musik gehört. Oft stand er nur auf, um seine Antidepressiva zu schlucken, die er bereits seit einigen Jahren nahm, nachdem ihn ein Schicksalsschlag zu dem gemacht hatte, was er war. Einen alternden Strohwitwer, der immer mal wieder mit Phasen von Depressionen zu kämpfen hatte und nie wusste, wann diese ihn wieder heimsuchen würden. Im Vergleich dazu war der heutige Tag ein Genuss und er fragte sich sogar, ob er nicht bald mal wieder seine geliebte Anstalt heimsuchen könnte.
Die Anatomische Anstalt der Ludwig-Maximilians-Universität in München war seit bald dreißig Jahren seine Arbeitsstelle. Eigentlich reichte es aus, von der Anatomischen Anstalt zu sprechen, da alle anderen anatomischen Institute auf der Welt schon vor längerem die Zeichen der Zeit erkannt und sich in Institute für Anatomie und Zellbiologie umgetauft hatten. Das klang auch viel besser, besonders im Englischen als „Institute of Anatomy and Cell Biology“. Mit diesem Anglizismus sollte endlich der Muff der Jahrhunderte aus den Gemäuern vertrieben werden, in denen die Anatomen die wissenschaftlichen Entwicklungen bis ins Zwanzigste Jahrhundert hinein als Speerspitze vorangetrieben, dann aber zunehmend den Anschluss verpasst hatten, sodass die mehr experimentell ausgerichteten Disziplinen in den Grundlagenfächern der Medizin wie Physiologie und Biochemie den Anatomen zuerst den Rang und dann auch den Schneid abgekauft hatten. Und das war für die Urmutter der Medizin, als die sich die Anatomie zu Recht immer noch empfand, weiterhin schwer zu ertragen. An vielen Universitäten war es schon so, dass die Anatomen nur noch als die „Lehrdödel“, wie Nodus zu sagen pflegte, respektiert wurden. Sowohl die Anerkennung als auch die personellen und materiellen Ressourcen wurden anderweitig verteilt, um für die Universitäten im Wettbewerb der Exzellenzinitiative Millionen an Fördergeldern und das weltweit damit assoziierte Prestige einzuholen. Von daher war der Begriff Anatomische Anstalt in München sogar recht passend, da Nodus bereits vor vielen Jahren die experimentelle Forschung an den Nagel gehängt und sich auf seinen Anatomieunterricht konzentriert hatte.
Nodus war damit nicht nur an seiner eigenen Universität zum Außenseiter geworden, sondern auch in der Anatomischen Gesellschaft, in der alle Anatomen im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus organisiert waren. Gerade die Jüngeren, durchaus aber auch einige gleichaltrige Kollegen, die wie Nodus nur noch wenige Jahre vom Ruhestand trennte, belächelten den Kollegen aus München zumindest hinter dessen Rücken. Nodus war das bewusst, aber das kümmerte ihn nicht weiter. Er war im Reinen mit sich und seiner Arbeitseinstellung. Zumal es kaum einen gab, der ihm bei der Präparation des menschlichen Körpers das Wasser reichen konnte. Wenn Nodus zu Skalpell und Pinzette griff und zu Werke ging, dann war allen schnell klar, dass hier ein Meister seines Faches tätig war. Daher wurde er auch gerne zu Fortbildungsveranstaltungen wie dem „Präparieren für Anatomen“ eingeladen, wo er in jedem Jahr aufs Neue den jungen Kolleginnen und Kollegen seine Kniffe und Tricks vermitteln durfte, die einen Künstler wie ihn von einem Durchschnittsanatomen unterschied. Da standen dann sogar die „Großkopferten“, die Herren Institutsdirektoren, mit unverhohlener Bewunderung am Tisch und schauten ihm über die Schulter. Wohlwissend, dass sie dieses präparatorische Niveau in diesem Leben nicht mehr erreichen würden. Und das war auch verständlich, da sie sich neben dem Unterricht, den die meisten seiner Kolleginnen und Kollegen übrigens sehr gerne machten, vor allem dem Schreiben von Forschungspublikationen und Anträgen um Forschungsgelder widmeten. Es ist eben noch kein Meister vom Himmel gefallen und viele erfahrene Anatomen präparierten sicher auch schnell und zielstrebig. Aber filigran und behände wie Nodus war eben kaum einer von ihnen. Nodus hätte ein Vermögen gegeben, wenn er dieses hätte, um zu sehen, wie wohl Leonardo da Vinci damals zu Beginn des sechzehnten Jahrhunderts präpariert haben mochte. Leonardo war ja nach seiner Einschätzung nicht nur einer der größten Anatomen aller Zeiten gewesen, sondern hatte als Künstler mit der „Mona Lisa“ und dem „letzten Abendmahl“ zwei der bedeutendsten Kunstwerke aller Zeiten geschaffen und obendrein als Ingenieur fürchterliche Kriegsmaschinen wie Panzer und Maschinengewehre ersonnen und auf zahlreichen Skizzen verewigt. Seine Leidenschaft aber hatte der Anatomie gegolten. Allerdings konnte man mit dieser kein Geld verdienen, wenn man wie Leonardo kein Mediziner war, sondern in Florenz zum Künstler ausgebildet worden ist. Und selbst nur an wenigen Universitäten Italiens, Frankreichs, Österreichs und Deutschland gab es zu dieser Zeit überhaupt Anatomen, die als Professoren angestellt waren. So kam es, dass Leonardo da Vinci die ungefähr dreißig Leichen, die er über sein ganzes Leben hinweg präparierte, um den menschlichen Körper zu verstehen und auch in seinen Kunstwerken exakt darstellen zu können, nachts in den Kellern von Hospitälern sezierte.