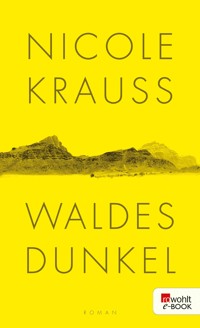
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nicole Krauss, die Autorin des Welterfolges «Die Geschichte der Liebe», kehrt mit einem phantastischen Roman zurück: Ein vom Leben enttäuschter reicher New Yorker Anwalt und eine Schriftstellerin mit Eheproblemen machen sich auf die Suche nach dem Unbekannten in sich selbst und finden in der Wüste Israels überraschende Wege, über sich, ihre Träume und die Welt hinaus ins Unendliche zu schauen. Jules Epstein, 68, einst Beweger und politischer Macher mit übergroßem Ego, gerät nach der Scheidung von seiner langjährigen Frau aus dem Tritt. Zum Schrecken seiner Kinder verschenkt er den größten Teil seines Vermögens und möchte den Rest in eine Stiftung zum Gedenken an seine verstorbenen Eltern stecken. Am liebsten würde er den seit 2000 Jahren abgeholzten Mount Hebron in Israel aufforsten lassen. Schon im Flieger allerdings lernt er einen Rabbiner kennen, der ein Treffen sämtlicher lebender Abkömmlinge von König David plant und darauf besteht, Epstein gehöre zu dieser traditionsreichen dynastischen Linie. Epstein versucht, den versponnenen Rabbi loszuwerden, aber dann trifft er auf dessen verführerische Tochter, die in der Wüste Negev einen Film dreht … Die junge Autorin Nicole aus Brooklyn lässt nach einer Epiphanie in der Küche, bei der sie sich nur noch als nutzloses Staubkorn im Multiversum sieht, ihre Familie zurück und flieht ins Hilton von Tel Aviv, wo sie seit ihrer Geburt jedes Jahr gewesen ist. Ein Ort der Ruhe, hofft sie, an dem sie sich wiederfinden kann. Doch ein emeritierter Literaturprofessor mit dubioser Mossad-Vergangenheit lauert ihr ständig auf und bedrängt sie, ein unvollendetes Drama fertigzuschreiben, das angeblich von Kafka stammt. Und während aus den Palästinensergebieten Raketen über den nächtlichen Himmel ziehen, landet Nicole, irregeleitet vom sinistren Professor, allein in einer Hütte in der Wüste Negev. Auf dem Schreibtisch nur zwei Dinge: eine alte Schreibmaschine und ein Bildband, betitelt «Die Wälder Israels». Mit sprühender Intelligenz und erzählerischer Raffinesse webt Nicole Krauss ein traumhaft metaphorisches Gespinst von einem Roman, frei nach Dante: «Ich fand auf unseres Lebensweges Mitte in eines Waldes Dunkel mich verschlagen, weil sich vom rechten Pfad verirrt die Schritte.»
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 426
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Nicole Krauss
Waldes Dunkel
Roman
Über dieses Buch
Nicole Krauss, die Autorin des Welterfolges «Die Geschichte der Liebe», kehrt mit einem phantastischen Roman zurück: Ein vom Leben enttäuschter reicher New Yorker Anwalt und eine Schriftstellerin mit Eheproblemen machen sich auf die Suche nach dem Unbekannten in sich selbst und finden in der Wüste Israels überraschende Wege, über sich, ihre Träume und die Welt hinaus ins Unendliche zu schauen.
Jules Epstein, 68, einst Beweger und politischer Macher mit übergroßem Ego, gerät nach der Scheidung von seiner langjährigen Frau aus dem Tritt. Zum Schrecken seiner Kinder verschenkt er den größten Teil seines Vermögens und möchte den Rest in eine Stiftung zum Gedenken an seine verstorbenen Eltern stecken. Am liebsten würde er den seit 2000 Jahren abgeholzten Mount Hebron in Israel aufforsten lassen. Schon im Flieger allerdings lernt er einen Rabbiner kennen, der ein Treffen sämtlicher lebender Abkömmlinge von König David plant und darauf besteht, Epstein gehöre zu dieser traditionsreichen dynastischen Linie. Epstein versucht, den versponnenen Rabbi loszuwerden, aber dann trifft er auf dessen verführerische Tochter, die in der Wüste Negev einen Film dreht …
Die junge Autorin Nicole aus Brooklyn lässt nach einer Epiphanie in der Küche, bei der sie sich nur noch als nutzloses Staubkorn im Multiversum sieht, ihre Familie zurück und flieht ins Hilton von Tel Aviv, wo sie seit ihrer Geburt jedes Jahr gewesen ist. Ein Ort der Ruhe, hofft sie, an dem sie sich wiederfinden kann. Doch ein emeritierter Literaturprofessor mit dubioser Mossad-Vergangenheit lauert ihr ständig auf und bedrängt sie, ein unvollendetes Drama fertigzuschreiben, das angeblich von Kafka stammt. Und während aus den Palästinensergebieten Raketen über den nächtlichen Himmel ziehen, landet Nicole, irregeleitet vom sinistren Professor, allein in einer Hütte in der Wüste Negev. Auf dem Schreibtisch nur zwei Dinge: eine alte Schreibmaschine und ein Bildband, betitelt «Die Wälder Israels».
Mit sprühender Intelligenz und erzählerischer Raffinesse webt Nicole Krauss ein traumhaft metaphorisches Gespinst von einem Roman, frei nach Dante: «Ich fand auf unseres Lebensweges Mitte in eines Waldes Dunkel mich verschlagen, weil sich vom rechten Pfad verirrt die Schritte.»
Vita
Nicole Krauss, geboren 1974 in New York, studierte Literatur in Stanford und Oxford sowie Kunstgeschichte in London. Sie debütierte 2002 mit «Kommt ein Mann ins Zimmer» als Romanautorin. Mit ihrem zweiten Roman «Die Geschichte der Liebe» gelang ihr ein grandioser internationaler Erfolg. Er wurde in 35 Sprachen übersetzt und u.a. mit dem Prix du Meilleur Livre Étranger ausgezeichnet. Krauss lebt in Brooklyn.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel «Forest Dark» bei HarperCollins, New York.
Sämtliche in diesem Roman zitierten Stellen aus den Werken Franz Kafkas wurden der Kritischen Ausgabe der Werke von Franz Kafka, herausgegeben von Gerhard Neumann, Jost Schillemeit, Sir Malcolm Pasley und Gerhard Kurz, erschienen im S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1982–2013, entnommen.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, März 2018
Copyright © 2018 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«Forest Dark» Copyright © 2017 by Nicole Krauss
Umschlaggestaltung Hafen Werbeagentur, Hamburg
ISBN 978-3-644-00125-1
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für meinen Vater
Die Vertreibung aus dem Paradies ist in ihrem Hauptteil ewig: Es ist also zwar die Vertreibung aus dem Paradies endgültig, das Leben in der Welt unausweichlich, die Ewigkeit des Vorganges aber macht es trotzdem möglich, dass wir nicht nur dauernd im Paradiese bleiben könnten, sondern tatsächlich dort dauernd sind, gleichgültig, ob wir es hier wissen oder nicht.
Franz Kafka
EINS
Ayeka
Zur Zeit seines Verschwindens hatte Epstein seit drei Monaten in Tel Aviv gelebt. Niemand hatte seine Wohnung gesehen. Seine Tochter Lucie war mit ihren Kindern zu Besuch gekommen, doch Epstein brachte sie im Hilton unter, wo er sie zu üppigen Frühstücken traf, bei denen er nur am Tee nippte. Als Lucie fragte, ob sie nicht mal bei ihm vorbeikommen könne, hatte er abgewiegelt und erklärt, es sei klein und bescheiden, nicht dazu geeignet, Gäste zu empfangen. Noch verstört wegen der späten Scheidung ihrer Eltern, hatte sie ihn mit zusammengekniffenen Augen angesehen – nichts an Epstein war je klein oder bescheiden gewesen –, aber trotz ihres Argwohns hatte sie sich damit abfinden müssen, wie auch mit all den anderen Veränderungen, die über ihren Vater gekommen waren. Am Ende waren es die Beamten der Kriminalpolizei, die Lucie, Jonah und Maya in die Wohnung ihres Vaters führten, die sich, wie sich herausstellte, in einem verfallenden Gebäude nahe dem alten Hafen von Jaffa befand. Die Farbe blätterte ab, und die Dusche zielte direkt auf die Toilette. Eine Kakerlake stolzierte majestätisch über den Steinboden. Erst nachdem der Kriminalbeamte mit dem Schuh draufgetreten hatte, kam es Maya, Epsteins jüngstem und intelligentestem Kind, in den Sinn, dass sie, die Kakerlake, vielleicht die Letzte gewesen war, die ihren Vater gesehen hatte. Wenn Epstein überhaupt je wirklich dort gelebt hatte – die einzigen Dinge, die darauf hindeuteten, waren ein paar von der feuchten, durch ein offenes Fenster eindringenden Luft verzogene Bücher und ein Fläschchen der Coumadin-Tabletten, die er eingenommen hatte, seit fünf Jahre zuvor ein Vorhofflimmern entdeckt worden war. Man hätte den Ort kein Dreckloch nennen können, und doch hatte er mehr mit den Slums von Kalkutta gemein als mit den Räumen, in denen seine Kinder mit ihrem Vater an der Amalfiküste oder auf dem Cap d’Antibes gewesen waren. Obwohl, wie jene anderen Räume bot auch dieser einen Blick aufs Meer.
In diesen letzten Monaten war Epstein schwer erreichbar gewesen. Seine Antworten kamen nicht mehr prompt, egal, zu welcher Tages- oder Nachtzeit. Wenn er bis dahin immer das letzte Wort gehabt hatte, so weil er nie eine Antwort schuldig geblieben war. Doch allmählich wurden seine Nachrichten seltener. Die Zeit dazwischen dehnte sich aus, weil sie sich in ihm ausdehnte: die vierundzwanzig Stunden, die er einst mit Gott und der Welt gefüllt hatte, wurden durch einen Maßstab von Jahrtausenden ersetzt. Seine Familie und Freunde gewöhnten sich an sein unregelmäßiges Schweigen, und so schlug niemand gleich Alarm, als er sich in der ersten Februarwoche gar nicht mehr meldete. Am Ende war es Maya, die nachts mit dem Gefühl aufwachte, es liefe ein Zittern durch den unsichtbaren Draht, der sie noch immer mit ihrem Vater verband, und Epsteins Cousin bat, nach ihm zu sehen. Moti, der in den Genuss vieler tausend Dollar von Epstein gekommen war, streichelte dem schlafenden Lover in seinem Bett über den Hintern, dann zündete er sich eine Zigarette an und zwängte seine nackten Füße in die Schuhe, denn obwohl es mitten in der Nacht war, freute er sich über die Gelegenheit, Epstein von einem neu aufgetanen Investment zu erzählen. Doch als Moti bei der auf die Hand gekritzelten Adresse in Jaffa ankam, rief er Maya zurück. Es müsse ein Irrtum sein, sagte er ihr, ausgeschlossen, dass ihr Vater in einer derartigen Absteige lebe. Maya telefonierte mit Epsteins Anwalt Schloss, dem Einzigen, der überhaupt noch etwas wusste, aber der bestätigte die Adresse. Als Moti schließlich die junge Mieterin im ersten Stock aus dem Bett scheuchte, indem er einen kurzen dicken Finger stur auf die Klingel gedrückt hielt, bestätigte sie ihrerseits, dass Epstein die letzten paar Monate tatsächlich über ihr gewohnt habe, aber es sei etliche Tage her, seit sie ihn zuletzt gesehen oder vielmehr gehört hatte, denn das Geräusch seiner nachts über ihre Decke wandernden Schritte war ihr eine vertraute Gewohnheit geworden. Obwohl sie es nicht wissen konnte, während sie verschlafen an der Tür stand und mit dem zur Glatze neigenden Cousin ihres Nachbarn von oben sprach, sollte die junge Frau sich im Zuge der nunmehr rasant eskalierenden Ereignisse an das Geräusch vieler Leute gewöhnen, die über ihrem Kopf ein und aus gingen, um wieder und wieder die Schritte eines Mannes zu verfolgen, den sie kaum kannte und dem sie sich doch seltsam nahe gefühlt hatte.
Die Polizei behielt den Fall nur einen halben Tag, ehe er vom Schin Bet übernommen wurde. Schimon Peres persönlich rief die Familie an, um zu sagen, dass Berge versetzt würden. Der Taxifahrer, der Epstein sechs Tage zuvor abgeholt hatte, wurde ausfindig gemacht und zum Verhör gebracht. Zu Tode erschrocken, lächelte er die ganze Zeit, dass seine Goldzähne blitzten. Später führte er die Schin-Bet-Kriminalisten zu der Straße am Toten Meer, und nach einigen Verwirrungen wegen versagender Nerven gelang es ihm, die Stelle zu lokalisieren, wo er Epstein abgesetzt hatte, eine Kreuzung nahe den kahlen Hügeln auf halber Strecke zwischen den Höhlen von Qumran und Ein Gedi. Die Suchtrupps schwärmten in die Wüste aus, doch alles, was sie fanden, war Epsteins leere Aktentasche mit seinem Monogramm, was, wie Maya es ausdrückte, die Möglichkeit seiner Transsubstantiation nur umso realer erscheinen ließ.
Während jener Tage und Nächte waren seine Kinder, versammelt in den Gemächern der Hilton-Suite, hin und her gerissen zwischen Hoffnung und Schmerz. Irgendein Telefon klingelte immer – Schloss allein bediente drei –, und jedes Mal klammerten sie sich an die jüngste durchgegebene Information. Jonah, Lucie und Maya erfuhren Dinge über ihren Vater, die sie nicht gewusst hatten. Aber am Ende kamen sie der Beantwortung der Frage nicht näher, was er mit alldem beabsichtigt habe oder was aus ihm geworden sei. Im Lauf der Tage hatten die Anrufe nachgelassen und keine Wunder gewirkt. Allmählich stellten die Kinder sich auf die neue Realität ein, in der ihr Vater, der im Leben so stabil und entschieden gewesen war, sich mit einem äußerst dubiosen letzten Akt verabschiedet hatte.
Es wurde ein Rabbi bestellt, der ihnen auf Englisch mit schwerem Akzent erklärte, das jüdische Gesetz verlange absolute Gewissheit über den Tod, ehe die Trauerrituale befolgt werden könnten. In Fällen, in denen es keine Leiche gab, mochte ein Zeuge des Todes genügen. Und selbst ohne Leiche und ohne Zeugen genügte ein Bericht, dass die Person von Dieben getötet, ertrunken oder von einem wilden Tier verschleppt worden sei. Aber in diesem Fall gab es keine Leiche, keinen Zeugen, keinen Bericht. Weder Diebe noch wilde Tiere, soweit irgendjemand wusste. Nur eine unergründliche Abwesenheit, wo einst ihr Vater gewesen war.
Niemand hätte sich das vorstellen können, und doch erschien es letztlich als ein passendes Ende. Der Tod war zu klein für Epstein. Rückblickend nicht einmal eine reale Möglichkeit. Im Leben hatte er den ganzen Raum eingenommen. Er war nicht zu groß dimensioniert, nur einfach unbeherrschbar. Es gab zu viel von ihm, er quoll ständig über. Alles strömte nur so aus ihm heraus: die Leidenschaft, die Wut, die Begeisterung, die Verachtung gegenüber Menschen und die Liebe zur gesamten Menschheit. Streit war das Medium, mit dem er aufgewachsen war, und er brauchte ihn, um zu wissen, dass er lebte. Mit drei Vierteln derer, die er ins Herz geschlossen hatte, zerstritt er sich; wer blieb, konnte nichts falsch machen und wurde auf ewig von Epstein geliebt. Ihn zu kennen bedeutete, entweder von ihm zerquetscht oder wahnsinnig aufgebläht zu werden. Man erkannte sich selbst in seinen Beschreibungen kaum wieder. Er hatte eine lange Reihe von Schützlingen. Epstein blies ihnen seinen Atem ein, sie wurden groß und größer, wie jeder, den er zu lieben beschloss. Am Ende flogen sie wie Ballons bei Macy’s Thanksgiving-Parade. Aber dann, eines Tages, verfingen sie sich in Epsteins hohem moralischem Geäst und platzten. Von da an waren ihre Namen verflucht. In seinen inflationären Gewohnheiten war Epstein zutiefst Amerikaner, in seinem mangelnden Respekt vor Grenzen und seinem Tribalismus jedoch nicht. Er war etwas anderes, und dieses andere führte ständig zu Missverständnissen.
Trotzdem hatte er eine Art, Leute mitzureißen, sie auf seine Seite zu bringen, unter den breiten Schirm seiner Politik. Er leuchtete von innen und strahlte dieses Licht so unbekümmert aus wie jemand, der es nicht nötig hat zu knausern oder zu sparen. Mit ihm zusammen zu sein, war nie langweilig. Seine Lebensgeister schwollen an und ab und wieder an, sein Temperament loderte, er war nachtragend, aber nie weniger als absolut vereinnahmend. Er war unendlich neugierig, und wenn sein Interesse an etwas oder jemandem geweckt war, ging er den Dingen erschöpfend auf den Grund. Er zweifelte nie daran, dass alle anderen sich ebenso für diese Themen interessierten wie er selbst. Doch nur wenige konnten seiner Ausdauer standhalten. Am Schluss waren es stets seine Tischgefährten, die zuerst darauf drängten, nach Hause zu gehen, und selbst dann folgte Epstein ihnen noch aus dem Restaurant hinaus, mit dem Finger in die Luft stechend, begierig, seine Sache auf den Punkt zu bringen.
Er war immer und bei allem der Erste gewesen. Wenn seine natürlichen Anlagen nicht reichten, brachte er sich durch schiere Willenskraft dazu, die eigenen Grenzen zu überschreiten. Als junger Mann war er zum Beispiel kein geborener Redner gewesen; ein Lispeln kam ihm in die Quere. Auch war er keine Sportlernatur. Aber es gelang ihm, früh in beiden Dingen, und besonders in diesen, zu glänzen. Das Lispeln wurde überwunden – nur wenn man mit ganz feinem Ohr hinhörte, konnte man noch eine leichte Verschleifung infolge der Operation entdecken, die er hatte vornehmen lassen –, und viele Stunden Training und das Trimmen eines schlauen, mörderischen Instinkts machten ihn zum Meister im Leichtgewichtringen. Wenn er auf eine Wand stieß, warf er sich so oft dagegen und rappelte sich wieder auf, bis er eines Tages geradewegs hindurchmarschierte. Diese Verbindung von ungeheurem Druck und Anstrengung war hinter allem zu spüren, was er tat, und doch erschien das, was bei jedem anderen wohl nach Eifer ausgesehen hätte, bei ihm als eine Form von Anmut. Schon als Junge waren seine Bestrebungen gargantuesk gewesen. In der Siedlung von Long Beach, Long Island, in der er aufwuchs, hatte Epstein auf zehn Häuser eine monatliche Abschlagszahlung erhoben, gegen die er, bei einem Limit von zehn Stunden pro Monat, rund um die Uhr verfügbar war, um seine Dienste zu verrichten, ein immer umfangreicher werdendes Angebot, das er säuberlich gelistet mit den Abrechnungen herumschickte (Rasenmähen, Hundeausführen, Autowaschen, sogar verstopfte Toiletten reinigen, denn er kannte keine Hemmschwelle). Er würde endlos Geld haben, weil das sein Schicksal war; lange bevor er in Geld einheiratete, wusste er schon genau, was damit anzufangen war. Mit dreizehn kaufte er sich von seinen Ersparnissen einen blauen Seidenschal, den er so lässig trug wie seine Freunde ihre Turnschuhe. Wie viele Leute wissen denn etwas mit Geld anzufangen? Seine Frau Lianne war allergisch gegen das Vermögen ihrer Familie gewesen; es ließ sie starr und stumm werden. Sie hatte ihre frühen Jahre damit zugebracht, ihre Fußspuren in formalisierten Gärten zu verwischen. Aber Epstein brachte ihr bei, was man damit anfangen konnte. Er kaufte einen Rubens, einen Sargent, eine Mortlake-Tapisserie. Er hängte sich einen kleinen Matisse in die Ankleide. Unter einer Ballerina von Degas saß er ohne Hose. Es war keine Frage von Grobschlächtigkeit oder dass er nicht in seinem Element gewesen wäre. Nein, Epstein war sehr geschliffen. Er war nicht geläutert – er verspürte nicht den geringsten Wunsch, seine Unreinheiten zu verlieren –, aber er war auf Hochglanz poliert. Im Vergnügen sah er nichts, dessen man sich schämen musste; seines war groß und echt, daher konnte er sich auch unter den erlesensten Dingen zu Hause fühlen. Jeden Sommer mietete er dasselbe «schäbige» Schlösschen in Granada, wo man die Zeitung fallen lassen und die Füße hochlegen konnte. Er suchte sich eine Stelle an der verputzten Wand, wo er mit Bleistiftstrichen die Größe seiner Kinder markierte. In späteren Jahren bekam er feuchte Augen, wenn dieser Ort erwähnt wurde – er hatte so viel falsch verstanden, er hatte es vermasselt, und doch hatte er dort, wo seine Kinder unbeschwert unter den Orangenbäumen spielten, etwas richtig gemacht.
Aber am Ende hatte es eine Art Abtrift gegeben. Im Nachhinein, als seine Kinder zurückblickten und zu begreifen versuchten, was geschehen war, konnten sie den Beginn seiner Verwandlung genau an dem Punkt festmachen, an dem er sein Interesse am Vergnügen verlor. Eine Kluft öffnete sich zwischen Epstein und seinem großen Hunger – dieser wich hinter den Horizont zurück, den ein Mensch in sich trägt. Fortan verzichtete er auf die Jagd nach exquisiter Schönheit. Ihm fehlte das, was nötig war, um alles in Einklang zu bringen, oder er war es leid, danach zu streben. Eine Weile hingen die Gemälde noch an den Wänden, aber er hatte nicht mehr viel mit ihnen zu tun. Sie führten, in ihren Rahmen träumend, ihr Eigenleben fort. Etwas in ihm hatte sich verändert. Der Starksturm, Epstein zu sein, blies nicht mehr nach draußen. Eine große, unnatürliche Stille legte sich über alles, wie vor radikalen Wetterereignissen. Dann wechselte der Wind und drehte sich nach innen.
Das war der Moment, in dem Epstein begann, Dinge wegzugeben. Zunächst eine kleine Maquette von Henry Moore, die er seinem Arzt gab, als dieser sie bei einem Hausbesuch bewunderte. Von seinem Bett aus erklärte der grippekranke Epstein Doktor Silverblatt, in welchem Schrank die Luftpolsterfolie zu finden sei. Ein paar Tage danach zog er den Siegelring von seinem kleinen Finger und ließ ihn dem überraschten Pförtner Haaroon anstelle eines Trinkgelds in die Hand fallen; seine nackte Faust im Licht der Herbstsonne wendend, lächelte er in sich hinein. Bald danach gab er seine Patek Philippe weg. «Ich mag deine Uhr, Onkel Jules», hatte sein Neffe gesagt, und schon löste Epstein das Krokoarmband und schenkte sie ihm. «Ich mag auch deinen Mercedes», sagte sein Neffe, worauf Epstein nur lächelte und dem Jungen die Wange tätschelte. Aber rasch verstärkte er seine Bemühungen. Weiter gebend, schneller gebend, begann er genauso wild zu schenken, wie er früher akquiriert hatte. Die Gemälde gingen eins nach dem anderen an Museen; er hatte die Kunstspedition auf der automatischen Anwahl, wusste, welcher der Männer Roggensandwich mit Pute und welcher Fleischwurst liebte, und sorgte dafür, dass der Deli-Lieferdienst wartete, wenn sie ankamen. Als sein Sohn Jonah, darauf bedacht, nicht den Anschein selbstsüchtiger Motive zu erwecken, ihn von weiterer Philanthropie abzubringen versuchte, sagte Epstein ihm, er schaffe sich Raum zum Denken. Wenn Jonah darauf hingewiesen hätte, sein Vater sei doch sein Leben lang ein rigoroser Denker gewesen, hätte Epstein vielleicht erklärt, dieses Denken sei von einer ganz anderen Art: ein Denken, das noch nicht wisse, worauf es hinauswolle. Ein Denken ohne Hoffnung auf Erfolg. Aber Jonah – der so überempfindlich war, dass Epstein eines Nachmittags, auf einer privaten Führung durch die neuen Galerien griechischer und römischer Kunst im Met, vor einer Büste aus dem zweiten Jahrhundert gestanden und seinen Erstgeborenen darin gesehen hatte – antwortete nur mit verletztem Schweigen. Wie bei allem, was Epstein tat, fasste Jonah die absichtliche Entsorgung von Vermögenswerten durch seinen Vater als Affront und einen Grund mehr auf, sich gekränkt zu fühlen.
Ansonsten machte Epstein keine Anstalten, sich irgendjemandem gegenüber zu erklären, außer einmal Maya. Dreizehn Jahre nach Jonah und zehn nach Lucie, zu einer weniger turbulenten und bewegten Zeit in Epsteins Leben auf die Welt gekommen, sah Maya ihren Vater in einem anderen Licht. Zwischen ihnen herrschte eine natürliche Ungezwungenheit. Auf einem Spaziergang durch die nördlichen Gebiete des Central Park, wo Eiszapfen von den großen Schiefernasen hingen, erzählte er seiner jüngsten Tochter, dass er sich allmählich von all diesen Dingen um ihn erstickt fühle. Dass er eine unwiderstehliche Sehnsucht nach Leichtigkeit empfinde – etwas, was ihm, wie er erst jetzt merke, sein Leben lang fremd gewesen sei. Sie blieben einen Augenblick am oberen See stehen, der mit einer dünnen grünlichen Eisschicht bedeckt war. Als eine Schneeflocke auf Mayas schwarze Wimpern fiel, wischte Epstein sie sanft mit dem Daumen weg, und Maya sah ihren Vater mit fingerlosen Handschuhen einen leeren Einkaufswagen den Upper Broadway hinunterschieben.
Er schickte Kinder von Freunden aufs College, ließ Kühlschränke liefern, bezahlte der Frau des altgedienten Hausmeisters seiner Anwaltskanzlei ein Paar neue Hüften. Er leistete sogar die Anzahlung auf ein Haus für die Tochter eines alten Freundes; kein beliebiges Haus, sondern ein großzügiges Anwesen im Greek-Revival-Stil mit alten Bäumen und mehr Rasen, als die überraschte neue Eigentümerin gebrauchen konnte. Sein Anwalt Schloss –Testamentsvollstrecker und langjähriger Vertrauter –, durfte sich nicht einmischen. Schloss hatte schon einmal einen Mandanten gehabt, der von der Krankheit radikaler Wohltätigkeit befallen worden war, ein Milliardär, der seine Häuser eins nach dem anderen verschenkte, gefolgt von dem Boden unter seinen Füßen. Das sei eine Art Sucht, sagte er Epstein, und später werde er es vielleicht bereuen. Schließlich sei er noch keine siebzig; er könne noch dreißig Jahre leben. Aber Epstein schien ihm kaum zugehört zu haben, genau wie er nicht zugehört hatte, als der Anwalt heftig davon abriet, Lianne mit ihrem ganzen Vermögen gehen zu lassen, und wie er ein paar Monate später nicht zuhörte, als Schloss erneut versuchte, ihn von etwas abzubringen, diesmal von seinem Rückzug aus der Anwaltskanzlei, deren Partner er fünfundzwanzig Jahre lang gewesen war. Epstein hatte nur über den Tisch hinweg gelächelt und das Thema auf seine Lesevorlieben gebracht, die neuerdings eine Wendung zum Mystischen genommen hatten.
Es habe mit einem Buch begonnen, einem Geburtstagsgeschenk von Maya, erzählte er Schloss. Sie schenkte ihm immer seltsame Bücher, die er manchmal las und meistens nicht, was sie jedoch nicht zu stören schien – von Natur aus ein freier Geist, war sie das Gegenteil ihres Bruders Jonah und nahm selten etwas übel. Epstein hatte es eines Abends aufgeschlagen, ohne die Absicht, es wirklich zu lesen, aber es hatte ihn mit fast magnetischer Kraft hineingezogen. Es stammte von einem israelischen, in Polen geborenen Dichter, der mit sechsundsechzig gestorben war, zwei Jahre jünger als Epstein jetzt. Aber das autobiographische Büchlein, das Zeugnis eines Menschen allein im Angesicht Gottes, war geschrieben worden, als der Dichter erst siebenundzwanzig war. Das, sagte Epstein zu Schloss, habe ihn überwältigt. Mit siebenundzwanzig sei er selbst geblendet gewesen von Ehrgeiz und Hunger – auf Geld, Sex, Schönheit, Liebe, Größe, aber auch auf das Alltägliche, auf alles Sichtbare, Riechbare, Fühlbare. Wie hätte sein Leben verlaufen können, wenn er sich mit der gleichen Intensität dem Reich des Spirituellen gewidmet hätte? Warum hatte er sich dem so vollständig verschlossen?
Während er sprach, hatte Schloss ihn auf sich wirken lassen: seinen hin und her irrenden Blick, das silbergraue Haar, das bis über den Kragen fiel, erstaunlich, wo er doch immer so peinlich auf sein Äußeres geachtet hatte. «Was haben Sie zum Vorteil des Steaks gegen seine Konkurrenten zu sagen?», war die berühmte Frage, die Epstein dem Ober zu stellen pflegte. Aber jetzt blieb die Platte mit der Seezunge unberührt und strafte seinen gewohnten Hunger Lügen. Erst als der Ober kam, um zu fragen, ob etwas nicht in Ordnung sei, senkte Epstein den Blick und erinnerte sich an das Essen, aber auch dann stocherte er nur mit der Gabel darin herum. Nach Schloss’ Eindruck hatte das, was Epstein widerfuhr – die Scheidung, der Rückzug, dass alles sich auflöste, von ihm abfiel –, nicht mit einem Buch begonnen, sondern vielmehr mit dem Tod seiner Eltern. Aber dann, als Schloss Epstein in den Fond der dunklen Limousine steigen ließ, die vor dem Restaurant auf ihn wartete, besann der Anwalt sich einen Augenblick, die Hand auf dem Autodach. Er blickte zu dem im dunklen Inneren merkwürdig verschwommenen Epstein hinein und fragte sich kurz, ob mit seinem langjährigen Mandanten nicht etwas Schlimmeres sei – eine Art neurologische Verwirrung vielleicht, die sich ins Extreme steigern könnte, ehe sie als Krankheit diagnostiziert würde. Damals hatte Schloss den Gedanken vertrieben, aber später erschien er ihm als visionär.
Und tatsächlich, nach fast einjährigem Abhämmern all dessen, was sich ein Leben lang aufgetürmt hatte, erreichte Epstein schließlich die unterste Schicht. Dort stieß er auf die Erinnerung an seine Eltern, die nach dem Krieg an die Ufer Palästinas gespült worden waren und ihn unter einer durchgebrannten Glühbirne gezeugt hatten, die zu ersetzen sie nicht das Geld besaßen. Im Alter von achtundsechzig Jahren, mit nunmehr freiem Raum zum Denken, fühlte er sich verzehrt von jener Dunkelheit, tief davon berührt. Seine Eltern hatten ihn, ihren einzigen Sohn, nach Amerika gebracht und, kaum dass sie Englisch gelernt hatten, ihre in anderen Sprachen begonnenen Schreikämpfe wieder aufgenommen. Später kam seine Schwester Joanie dazu, aber sie, ein verträumtes, teilnahmsloses Kind, ließ sich nicht ködern, und so blieb es ein Dreieckskampf. Seine Eltern schrien einander an, und sie schrien ihn an, worauf er gegen einen oder beide zurückschrie. Seine Frau Lianne hatte sich nie an solch heftige Liebe gewöhnen können, obwohl sie deren Hitze anfangs, da sie selbst aus einer Familie kam, in der sogar das Niesen unterdrückt wurde, anziehend gefunden hatte. Schon früh, während der Brautwerbung, hatte Epstein ihr erzählt, die Brutalität und Zärtlichkeit seines Vaters hätten ihn gelehrt, dass ein Mensch nicht kleinzukriegen sei, eine Lektion, die ihm sein Leben lang als Leitfaden dienen sollte, und lange Zeit hatte Lianne darin – in Epsteins eigener Komplexität, seiner Widersetzlichkeit gegen leichte Einordnung – etwas Liebenswertes gesehen. Doch schließlich war es ihr zu viel geworden, wie es so vielen anderen zu viel geworden war, wenngleich nie seinen Eltern, die seine unermüdlichen Sparringpartner blieben und, wie Epstein es manchmal empfand, nur deshalb so hartnäckig fortgelebt hatten, um ihn zu quälen. Er hatte sich um sie gekümmert bis ans Ende, welches sie in einem Penthouse in Miami verlebten, das er ihnen gekauft hatte, mit Hochflorteppichen, in denen sie bis zu den Knöcheln versanken. Aber Frieden hatte er nie mit ihnen gefunden, und erst nach ihrer beider Tod – seine Mutter war dem Vater innerhalb von drei Monaten gefolgt – und nachdem er fast alles weggegeben hatte, verspürte Epstein den scharfen Stich des Bedauerns. Die nackte Glühbirne flackerte hinter seinen entzündeten Lidern, wenn er zu schlafen versuchte. Er konnte nicht schlafen. Hatte er versehentlich den Schlaf weggegeben, mit allem anderen?
Er wollte etwas im Namen seiner Eltern tun. Aber was? Seine Mutter hatte, noch zu Lebzeiten, eine Gedenkbank in dem kleinen Park vorgeschlagen, in dem sie zu sitzen pflegte, während sein Vater oben in Anwesenheit Conchitas, der Tag-und-Nacht-Betreuerin, den Geist aufgab. Von jeher eine große Leserin, nahm seine Mutter stets ein Buch mit in den Park. In ihren letzten Jahren hatte sie sich an Shakespeare gemacht. Einmal hörte Epstein sie zu Conchita sagen, sie müsse unbedingt König Lear lesen. «Das gibt es sicher auch auf Spanisch», hatte sie zu der Betreuerin gesagt. Jeden Nachmittag, wenn die Sonne nicht mehr auf dem höchsten Stand war, fuhr seine Mutter, die Großdruckausgabe eines Stücks von dem Barden in der nachgemachten Prada-Tasche, die sie – gegen Epsteins Proteste, dass er ihr eine echte kaufen würde – bei einem Afrikaner am Strand erstanden hatte (was brauchte sie eine echte?), mit dem Aufzug nach unten. Der Park war heruntergekommen, die Spielgeräte von Möwen verschissen, aber in der Nachbarschaft gab es sowieso niemanden unter fünfundsechzig, der darauf hätte herumklettern können. Hatte seine Mutter es ernst gemeint mit der Bank, oder hatte sie das nur mit dem üblichen Sarkasmus vorgeschlagen? Epstein wusste es nicht, und so wurde zur Sicherheit eine Bank aus Lapachoholz, das dem tropischen Wetter standhalten konnte, für den schmuddeligen Park in Florida bestellt, an der Lehne ein angeschraubtes Messingschild, auf dem stand: ZUR ERINNERUNG AN EDITH «EDIE» EPSTEIN. «NICHT BRAUCH’ ICH ZU GEFALLEN DIR DURCH ANTWORT.» – WILLIAM SHAKESPEARE. Er ließ dem kolumbianischen Pförtner des Gebäudes seiner Eltern zweihundert Dollar da, damit er es zweimal im Monat zugleich mit dem Messing in der Eingangshalle polierte. Doch als der Pförtner ihm ein Foto von der makellosen Bank schickte, schien es Epstein schlimmer zu sein, als wenn er gar nichts getan hätte. Er erinnerte sich daran, wie seine Mutter ihn immer angerufen hatte, wenn er zu lange nichts von sich hören ließ, und mit von sechzig Jahren Rauchen heiserer Stimme Gott zitierte, der den gefallenen Adam rief: «Ayeka?» Wo bist du? Dabei wusste Gott sehr wohl, wo Adam steckte.
Am Abend vor dem ersten Jahrestag des Todes seiner Eltern beschloss Epstein zwei Dinge: einen Zwei-Millionen-Kredit gegen die Sicherheit seines Apartments an der Fifth Avenue aufzunehmen und nach Israel zu reisen. Das Geldaufnehmen war neu, aber nach Israel war er, einem Wust von Bindungen verpflichtet, im Lauf der Jahre oft zurückgekehrt. Mit der Executive Lounge im fünfzehnten Stock des Hilton als rituellem Stammsitz hatte er dort regelmäßig Besuche von einer langen Reihe von Freunden, Verwandten und Geschäftspartnern empfangen, sich für alles begeistert, Geld, Meinungen, Ratschläge ausgeteilt, alte Streitigkeiten beigelegt und neue entzündet. Aber diesmal wurde seine Assistentin angewiesen, den Kalender nicht wie üblich zu füllen. Stattdessen wurde sie gebeten, Termine mit den Entwicklungsbüros der Hadassah, des Weizmann-Instituts und der Ben-Gurion-Universität zu vereinbaren, um die Möglichkeiten einer Stiftung im Namen seiner Eltern zu eruieren. Die restliche Zeit solle frei bleiben, sagte Epstein ihr; vielleicht werde er endlich ein Auto mieten, um eine Rundfahrt durch Teile des Landes zu machen, wo er seit vielen Jahren nicht gewesen sei, wie er es schon oft gesagt, aber nie getan habe, weil er dauernd damit beschäftigt gewesen sei, Konflikte beizulegen, sich in alles Mögliche zu verstricken und sich den Mund fusselig zu reden. Er wolle den See Genezareth, den Negev, die Felshügel von Judäa wiedersehen. Das Mineralblau des Toten Meeres.
Während er sprach, blickte Sharon, die Assistentin, zu ihm auf, und im vertrauten Gesicht ihres Chefs sah sie etwas, was sie nicht kannte. Falls dies sie leicht beunruhigte, dann nur, weil es ihr wichtig war, ihren Job gut zu machen, und gut bedeutete zu wissen, was Epstein wollte und wie genau er es gern haben mochte. Nachdem sie seine Explosionen überlebt hatte, war ihr bewusst geworden, welche Großzügigkeit mit Epsteins Temperament einherging, und über die Jahre hatte er ihre Loyalität durch die seine gewonnen.
Am Tag vor der Abreise nach Israel besuchte Epstein eine kleine Veranstaltung mit Mahmud Abbas, die das Center for Middle East Peace im Plaza Hotel organisiert hatte. An die fünfzig Vertreter der Führung amerikanischer Juden waren eingeladen worden, sich mit dem Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde zusammenzusetzen, der wegen einer Rede vor dem UN-Sicherheitsrat in der Stadt war und sich bereiterklärt hatte, ihre jüdischen Ängste bei einem Drei-Gänge-Menü zu beschwichtigen. Früher hätte die Einladung Epstein elektrisiert. Er wäre hingeeilt und hätte sich wichtiggemacht. Aber was konnte sie ihm jetzt noch bringen? Was konnte der vierschrötige Mann aus Safed ihm erzählen, was er nicht schon wusste? Er hatte das alles satt – die heiße Luft ebenso wie die Lippenbekenntnisse, seine eigenen und die anderer. Auch er wollte Frieden. Erst in letzter Minute entschied er sich um und textete kurzerhand Sharon, die seinen Platz nur mit Mühe von einer spät hinzugekommenen Delegation des Außenministeriums zurückerobern konnte. Er hatte so viel aufgegeben, doch seine Neugier hatte er noch nicht verloren. Jedenfalls wäre er vorher sowieso um die Ecke bei der Rechtsabteilung der Bank, um – ungeachtet Schloss’ inständiger Bitten – die Dokumente für die Grundschuld auf sein Apartment zu unterzeichnen.
Und doch, kaum saß Epstein an der langen Tafel, Schulter an Schulter mit den Bannerträgern seines Volkes, die fleißig Schnittlauchbutter auf ihre Hefebrötchen strichen, während der leise sprechende Palästinenser vom Ende des Konflikts und vom Ende der Forderungen sprach, bereute er seinen Sinneswandel. Der Saal war klein, es gab keinen Weg hinaus. Früher hätte er es getan. Erst letztes Jahr, bei einem Staatsbankett zu Ehren von Schimon Peres im Weißen Haus, war er mitten in Itzhak Perlmans Interpretation des Tempo di Minuetto aufgestanden, um pinkeln zu gehen – wie viele Stunden seines Lebens hatte er summa summarum damit verbracht, Perlman zuzuhören? Eine stramme Woche? Der Secret Service hatte sich schlagartig vor ihm aufgebaut; sobald der Präsident seinen Platz eingenommen hatte, durfte niemand mehr den Saal verlassen. Aber beim Ruf der Natur sind alle Menschen gleich. «Es ist ein Notfall, Gentlemen», hatte er gesagt, während er sich an den schwarzen Anzügen vorbeidrängte. Etwas gab nach, wie es für Epstein immer nachgegeben hatte; er wurde an den messingbeknopften Militärwachen vorbei zur Toilette eskortiert. Aber dieses Bedürfnis, sich Geltung zu verschaffen, war in Epstein erloschen.
Der Caesar Salad wurde serviert, die Diskussion eröffnet, und Dershowitz’ sonore Stimme – «Mein lieber alter Freund Abu Mazen» – ertönte. Rechts neben Epstein fingerte der Botschafter von Saudi-Arabien an seinem schnurlosen Mikrophon, in Unkenntnis dessen, wie es funktionierte. Gegenüber am Tisch saß mit schweren Lidern gleich einer Eidechse in der Sonne Madeleine Albright, eine innere Intelligenz ausstrahlend; auch sie war schon nicht mehr wirklich dort, zu Angelegenheiten metaphysischer Natur entrückt, so jedenfalls erschien es Epstein, der plötzlich den Wunsch empfand, sie beiseitezunehmen und diese tieferen Anliegen zu diskutieren. Er tastete in seiner Innentasche nach dem Büchlein mit dem abgewetzten grünen Leineneinband, das Maya ihm zum Geburtstag geschenkt hatte und das er seit einem Monat überall mit sich herumtrug. Es war nicht dort, er musste es im Mantel gelassen haben.
Genau in dem Moment, als er seine Hand wieder aus der Tasche zog, bemerkte Epstein aus dem Augenwinkel zum ersten Mal den hünenhaften bärtigen Mann mit dunklem Anzug und einer großen schwarzen Kopfbedeckung, der am Rand der Gruppe stand, nicht bedeutend genug, um einen Platz am Tisch zu erhalten. Das kleine Lächeln auf seinen Lippen rief zahlreiche Fältchen um die Augen hervor, und seine Arme waren über der Brust verschränkt, als hielte er eine unbändige Energie im Zaum. Aber Epstein spürte, dass in ihm keine Selbstbeherrschung aus Bescheidenheit arbeitete, sondern etwas anderes.
Die Führung der amerikanischen Juden fuhr fort, ihre fraglosen Fragen abzuspulen; die Salatteller wurden von den indischen Obern abgeräumt und durch pochierten Lachs ersetzt. Schließlich war Epstein mit seinem Beitrag an der Reihe. Er beugte sich vor und schaltete das Mikro ein. Es gab ein lautes statisches Knacken, das den saudischen Botschafter zusammenzucken ließ. Während der folgenden Stille blickte Epstein in die Runde der ihm erwartungsvoll zugewandten Gesichter. Er hatte keinen Gedanken daran verschwendet, was er sagen wollte, und jetzt schweifte sein Geist, der immer auf sein Ziel zugesteuert war wie eine Drohne, geruhsam ab. Er schaute sich bedächtig um. Die Gesichter der anderen, verunsichert, wie sie auf sein Schweigen reagieren sollten, faszinierten ihn auf einmal. Ihr Unbehagen faszinierte ihn. War er sonst immun gegen das Unbehagen anderer gewesen? Nein, immun war ein zu starkes Wort. Aber er hatte nicht groß darauf geachtet. Jetzt beobachtete er sie, wie sie den Blick auf ihre Teller senkten und unbehaglich auf den Stühlen hin und her rutschten, bis die Moderatorin sich schließlich einschaltete. «Wenn Jules … Mr. Epstein … nichts hinzuzufügen hat, sollten wir dazu übergehen –», aber genau in diesem Moment musste die Moderatorin sich, unterbrochen von einer Stimme hinter ihr, plötzlich umwenden.
«Wenn er nichts sagen möchte, springe ich ein.»
Auf der Suche danach, woher der Einwurf gekommen war, begegnete Epstein den blitzenden Augen des Hünen mit der gestrickten schwarzen Kippa. Er wollte gerade antworten, als der Mann erneut das Wort ergriff.
«Präsident Abbas, danke, dass Sie heute hier sind. Sie mögen mich entschuldigen: wie meine Kollegen habe ich keine Frage an Sie, nur etwas zu sagen.»
Ein erleichtertes Lachen rippelte durch den Saal. Seine mühelos tragende Stimme ließ die Benutzung eines Mikrophons lächerlich erscheinen.
«Mein Name ist Rabbi Menachem Klausner. Ich habe fünfundzwanzig Jahre in Israel gelebt. Ich bin der Gründer von Gilgul, einem Programm, das Amerikaner nach Safed bringt, um jüdische Mystik zu studieren. Ich lade Sie alle ein, sich über uns zu informieren, vielleicht sogar einmal an unseren Tagen der Einkehr teilzunehmen – wir sind jetzt bei fünfzehn im Jahr, und es werden mehr. Präsident Abbas, es wäre eine Ehre, Sie zu empfangen, obwohl Sie die Höhen von Safed natürlich besser kennen als die meisten von uns.»
Der Rabbi legte eine Pause ein und rieb seinen glänzenden Bart.
«Während ich hier stand und meinen Freunden lauschte, kam mir eine Geschichte in den Sinn. Eine Lektion fürwahr, die der Rabbi uns einmal in der Schule erteilte. Ein wirklicher tzaddik, einer der besten Lehrer, die ich hatte – wäre er nicht gewesen, hätte mein Leben sich anders entwickelt. Er las uns immer aus der Tora vor. An jenem Tag war es die Genesis, und bei der Zeile ‹Da vollendete Gott am siebten Tag seine Arbeit› hielt er inne und blickte auf. Ob wir etwas Seltsames bemerkt haben?, will er wissen. Wir kratzen uns die Köpfe. Jeder weiß, dass der siebte Tag der Sabbat ist, was also war so seltsam?
‹Aha!›, sagt der Rabbi und springt auf, wie immer, wenn er erregt ist. Aber es heißt nicht, dass Gott am siebten Tag ruhte! Es heißt, dass er seine Arbeit vollendete. Wie viele Tage hat es gebraucht, um den Himmel und die Erde zu erschaffen?, fragt er uns. Sechs, sagen wir. Also, warum heißt es nicht, Gott habe es da vollendet. Am sechsten vollendet und am siebten geruht?»
Epstein blickte sich um und fragte sich, wohin das alles führen sollte.
«Nun, der Rabbi erzählt uns, als die alten Weisen sich versammelten, um über dieses Problem zu beraten, kamen sie zu dem Schluss, es müsse auch am siebten Tag einen Schöpfungsakt gegeben haben. Aber was für einen? Die Meere und das Land existierten schon. Die Sonne und der Mond. Pflanzen und Bäume, Tiere und Vögel. Sogar der Mensch. Was mochte dem Universum noch fehlen?, fragten die alten Weisen. Zuletzt machte ein grauhaariger Gelehrter, der immer allein in einer Ecke saß, den Mund auf. ‹Menucha›, sagte er. ‹Was?›, fragten die anderen. ‹Sprich lauter, wir können dich nicht hören.› – ‹Mit dem Sabbat schuf Gott menucha›, sagte der alte Gelehrte, ‹und dann war die Welt vollendet.›»
Madeleine Albright schob ihren Stuhl zurück und strebte aus dem Saal, wobei der Stoff ihres Hosenanzugs ein sacht scheuerndes Geräusch machte. Der Redner wirkte unbeeindruckt. Einen Augenblick dachte Epstein, er würde sich ihres leeren Stuhls bemächtigen, genau wie der Redezeit, die Epstein hatte verfallen lassen. Aber er blieb stehen, die bessere Voraussetzung, um den Raum zu beherrschen. Die in seiner Nähe waren ein wenig abgerückt, um ihm Platz zu verschaffen.
«‹Also, was bedeutet menucha?›, fragt der Rabbi uns. Eine Bande zappliger Kinder, die aus dem Fenster starren und sich für nichts interessieren, als draußen zu sein und Ball zu spielen. Niemand sagt etwas. Der Rabbi wartet, und als klarwird, dass er uns die Antwort nicht geben wird, macht ein Junge hinten im Raum, der Einzige mit polierten Schuhen, der immer direkt zu seiner Mutter nach Hause geht, der viele Generationen entfernte Nachkomme des grauhaarigen Gelehrten, der die alte Weisheit des Eckensitzens schon in sich trägt, den Mund auf: ‹Ruhe›, sagt er. ‹Ruhe!›, ruft der Rabbi speichelsprühend wie immer, wenn er erregt ist. ‹Aber nicht nur das! Weil menucha nicht nur eine Pause von der Arbeit bedeutet. Nicht nur eine Unterbrechung der Anstrengung. Es ist nicht einfach das Gegenteil von Schweiß und Mühen. Wenn es eines besonderen Schöpfungsakts bedurfte, um es ins Leben zu rufen, muss es jedenfalls etwas Außerordentliches sein. Nicht das Negativ von etwas bereits Existierendem, sondern ein einzigartiges Positivum, ohne das die Welt unvollendet wäre. Nein, nicht einfach Ruhe›, sagt der Rabbi. ‹Beschaulichkeit! Heiterkeit! Erholung! Frieden. Ein Zustand, in dem es keinen Zwist und kein Kämpfen gibt. Keine Angst und kein Misstrauen. Menucha. Der Zustand, in dem der Mensch still liegt.›
Abu Mazen, mit Verlaub» – Klausner senkte die Stimme und rückte seine auf den Hinterkopf gerutschte Kippa zurecht –, «in jenem Klassenraum mit lauter Zwölfjährigen verstand kein Einziger, was der Rabbi meinte. Aber ich frage Sie: Versteht auch nur einer der unsrigen in diesem Raum es besser? Diesen Schöpfungsakt, der unter allen anderen hervorsticht, den einzigen, der nicht etwas Ewiges begründete? Am siebten Tag schuf Gott menucha. Aber Er machte sie vergänglich. Unfähig, zu dauern. Warum? Warum, wo doch alles andere, was er schuf, der Zeit widersteht?»
Klausner hielt inne, ließ den Blick durch den Saal schweifen. Seine gewaltige Stirn glänzte vor Schweiß, obwohl sonst nichts darauf hindeutete, dass er sich verausgabte. Epstein beugte sich vor, wartete.
«Damit es dem Menschen zufalle, sie immer wieder neu zu erschaffen», sagte Klausner schließlich. «Menucha neu zu erschaffen, damit er sich dessen inne sei, dass er der Welt kein Zuschauer ist, sondern ein Beteiligter. Dass ohne seine Handlungen die Welt, die Gott für uns bestimmt hat, unvollendet bleiben wird.»
Ein einsames, müdes Klatschen ertönte von weit hinten aus dem Saal. Als es sich, unbegleitet, in Stille verlor, begann der Palästinenserführer zu sprechen, verkündete, mit Unterbrechungen zur Übermittlung durch den Übersetzer, die Botschaft von seinen acht Enkelkindern, die alle das Seeds of Peace Camp besucht hatten, vom Zusammenleben im Miteinander, von der Ermutigung zum Dialog, vom Aufbau von Beziehungen. Seinen Kommentaren schlossen sich ein paar letzte Redner an, dann war die Veranstaltung zu Ende, alle erhoben sich, und Abbas marschierte mit seiner Entourage im Gefolge, eine Reihe ausgestreckter Hände drückend, am Tisch entlang und aus dem Saal.
Epstein, begierig, hinauszukommen und seiner Wege zu gehen, strebte zur Garderobe. Doch während er in der Schlange stand, spürte er einen Klaps auf der Schulter. Als er sich umdrehte, sah er ins Gesicht des Rabbi, der die Predigt mit Hilfe gestohlener Zeit gehalten hatte. Eineinhalb Köpfe größer als Epstein, strahlte er die drahtige, sonnengegerbte Stärke von jemandem aus, der lange in der Levante gelebt hat. Aus der Nähe leuchteten seine blauen Augen von gespeichertem Sonnenlicht. «Menachem Klausner», wiederholte er für den Fall, dass es Epstein vorher entgangen war. «Ich hoffe, ich bin Ihnen eben da drinnnen nicht auf die Zehen getreten?»
«Nein», sagte Epstein, während er die Marke für seinen Mantel auf den Tresen klatschte. «Sie haben gut gesprochen. Ich hätte es nicht besser sagen können.» Er meinte es ehrlich, hatte aber keine Lust, jetzt weiter darauf einzugehen. Die Garderobenfrau humpelte, und Epstein beobachtete, wie sie sich entfernte, um ihre Aufgabe zu erfüllen.
«Danke, aber ich habe nicht viel dazu beigetragen. Das meiste ist von Heschel.»
«Ich dachte, Sie hätten gesagt, es sei Ihr alter Rabbi gewesen.»
«So gibt es eine bessere Geschichte her», sagte Klausner und zog die Augenbrauen hoch. Über ihnen änderte sich das Muster der tiefen Falten mit jedem übertriebenen Mienenspiel.
Epstein hatte Heschel nie gelesen, und überhaupt war es warm im Raum, und was er am dringendsten wollte, war, endlich im Freien zu sein, erfrischt von der Kälte. Doch als die Garderobenfrau von dem Drehständer zurückkehrte, hing ein fremder Mantel über ihrem Arm.
«Das ist nicht meiner», sagte Epstein und schob den Mantel über den Tresen zurück.
Die Frau sah ihn voller Verachtung an. Doch als er ihren starren Blick mit einem noch starreren erwiderte, kapitulierte sie und humpelte zum Ständer zurück. Ein Bein war kürzer als das andere, aber man hätte ein Heiliger sein müssen, um es ihr nicht zu verübeln.
«Tatsächlich sind wir uns schon mal begegnet», sagte Menachem Klausner hinter ihm.
«Wirklich?», sagte Epstein, kaum den Kopf wendend.
«In Jerusalem, bei der Hochzeit der Tochter von den Schulmanns.»
Epstein nickte, konnte sich aber nicht daran erinnern.
«Einen Epstein vergesse ich nie.»
«Wieso das?»
«Weder einen Epstein noch einen Abravanel, einen Dayan oder sonst wen von einem Geschlecht, das sich bis zum Geblüt des Hauses David zurückverfolgen lässt.»
«Epstein? Es sei denn, Sie beziehen sich auf das Königtum irgendeines hinterwäldlerischen Stetl, liegen Sie mit Epstein falsch.»
«Aber selbstverständlich sind Sie einer von uns.»
Jetzt musste Epstein lachen.
«Von uns?»
«Natürlich. Klausner ist ein großer Name in der Davidischen Genealogie. Nicht ganz vom selben Schlag wie Epstein, wohlgemerkt. Wenn nicht einer Ihrer Vorfahren den Namen aus der Luft gegriffen hat, was unwahrscheinlich ist, führt die Linie der Erzeuger, die Sie hervorgebracht hat, geradewegs zum König von Israel zurück.»
Epstein verspürte den widerstreitenden Drang, einen Fünfziger aus seiner Geldbörse zu ziehen, um Klausner loszuwerden, und ihn weiter zu befragen. Der Rabbi hatte etwas Fesselndes oder hätte es jedenfalls ein andermal gehabt.
Die Garderobenfrau drehte noch immer müßig an dem Ständer, ab und zu anhaltend, um die Nummern über den Haken zu sichten. Sie nahm einen khakifarbenen Trenchcoat herunter. «Nicht der», rief Epstein, bevor sie versuchen konnte, ihn ihm zu geben. Sie schleuderte ihm einen vernichtenden Blick zu und setzte ihr Drehen und Suchen fort.
Epstein, der es nicht länger aushielt, bahnte sich einen Weg hinter den Tresen. Die Frau sprang mit übertriebenem Entsetzen zurück, als befürchtete sie, er werde ihr einen Knüppel über den Kopf schlagen. Aber als Epstein selbst erfolglos die aufgehängten Mäntel zu durchsuchen begann, wurde ihre Miene eher süffisant. Als sie nach vorne humpelte, um Menachem Klausners Marke zu nehmen, protestierte der Predigtmacher mit dem dreitausend Jahre alten Stammbaum: «Nein, nein. Ich kann warten. Wie sieht der Mantel denn aus, Jules?»
«Marineblau», brummte Epstein, während er die Tweed- und Wollärmel unter leichten Schlägen an sich vorbeischwingen ließ. Aber der Mantel, von dem er jetzt schlecht behaupten konnte, er habe große Ähnlichkeit mit dem auf dem Tresen, sei nur einfach unendlich viel weicher und teurer, war nirgendwo zu finden. «Das ist ja lächerlich», stotterte er. «Jemand muss ihn mitgenommen haben.»
Epstein hätte schwören können, dass er die Garderobenfrau lachen hörte. Doch als er sich nach ihr umdrehte, kehrte sie ihm ihren gebeugten, fast quadratischen Rücken zu und bediente bereits die nächste Person in der Schlange hinter Klausner. Epstein spürte, wie ihm die Hitze ins Gesicht stieg und die Kehle sich zuschnürte. Es war eine Sache, aus freiem Willen Millionen wegzugeben, aber dass man ihm seinen Mantel vom Rücken nahm, war etwas anderes. Er wollte nur noch weg von hier, allein in seinem eigenen Mantel durch den Park gehen.
Ein Klingelton kündigte den Aufzug an, dessen Türen sich öffneten. Ohne ein weiteres Wort schnappte Epstein sich den Mantel, der auf dem Tresen lag, und ging los. Klausner rief ihm hinterher, aber gerade noch rechtzeitig schlossen sich die Türen, und Epstein wurde allein durch die Etagen nach unten befördert.
Vor dem Seitenausgang des Hotels drängten sich Abu Mazens Männer in die Limousine. An dem letzten von ihnen entdeckte Epstein seinen Mantel. «Hey!», rief er, indem er das derbe Kleidungsstück auf seinem Arm schwenkte. «HEY! Sie haben meinen Mantel an!» Aber der Mann hörte es nicht, oder wollte es nicht hören, und kaum hatte er die Tür hinter sich zugeschlagen, löste die Limousine sich von der Bordsteinkante und glitt die Fifty-Eighth Street hinunter.
Epstein sah ungläubig hinterher. Der Hotelportier beäugte ihn nervös, vielleicht in Sorge, er würde eine Szene machen. Stattdessen blickte Epstein missmutig auf den Mantel in seinen Händen, ehe er seufzend einen Arm, dann den anderen in die Ärmel steckte und ihn mit den Schultern hochzog. Die Aufschläge hingen über seinen Knöcheln. Als er die Central Park South überquerte, blies ein kalter Wind durch den dünnen Stoff, und Epstein griff instinktiv nach den Lederhandschuhen in die Taschen. Aber alles, was er fand, war eine kleine, arabisch beschriftete Blechdose mit Pfefferminzbonbons. Er warf sich eins in den Mund und begann zu lutschen; es war so scharf, dass ihm die Augen tränten. Damit also regten sie das Wachstum ihrer Brustbehaarung an. Er stieg die Treppe hinunter und schlug am Parkeingang den Weg ein, der an dem verschilften Weiher entlangführte.
Der Himmel war jetzt von einem staubigen Rosa, im Westen schwach orange. Bald würden die Laternen angehen. Der Wind nahm zu, und hoch oben wogte, langsam ihre Form verändernd, eine weiße Plastiktüte vorbei.
Die Seele ist ein Meer, in dem wir schwimmen. Es gibt kein Ufer diesseits, nur jenseits, in weiter Ferne, ist ein Ufer, und das ist Gott.
Es war eine Zeile aus dem kleinen grünen Büchlein, das Maya ihm vor bald zwei Monaten zum Geburtstag geschenkt und in dem er manche Abschnitte so oft gelesen hatte, dass er sie auswendig konnte. Eben an einer Bank vorbeigekommen, machte Epstein kehrt und setzte sich, während er in die Innentasche seines Jacketts langte. Daran erinnert, dass sie leer war, sprang er erschrocken auf. Das Buch! Er hatte es in seinem Mantel gelassen! Seinem Mantel, der momentan auf dem Rücken eines von Abbas’ Gefolgsmännern unterwegs nach Osten war. Er fummelte nach seinem Handy, um seiner Assistentin Sharon zu texten. Aber auch das Handy war nirgendwo zu finden. «Scheiße!», rief Epstein. Eine Mutter, die einen Doppelkinderwagen den Weg entlangschob, warf ihm einen misstrauischen Blick zu und beschleunigte das Tempo.
«Hey!», rief Epstein. «Entschuldigen Sie!» Die Frau sah sich kurz um, ohne ihren hurtigen Schritt zu verlangsamen. Epstein rannte ihr hinterher. «Hören Sie», sagte er atemlos, neben ihr in Gleichschritt fallend, «ich habe gerade gemerkt, dass ich mein Handy verlegt habe. Könnte ich Ihres eine Sekunde ausleihen?»
Die Frau sah ihre Kinder an – Zwillinge offenbar, in pelzgefütterte Schlafsäcke gepackt, Triefnasen und wache schwarze Augen. Mit zusammengebissenen Zähnen griff sie in ihre Tasche und zog ihr Handy heraus. Epstein klaubte es ihr aus der Hand, kehrte ihr den Rücken und wählte seine eigene Nummer. Es klingelte, dann meldete sich seine Mailbox. Hatte er das Handy vorhin bei der Unterzeichnung des Kreditvertrags ausgeschaltet, oder hatte Abbas’ Mann es getan? Der Gedanke, dass seine Anrufe bei dem Palästinenser landeten, erfüllte ihn mit Schrecken. Er wählte Sharons Nummer, aber auch dort antwortete niemand.
«Nur ein schneller Text», erklärte Epstein und tippte mit klammen Fingern die Nachricht ein: Sofort UN-Sicherheitsrat kontaktieren. Mantelverwechslung im Plaza. Einer von Abbas’ Spezis ist mit meinem abgehauen: Loro Piana, Kaschmir, marineblau. Er drückte auf Senden, dann tippte er noch etwas: Handy und andere Wertsachen in Manteltasche. Doch als er im Begriff war, auch dies abzufeuern, besann er sich eines Besseren und löschte es, damit Abbas’ Mann nicht noch mit der Nase darauf gestoßen wurde, was er da unwissentlich in Besitz hatte. Aber nein: Das war lächerlich. Was wollte der schon mit einem fremden Telefon und dem obskuren Buch eines toten israelischen Dichters?
Die Zwillinge begannen zu niesen und zu schniefen, während die Mutter ungeduldig von einem Fuß auf den anderen trat. Epstein, der keine Erfahrung mit der Empfängerseite von Wohltätigkeit hatte, tippte den Satz noch einmal, schickte ihn ab und behielt das Telefon weiter in der Hand, um abzuwarten, dass es sich mit der Antwort seiner Assistentin rührte. Aber es blieb reglos in seinen Händen. Wo zum Teufel war sie? Nicht mein Handy natürlich, tippte er. Versuche es gleich noch mal. Er wandte sich zu der Frau um, die ihr Telefon mit einem genervten Brummen an sich nahm und ohne auch nur ein Wort des Abschieds davonmarschierte.
In einer Dreiviertelstunde sollte er Maura in der Avery Fisher Hall treffen. Sie kannten einander aus der Kindheit, und nach Epsteins Scheidung war Maura seine häufige Begleitung bei Konzerten geworden. Er begann nord- und westwärts zu gehen, kürzte quer über den Rasen ab, im Kopf fieberhaft damit beschäftigt, Textnachrichten zu verfassen. Doch als er sich einem Gebüsch näherte, stob eine Schar brauner Spatzen daraus hervor und zerstreute sich im düsteren Himmel. Bei ihrem plötzlichen Ausbruch in die Freiheit verspürte Epstein eine Welle des Trostes. Es war ja nur ein altes Buch, nicht wahr? Sicher konnte er ein anderes Exemplar auftreiben. Er würde Sharon darauf ansetzen. Oder besser noch, warum das Buch nicht genauso leicht verschwinden lassen, wie es gekommen war? Hatte er nicht schon genommen, was er daraus brauchte?





























