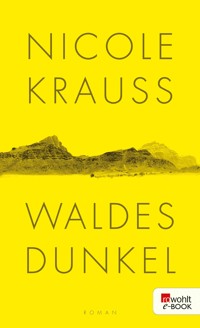9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die vierzehnjährige Alma wurde nach der Hauptfigur eines Romans benannt. Leo Gursky hatte den Text als junger Mann in Polen geschrieben, für seine große Liebe Alma. Nun lebt er als einsamer alter Mann in New York. Er weiß nicht, dass das Buch den Holocaust überstanden hat. Bis die junge Alma sich auf die Suche nach ihm macht. «Bezaubernd, zärtlich und sehr originell.» (J. M. Coetzee) «Ein großartiger Roman.» (Spiegel) «Dies ist ein gewaltiges Buch, das unser müdes Herz erfrischt. Nicole Krauss sei gepriesen dafür.» (Colum McCann) «Einfach anfangen zu lesen. Es ist wunderbar.» (Stern) «Ein außergewöhnlicher Roman, lebensprall, klug und poetisch, von eigenwilligem Charme, staunenswerter Anschaulichkeit und gesegnet mit einem zärtlichen Humor.» (FAZ)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Nicole Krauss
Die Geschichte der Liebe
Roman
Aus dem Englischen von Grete Osterwald
FÜR MEINE GROSSELTERN, DIE MICH DAS GEGENTEIL VON VERSCHWINDEN LEHRTEN
UND FÜR JONATHAN, MEIN LEBEN
DIE LETZTEN WÖRTER AUF ERDEN
Wenn sie meinen Nachruf schreiben. Morgen. Oder am Tag darauf. Wird es heißen: LEO GURSKY HINTERLÄSST EINE WOHNUNG VOLLER SCHROTT. Ich wundere mich, dass ich hier nicht längst lebendig begraben bin. Es ist nicht geräumig. Den Weg zwischen Bett und Klo, Klo und Küchentisch, Küchentisch und Wohnungstür muss ich mir freikämpfen. Vom Klo zur Wohnungstür, unmöglich, da muss ich über den Küchentisch. Ich stelle mir mein Bett gern als Homeplate vor, das Klo als First, den Küchentisch als Second, die Wohnungstür als Third Base: Klingelt es, während ich im Bett liege, muss ich um Klo und Küchentisch herum, ehe ich zur Tür gelange. Wenn es zufällig Bruno ist, lasse ich ihn wortlos ein und sprinte ins Bett zurück, das Gebrüll der unsichtbaren Menge in den Ohren.
Oft frage ich mich, wer der letzte Mensch sein wird, der mich lebendig sieht. Müsste ich wetten, würde ich auf den Jungen setzen, der das Fertigessen vom Chinesen bringt. Ich bestelle an vier von sieben Abenden. Wann immer er kommt, mache ich ein großes Trara um die Suche nach meiner Geldbörse. Er steht dann da, zwischen Tür und Angel, das fettige Päckchen in der Hand, während ich mich frage, ob dies der Abend ist, an dem ich meine Frühlingsrolle aufessen, ins Bett klettern und im Schlaf einen Herzinfarkt bekommen werde.
Ich bemühe mich sehr darum, gesehen zu werden. Manchmal, wenn ich rausgehe, kaufe ich mir einen Saft, obwohl ich keinen Durst habe. Ist der Laden voll, bringe ich es sogar fertig, das Wechselgeld auf den Boden fallen zu lassen, dass Nickels und Dimes in alle Richtungen springen. Dann bücke ich mich runter auf die Knie. Es fällt mir sehr schwer hinzuknien, und noch schwerer, mich wieder aufzurichten. Und doch. Mag schon sein, dass ich dabei aussehe wie ein Narr. Oder ich gehe zu Athlete’s Foot und sage: Was für Turnschuhe haben Sie da? Der Verkäufer sieht mich an, den armen schmock, als der ich ihm erscheine, und zeigt mir das einzige Paar Opa-Rockports, das sie führen, etwas in strahlendem Weiß. Naa, sage ich, die habe ich schon, dann gehe ich rüber zu den Reeboks, greife etwas heraus, was kaum noch aussieht wie ein Schuh, einen wasserdichten Booty beispielsweise, und frage nach Größe 41.Der Junge sieht mich wieder an, genauer. Lange sieht er mich an, und scharf. Größe 41, wiederhole ich, den netzbeschichteten Schuh fest im Griff. Kopfschüttelnd geht er nach hinten, sie aus dem Lager zu holen, und bis er wieder da ist, ziehe ich die Socken aus. Ich kremple die Hosenbeine hoch, blicke hinab auf meine Füße, diese hutzligen Dinger, und es verstreicht eine peinliche Minute, bis klar wird, ich warte, dass er mir die Booties anzieht. Kaufen tue ich nie. Alles, was ich will, ist, an meinem Todestag nicht ungesehen zu bleiben.
Vor ein paar Monaten sah ich eine Annonce in der Zeitung: NACKTMODELL FÜR ZEICHENKURS GESUCHT, $15STD. Das klang zu schön, um wahr zu sein. So viel gesehen zu werden. Von so vielen. Ich rief die Nummer an. Eine Frau sagte mir, ich solle nächste Woche Dienstag vorbeikommen. Ich wollte mich beschreiben, aber das interessierte sie nicht. Egal, sagte sie.
Die Tage vergingen langsam. Ich erzählte Bruno davon, aber er missverstand und meinte, ich hätte vor, einen Zeichenkurs zu machen, um nackte Mädchen zu sehen. Er wollte sich nicht korrigieren lassen. Zeigen sie ihre Titten?, fragte er. Ich zuckte die Achseln. Und das da unten?
Nachdem Mrs.Freid aus dem dritten Stock gestorben war und es drei Tage gedauert hatte, bis jemand sie fand, gewöhnten Bruno und ich uns an, nacheinander zu schauen. Wir fanden immer eine kleine Ausrede. Mein Klopapier ist alle, sagte ich etwa, wenn Bruno aufmachte. Ein Tag verging. Dann klopfte es bei mir. Ich habe mein Fernsehprogramm verlegt, erklärte er, und ich ging ihm meines holen, obwohl ich wusste, dass seines genau da auf seiner Couch lag, wo es immer lag. Einmal kam er sonntagnachmittags herunter. Ich brauche eine Tasse Mehl, sagte er. Es war taktlos, aber es rutschte mir so heraus: Du kannst doch gar nicht kochen. Betretenes Schweigen. Bruno sah mir in die Augen. Hast du eine Ahnung, sagte er, ich backe einen Kuchen.
Bei meiner Ankunft in Amerika kannte ich kaum jemanden, nur einen Vetter zweiten Grades, der Schlosser war, also arbeitete ich für ihn. Wäre er Schuster gewesen, wäre ich Schuster geworden; hätte er Scheiße geschaufelt, hätte ich mitgeschaufelt. Aber: Er war Schlosser. Er brachte mir das Handwerk bei, und es wurde mein Beruf. Wir hatten zusammen einen kleinen Betrieb, doch eines Tages erkrankte er an Tb, die Leber musste ihm herausgeschnitten werden, er bekam über 40Grad Fieber und starb, also übernahm ich. Ich schickte seiner Frau die Hälfte vom Gewinn, auch später noch, als sie einen Doktor geheiratet hatte und nach Bay Side gezogen war. Ich blieb über fünfzig Jahre im Geschäft. Es ist nicht das, was ich mir gewünscht hätte. Und doch. Die Wahrheit ist, dass es mir lieb geworden ist. Ich verschaffte denen Einlass, die ausgeschlossen waren, während ich anderen auszuschließen half, was nicht eingelassen werden durfte, damit sie albtraumfrei schlafen konnten.
Dann, eines Tages, sah ich aus dem Fenster. Vielleicht in die Betrachtung des Himmels vertieft. Setz einen Toren ans Fenster, und es kommt ein Spinoza heraus. Der Nachmittag verging, Dunkelheit brach herein. Ich reckte mich nach der Strippe der Glühbirne, und plötzlich war es, als hätte mir ein Elefant aufs Herz getreten. Ich fiel auf die Knie. Ich dachte: Ewig habe ich nicht gelebt. Eine Minute verging. Noch eine Minute. Noch eine. Ich klammerte mich an den Fußboden, schleppte mich zum Telefon.
Fünfundzwanzig Prozent meines Herzmuskels starben ab. Es dauerte, bis ich mich erholt hatte, und ich nahm meine Arbeit nie wieder auf. Ein Jahr verging. Ich spürte die Zeit um ihrer selbst willen zerrinnen. Ich starrte aus dem Fenster. Sah den Herbst Winter, den Winter Frühling werden. An manchen Tagen kam Bruno herunter und setzte sich zu mir. Wir kennen uns von ganz früher, als wir kleine Jungen waren; wir sind zusammen in die Schule gegangen. Er war einer meiner engsten Freunde, mit dicker Brille, rötlichen Haaren, die er hasste, und überschnappender Stimme, wenn er sich aufregte. Ich wusste nicht, dass er noch lebte, aber dann ging ich eines Tages den East Broadway entlang und hörte diese Stimme. Ich drehte mich um. Mit dem Rücken zu mir stand er vor einem Lebensmittelladen und fragte nach dem Preis irgendeiner Frucht. Ich dachte: Du hast sie nicht mehr alle, was bist du nur für ein Träumer, wie wahrscheinlich ist das – dein Sandkastenfreund? Wie angewurzelt stand ich auf dem Bürgersteig. Er ist unter der Erde, sagte ich mir. Und du, du bist hier, in den Vereinigten Staaten von Amerika, da ist McDonald’s, reiß dich zusammen. Ich wartete nur, um sicherzugehen. Sein Gesicht hätte ich nicht wiedererkannt. Aber: Sein Gang war unverkennbar. Er war schon fast an mir vorbei, da streckte ich den Arm aus. Ich wusste nicht mehr, was ich tat, vielleicht sah ich Gespenster, ich packte ihn am Ärmel. Bruno, sagte ich. Er blieb stehen und drehte sich um. Zuerst schien er erschrocken, dann verwirrt. Bruno. Er sah mich an, Tränen stiegen ihm in die Augen. Ich packte seine andere Hand, hielt einen Ärmel und eine Hand. Er fing an zu zittern. Strich mir über die Wange. Wir standen mitten auf dem Bürgersteig, Leute eilten vorbei, es war ein warmer Junitag. Sein Haar war dünn und weiß. Er ließ das Obst fallen. Bruno.
Ein paar Jahre später starb seine Frau. Es wurde ihm zu viel, ohne sie in der Wohnung zu leben, alles erinnerte ihn, und als im Stockwerk über mir etwas frei wurde, zog er ein. Oft sitzen wir zusammen an meinem Küchentisch. Den ganzen Nachmittag manchmal, ohne ein Wort zu sagen. Und wenn, sprechen wir nie Jiddisch. Die Wörter unserer Kindheit sind uns fremd geworden – wir konnten sie so nicht mehr benutzen, also wollten wir sie lieber gar nicht mehr benutzen. Das Leben verlangte eine neue Sprache.
Bruno, mein treuer alter Freund. Ich habe ihn nicht richtig beschrieben. Genügt es zu sagen, er sei unbeschreiblich? Nein. Lieber scheitern, als es gar nicht erst versuchen. Der weiche weiße Flaum, der deine Schädeldecke umspielt, wie eine halb abgeblasene Pusteblume. Oft war ich versucht, Bruno, auf deinen Kopf zu pusten und einen Wunsch zu tun. Nur ein letzter Rest Anstand hält mich davon ab. Aber vielleicht sollte ich mit deinem Wuchs anfangen, der sehr klein ist. An guten Tagen reichst du mir kaum bis an die Brust. Oder mit den Brillengläsern, die du aus einer Schachtel gefischt und zu deinen erklärt hast, riesige runde Dinger, die deine Augen weiten, als zeigten sie anhaltend 4,5 auf der Richterskala an. Das ist eine Frauenbrille, Bruno! Ich hatte nie den Mut, es dir zu sagen. Oft habe ich es versucht. Und noch etwas. In unserer Jugend warst du der bessere Schriftsteller. Ich war damals zu stolz, es dir zu sagen. Aber: Ich wusste es. Glaub mir, wenn ich sage, ich wusste es damals wie heute. Der Gedanke quält mich, es nie gesagt zu haben, auch der, was alles aus dir hätte werden können. Verzeih mir, Bruno. Mein ältester, mein bester Freund. Ich war nicht fair. Du bist mir ein so treuer Begleiter am Ende meines Lebens. Du, ausgerechnet du, der du die Wörter für das alles hättest finden können.
Einmal, vor langer Zeit, fand ich Bruno mitten im Wohnzimmer liegend, ein leeres Pillenfläschchen neben sich. Er hatte genug gehabt, wollte nur noch schlafen, in alle Ewigkeit. Auf seiner Brust klebte ein Zettel mit drei Wörtern: ADIEU, MEINE LIEBEN. Ich schrie auf. NEIN, BRUNO, NEIN, NEIN, NEIN, NEIN, NEIN, NEIN, NEIN! Ich schlug ihm ins Gesicht. Schließlich flatterten die Augenlider hoch. Sein Blick war stumpf und leer. WACH AUF, DU DUMMKOPP!, rief ich.HÖR MIR JETZT ZU: DU MUSST AUFWACHENSeine Augen klappten wieder zu. Ich wählte die 911, holte eine Schüssel kaltes Wasser und schüttete es über ihn. Ich legte das Ohr an sein Herz. Weit entfernt ein schwaches Rauschen. Der Krankenwagen kam. In der Klinik wurde ihm der Magen ausgepumpt. Warum haben Sie all die Pillen geschluckt?, fragte der Doktor. Bruno, krank, erschöpft, schlug kühl die Augen auf. WAS GLAUBEN SIE WOHL, WARUM ICH ALL DIE PILLEN GESCHLUCKT HABE?, brüllte er. Die ganze Wachstation war still; alles glotzte. Bruno drehte sich stöhnend zur Wand. An diesem Abend brachte ich ihn ins Bett. Bruno, sagte ich. Tut mir ja so leid, sagte er. So selbstsüchtig. Ich seufzte und wandte mich zum Gehen. Bleib bei mir!, schrie er.
Wir sprachen nie mehr davon. Wie wir auch nie von unserer Kindheit sprachen, von den Träumen, die wir geteilt und verloren hatten, von allem, was geschehen und was nicht geschehen war. Einmal saßen wir schweigend zusammen. Plötzlich fing einer von uns an zu lachen. Es war ansteckend. Es gab keinen Grund, aber wir mussten kichern, und als Nächstes bogen wir uns auf den Stühlen und brüllten, brüllten vor Lachen, dass uns die Tränen über die Wangen strömten. Ein nasser Fleck erblühte in meinem Schoß, und wir lachten umso mehr, ich schlug mit den Fäusten auf den Tisch, rang nach Luft, dachte: Wenn ich abtrete, dann vielleicht so, in einem Lachanfall, was könnte besser sein, lachend und weinend, lachend und singend, lachend, um nicht zu vergessen, dass ich alleine bin, dass dies das Ende meines Lebens ist, dass draußen vor der Tür der Tod auf mich wartet.
Als ich ein Junge war, schrieb ich leidenschaftlich gern. Es war das Einzige, was ich in meinem Leben tun wollte. Ich erfand Personen und füllte Notizbücher mit Geschichten aus ihrem Leben. Ich schrieb über einen Jungen, der heranwuchs und so behaart wurde, dass die Leute Jagd auf sein Fell machten. Er musste sich auf Bäumen verstecken und verliebte sich in einen Vogel, der ihn für einen Dreihundert-Pfund-Gorilla hielt. Ich schrieb über siamesische Zwillingsmädchen, von denen eines sich in mich verliebte. Ich glaubte, die Sexszenen wären einzigartig. Und doch. Als ich älter wurde, beschloss ich, ein wirklicher Schriftsteller zu werden. Ich versuchte, über wirkliche Dinge zu schreiben. Ich wollte die Welt beschreiben, weil es zu einsam war, in einer unbeschriebenen Welt zu leben. Ich schrieb drei Bücher, bevor ich einundzwanzig war, wer weiß, was mit ihnen geschehen ist. Das erste handelte von Slonim, der Stadt, in der ich lebte, wo mal Polen und mal Russland war. Für das Frontispiz zeichnete ich einen Plan, in den ich Häuser und Läden eintrug, hier war Kipnis, der Schlachter, und hier Grodzenski, der Schneider, hier lebte Fischl Schapiro, der entweder ein großer zaddik oder ein Idiot war, das wusste niemand so genau, und hier der Platz und das Feld, wo wir spielten, und hier die Stelle, wo der Fluss breiter, und hier die, wo er enger wurde, hier begann der Wald, und hier stand der Baum, an dem Beyla Asch sich aufhängte, und hier und hier. Und doch. Als ich es der einzigen Person in Slonim gab, an deren Meinung mir etwas lag, zuckte sie nur die Achseln und sagte, sie hätte es lieber, wenn ich mir Sachen ausdächte. Also schrieb ich ein zweites Buch und dachte mir alles aus. Ich füllte es mit Menschen, denen Flügel, und Bäumen, deren Wurzeln in den Himmel wuchsen, mit Leuten, die ihren eigenen Namen vergaßen, und Leuten, die nichts vergessen konnten; sogar eigene Wörter dachte ich mir aus. Als ich fertig war, rannte ich den ganzen Weg zu ihrem Haus. Ich stürmte durch die Tür, die Treppe hinauf, und überreichte es der einzigen Person in Slonim, an deren Meinung mir etwas lag. An die Wand gelehnt, beobachtete ich ihr Gesicht, während sie las. Draußen wurde es dunkel, aber sie las weiter. Stunden vergingen. Ich rutschte auf den Boden. Sie las und las. Als sie fertig war, blickte sie auf. Lange gab sie keinen Ton von sich. Dann sagte sie, ich solle vielleicht nicht alles erfinden, das mache es schwer, auch nur etwas zu glauben.
Andere hätten vielleicht aufgegeben. Ich fing von vorne an. Diesmal schrieb ich nicht über wirkliche Dinge und nicht über erfundene. Ich schrieb über das Einzige, was ich wusste. Die Seiten häuften sich. Auch nachdem die einzige Person, an deren Meinung mir etwas lag, ein Schiff nach Amerika genommen hatte, fuhr ich fort, Seiten mit ihrem Namen zu füllen.
Nachdem sie weg war, brach die Welt zusammen. Kein Jude war mehr sicher. Es gab Gerüchte über unfassbare Dinge, und weil wir sie nicht fassen konnten, glaubten wir sie nicht, bis wir keine Wahl mehr hatten und es zu spät war. Ich arbeitete in Minsk, verlor aber meine Stelle und kehrte nach Slonim zurück. Die Deutschen stießen nach Osten vor. Sie kamen näher und näher. An dem Morgen, als wir die Panzer heranrollen hörten, sagte mir meine Mutter, ich solle mich im Wald verstecken. Ich wollte meinen jüngsten Bruder mitnehmen, er war erst dreizehn, aber sie sagte, sie kümmere sich selbst um ihn. Warum habe ich gehorcht? Weil es einfacher war? Ich rannte in den Wald. Legte mich still auf den Boden. In der Ferne bellten Hunde. Stunden vergingen. Und dann die Schüsse. So viele Schüsse. Aus irgendeinem Grund schrien sie nicht. Vielleicht konnte ich ihre Schreie auch nicht hören. Danach nur Stille. Mein Körper war taub, ich erinnere mich, ich schmeckte Blut im Mund. Ich weiß nicht, wie viel Zeit verging. Tage. Ich bin nicht zurückgekehrt. Als ich wieder aufstand, hatte ich alles abgeworfen, was in mir je geglaubt hatte, ich würde Wörter noch für die geringste Lebensregung finden.
Und doch.
Ein paar Monate nach meinem Herzinfarkt, siebenundfünfzig Jahre nachdem ich es aufgegeben hatte, fing ich wieder an zu schreiben. Nur für mich allein, nicht für sonst jemanden, das war der Unterschied. Es kam nicht darauf an, ob ich die Wörter fand; ja mehr noch, ich wusste, es würde unmöglich sein, die richtigen zu finden. Und weil ich akzeptierte, dass das, was ich einst für möglich gehalten hatte, in Wirklichkeit unmöglich war, und weil ich wusste, ich würde niemandem je ein Wort davon zeigen, schrieb ich einen Satz:
Es war einmal ein Junge.
So blieb er stehen, starrte tagelang aus dem ansonsten leeren Blatt hervor. In der folgenden Woche fügte ich einen hinzu. Bald war die ganze Seite voll. Es machte mich glücklich, so als spräche ich laut mit mir selbst, wie ich es manchmal tue.
Einmal sagte ich zu Bruno: Rate, was glaubst du, wie viele Seiten ich schon habe?
Keine Ahnung, sagte er.
Schreib eine Zahl auf, sagte ich, und schieb sie über den Tisch. Er zuckte die Achseln und zog einen Stift aus der Tasche. Mein Gesicht erforschend, dachte er eine oder zwei Minuten nach. Er beugte sich über die Serviette, kritzelte eine Zahl hin und drehte sie um. Ich schrieb die wirkliche Zahl, 301, auf meine eigene Serviette. Wir schoben beide über den Tisch. Ich hob Brunos hoch. Aus Gründen, die ich mir nicht erklären kann, hatte er 200000 geschrieben. Er nahm meine Serviette, drehte sie um und machte ein langes Gesicht.
Zuweilen glaubte ich, die letzte Seite meines Buches und die letzte meines Lebens wären ein und dasselbe, das Ende meines Buches würde auch mein Ende sein, ein Windsturm würde durch mein Zimmer fahren und die Seiten wegfegen, und wenn die Luft wieder rein wäre von all den flatternden weißen Blättern, würde es still sein im Raum und der Stuhl, auf dem ich eben noch gesessen hatte, leer.
Jeden Morgen schrieb ich ein wenig mehr. 301Seiten, das ist keine Kleinigkeit. Hin und wieder, wenn ich fertig war, ging ich ins Kino. Für mich ist das immer eine große Sache. Vielleicht kaufe ich mir eine Tüte Popcorn, die ich gegebenenfalls – wenn Zuschauer in der Nähe sind – verschütte. Ich sitze gern vorne, am liebsten so, dass die Leinwand meinen ganzen Blick ausfüllt, damit nichts mich ablenken kann von diesem Moment. Und dann wünsche ich mir, der Moment möge ewig dauern. Ich kann gar nicht sagen, wie glücklich es mich macht, ihn da oben zu betrachten, in überdimensionalem Großformat. Größer als das Leben, würde ich sagen, wenn ich diesen Ausdruck je verstanden hätte. Was ist schon größer als das Leben? In der ersten Reihe zu sitzen und oben, eine Etage höher, einem schönen Mädchen ins Gesicht zu sehen, während die Vibration ihrer Stimme einem die Beine massiert, erinnert an die Größe des Lebens. Also sitze ich in der ersten Reihe. Wenn ich mit steifem Hals und nickendem Ständer herauskomme, ist es ein guter Platz gewesen. Ich bin kein geiler alter Mann. Ich bin ein Mann, der so groß sein wollte wie das Leben.
Es gibt Abschnitte in meinem Buch, die weiß ich auswendig, ich trage sie im Herzen.
Im Herzen, das sage ich nicht leicht dahin.
Mein Herz ist schwach und unzuverlässig. Wenn ich sterbe, wird es wegen des Herzens sein. Ich versuche, es so wenig wie möglich zu belasten. Wenn etwas Folgenschweres droht, lenke ich es woandershin. In meine Eingeweide beispielsweise, oder meine Lunge, die sich dann vorübergehend aufpumpen mag, mir aber nie den nächsten Atemzug versagt hat. Komme ich an einem Spiegel vorbei und erhasche einen Blick auf mich selbst oder warte auf den Bus, und hinter mir stehen ein paar Gören, die sagen: «Wer riecht hier scheiße?» – die kleinen, alltäglichen Erniedrigungen–, stecke ich solche Dinge, allgemein gesprochen, mit der Leber weg. Andere Schläge gehen woandershin. Die Bauchspeicheldrüse behalte ich all dem vor, was mich an Verlusten trifft. Es ist wahr, davon gibt es reichlich, dabei ist das Organ so klein. Aber: Man kann nur staunen, was es alles schafft; ein kurzer scharfer Schmerz, schon ist es vorbei. Manchmal stelle ich mir meine eigene Autopsie vor. Enttäuschung über mich selbst: rechte Niere. Enttäuschung anderer über mich: linke Niere. Persönliche Misserfolge: kischkeß. Das sollte sich nicht so anhören, als hätte ich eine Wissenschaft daraus gemacht. So gut ist es nicht durchdacht. Ich nehme es, wie es kommt. Mir fallen nur bestimmte Muster auf. Wenn die Uhren vorgestellt werden und es dunkelt, bevor ich dazu bereit bin, spüre ich das, warum, kann ich nicht erklären, in den Handgelenken. Und wenn ich mit steifen Fingern aufwache, habe ich höchstwahrscheinlich von meiner Kindheit geträumt. Von dem Feld, auf dem wir spielten, dem Feld, wo alles entdeckt wurde und alles möglich war. (Wir rannten so schnell, dass wir glaubten, Blut spucken zu müssen: So klingt für mich die Kindheit, keuchender Atem und über harte Erde schrappende Schuhe.) Steife Finger sind mein Traum von der Kindheit, so wie sie mir am Ende meines Lebens erscheint. Ich muss die Finger unter fließend heißes Wasser halten, dass es dampft und der Spiegel beschlägt, dazu draußen das Rascheln von Tauben. Gestern sah ich einen Mann einen Hund treten, das traf mich hinter den Augen. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, einen Ort vor Tränen? Der Schmerz des Vergessens: die Wirbelsäule. Der Schmerz des Erinnerns: die Wirbelsäule. Immer wenn mir plötzlich bewusst wird, dass meine Eltern tot sind – selbst heute noch überrascht es mich, auf der Welt zu sein, während das, woraus ich entstanden bin, aufgehört hat zu existieren –: meine Knie. Es kostet eine halbe Tube Ben-Gay und einen Riesenaufwand, sie wieder anzuwinkeln. Alles hat seine Zeit, und jedes Mal, wenn ich aufwache, um mich einen Augenblick dem falschen Glauben hinzugeben, es schlafe jemand neben mir: eine Hämorrhoide. Einsamkeit: So viel verkraftet kein einzelnes Organ.
Jeden Morgen ein wenig mehr.
Es war einmal ein Junge. Er lebte in einem Dorf, das nicht mehr existiert, in einem Haus, das nicht mehr existiert, am Rande eines Feldes, das nicht mehr existiert, wo alles entdeckt wurde und alles möglich war. Ein Stock konnte ein Schwert sein. Ein Kieselstein ein Diamant. Ein Baum ein Schloss.
Es war einmal ein Junge, der lebte in einem Haus jenseits des Feldes, gegenüber von einem Mädchen, das nicht mehr existiert. Sie dachten sich tausend Spiele aus. Sie war die Königin und er der König. Im Herbstlicht schimmerte ihr Haar wie eine Krone. Sie sammelten die Welt, eine kleine Hand voll um die andere. Wenn es dunkelte, trennten sie sich mit Blättern in den Haaren.
Es war einmal ein Junge, der liebte ein Mädchen, und ihr Lachen war eine Frage, mit deren Beantwortung er sein ganzes Leben verbringen wollte. Als sie zehn waren, fragte er sie, ob sie ihn heiraten würde. Als sie elf waren, küsste er sie zum ersten Mal. Als sie dreizehn waren, bekamen sie Streit und redeten drei Wochen nicht miteinander. Als sie fünfzehn waren, zeigte sie ihm die Narbe auf ihrer linken Brust. Ihre Liebe war ein Geheimnis, das sie niemandem erzählten. Er versprach ihr, solange er lebte, würde er nie ein anderes Mädchen lieben. Was, wenn ich sterbe?, fragte sie. Auch dann, sagte er. Zu ihrem sechzehnten Geburtstag schenkte er ihr ein englisches Wörterbuch, und sie lernten zusammen die Wörter. Was ist das?, fragte er, während er mit dem Zeigefinger um ihren Knöchel fuhr, und sie schlug es nach. Und das?, fragte er, indem er ihren Ellbogen küsste. Elbow! Was ist denn das für ein Wort?, und dann leckte er ihn ab und brachte sie zum Kichern. Was ist damit?, fragte er und berührte die weiche Haut hinter ihrem Ohr. Ich weiß nicht, sagte sie, machte die Taschenlampe aus und rollte sich mit einem Seufzer auf den Rücken. Als sie siebzehn waren, liebten sie sich zum ersten Mal, auf einem Bett aus Stroh in einem Stall. Später – als Dinge geschahen, die sie sich niemals hätten vorstellen können – schrieb sie ihm einen Brief, in dem stand: Wann wirst du begreifen, dass es nicht für alles Wörter gibt?
Es war einmal ein Junge, der liebte ein Mädchen, dessen Vater schlau genug war, alle Zloty, die er besaß, zusammenzukratzen und seine jüngste Tochter nach Amerika zu schicken. Zuerst wollte sie nicht gehen, aber auch der Junge wusste genug, um darauf zu drängen, und schwor ihr bei seinem Leben, er würde Geld verdienen und einen Weg finden, ihr zu folgen. Also ging sie. Er bekam Arbeit in der nächsten Stadt, als Hausmeister in einem Krankenhaus. Nachts blieb er auf und schrieb an seinem Buch. Er schickte ihr einen Brief, in den er in winziger Handschrift elf Kapitel seines Buches übertrug. Obwohl er sich nicht einmal sicher war, ob die Post ankommen würde. Er sparte so viel Geld wie möglich. Eines Tages wurde er entlassen. Niemand sagte ihm, warum. Er kehrte nach Hause zurück. Im Sommer 1941 stießen die Einsatzgruppen tiefer nach Osten vor und töteten Hunderttausende von Juden. An einem strahlend heißen Julitag zogen sie in Slonim ein. Zu dieser Stunde lag der Junge auf dem Rücken im Wald und dachte an das Mädchen. Man könnte sagen, es war seine Liebe zu ihr, die ihn gerettet hat. In den folgenden Jahren wurde der Junge ein Mann, der sich unsichtbar machte. So entrann er dem Tod.
Es war einmal ein Mann, der, unsichtbar geworden, in Amerika ankam. Er hatte sich dreieinhalb Jahre lang versteckt, meist auf Bäumen, aber auch in Spalten, Kellern, Löchern. Dann war es vorbei. Die russischen Panzer rollten ein. Sechs Monate lebte er in einem Vertriebenenlager. Er bekam Verbindung zu seinem Cousin, der in Amerika Schlosser war. Im Kopf übte er wieder und wieder die wenigen Wörter, die er auf Englisch wusste. Knee. Elbow. Ear. Schließlich kamen seine Papiere. Er nahm einen Zug zu einem Schiff, und eine Woche später landete er im Hafen von New York. Es war ein kühler Novembertag. Zusammengefaltet in seiner Hand die Adresse des Mädchens. In dieser Nacht lag er wach auf dem Boden im Zimmer seines Cousins. Die Heizung zischte und klopfte, doch er war dankbar für die Wärme. Morgens erklärte ihm der Cousin dreimal, wie er mit der Subway nach Brooklyn kam. Er kaufte einen Strauß Rosen, aber sie ließen die Köpfe hängen, weil er sich verirrte, obwohl ihm sein Cousin den Weg dreimal erklärt hatte. Schließlich fand er den Ort. Erst als sein Finger die Klingel drückte, kam ihm der Gedanke, dass er vielleicht hätte anrufen sollen. Sie öffnete die Tür. Sie trug ein blaues Kopftuch über dem Haar. Durch die Wand der Nachbarn konnte er die Rundfunkübertragung eines Ballspiels hören.
Es war einmal vor langer Zeit, da stieg die Frau, die damals noch ein Mädchen war, auf ein Schiff nach Amerika und erbrach während der ganzen Fahrt, nicht, weil sie seekrank, sondern weil sie schwanger war. Als sie das herausfand, schrieb sie dem Jungen. Jeden Tag wartete sie auf einen Brief von ihm, aber keiner kam. Sie wurde dicker und dicker. Sie versuchte es zu verbergen, damit sie ihre Arbeit in der Kleiderfabrik nicht verlor. Ein paar Wochen vor der Geburt des Babys erhielt sie Nachricht von jemandem, der gehört hatte, in Polen würden Juden umgebracht. Wo?, fragte sie, aber niemand wusste, wo. Sie ging nicht mehr zur Arbeit. Sie konnte sich nicht überwinden aufzustehen. Nach einer Woche kam der Sohn ihres Chefs sie besuchen. Er brachte ihr etwas zu essen und stellte einen Blumenstrauß in eine Vase neben ihrem Bett. Als er merkte, dass sie schwanger war, rief er eine Hebamme. Ein kleiner Junge wurde geboren. Eines Tages setzte sich das Mädchen im Bett auf und sah den Sohn ihres Chefs das Baby in einem Sonnenstrahl wiegen. Ein paar Monate später willigte sie ein, ihn zu heiraten. Zwei Jahre später bekam sie noch ein Kind.
Der Mann, der unsichtbar geworden war, stand in ihrem Wohnzimmer und hörte sich das alles an. Er war fünfundzwanzig Jahre alt. Er hatte sich so verändert, seit er sie das letzte Mal gesehen hatte, und jetzt wollte etwas in ihm ein hartes, kaltes Lachen lachen. Sie gab ihm ein kleines Foto von dem Jungen, der inzwischen fünf war. Ihre Hand zitterte. Sie sagte: Du hast nicht mehr geschrieben. Ich dachte, du wärst tot. Er blickte auf das Foto von dem Jungen, der heranwachsen und aussehen würde wie er und der, obwohl der Mann es noch nicht wusste, aufs College gehen, sich verlieben und, von der Liebe verlassen, ein berühmter Schriftsteller werden würde. Wie heißt er?, fragte er. Sie sagte: Ich habe ihn Isaac genannt. Lange standen sie schweigend da, während er auf das Bild starrte. Schließlich brachte er drei Wörter heraus: Komm mit mir. Von der Straße drang Kindergeschrei herauf. Sie kniff die Augen fest zusammen. Komm mit mir, sagte er und streckte ihr die Hand entgegen. Tränen rollten ihr übers Gesicht. Dreimal fragte er sie. Sie schüttelte den Kopf. Ich kann nicht, sagte sie. Sie senkte den Blick zu Boden. Bitte, sagte sie. Also tat er das Schwerste, was er je in seinem Leben getan hatte: Er nahm seinen Hut und ging.
Und wenn der Mann, der einmal ein Junge gewesen war und versprochen hatte, er werde sich, solange er lebe, nie in ein anderes Mädchen verlieben, sein Versprechen hielt, so nicht, weil er standhaft oder gar treu gewesen wäre. Er konnte einfach nicht anders. Und nachdem er sich dreieinhalb Jahre versteckt hatte, schien es nicht undenkbar, auch seine Liebe zu einem Sohn zu verstecken, der nicht wusste, dass es ihn gab. Zumindest nicht, wenn die einzige Frau, die er je lieben würde, es von ihm verlangte. Und letztlich, was bedeutet es schon für einen Mann, der ohnehin gänzlich verschwunden ist, noch etwas zu verbergen?
Am Abend bevor ich für den Zeichenkurs Modell stehen sollte, war ich nervös und aufgeregt. Ich knöpfte mein Hemd auf und zog es aus. Dann schnallte ich die Hose auf und zog sie aus. Mein Unterhemd. Die Unterhose. Mit Socken an den Füßen stand ich vor dem Spiegel im Flur. Ich hörte Kindergeschrei vom Spielplatz auf der anderen Straßenseite. Die Strippe der Glühbirne hing über mir, aber ich zog nicht daran. Ich stand da und betrachtete mich im schwindenden Licht. Ich habe mich nie für gut aussehend gehalten.
Meine Mutter und meine Tanten hatten mir als Kind immer gesagt, wenn ich größer sei, würde ich ein hübscher Junge werden. Es war mir damals schon klar, dass ich keinen sehenswerten Anblick bot, aber ich glaubte, ein gewisses Maß an Schönheit würde sich eines Tages schon einstellen. Ich weiß nicht, was ich mir ausmalte: dass meine Ohren, die in einem unwürdigen Winkel abstanden, sich anlegen, dass mein Kopf ihnen irgendwie entgegenwachsen würde? Dass mein Haar, ungefähr so borstig wie eine Klobürste, sich mit der Zeit von selber glätten und im Licht glänzen würde? Dass sich mein so wenig versprechendes Gesicht – schwer hängende Froschlider, dazu schmale Lippen – in etwas nicht Beklagenswertes verwandeln würde? Jahrelang wachte ich morgens auf und ging hoffnungsvoll zum Spiegel. Auch als ich dafür schon zu alt war, hoffte ich noch. Das Älterwerden brachte keine Besserung. Wenn überhaupt, ging es bergab, als ich in die Pubertät kam und das Nette, Reizende, das alle Kinder haben, mich im Stich ließ. Zur Zeit meiner Bar-Mizwa wurde ich von einer Akneplage heimgesucht, die vier Jahre dauerte. Aber ich hoffte noch immer. Kaum wich die Akne, wich auch mein Haaransatz, als suche er Abstand von den peinlichen Gesichtszügen. Meine Ohren, geschmeichelt durch die neue Aufmerksamkeit, die sie nun genossen, schienen weiter ins Rampenlicht zu drängen. Die Augenlider wurden schlaff – einiges an Muskelspannung ging in den Kampf der Ohren–, und die Brauen begannen ein Eigenleben zu führen, indem sie vorübergehend alles erreichten, was man ihnen wünschen konnte, bald aber urwüchsig jeglichen Wunsch übertrafen. Jahrelang hoffte ich weiter, dass die Dinge sich anders entwickeln würden, aber ich schaute nicht mehr in den Spiegel, und wenn, hielt ich das, was ich sah, für alles andere als das, was es war. Mit der Zeit dachte ich immer weniger daran. Dann fast gar nicht mehr. Und doch. Schon möglich, dass irgendetwas in mir die Hoffnung nie ganz aufgegeben hat – dass es sogar heute noch Momente gibt, in denen ich vor dem Spiegel stehe, meinen schrumpeligen pischer in der Hand, und glaube, mit meiner Schönheit, das wird schon noch werden.
Am Morgen vor dem Zeichenkurs, dem 19.September, wachte ich aufgeregt auf. Ich zog mich an und aß meinen Müsli-Frühstücksriegel, dann ging ich aufs Klo und harrte erwartungsvoll aus. Eine halbe Stunde nichts, aber mein Optimismus ließ nicht nach. Dann produzierte ich ein paar Kötelchen. Hoffnungsvoll wartete ich auf mehr. Es ist nicht unmöglich, dass ich auf dem Klo sitzend sterben werde, die Hosenbeine um die Knöchel. Schließlich verbringe ich so viel Zeit dort, und all das wirft eine Frage auf, nämlich: Wer wird der Erste sein, der mich tot sieht?
Ich wusch mich mit dem Schwamm und zog mich an. Der Tag schleppte sich dahin. Als ich so lange gewartet hatte, wie es ging, nahm ich einen Bus quer durch die Stadt. Die Zeitungsanzeige steckte quadratisch gefaltet in meiner Tasche, und ich holte sie mehrmals heraus, um mir die Adresse anzusehen, obwohl ich sie auswendig wusste. Ich brauchte eine Weile, um das Gebäude zu finden. Zuerst glaubte ich an einen Irrtum. Ich lief dreimal daran vorbei, bis mir klar wurde, dass es dieses sein musste. Ein altes Lagerhaus. Die Eingangstür war verrostet und wurde durch einen Pappkarton offen gehalten. Einen Moment lang erlaubte ich mir die Vorstellung, ich sei dorthin gelockt worden, um ausgeraubt und umgebracht zu werden. Ich sah meine Leiche in einer Blutlache auf dem Boden.
Der Himmel hatte sich verdüstert, es fing an zu regnen. Ich war dankbar für den Wind und die Tropfen auf meinem Gesicht, weil ich dachte, mir bliebe nicht mehr lange Zeit zu leben. Ich stand da, unfähig, vorwärts, unfähig, zurück zu gehen. Schließlich hörte ich von drinnen Gelächter. Siehst du, du bist lächerlich, dachte ich. Ich griff nach der Klinke, doch im selben Moment schwang die Tür auf. Ein Mädchen in einem zu großen Pullover kam heraus. Sie schob die Ärmel hoch. Ihre Arme waren dünn und blass. Brauchen Sie Hilfe?, fragte sie. Ihr Pullover hatte kleine Löcher. Er reichte ihr bis zu den Knien, und darunter trug sie einen Rock. Ihre Beine waren nackt, trotz der Kälte. Ich suche einen Zeichenkurs. Da war eine Annonce in der Zeitung, vielleicht bin ich hier falsch – ich kramte in meiner Manteltasche nach der Anzeige. Sie deutete nach oben. Erster Stock, der Raum rechts. Aber es fängt erst in einer Stunde an. Ich sah an dem Gebäude hinauf. Ich dachte, vielleicht verlaufe ich mich, darum bin ich früher hergekommen. Sie zitterte. Ich zog meinen Regenmantel aus. Hier, nehmen Sie den. Sie werden noch krank. Sie zuckte die Achseln, machte aber keine Anstalten zuzugreifen. Ich hielt so lange den Arm ausgestreckt, bis klar war, dass sie es nicht tun würde.
Es blieb nichts zu sagen. Da waren Treppen, und ich ging hoch. Mir klopfte das Herz. Ich erwog umzukehren: an dem Mädchen vorbei, die vermüllte Straße hinunter und durch die Stadt zu meiner Wohnung, wo es genug zu tun gab. Was war ich doch für ein Narr, zu glauben, sie würden sich nicht abwenden, wenn ich mein Hemd auszog, die Hose herunterließ und nackt vor ihnen stand? Zu glauben, sie würden meine von Krampfadern durchzogenen Beine betrachten, meine haarigen, hängenden knejdlach – und dann was? Anfangen zu zeichnen? Und doch. Ich kehrte nicht um.
Ich hielt mich am Geländer fest und stieg die Treppe hoch. Ich hörte den Regen auf dem Oberlicht. Schmutzige Helligkeit drang hindurch. Am Treppenabsatz ging ein Flur ab. Links ein Raum, wo ein Mann an einer großen Leinwand malte. Der Raum rechts war leer, bis auf einen mit einer Bahn schwarzen Samtes bedeckten Kasten und einen lockeren Kreis von Klappstühlen und Staffeleien drum herum. Ich ging hinein, setzte mich und wartete.
Nach einer halben Stunde kamen die ersten Leute. Eine Frau fragte mich, wer ich sei. Ich bin wegen der Anzeige hier, sagte ich. Ich habe angerufen und mit jemand gesprochen. Zu meiner Erleichterung schien sie zu verstehen. Sie zeigte mir, wo ich mich ausziehen konnte, eine Ecke, in der behelfsmäßig ein Vorhang angebracht war. Ich stand da, und sie zog ihn um mich zu. Ich hörte, wie ihre Schritte sich entfernten, und stand weiter da. Eine Minute verging, dann zog ich meine Schuhe aus. Ich stellte sie ordentlich nebeneinander. Ich zog meine Socken aus und steckte sie in die Schuhe. Ich knöpfte mein Hemd auf und zog es aus; es gab einen Haken, also hängte ich es daran. Ich hörte Stühle kratzen und dann Gelächter. Plötzlich lag mir nichts mehr daran, gesehen zu werden. Gern hätte ich meine Schuhe geschnappt, wäre aus dem Zimmer geschlichen, die Treppe hinunter und weg von hier. Und doch. Ich öffnete den Reißverschluss meiner Hose. Dann kam mir ein Gedanke: Was hieß «nackt» eigentlich genau?
Meinten sie wirklich ohne Unterwäsche? Ich überlegte. Was, wenn sie Unterwäsche erwarteten, und ich kam mit meinen schlenkernden Ihr-wisst-schon-was heraus? Ich griff nach der Anzeige in meiner Hosentasche. NACKTMODELL stand da. Sei nicht blöd, sagte ich mir. Das sind keine Amateure. Die Unterhose hing schon um die Knie, als die Schritte der Frau zurückkehrten. Kommen Sie klar da drin? Jemand öffnete ein Fenster, und ein Auto spritzte durch den Regen. Ja, ja, ich bin gleich so weit. Ich sah nach unten. Ein kleiner Schmierfleck. Meine Gedärme. Sie hören nie auf, mich zu erschrecken. Ich stieg aus meiner Unterhose und knüllte sie zu einem Ball.
Ich dachte: Vielleicht bin ich am Ende doch hierher gekommen, um zu sterben. Stimmte es nicht, dass ich das Lagerhaus noch nie gesehen hatte? Vielleicht waren die hier das, was man Engel nennt. Natürlich, das Mädchen von draußen, wie hatte mir das entgehen können, sie war so blass gewesen. Ich stand reglos da. Fing an zu frieren. Ich dachte: So ist es, wenn der Tod dich holt. Nackt in einem verlassenen Lagerhaus. Morgen würde Bruno herunterkommen, an meine Tür klopfen, und niemand würde antworten. Verzeih mir, Bruno! Ich hätte gern adieu gesagt. Tut mir leid, dass ich dich mit den wenigen Seiten enttäuscht habe. Dann dachte ich: Mein Buch. Wer würde es finden? Würde es weggeworfen werden, zusammen mit meinen anderen Sachen? Obwohl ich glaubte, ich hätte es für mich selbst geschrieben, wünschte ich mir doch eigentlich, dass es jemand las.
Ich schloss die Augen und atmete tief ein. Wer würde meinen Körper waschen? Wer würde in Trauer das Kaddisch für mich sprechen? Ich dachte: Die Hände meiner Mutter. Ich zog den Vorhang auf. Das Herz schlug mir bis zum Hals. Ich trat hinaus. Ins Licht blinzelnd, stand ich vor ihnen.
Ich war nie ehrgeizig gewesen.
Ich weinte zu leicht.
Ich war kein Kopfmensch.
Oft fehlten mir die Worte.
Während andere beteten, bewegte ich nur die Lippen.
Bitte.
Die Frau, die mir gezeigt hatte, wo ich mich umziehen konnte, deutete auf den in Samt gehüllten Kasten.
Stellen Sie sich dorthin.
Ich ging über den Fußboden. Es waren etwa zwölf Leute, die auf den Stühlen saßen, mit Zeichenstiften in der Hand. Das Mädchen im langen Pullover war dabei.
Wie es Ihnen am bequemsten ist.
Ich wusste nicht, wohin ich mich wenden sollte. Sie saßen im Kreis, irgendjemand musste sich mit meiner Hinteransicht abfinden, egal, wie ich mich drehte. Ich beschloss, so stehen zu bleiben. Ich ließ die Arme an den Seiten herabhängen und fixierte einen Punkt am Boden. Sie hoben ihre Stifte.
Nichts geschah. Dafür spürte ich den Plüsch unter meinen Fußsohlen, spürte die Armhaare sich aufrichten, die Finger schwer werden wie zehn kleine, nach unten ziehende Gewichte. Spürte meinen Körper unter zehn Augenpaaren erwachen. Ich hob den Kopf.
Versuchen Sie stillzuhalten, sagte die Frau.
Ich starrte auf einen Riss im Betonboden. Hörte, wie die Stifte sich über das Papier bewegten. Ich wollte lächeln. Mein Körper fing schon an zu rebellieren, die Knie begannen zu zittern und die Rückenmuskeln wehzutun. Aber: Es kümmerte mich nicht. Wenn nötig, würde ich den ganzen Tag hier stehen. Fünfzehn, zwanzig Minuten vergingen. Dann sagte die Frau: Ich schlage vor, wir machen eine kurze Pause und setzen dann mit einer anderen Pose fort.
Ich saß. Ich stand. Ich drehte mich um die eigene Achse, sodass diejenigen, die meine Hinteransicht noch nicht kannten, sie jetzt kennen lernten. Seiten wurden umgeblättert. So ging es wer weiß wie lange weiter. Einmal glaubte ich, ohnmächtig zu werden. Ich kreiste zwischen Fühlen und Benommenheit, Fühlen und Benommenheit. Meine Augen tränten vor Schmerz.
Irgendwie bekam ich meine Kleider wieder an. Ich fand meine Unterhose nicht und war zu müde zum Suchen. Ans Geländer geklammert, schaffte ich es die Treppe hinunter. Die Frau lief mir nach, sagte: Warten Sie, Sie haben die fünfzehn Dollar vergessen. Ich nahm das Geld, und als ich es in die Tasche stecken wollte, fühlte ich dort das Knäuel der Unterhose. Danke. Das kam von Herzen. Ich war erschöpft. Aber glücklich.
Ich möchte irgendwo festhalten: Ich habe versucht, nicht nachtragend zu sein. Und doch. Es gab Zeiten in meinem Leben, ganze Jahre, da hat die Wut mich untergekriegt. Hässlich kehrte ich mein Innerstes nach außen. In der Verbitterung fand ich eine gewisse Genugtuung. Ich machte ihr den Hof. Sie stand draußen, und ich lud sie ein. Ich blickte finster auf die Welt. Und finster blickte die Welt zurück. Erstarrt im Banne wechselseitigen Abscheus. Ich knallte den Leuten die Tür vor der Nase zu. Ich furzte, wann immer ich dazu Lust hatte. Ich beschuldigte Kassiererinnen, mich um einen Penny zu betrügen, während ich den Penny in der Hand hielt. Und dann, eines Tages, wurde mir bewusst, dass ich auf dem besten Weg war, einer von diesen Tauben vergiftenden schmocks zu werden. Die Leute wechselten die Straßenseite, wenn sie mir begegneten. Ich war ein menschliches Krebsgeschwür. Aber um ehrlich zu sein: Ich war nicht wirklich wütend. Nicht mehr. Ich hatte meine Wut vor langer Zeit irgendwo vergessen. Hatte sie auf einer Parkbank abgelegt und war weggegangen. Und doch. Es war so lange so gewesen, und ich wusste nicht, wie ich mich anders verhalten sollte. Eines Tages wachte ich auf und sagte mir: Es ist nicht zu spät. Die ersten Tage waren seltsam. Ich musste das Lächeln vor dem Spiegel üben. Aber es kam wieder. Es war, als wäre eine Last von mir genommen. Ich ließ los, und etwas ließ mich los. Ein paar Monate später fand ich Bruno.
Als ich vom Zeichenkurs nach Hause kam, hing ein Zettel von Bruno an der Tür: WOO BIST DU? Ich war zu müde, die Treppe hinaufzusteigen, um ihm Bescheid zu sagen. Drinnen war es dunkel, und ich zog die Strippe der Glühbirne im Flur. Ich sah mich im Spiegel. Mein Haar, oder was davon übrig war, stand hinten ab wie ein Wellenkamm. Mein Gesicht wirkte verschrumpelt wie etwas, was zu lange draußen im Regen war.
Ich fiel angezogen ins Bett, noch immer ohne Unterhose. Es war nach Mitternacht, als das Telefon klingelte. Ich erwachte aus einem Traum, in dem ich meinem Bruder Josef gezeigt hatte, wie man im hohen Bogen pinkelt. Manchmal habe ich Albträume. Das hier war keiner. Wir waren im Wald, froren uns in der Kälte den Hintern ab. Es dampfte aus dem Schnee. Josef drehte sich zu mir um, lächelnd. Ein schönes Kind, blond mit grauen Augen. Grau wie das Meer an einem sonnenlosen Tag, oder wie der Elefant, den ich in der Stadt auf dem Platz gesehen hatte, als ich in Josefs Alter war. Klar und deutlich hatte er da gestanden, im staubigen Sonnenlicht. Später konnte sich niemand erinnern, ihn gesehen zu haben, und weil unmöglich zu verstehen war, wie ein Elefant nach Slonim gekommen sein sollte, glaubte mir niemand. Aber ich habe ihn gesehen.
In der Ferne ertönte eine Sirene. Mein Bruder machte gerade den Mund auf, um etwas zu sagen, da riss der Traum ab, und ich erwachte im stockdunklen Schlafzimmer, während der Regen an die Scheibe platschte. Das Telefon klingelte weiter. Bruno, zweifelsohne. Ich wäre nicht drangegangen, wenn ich nicht befürchtet hätte, er würde die Polizei rufen. Warum klopfte er nicht einfach mit dem Spazierstock an die Heizung wie sonst immer? Dreimal klopfen bedeutet LEBST DU NOCH?, zweimal bedeutet JA, einmal NEIN. Wir machen das nur nachts, tagsüber gibt es zu viele andere Geräusche, und narrensicher ist es sowieso nicht, da Bruno gewöhnlich mit dem Walkman auf den Ohren einschläft.
Ich schlug die Decke zurück und stolperte, gegen ein Tischbein stoßend, zum Telefon. HALLO?, rief ich in den Hörer, aber die Leitung war tot. Ich legte auf, ging in die Küche und nahm ein Glas oben aus dem Schrank. Das Wasser gluckerte in der Leitung und spritzte im Schwall heraus. Ich nahm einen Zug, dann fiel mir meine Pflanze ein. Ich habe sie schon fast zehn Jahre. Sie ist kaum noch am Leben, aber immerhin. Eher braun als grün. Viel Verdorrtes dran. Dennoch überlebt sie, immer nach links geneigt. Auch wenn ich sie so herumdrehe, dass die Sonnenseite nicht mehr die Sonnenseite ist, neigt sie sich weiter stur nach links, entscheidet sich gegen das physische Bedürfnis und für den kreativen Akt. Ich schüttete den Rest meines Wassers in ihren Topf. Überhaupt, was heißt schon blühen?
Im nächsten Augenblick klingelte das Telefon wieder. Schon gut, schon gut, sagte ich, während ich den Hörer abnahm. Brauchst nicht das ganze Haus zu wecken. Schweigen am anderen Ende. Ich sagte: Bruno?
Spreche ich mit Mr.Leopold Gursky?
Ich nahm an, jemand wolle mir etwas verkaufen. Sie rufen immer an, um etwas zu verkaufen. Einmal sagten sie, ich solle einen Scheck über 99Dollar schicken, dann sei ich in der Vorauswahl für eine Kreditkarte, und ich sagte: Prima, klar, und wenn ich mich unter eine Taube stelle, bin ich in der Vorauswahl für eine Ladung Scheiße.
Aber der Mann sagte, er wolle nichts verkaufen. Er habe sich aus seinem Haus ausgeschlossen. Er habe sich von der Auskunft die Nummer eines Schlüsseldienstes geben lassen. Ich erklärte ihm, ich sei im Ruhestand. Der Mann machte eine Pause. Offenbar konnte er sein Pech nicht fassen. Er hatte schon drei andere Nummern angerufen und niemanden erreicht. Es schüttet hier draußen, sagte er.
Können Sie nicht irgendwo anders übernachten? Morgens ist es leicht, einen Schlosser zu bekommen. Davon gibt es jede Menge.
Nein, sagte er.
Na schön, ich meine, wenn es zu viel verlangt ist – fing er wieder an und hielt dann inne, darauf wartend, dass ich etwas sagte. Ich tat es nicht. Also dann. Ich hörte seiner Stimme die Enttäuschung an. Entschuldigen Sie die Störung.
Trotzdem legte er nicht auf, er nicht und ich auch nicht. Ich war voller Schuldgefühle. Ich dachte: Was brauche ich den Schlaf? Dafür ist noch Zeit genug. Morgen. Oder am Tag darauf.
Schon gut, schon gut, sagte ich, obwohl ich es nicht sagen wollte. Ich würde mein Werkzeug ausgraben müssen. Ebenso gut konnte ich eine Stecknadel im Heuhaufen suchen oder einen Juden in Polen. Augenblick mal, ich hole einen Stift.
Er gab mir eine Adresse ganz im Norden der Stadt. Erst nachdem ich aufgelegt hatte, fiel mir ein, dass ich um diese Zeit ewig auf einen Bus warten müsste. In der Küchenschublade lag die Karte des Goldstar Car Service, nicht, dass ich je dort anriefe. Aber: Man weiß nie. Ich bestellte ein Taxi und fing an, den Wandschrank im Flur nach meinem Werkzeugkasten zu durchwühlen. Statt seiner fand ich den Kasten mit den alten Brillen. Wer weiß, woher ich sie habe. Wahrscheinlich hat sie jemand auf der Straße verkauft, zusammen mit ein paar Geschirrstücken und einer Puppe ohne Kopf. Gelegentlich probiere ich welche aus. Einmal habe ich mir mit einer Damen-Lesebrille auf der Nase ein Omelett zubereitet. Es war ein Mammutomelett, beim bloßen Anblick wurde mir bang. Ich fischte eine Brille aus dem Kasten. Die Gläser waren viereckig und fleischfarben getönt, einen guten Zentimeter dick. Ich setzte sie auf. Der Boden unter mir sackte ab, und als ich versuchte, einen Schritt zu tun, kam er ruckartig wieder hoch. Ich torkelte zum Spiegel. Um etwas Schärfe zu gewinnen, ging ich ganz nahe heran, aber ich hatte mich verrechnet und bumste an die Scheibe. Es klingelte. Immer dasselbe, alle kommen, wenn dir die Hose um die Knöchel hängt. Augenblick, ich bin gleich unten, brüllte ich in die Sprechanlage. Als ich die Brille abnahm, stand der Werkzeugkasten genau vor meiner Nase. Ich fuhr mit der Hand über den ramponierten Deckel. Dann schnappte ich meinen Regenmantel, der auf dem Boden lag, strich mir das Haar im Spiegel glatt und ging. Brunos Zettel hing noch an der Tür. Ich knüllte ihn in meine Tasche.
Eine schwarze Limousine stand auf der Straße, durch das Licht der Scheinwerfer strich Regen. Ansonsten weit und breit nur ein paar leere Autos, entlang der Bordsteinkante geparkt. Ich wollte schon ins Haus zurück, aber der Fahrer der Limousine ließ das Fenster herunter und rief meinen Namen. Er trug einen purpurroten Turban. Ich trat ans Fenster. Das muss ein Irrtum sein, sagte ich. Ich habe ein Taxi bestellt.
Okay, sagte er.
Aber das ist eine Limousine, betonte ich.
Okay, wiederholte er, indem er mich hereinwinkte.
Extras kann ich nicht bezahlen.