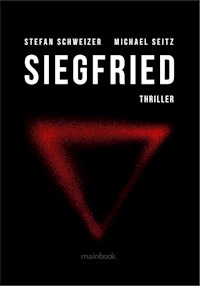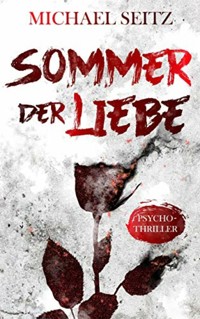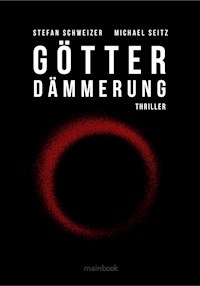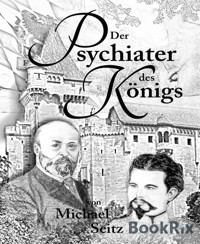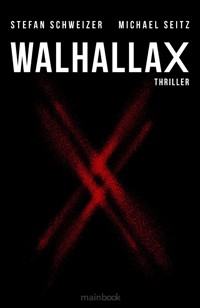
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mainbook Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Wagner-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Tag X ist da! "WalhallaX" ist der fulminante Abschluss der Wagner-Trilogie des Autorenduos Seitz & Schweizer – Dystopie und Thriller zugleich. Deutschland in naher Zukunft: Journalist Tscharly Huber kämpft gegen seinen Erzfeind, den ehemaligen Verfassungsschutz-Agenten Roland Wagner. Tscharly bleibt wenig Zeit, denn die "neuen Rechten" sehen nach jahrelangen Vorbereitungen ihr Ziel, die Macht in Deutschland an sich zu reißen, in greifbarer Nähe. Inflation, Versorgungsengpässe, scheinbare Unregierbarkeit, soziale Spannungen und politische Hetze sind der Nährboden dieser "rechten Revolution". Tscharlys Frau Kira und sein kleiner Sohn werden zu Gefangenen dieser Bewegung. Kann Tscharly ihr Leben retten? Kann er Wagner und seine Gefährten in buchstäblich letzter Sekunde aufhalten? Der Roman ist Mahnung, nicht Prophezeiung. Skrupellos und machtbesessen putschen neue Nazis eine neue Weltordnung herbei. Das Rad der Zeit soll zurückgedreht und Menschenrechte wie Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit durch nationalsozialistische Weltanschauung ersetzt werden. "WalhallaX" zeigt schonungslos: Dieses Horrorszenario eines jeden aufrechten Demokraten ist dabei, Wirklichkeit zu werden …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michael Seitz
Stefan Schweizer
WalhallaX
Dystopischer Thriller
Achtung: Die folgenden Inhalte können auf manche Leserinnen und Leser verstörend wirken.
eISBN 978-3-948987-96-1
Copyright © 2023 mainbook Verlag
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Gerd Fischer
Covergestaltung und Bildrechte: Lukas Hüttner
Auf der Verlagshomepage finden Sie weitere spannende Bücher: www.mainbook.de
Inhalt
Vorwort
Drei Tage vor dem „Tag X“
Teil 1
1. Montag, sieben Tage vor dem „Tag X“
2. Donnerstag, Juni desselben Jahres, Tag der „Sommersonnenwende“
3. Dienstag, sechs Tage vor dem „Tag X“
4. Donnerstag, Juni desselben Jahres, Tag der „Sommersonnenwende“, abends
5. Mittwoch, fünf Tage vor dem „Tag X“
6. Juni desselben Jahres, Tag der „Sommersonnenwende“, nachts
7. Ein Tag nach dem Rechtsrockkonzert, Juni desselben Jahres
8. Mittwoch, fünf Tage vor dem „Tag X“
9. Ein Tag nach dem Rechtsrockkonzert, Juni desselben Jahres
10. Donnerstag, vier Tage vor dem „Tag X“
11. Donnerstag, vier Tage vor dem „Tag X“
12. Donnerstag, vier Tage vor dem „Tag X“
Teil 2
13. Freitag, drei Tage vor dem „Tag X“
14. Freitag, drei Tage vor dem „Tag X“
15. Freitag, drei Tage vor dem „Tag X“
16. Freitag, drei Tage vor dem „Tag X“
17. Freitag, drei Tage vor dem „Tag X“
18. Freitag, drei Tage vor dem „Tag X“
19. Samstag, zwei Tage vor dem „Tag X“
20. Samstag, zwei Tage vor dem „Tag X“
21. Samstag, zwei Tage vor dem „Tag X“
22. Samstag, zwei Tage vor dem „Tag X“
23. Sonntag, ein Tag vor dem „Tag X“
24. Sonntag, ein Tag vor dem „Tag X“
25. Sonntag, ein Tag vor dem „Tag X“
Teil 3
26. Montag, „Tag X“
27. Montag, „Tag X“
28. Montag, „Tag X“
29. Montag, „Tag X“
30. Montag, „Tag X“
31. Montag, „Tag X“
32. Montag, „Tag X“
33. Montag, „Tag X“
34. Montag, „Tag X“
35. Montag, „Tag X“
36. Montag, „Tag X“
37. Montag, „Tag X“
Autor Michael Seitz
Michael Seitz, Jahrgang 1976, hat seine Kindheit und Jugend in München und im ländlichen Niederbayern verbracht und lebt seit 2005 in Wien. Er schreibt vorwiegend historische Romane und Gegenwartskrimis. Seitz genießt es, mit seiner Frau und seinen beiden Kindern durch Wien zu flanieren und in Buchgeschäften zu schmökern.
Veröffentlichungen (Auswahl): „Die verlorenen Kinder“ (Droemer Knaur, 2017), „Der Falter“ (Droemer Knaur, 2018), „Kinderspiel – Die Fesseln der Vergangenheit“ (Droemer Knaur, 2019), „Sechs“ (Droemer Knaur, 2019)
Autor Stefan Schweizer
Stefan Schweizer studierte, promovierte und lehrte an der Universität Stuttgart. Er lebt im Speckgürtel der Bundeshauptstadt, bewegt sich gerne in fremden Kulturen, in exotischen subkulturellen Milieus und ist Grenzgänger zwischen den Scenes.
Veröffentlichungen (Auswahl): „Seitenwende“ (gemeinsam mit Gerd Fischer, mainbook 2023), „Mörderklima“ (Klimawandel-Krimi, mainbook, 2020), „Die Akte Baader“ (Gmeiner, 2018), „Roter Herbst 77 – RAF 2.0“ (Südwestbuch, 2017), „Roter Frühling 72, RAF 1.0“ (Südwestbuch, 2017), „BERLIN GANGSTAS“ (Schwarzkopf & Schwarzkopf, 2016), „Goldener Schuss“ (Gmeiner, 2015).
Vorwort
Und ich sah: Ein anderes Tier stieg aus der Erde herauf. Es hatte zwei Hörner wie ein Lamm, aber es redete wie ein Drache. (Offenbarung des Johannes, 13,11, Neues Testament)
Der vorliegende Roman – eine literarische Fiktion – soll Ausdruck menschlicher Ängste und Dystopie sein, ähnlich wie die Offenbarung des Johannes, der neben seinem Evangelium auch das Buch der Offenbarung in der Bibel verfasst hat. Johannes’ Meisterwerk dient den Menschen bis heute weniger als Prophezeiung eines gewaltsamen Weltuntergangs, denn als wort- und bildgewaltige Mahnung. Johannes benutzte um 95 n. Chr. die Stilmittel des Fantasy-Autors. Wir haben uns entschieden, einen politischen Thriller zu verfassen. In diesem offenbaren wir den Leserinnen und Lesern ein mögliches Szenario, quasi, was passieren könnte, wenn „die neuen Rechten“ ihre Visionen Wirklichkeit werden lassen. Selbstredend distanzieren wir uns von allem rechten Gedankengut, das von den Antagonisten in diesem Werk gedacht, geredet und in Taten umgesetzt wird. Doch es war nötig, sich beim Schreiben mit deren Gedanken und Gefühlen auseinanderzusetzen. Denn auch dieses Werk soll eine Enthüllung sein, genau wie des Evangelisten Johannes’ Offenbarung. Denn auch die „neuen Rechten“ treten oftmals als Schafe in Erscheinung und erwiesen sich als Drachen – oder wie man heute sprichwörtlich sagt: „Wölfe im Schafspelz.“ Den Blick dorthin zu lenken, war beim Schreiben dieses Buches unsere hehre Absicht. Wir sind davon überzeugt, dass die Menschheit, abgesehen von klimatischen Einflüssen, eine Überlebenschance hat, wenn wir über Länder und Grenzen hinweg die Antwort auf die Frage aller Fragen finden. Eine Waffe, um Spaltung, Kriege und Hass ein für alle Mal zu beenden.
Wenn man auf Johannes’ literarisches Meisterwerk vertraut, dann heißt die Antwort schlicht: Liebe.
Drei Tage vor dem „Tag X“
Das Wort stand in blutroter Farbe über dem Eingang des Glasgebäudes im Münchener Osten. Lügenpresse.
Chefredakteur Tscharly Huber besah sich das Dilemma. Drohungen gegen ihn und seine Mitarbeiter waren in den letzten Jahren zu einem Teil seines täglichen Geschäftes geworden. Facilitymanager Robert gestikulierte mit nach vorne gebeugtem Kopf und schwingenden Armen, um seiner Empörung über die Schmiererei Ausdruck zu verleihen. Robert arbeitete seit über vierzig Jahren für die Münchener Neuesten Nachrichten und hatte aufgrund seiner geistigen Behinderung einen geschützten Arbeitsplatz inne. Gestern hatten sie auf dem Oktoberfest Roberts Dienstjubiläum gefeiert. Tscharly war beim Aufwachen verkatert gewesen. Obwohl er nur eine einzige Maß Bier zum Spitzenpreis von 28,50 Euro getrunken hatte! Der Maßpreis auf der Theresienwiese erreichte durch die Inflation immer utopischere Höhen. Dazu gab es Blasmusik im Ballermann-Stil, was auch nicht unbedingt jedermanns Geschmack war. Aber was sein musste, musste sein. Robert war hier bereits angestellt gewesen, bevor Tscharly überhaupt bei den Münchener Neuesten Nachrichten volontiert hatte. Robert war der gute Geist des Hauses und sollte in vier Wochen in seinen wohlverdienten Ruhestand verabschiedet werden. Eigentlich Zeit, endlich nach einem Ersatz Ausschau zu halten. Warum nur sträubte sich in Tscharly alles dagegen, ein Unikat wie seinen Robert zu ersetzen? In Gedanken nannte er ihn stets: mein Robert – mein alter Robert. Naturgemäß hatte Robert als Hausmeister die Schmiererei als Erster entdeckt.
Die Kugel, die das Gehirn des ältesten Angestellten des Verlags an diesem sonnigen Herbstmorgen Ende September durchdrang, hinterließ ein glattes Einschussloch auf dessen Stirn. Lautlos fällte der Schuss ihn wie eine Eiche vor Tscharlys Augen. Wie in Zeitlupe sank Robert zu Boden. Blutspritzer besudelten das weiße Pflaster vor den Glastüren der Redaktion. Die Glastüren konnten sich nicht entscheiden, ob sie öffnen oder schließen sollten. Tscharly drehte sich reflexartig um einhundertachtzig Grad und erspähte die Scharfschützen, die von der Ladefläche eines weißen Lieferwagens mit der Aufschrift „Bayerisches Biosauerkraut“ sprangen. Tscharly traute seinen Augen nicht; die Angreifer trugen Masken sämtlicher deutscher Bundeskanzler und dazu Lederhosen wie eine Blaskapelle. Selbst Helmut Kohl und Helmut Schmidt waren mit blauweiß karierten Hemden ausgestattet. Die Kniestrümpfe reichten den Kanzlern bis unter die Kniekehlen. Verbissen ballerten die beiden mit Maschinenpistolen in Richtung der hin und her ruckenden Glastüren des Verlagsgebäudes, in dem Tscharly als leitender Chefredakteur die Hauptverantwortung trug. Tscharly sah für Sekunden nur Schwärze vor seinen Augen – und jede Menge pinker Sterne wie in einem klischeehaft gezeichneten Comic. Tscharly sprang zu Boden. Ein Bein in einem schwarzen Springerstiefel stampfte achtlos über die Brust des Toten neben ihm hinweg. Auch Kanzler Gerhard Schröder trug Haferlschuhe wie ein Geißen-Peter und zielte mit der Maschinenpistole direkt auf Tscharlys Gesicht. Tscharly trat dem Genossen reflexartig in die Hoden. Schröders schmerzerfülltes Gebrüll verhallte im Kugelhagel, der in Tscharly düstere Erinnerungen an seine Zeiten als Kriegsberichterstatter in Sarajewo heraufbeschwor. Wie ein Flashback, das mit der gegenwärtigen Szene verschmolz. Schröder taumelte wie ein angeschlagener Boxer hin und her, wodurch die Schussrichtung seines Laufes abgelenkt wurde. Anstelle von Tscharlys Schädel zerbarst die Glasfront der Münchener Neuesten Nachrichten.
„Die Reichskristallnacht ist eröffnet!“, brüllte CDU-Kurzzeitkanzler Kurt Georg Kiesinger, das alte Ohrfeigengesicht.
Helmut Kohl stützte seinen Amtsnachfolger Gerhard Schröder und sie verschwanden im Verlagsgebäude. Kurt Georg Kiesinger drehte sich um die eigene Achse und feuerte ziellos über den Parkplatz wie eine versprengte Nachhut. Was für ein unrühmliches Ende des ersten Kanzlers der ersten großen Koalition, die jemals in der Bundesrepublik regiert hatte, fuhr es Tscharly in einem Anflug ohnmächtigen Zynismus durchs Gehirn. Kiesingers Geschosse richteten unter den Fahrzeugen in Sekundenschnelle einen Schaden im sechsstelligen Bereich an, Glas zersplitterte, Blech wurde durchlöchert.
Konrad Adenauer hob den rechten Arm verräterisch zum Hitlergruß und stürmte ebenfalls auf das Tor zu. Tscharly warf sich auf den Polit-Zombie. Er brachte mit einem gezielten Handkante-gegen-Nasenscheidewand Schlag den ersten Kanzler der Bundesrepublik Deutschland zu Fall. Adenauer landete wie ein Mehlsack auf ihm und zeigte unbändige Kräfte.
Irgendwo brüllte auch Adenauers unbeliebter Nachfolger, Wirtschaftswunderkanzler Ludwig Erhard, mit lautem Organ „Wollt ihr den totalen Krieg?“, als wäre er Hitlers Propagandaminister Joseph Goebbels, der die Deutschen am 18. Februar 1943 zum „Endsieg“ peitschen wollte.
„Lügenpresse!“, plärrte Genosse Willi Brandt, was die Szene surreal anmuten ließ; immerhin war der echte Genosse Brandt aktiv im Widerstand gegen Hitler tätig gewesen und hatte sein Leben im Untergrund gegen die Nationalisten riskiert.
„Heil Hitler!“, brüllte der falsche Brandt.
Tscharly hatte nicht die Zeit, das Surreale der Szene zu begreifen. Er griff Kanzler Adenauer im Nacken und presste ihn mit offenem Mund voran gegen die Kante eines Stufenabsatzes vor der Redaktion. Einmal. Zweimal. Des Kanzlers Kiefer brach.
Tscharly sprang auf und stellte seinen rechten Fuß auf Adenauers Kopf. Er hörte und spürte endlich auch Adenauers Genick brechen. Adenauer erschlaffte, blutete aus dem Mund und aus den Nasenlöchern. Der Gründervater der Bundesrepublik Deutschland lag neben Tscharlys Robert – meinem Robert –, der mit geweiteten Augen in einen heiteren, wolkenlos blauen Himmel aufsah. Ein richtig schöner Tag für das Münchener Oktoberfest. Noch dazu der Freitag vor dem berühmten „italienischen Wochenende“, an dem traditionell die zahlreichen Gäste aus Italien die Theresienwiese stürmten. Der Himmel der Bayern. Weiß und blau … Und das alles geschah zur selben Zeit, während vor der Redaktion im Münchener Osten ein Gewehrkolben Tscharly mitten im Gesicht traf. Der Chefredakteur spürte seine Nase breiig, ehe er in die Knie ging und das Bewusstsein verlor. Das Ohrfeigengesicht Kiesinger hatte ihn quasi im Vorbeilaufen, wie nebenbei, ausgeschaltet. Aber warum nur hatte ihn der Alt-Nazi nicht mit einer Kugel erledigt?, fragte Tscharly sich Sekunden später, als er aus seiner Ohnmacht erwacht war. Er wischte sich das Blut mit dem Hemdsärmel vom Mund und raffte sich auf. Der Schmerz in seiner Nasenscheidewand pochte. Das Westernhemd mit den Fransen, das er aus seinem Urlaub in Nashville mitgebracht hatte, war komplett verschmiert. Wo blieben nur Sheriff und Kavallerie, wenn man sie mal brauchte? Tscharly griff in die Hosentasche, fand anstelle seines Smartphones nur einen Haufen Elektronikschrott vor; der Treppenabsatz hatte sich gegen das angeblich bruchsichere Plastik durchgesetzt. Tscharly spuckte Blut auf das Pflaster.
„Verfickte Scheiß-Nazis!“, schrie er und entriss dem mausetoten Adenauer dessen Maschinenpistole. Er konnte mit dem Gerät umgehen, schließlich gehörten Schießtrainings für die Mitarbeiter zum Sicherheitskonzept der Redaktion.
Er stürmte in die Bürohalle. Und kam zu spät. Im Großraumbüro im ersten Stock hagelten Schüsse und hatten bereits die Körper von mindestens dreißig Angestellten, die allesamt pünktlich um sieben Uhr zum Dienst erschienen waren, zerfetzt. Was für ein Glück für alle, die sich verspäteten oder sich frei genommen hatten. Für Tscharly als Leitendem Redakteur ein Desaster. Politik, Wirtschaft, Kunst und Kultur, Sport. Das waren die Ressorts, dessen Kolleginnen und Kollegen an diesem Morgen eindeutig eine Fehlentscheidung bei der Auswahl ihres Arbeitgebers getroffen hatten. Ein Kaffeetablett lag auf dem Boden. Espressi, Cappuccini und jede Menge Milchkaffee mischte sich mit dem Blut der fünfzigjährigen Assistentin, die wie jeden Morgen den Kaffee für die Besprechung aller Ressorts in den großen Sitzungsraum hatte bringen wollen. Die Frau hieß Annemarie Brooks und hatte US-amerikanische Wurzeln. Im Juli hatte sie ihren Brustkrebs endgültig besiegt. Tscharly zählte sie zu seinen engsten Vertrauten und hatte sich für sie gefreut. Und jetzt? Tscharly kroch über sie hinweg. Die Schüsse verstummten.
Ampelkanzler Olaf Scholz, dessen Anwesenheit Tscharly bisher entgangen war, stellte sich ihm mit einer Entschlossenheit, die man in dieser Form ganz und gar nicht von ihm kannte, in den Weg.
„Keinen Schritt weiter, Cowboy!“, sagte Scholz. Anstelle einer Waffe hielt er ein Funkgerät in seiner rechten Hand. „Kamerad und Ministerpräsident Franz Josef Strauß steht gerade mit einer Kohorte Bewaffneter in deiner Wohnung und kassiert deinen Sohn Konstantin ein. Gemeinsam mit den Genossen Mielke und Honecker, versteht sich!“
Ein Springermesser blitzte in der linken Hand des vermeintlichen Sozialdemokraten. Tscharly hob die MP.
„Tja, Tscharly, wir haben deine liebe Kira auf dem Weg hierher aufgegriffen. Die Gute hat eure Schmutzwäsche in die Wäscherei gebracht. Wir haben sie vor dem Geschäft abgepasst. Du hättest besser auf deine Frau aufpassen sollen. Es ist unsere Pflicht, die ganze Familie zusammenzuführen. Schließlich hat der kleine Konsti ein Recht, bei seiner Mama zu sein. – Tja, eine anständige deutsche Hausfrau hätte ihre Wäsche selbst gewaschen.“
Tscharly erstarrte und stierte auf zu seiner Frau. Keine zehn Meter entfernt. In Kiras geheimnisvollen grünen Augen offenbarte sich ihm nackte Panik. Tscharly legte die Waffe weg und griff unbewusst vor Nervosität nach den beiden Enden der Westernkrawatte an seinem Kragen. Bei den ganzen Drohungen, die es vor allem von rechten Verschwörern immer wieder gegen ihn und seine Familie gegeben hatte, war er wohl ein wenig sonderbar geworden in den letzten Jahren; dazu gehörte es, dass er begonnen hatte, sich wie ein Westernheld zu kleiden. Tscharly reckte sein Kinn entschlossen nach vorne. „Nehmen Sie mich als Ihre Geisel, Sie Arschloch, aber lassen Sie meine Frau und meinen Sohn in Ruhe.“
Scholz antwortete mit einer Lachsalve. „Wir bestimmen ab jetzt die Regeln, du linker Systemjournalist.“
„Aber Kira und Konsti, sie sind doch …“
„Schnauze!“, schrie auch der falsche Genosse Brandt und hielt Tscharly den Lauf seiner Maschinenpistole direkt an die Schläfe. Brandt roch nach billigem Rasierwasser; das wäre dem Original, der ein Womanizer gewesen war, wohl niemals passiert.
„Glaubst du, wir durchschauen dich nicht?“, sprach Scholz. „Glaubst du, wir durchschauen deine raffinierte Bilanz nicht? Du bist fünfzehn Jahre älter als deine rothaarige Hexe mit ihrem knackigen Arsch und von dem süßen kleinen Konsti wollen wir gar nicht erst reden. Dein Opfer nützt aber einen feuchten Kehricht. Wir brauchen dich noch, Tscharly. Du bist der Schlüssel.“
„Wofür?“
„Wir stellen hier die Fragen!“
„Ich habe mein Leben gelebt und ich höre auf, euch mit meiner Arbeit auf die Nerven zu gehen. Das ist es doch, was ihr wollt. Jede freie Meinung mundtot machen. So wie in Russland!“
„Wie tollkühn“, erwiderte Scholz unter seiner Gummimaske. Und Genosse Schröder stimmte ihm zu: „Russland ist ein schönes Land, sage ich nur.“
„Was wollt ihr von mir?“
„Du weißt genau, was wir wollen, Tscharly Huber“, sprach Scholz – ausgerechnet Scholz spielte sich in dieser Kombination als Rädelsführer auf. Dem echten Scholz hätte Tscharly nicht einmal zugetraut, sich am Stachus als Verkehrspolizist an einer Ampel durchzusetzen.
„Ich wüsste nicht …“
„Du weißt, wo sie ist.“
„Wer?“
Tscharly ergriff eine finstere Ahnung. Dazu die Kopfschmerzen, gegen die sich jeder Wiesenkater wie ein laues Lüftchen ausnahm.
Tscharly ahnte, worauf die wilde Kohorte aus war. „Ich schwöre, ich habe sie nicht mehr gesehen seit … Ist sie denn nicht … tot?“
„Du hast drei Tage, dann …“ Scholz hielt Kira die Klinge seines Springermessers an die Kehle. Kira blutete aus einer oberflächlichen Schnittwunde.
„Tscharly …“, wimmerte sie. „Konsti …“ Diese Arschlöcher hatten sie an ihrer verwundbarsten Stelle getroffen, beim liebsten, was sie auf der Welt besaß.
„Heil Hitler!“, plärrte der falsche Scholz und erhob den rechten Arm.
Das Geräusch von Rotoren verschluckte plötzlich jeden weiteren Laut. Das Gefühl, sich im Auge eines Orkans zu befinden, erfasste Tscharly. Dann erspähte er einen Helikopter, der vor der zerstörten Glasfront schwebte. Scherben flogen durch den Raum, was dem erhöhten Luftdruck durch die Rotoren geschuldet war. Die Kastanien und Blätter eines Baumes mischten sich unter die Glasgeschosse. Der Druck auf Tscharlys Trommelfell nahm schmerzhafte Ausmaße an, während die Armee der Kanzler in Trachtenoutfit gemeinsam mit Kira auf den Balkon der Redaktion rannte. Dort, wo in früheren Zeiten die Raucher ihrer Sucht gefrönt hatten, dockten die Kufen des Fluggerätes an. Die Kanzler hievten Kira an Bord der Maschine. Tscharly lief hinterher und warf sich neben einer Leiche zu Boden. Schüsse aus Maschinenpistolen hagelten auf den Balkon. Der durch die gewaltigen Rotoren verursachte Luftdruck zerstörte auch das, was von den Autos auf dem Parkplatz nach der Schießerei noch übriggeblieben war. Tscharly wurde von einer Böe beinahe über die Brüstung des Balkons geschleudert.
Herbstlaub flog wie Blattgold durch die Winde.
Das Surren der Rotoren blieb in Tscharlys Ohren zurück neben dem Hämmern seines Pulses. Er nahm die MP wieder an sich und lief im Zickzack durch die Redaktion. Die Treppe hinab. Nach draußen. Sein Robert lag noch immer an Ort und Stelle und schaute friedvoll in den Himmel. Tscharlys Blick fiel auf die Aufschrift: Lügenpresse.
Er zertrat eine Kastanie. Spürte sie unter dem Absatz seines Cowboystiefel zerknacken und wunderte sich mit einem Mal kein bisschen über die Polizeieinsatzfahrzeuge, die die Redaktion umstellten. Scharfschützen mit Helmen und vermummten Gesichtern rannten auf ihn zu.
Tscharly lief zurück in die Redaktion. Sie kreisten ihn ein.
„Halt! Stehen bleiben, Herr Huber!“
Tscharly stoppte abrupt.
„Herr Huber, uns liegt ein Haftbefehl gegen Sie vor“, lautete die nächste Hiobsbotschaft des Tages.
Tscharly schüttelte den Kopf. Was habe ich getan?, wollte er fragen. Einem Alt-Kanzler das Genick gebrochen?
„Ich wüsste nicht, was ich verbrochen habe“, entgegnete er. „Finden Sie lieber meine Frau, finden Sie meinen Sohn, die beiden sind entführt worden, dann können Sie mich meinetwegen einsperren!“
Der Anführer redete zu ihm durch ein Megafon, das seine Stimme metallisch verzerrte. Deutsch-Rap hatte sich auch schon mal besser angehört.
Tscharlys linker Mundwinkel zog sich kinnwärts; der Ansatz eines zynischen Grinsens, das seiner inneren Ohnmacht entsprang. „Wo ist hier die verstecke Kamera? So schnell seid ihr Scheißbullen doch sonst nicht zur Stelle, wenn man euch braucht.“
„Ihr berühmter Schwarzer Humor wird Ihnen schon noch vergehen, Herr Huber“, sprach der Beamte. „So wie ihre verleumderischen Kommentare über rechte Strömungen innerhalb der Exekutive ab heute der Vergangenheit angehören werden.“
Sanitäter eilten an ihnen vorbei in die Redaktion. Farben, Gerüche und Geräusche des Todes traten durch den Schock gefiltert in Tscharlys Gedächtnis; seine Wahrnehmung diente allein dem Überleben. Sein Verstand hatte sich nur noch nicht entschieden, ob er sich lieber totstellen, davonlaufen oder kämpfen sollte.
„Herr Huber, geben Sie uns jetzt sofort die MP!“, forderte der uniformierte Beamte ihn auf.
Bevor Tscharly Kanzler Konrad Adenauers Waffe aus der Hand gab, würde er sich eher selbst damit erschießen.
„Vorher sorgen Sie für die Sicherheit aller Mitarbeiter im ersten und im zweiten Stock meiner Zeitung“, erwiderte er.
Der Beamte schritt auf ihn zu. Ließ sich vom Lauf seiner MP nicht beeindrucken. „Sie werden doch nicht ernsthaft auf einen bayerischen Beamten schießen, Herr Brunner. Ich warne Sie, Herr Huber, das, was Sie jetzt machen, ist Widerstand gegen die Staatsgewalt. Sie stehen unter Schock und Sie wollen doch bestimmt nicht einen bayerischen Beamten ernsthaft …“
Der Beamte blieb stehen und nahm sein Megafon runter. Auge in Auge sahen sie einander an.
Tscharly wusste selbst nicht, ob er dazu in der Lage sein würde, jemanden aus dieser Nähe zu erschießen.
„Wenn du das zu mir sagst, lächle“, zitierte er den Westerncowboy-Schauspieler Gary Cooper – vielleicht wirkte derlei Irritation. Er fuhr fort: „Ich will wissen, wer hier was gegen mich in der Hand hat. So ein Haftbefehl kommt ja nicht einfach so aus Washington, Greenhorn.“ Der Versuch, sein Gegenüber mit einer völlig unsinnigen Antwort zu irritieren, schlug fehl. Der uniformierte Polizist beharrte stur auf seiner Position. „Folgen Sie uns auf die Polizeistation und Sie werden alles erfahren, Mister Tscharly Huber. Sie sollten wissen, dass alles, was Sie von jetzt an sagen und tun vor Gericht gegen Sie …“
Tscharly entsicherte die Waffe. „Sie und Ihre Bullentruppe haben es nicht einmal geschafft, das hier zu verhindern, Sheriff. Wie oft hat es in den letzten zehn Jahren Drohungen gegen sämtliche Redaktionen in diesem Land gegeben. Speziell gegen die Münchner Neuesten Nachrichten! Ihr exekutiven Scheißer habt nicht eine davon jemals ernst genommen. Ihr seid schuld …“
Der Beamte grinste wie ein Dutzend Saunabesucher bei einem Aufguss mit Pferdepisse. „Es heißt Rechtsstaat und nicht Linksstaat, du Arschloch von einem linken Systemjournalisten. Früher hat man sowas wie das hier Reichskristallnacht genannt. Und wie es in den Wald hinein schallt, so schallt es eben auch zurück …“
Tscharly feuerte. An die Decke. Verputz löste sich. Steine. Der Beamte und ein Dutzend seiner Kollegen sprangen zur Seite. Tscharly drehte sich um neunzig Grad. Den Eingang zur Redaktion im Visier machte er einen Satz über die Leiche einer Praktikantin. Patricia Rauch vom Feuilleton, Literaturwissenschaftlerin, fanatisches Hermann-Hesse-Groupie. Patricia war im sechsten Monat schwanger. Gewesen. Die Neonazis hatten ihr das Kind buchstäblich aus ihrem Unterleib herausgeschossen. Schüsse folgten. Als Tscharly den Eingang erreichte, sah er die Leiche der jungen Frau noch immer vor seinem geistigen Auge.
Auf dem Parkplatz drängte sich Polizeiauto an Polizeiauto. Ein Aufgebot aus Dutzenden Leuten von Exekutive, Notfallsanitätern und Ärzten.
Tatsächlich bewachten zwei Beamte bereits Tscharlys neuen roten Alfa Romeo Giulia. Eine Flucht mit dem Alfa konnte er definitiv abschreiben. Tscharly rannte auf einen Rettungswagen zu und schrie: „Gehen Sie aus dem Weg!“
Eine Gruppe von Notfallsanitätern in ihren roten Leuchtjacken machte ihm verstört Platz.
„Geben Sie mir den Schlüssel für dieses Fahrzeug! Na los.“
Der Fahrer eines der Rettungsfahrzeuge sah ihn entgeistert an. Erstarrt. Wie in Beton gegossen.
Tscharly schrie: „S – O – S!“
Fahrig streckte der Fahrer ihm den Schlüssel entgegen.
„Save our souls“, übersetzte er kaum hörbar den internationalen Code, las Tscharly an den Lippen des Mannes ab.
Tscharly startete den Motor und ließ die Kupplung ruckartig kommen. Die Drehzahlen im ersten Gang und im roten Bereich steuerte er direkt auf die Gruppe der Polizeibeamten zu. Tscharly rammte seitlich einen Polizeibus, der die Ausfahrt verstellte, und zog und schaltete vom ersten in den dritten Gang. Die Beamten sprangen zur Seite. Tscharly lenkte auf die die Fahrbahn. Er fuhr über die Friedrich-Eckart-Straße. Polizeisirenen kreischten. Fahrzeuge bildeten im Morgenverkehr eine Rettungsgasse; Tscharly steuerte den Rettungswagen pfeilgerade hindurch. Er schaltete Sirene und Blaulicht ein. Drückte das Gaspedal durch. Bremste. Rammte drei geparkte Pkw vor den Reihenhäusern. Blieb am Straßenrand stehen. Er sprang aus dem Wagen. Die Maschinenpistole umklammert, drehte er blitzschnell den Haustürschlüssel und setzte mit einem Sprung in den Flur über, den er eine Stunde zuvor gemeinsam mit Kira friedlich verlassen hatte. Der Aufbruch in einen neuen Arbeitstag, den sie gemeinsam hatten begehen wollen.
„Konstantin?“, rief er. „Konsti?“
Ein Wimmern ließ ihn zusammenzucken. Tscharly machte eine Drehung und stand vor einem Mädchen, zusammengekauert hinter der Wohnzimmertür, Zuflucht suchend und zitternd wie Espenlaub.
„Ariella“, entfuhr es ihm fast lautlos.
Das Au-pair-Mädchen aus Mailand murmelte etwas in seiner Muttersprache, das an ein Gebet erinnerte. Ein „Mama“ beendete ihre Worte wie ein Flehen an den lieben Gott. Italiener waren besonders gläubige Menschen. Dann liefen Tränen über die olivbraune Haut ihrer fast kindlichen Wangen. Das schwarze Haar war schweißnass und klebte auf der Kopfhaut. Wie lange kauerte sie wohl schon in dieser Position versteckt hinter der Tür …?
„Tscharly, i soldati lo hanno preso … Konstantin, er …“
„Schon gut.“ Er nahm sie in die Arme. „Wie haben die Soldaten denn ausgesehen?“
„Ich … ich weiß nicht. Schwarz. Vermummt.“
Sein Blick streifte das Familienfoto, das auf einem Wohnzimmerschrank stand. Neben einem wahren Hünen eines Kaktusses, der einen guten halben Meter groß war, befand sich der Bilderrahmen mit der Fotografie. Er blickte sich im Wohnzimmer um. Von seinem Sohn keine Spur.
„Ich bin zu spät gekommen“, sprach Tscharly.
„Sie waren hier, gleich nachdem du und Kira gegangen …“, schluchzte Ariella und hielt sich an ihm fest.
Er starrte zu der Kaktuspflanze, die ihm auf einmal wie ein Symbol erschien. Symbol und Fluch. Im entferntesten Sinn hat es mit dem Mann zu tun, der mir diesen israelischen Kaktus vererbt hat, war er verursacht, sich vor der jungen Frau zu rechtfertigen. Meinem alten Chef und Ex-Schwiegervater. Mit diesem Kaktus und Recherchen in der rechten Szene hat das Dilemma einst angefangen. Und seither … seine Gedanken stockten … holt es mich alle paar Jahre ein …
Er starrte zu seinem Sohn, der auf dem Foto vier gewesen war. Und zu Kira, die Konsti im Arm hielt und sich an ihn schmiegte. Was für eine glückliche Familie. Er hatte mit Kira eine neue Familie gegründet, um zu vergessen. Vor allem, um das eine Kind zu vergessen, seine Tochter Milla, die er bei einer Explosion verloren hatte. Was immer diese Leute, die Konstantin entführt hatten, Milla angetan hatten … Jetzt erst bemerkte er, dass Ariella noch immer ihr Nachthemd trug. Die Fingernägel hatte sie in einer anderen Farbe lackiert als die Zehennägel. Bunte Perlenketten an ihren Hand- und Fußgelenken verstärkten den Eindruck, es hier mit einem halben Kind zu tun zu haben … Die Haustür zerbarst mit einem lauten Knall und fiel aus ihren Angeln. Er starrte durch die Glasfront im Wohnzimmer mit Blick auf den Garten mit Schaukel, Rutsche und Sandkasten. Was für ein herrliches Idyll. Ein halbes Dutzend Scharfschützen räumte Hollywoodschaukel und Sitzgarnitur mit Esstisch zur Seite.
Sie kamen von vorne und von hinten …
„Komm!“ Er packte Ariella bei der Hand und rannte mit ihr die Treppen ins obere Stockwerk. Er zog sie vorbei an der Schlafzimmertür. Vorbei am Zimmer für das Au-pair, wo Kira liebevoll ein Herz mit der Aufschrift „caldo benvenuto“ angebracht hatte: Herzlich willkommen. Ariella stolperte hinter Tscharly in Konstantins Kinderzimmer, wo eine Banderole mit einem Tiger und einem Bären die knallgelben Wände flankierte. Neben der Tür hatte der Junge sein ferngesteuertes Feuerwehrauto und einen elektrischen Baukran geparkt. Legosteine, das Lieblingsspielzeug seines Sohnes, lagen überall verstreut. Sogar im Bett.
Tscharly stieß das Dachfenster auf.
„Sind wir Mafia …“, murmelte die Italienerin.
Er platzierte Konstantins Schreibtischsessel unter das Fenster. „Erklär ich dir … später …“ Er half ihr auf den Sessel und anschließend per Räuberleiter auf das schräge Dach. Wie ein alternder Trapezkünstler mit einem Hüftschaden kletterte er hinter der jungen Frau her und wunderte sich selbst über die Energie, die plötzlich durch seinen Körper jagte. Ariella ergriff seine Hand. Er drückte das Fenster nach unten zu, um ihnen den Weg abzuschneiden. Anschließend balancierten sie neben dem Rauchfang in Richtung des benachbarten Reihenhauses, die Mauer an Mauer standen.
Sekunden später erreichten sie die Dachrinne, die zwischen den beiden Schrägdächern verlief. Er hangelte sich weiter an den Rand des anderen Daches. Ariellas Hand drohte in der seinen zu Brei zerquetscht zu werden. Er erreichte als Erster den Dachvorsprung und spähte in einen Garten mit Pool.
„Madonna …“, wimmerte Ariella. Sie brabbelte irgendwas in Italienisch in ihren unsichtbaren Bart. Italienisch, das ist keine Sprache, das klingt wie Musik, lautete sein letzter Gedanke, bevor sie gleichzeitig mit Anlauf einen Satz nach vorne machten. Schusssalven ertönten im Stakkato. Die Geschosse flogen über ihre Köpfe hinweg und schlugen teilweise in das schmutzige Wasser ein, in dem Laub und Gräser an der Oberfläche trieben. Höchste Zeit, den Pool endlich zu leeren, bevor der erste Frost kam. Wie nachlässig diese Nachbarn doch waren! Ariellas Hand entglitt ihm. Sie tauchte voran an die Oberfläche empor.
Er tauchte neben ihr ebenfalls auf und rannte hinter ihr her, um ihren Körper mit seinem zu decken. Den Mitspieler decken, so wie er das als junger Mann beim Basketball gelernt hatte.
Sie liefen, pitschepatschenass, über den Pflasterweg zwischen den Gärten entlang. Wachhunde kläfften hinter Hecken. Alarmanlagen heulten. Ein Igel rollte sich vor ihnen auf dem Weg zusammen. Lebensmüde Wespen schwebten mit ihren letzten Kräften dem sicheren Herbsttod entgegen.
„Da …“
Tscharly entdeckte als Erster den Lieferwagen mit der offenen Tür.
Ein Hüne in lederner Biker-Kluft sprang aus dem Fahrzeug und schoss mit einer Maschinenpistole, wodurch Tscharlys Hoffnungsschimmer augenblicklich erstarb wie eine Eintagsfliege bei Sonnenfinsternis. Der Hüne packte Ariella an den Haaren und schoss gleichzeitig mit der Waffe in der anderen Hand auf die entgegenkommenden Schützen.
Tscharly erkannte den Hünen an seiner monströsen Körperform …
„Siegfried …“
Dem Hünen fehlte die rechte Ohrmuschel. Stattdessen ragte eine Antenne aus dem Gehörgang. Kein Zweifel. Das war er …
„Siegfried!“, schrie Tscharly. „Lass sie los! Mein Gott …“
Das nasse Nachthemd hing wie das Überbleibsel eines misslungenen Wet-T-Shirts-Contests an Ariellas Körper. Sie blutete aus der Nase und über der rechten Schulter, wodurch das Weiß des Kleidungsstücks empfindliche Flecken abbekommen hatte, soweit Tscharly das erkennen konnte.
Drei ihrer Verfolger starben im Kugelhagel.
Tscharly versuchte Siegfried Ariella zu entreißen. Er versetzte ihm einen Schlag mit der Handkante in die Achselhöhle. Siegfried zeigte keinerlei Anzeichen von Schmerz an seinen massigen Armen, die von ihrem Muskelausmaß eher Oberschenkeln ähnelten. Tscharly schlug zu und traf Weichstellen. Trotzdem kam dem Hünen kein Schmerzlaut über die Lippen. Erst als die Anzahl der Polizisten überhandnahm, ließ er Ariella endlich los. Tscharly wurde erneut schwarz vor Augen. Der Gedanke an seinen Sohn und seine Frau verlieh ihm die Kraft, sich zu wehren. Er versuchte, Siegfrieds Ellbogen über seinen Kopf zu streifen, was jedoch aufgrund der Kraft seines Bezwingers misslang. Allerdings verschaffte er sich immer wieder Luft zum Atmen und gewann dadurch ein klein wenig Zeit. Er musste nur hoffen, dass er lange genug durchhielt, bis jemand zufällig mit einer Pistole vorbeikam, um den Muskelprotz, der aufgrund einer genetischen Mutation von Geburt an keinerlei Schmerz kannte, zu töten … Mehr, Herrgott, brauche ich gar nicht, als ein solches Wunder …
Er konnte sich vorstellen, was der junge Mann von ihm wollte.
„Siegfried, deine Mutter … Milla – sie ist tot“, krächzte er mit letzter Luft. „Niemand kann sie wieder lebendig machen …“
Ein Lachen folgte als Antwort. Lag darin Widerspruch, Spott oder Zustimmung? Zynismus …?
„Meine Tochter … deine Mutter … sie kann dir nichts mehr tun. Milla ist gestorben bei der Explosion damals …“
Tscharly verbiss sich in den straffen Bizeps. Keine Schmerzreaktion, wie zu erwarten gewesen war. Tscharly schluckte Blut und Hautfetzen – Fleisch. Hustete und spürte die Kraft in seinen Knien nach und nach schwinden. Die Rotoren eines Hubschraubers, der über die Kleingärten herangeschwebt kam, rissen Äste, Zweige und Blätter von Bäumen und Hecken. Ein ganzes Trampolin wirbelte durch die Luft. Sand. Siegfried glotzte in den Himmel und ließ prompt von Tscharly ab. Tscharly landete auf dem Boden und krabbelte auf allen Vieren.
Es schien, als habe Siegfried einen Befehl bekommen; vielleicht über die Antenne über dem rechten Gehörgang. Eine chromblitzende Antenne.
Tscharly raffte sich auf. Rannte um den weißen Lieferwagen herum und setzte sich hinter das Lenkrad. Der künstliche Orkan hatte das Dach des Lieferwagens eingedrückt wie nach einem Steinschlag. Wie durch ein Wunder hatte die Frontscheibe nur einen gewaltigen Sprung von einem Ende bis zu ihrem anderen abbekommen. Der Schlüssel steckte. Tscharly startete den Motor und raste über den Fußgängerweg davon.
Nach fünfzig Metern legte er eine Vollbremsung hin.
Ariella blockierte die Fahrbahn.
„Was willst du?“, schrie er durch das offene Seitenfenster.
Ehe er sich versah, stand sie auf der Beifahrerseite und klopfte gegen die Tür.
Per Knopfdruck öffnete er das Seitenfenster.
„Wollen Sie mich hier tatsächlich einfach so stehen lassen?“, fauchte sie. „Sie haben meinen Eltern mit Ihrer Unterschrift versichert, dass Sie und Ihre Frau auf mich aufpassen werden, solange ich hier in München bin … Diese Kerle … Mafia … sie laufen überall hier herum …“
„Nimm den nächsten Zug zurück nach Mailand und richte deinen Eltern aus, es tut mir leid …“, wollte er ihr vorschlagen.
Ehe er zu einer Antwort ansetzen konnte, hatte sie bereits die Tür aufgerissen und warf sich in ihrem klatschnassen Nachthemd auf den Beifahrersitz neben ihn.
„Basta!“ Sie funkelte ihn mit ihren dunklen Augen wütend an.
Er gab Gas. Lenkte den Lieferwagen wie in einem Labyrinth links, rechts und steuerte in Richtung eines Ausgangs. Die plötzliche Stille, die eingesetzt hatte, fühlte sich noch beängstigender an als zuvor die Schusssalven.
Ein Smartphone klingelte. Musik von Rihanna.
„Was ist das jetzt?“, fluchte er.
Sie spreizte die Finger der anderen Hand.
„Soll das heißen …“ Er erkannte ihr Gerät. „… dass du das die ganze Zeit …“
„Niemals ohne mein iPhone“, sagte sie.
„Generation Z“, murmelte er.
Mit einem schadenfrohen Grinsen auf den Lippen sprach sie: „Unbekannte Nummer.“
Sie stellte das Gerät auf laut. Er hörte eine ihm wohlbekannte Stimme: „Hallo, Tscharly, gratuliere zur missglückten Flucht.“
Er hätte vor Schreck beinahe eine Kiste mit Streusand gerammt.
„Wagner, du Scheißkerl!“, lauteten seine ersten Worte.
Der Anrufer blieb scheinbar gelassen. „Ein wenig mehr Dankbarkeit hätte ich mir schon gewünscht. Immerhin – wenn ich nicht gerade meine Leute im Helikopter zu dir geschickt hätte, dann hätte dein missratener Enkel dir ohne weiteres den Garaus gemacht. Glaub mir, ich kenne meinen Adoptivsohn gut genug.“
„Du selbst hast mir Siegfried auf den Hals gehetzt.“
„Nein, Tscharly, der Junge weiß schon selbst, was er tut, wenn er für unsere Nationale Sache arbeitet. Er ist ein Patriot durch und durch. Seine Mutter hat ihm die Vaterlandsliebe mit der künstlichen Babymilch eingebläut.“
„Ich frage mich: Was will ein gefeuerter Ex-Verfassungsschutz-Agent von mir?“
Sein Gegenüber ließ sich nicht provozieren.
„Ich will nichts weiter als Milla zurück.“
„Meine Tochter ist tot.“
„Nein, Tscharly, darauf falle ich nicht herein. Du gibst mir Milla zurück und im Gegenzug siehst du deinen Sohn und deine Frau lebendig wieder.“
„Was will die Polizei von mir?“
„Sie suchen dich wegen Mordes an deinem Au-pair. Du hast die kleine süße Ariella Bianchi vergewaltigt und dann erstochen. Das berichten die Medien über dich. Das ganze Land sucht zur Stunde nach dir.“
Ariellas Augen füllten sich mit Fragezeichen. Er bedeutete ihr zu schweigen.
„Wie soll das gehen? Ich weiß gar nicht, wo Ariella jetzt ist …“
Ariella protestierte in ihrer Muttersprache.
„Ach, scheiße“, entgegnete Wagner, „das heißt dann wohl, meine Leute haben in der Eile die kleine Itakerin übersehen. Ach, man kann sich aber auch auf niemanden verlassen heutzutage. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und früher oder später wird die Kleine genauso mausetot sein, wie es sich für eine kleine Italo-Fotze gehört. Die Itaker haben uns hängen lassen im Krieg gegen den Bolschewismus.“
Tscharly spürte Wut in sich aufsteigen. „Na, warte, Wagner, wenn ich dich kriege, dann hänge ich dich persönlich an den Beinen auf, Hals über Kopf – wie den Duce …“
Wagner seufzte. „Besorg mir lieber Milla, Tscharly, und ich werde mir die Sache vielleicht noch anders überlegen.“
„Was hast du verdammt nochmal an dem Begriff ‚tot‘ nicht verstanden, du Möchtegernführer?“
„Tot ist ein Mensch erst, wenn es auch eine Leiche gibt. Wer tot ist, bestimme ich …“
„Die Explosion in Kärnten auf dem Berg …“
„Du hast die Scheiß-Explosion überlebt, ich habe überlebt und Siegfried … fast alle haben überlebt. Nur Milla soll die Löffel abgegeben haben? Nein, mein Lieber, die Verräterin hätte uns fast alle in die Luft gesprengt und hat sich dann still und heimlich aus dem Staub gemacht. Und Siegfried kennt ihr Geheimnis, da bin ich mir ziemlich sicher. Er weiß auch, wo sie zu finden ist. Aber er will es mir einfach nicht verraten. In seinem kindlichen Trotzverhalten. Siegfried hat mehr Muskeln als Verstand.“
„Wo soll ich denn nach meiner toten Tochter suchen, deiner Meinung nach?“
„Ich an deiner Stelle würde ganz einfach Siegfried folgen.“
„Aber …“
„Nichts aber!“
Tscharly spürte einen Frosch in seinem Hals.
Ende des Telefonats. Wagner hatte augenblicklich aufgelegt, ohne weiteren Widerspruch zu dulden.
„Und jetzt viel Spaß mit der Polizei“, hörte Tscharly seine eigene Stimme beim Anblick der Straßensperre, die in dreißig Metern Sichtweite vor ihnen auftauchte.
„Runter!“, rief er Ariella zu.
„Aber …“
Das jeweils halbe Dutzend Beamter links und rechts der Sperre feuerte scharf. Tscharly ging ebenfalls hinter dem Lenkrad in Deckung. Die Stoßdämpfer verbogen sich beim Zusammenprall mit der Sperre. Der Lieferwagen gewann den Materialtest gegen die Alustange, die nachgab und in völlig verformtem Zustand durch die Luft wirbelte. Tscharly hob den Kopf und erkannte endlich die Hauptstraße vor sich. Er blinkte rechts und tauchte mit Schwung in den fließenden Verkehr ein.
„Mamma, ti prego, portami fuori di qui. Questi tedeschi sono pazzi …“
Tscharly traute seinen Ohren nicht. „Bist du verrückt? Habe ich dir nicht gesagt, du sollst sofort dein Handy ausschalten?“
Sie legte eine Hand auf das Mikrofon. „Nein, das hast du nicht, Tscharly“, sprach sie ihn auf einmal mit Du an.
Er ignorierte die kleine Respektlosigkeit; das Sie hatte ihm ohnehin noch nie besonders behagt.
„Dann sage ich es dir eben jetzt“, herrschte er sie an und spürte das Problem, noch bevor er es hörte. „Scheiße, sie haben den Hinterreifen erwischt. – Los, schalt sofort dein Handy aus und nimm die SIM-Karte und den Akku raus …“ Das Geräusch der bloßen Felge auf dem Teer hörte sich wie eine Rüttelplatte mit Kolbenfresser an und erstickte jedes weitere Wort in seinem Mund.
Ariella redete weiter in ihr Gerät. Anscheinend mit ihrer Mama.
„Was hast du an Ausschalten nicht verstanden?“
„Das ist kein Handy. Du hast gesagt, ich soll das Handy ausschalten, aber das ist ein iPho …“
Er riss ihr das verdammte Gerät aus der Hand, versuchte gleichzeitig die Spur zu halten und verlor schließlich doch gegen die Scherkräfte. Fahrwerk und Reifenstellung fühlten sich an wie in einer Seifenkiste. Der Lieferwagen schlitterte schräg in die Gegenfahrbahn. Tscharly riss das Lenkrad herum, wodurch das Fahrzeug auch noch ins Schwanken geriet. Pkw und Lkw wichen aus. Hupen. Kollisionsgeräusche. Blech gegen Blech. Glasscherben zersplitterten. Tscharly gelang die Vollbremsung. Auge in Auge mit einem Lastkraftwagen mobilisierte er seine letzten Energien und sprang aus dem Fahrzeug. Ariella kam neben ihm zum Liegen. Er hielt ihre Hand fest. Sie retteten sich zum Bürgersteig und suchten keine Sekunde zu spät Deckung hinter einer Gruppe von Altglas-Containern. Der Lastwagen rammte den Lieferwagen frontal und schlitterte über die Fahrbahn wie über Schmierseife.
Eine gewaltige Stichflamme ging einer Explosion voraus. Ohrenbetäubender Lärm. Sie liefen querfeldein über eine Wiese, ohne auch nur einmal über die Schulter zu schauen. Rannten unter einer S-Bahnbrücke hindurch.
Ariella blieb stehen und schnaufte wie ein Ross bei der Waldarbeit.
„Ich brauch was zum Anziehen. Ich bin nackt unter meinem Nachthemd. Ich kann nicht mehr. Außerdem habe ich kalte Füße.“
Sie bibberte.
Er drehte sich um, konnte es immer noch nicht glauben, wie knapp sie soeben dem Tod entsprungen waren. Seine Realität glich der aus einem Action-Film.
„Wir haben es gleich geschafft“, versuchte er sich selbst und ihr Mut zuzusprechen. Sie erreichten das Gleis mit der S-Bahn nach fünf Minuten mäßigem Laufen. Für gewöhnlich brauchte er für diese Strecke eine Viertelstunde, wenn er mit Kira und Konsti in die Stadt zu einem Einkaufsbummel fuhr. Konsti liebte diese Ausflüge, weil sie seinetwegen bei McDonalds einkehrten und er sich danach noch Spielzeug kaufen durfte.
Die Lautsprecherstimme kündigte die Abfahrt des nächsten Zuges an. Die Wartenden trugen an diesem Morgen jede Menge Trachtengewänder. Soweit er schaute, erblickte er Gamsbärte, Hüte, Lederhosen und Dirndlgewänder mit Schürzen in allen möglichen Farben. Und überall die weiß-blauen Rautenmuster. Menschen unterhielten sich in sämtlichen Sprachen der Welt, nur kein einziges Wort Bayerisch. Der Dialekt schien in Vergessenheit geraten zu sein.
Eine junge Frau mit einem Reisekoffer zog Tscharlys Aufmerksamkeit auf sich. Die Figur der Asiaten und Ariellas Erscheinung besaßen Ähnlichkeit. Vielleicht … Bevor er den Gedanken zu Ende führen konnte, riss er der Besitzerin das Gepäckstück aus der Hand.
„Entschuldigen Sie … Es tut mir leid, aber es geht leider nicht anders …“
In breitem Bayerisch schrie die vermeintliche asiatische Touristin: „Hoit, du Depp! Steh bleibm!“
Tscharly befand sich bereits im Zug. Ariella an der einen Hand, den Koffer in der anderen. Die offenbar bayerische Asiatin hämmerte wie wild gegen das Seitenfenster und schimpfte.
Die S-Bahn fuhr los.
Der Koffer ließ sich mit einem Klack öffnen. „Hier, such dir was Schönes aus“, sagte er zu Ariella.
Passanten zückten ihre Smartphones, um die Szene zu filmen. Ein Andenken an den Urlaub auf der Münchner Oktoberfest-Wiesn. Zwei Stationen später stiegen sie aus. Ariella war in eine Jeans, Bluse und Turnschuhe geschlüpft. Sie wieselten durch die Menschenmenge. Überall Trachten, Trachten und nochmals Trachten. Jede Menge Italienisch wurde gesprochen. Heute war zwar erst Freitag, aber sogar die Durchsagen der Schaffner erfolgten bereits auf Italienisch.
Ariella klagte: „Die Schuhe drücken an meinen großen Zehen. Wo bringst du mich hin, Tscharly?“
„In Sicherheit“, antwortete er. „Bevor sie … bevor sie dich …“
„Wer sind sie?“
Sie blieb stehen.
Er zerrte an ihrem Arm. Sie entzog ihm ihre Hand.
„Hör gefälligst auf, mich wie ein kleines Kind zu behandeln, Tscharly Huber! Ich habe ein Recht darauf zu erfahren, warum mein Leben in Gefahr ist. Du hast mich schließlich in diese Situation gebracht“, sprach sie in beinahe akzentfreiem Deutsch. „Und wer ist dieser Wagner? Und was wollte dieser Siegfried von uns? Und was ist mit deiner Tochter, dieser … dieser Milla? Ich rühre mich keinen Zentimeter vom Fleck, bevor ich nicht erfahren habe, in was ich da hineingeraten bin. Hast du Ärger mit der Mafia … oder …“
„Ich habe keine Zeit, dir die Geschichte zu erzählen. Wir sind auf der Flucht, wenn du das noch immer nicht kapiert haben solltest.“