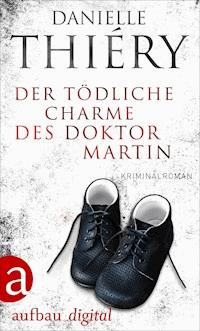Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kommissarin Edwige Marion
- Sprache: Deutsch
Edwige Marion, Leiterin der Pariser Mordkommission, hat einen rätselhaften Fall vor sich. Eine Frau wurde auf bestialische Weise ermordet. Offenbar kannte sie ihren Mörder und hatte Liebe erwartet, wo sie den Tod bekam. Der Körper des Opfers ist übersät mit verworrenen Zeichen und Mustern. Ein Code? Schnell wird den Ermittlern klar, dass es sich hier um einen Serienmörder handelt, dem es Lust bereitet, seine Opfer zu quälen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, der in Marions eigenes, privates Umfeld zu führen scheint …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Über Danielle Thiéry
Danielle Thiéry, geboren 1947, zwei Kinder, war Kriminalkommissarin in Paris und in den siebziger Jahren die erste Frau an der Spitze eines französischen Kommissariats. 1991 findet sie endlich die Zeit zu schreiben. Seitdem hat sie eine Fernsehserie entwickelt, an mehreren Fernsehproduktionen mitgearbeitet, einen autobiographischen Roman (Prix Bourgogne 1997) und zahlreiche Krimis (Prix Polar 1998) geschrieben.
Informationen zum Buch
Edwige Marion, Leiterin der Pariser Mordkommission, hat einen rätselhaften Fall vor sich: Eine Frau wurde auf bestialische Weise ermordet. Offenbar kannte sie ihren Mörder und hatte Liebe erwartet, wo sie den Tod bekam. Der Körper des Opfers ist übersät mit verworrenen Zeichen und Mustern. Ein Code? Schnell wird den Ermittlern klar, dass es sich hier um einen Serienmörder handelt, dem es Lust bereitet, seine Opfer zu quälen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, der in Marions eigenes, privates Umfeld zu führen scheint …
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Danielle Thiery
Was die Nacht verbirgt
Roman
Aus dem Französischen von Matthias Bernhard
Inhaltsübersicht
Über Danielle Thiéry
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Kapitel XVIII
Kapitel XIX
Kapitel XX
Kapitel XXI
Kapitel XXII
Kapitel XXIII
Kapitel XXIV
Kapitel XXV
Kapitel XXVI
Kapitel XXVII
Kapitel XXVIII
Kapitel XXIX
Kapitel XXX
Kapitel XXXI
Anmerkungen
Impressum
Für Michel und Yves, meine treuen Freunde
I
Mit einem ekstatischen Seufzer ließ sich die nackte Frau auf den Rücken sinken. Instinktiv bedeckte sie mit den Händen ihren Bauch, um die vertikale Narbe des Kaiserschnitts zu verbergen, die ihr ein Arzt vor zwanzig Jahren beigebracht hatte. Mit den Jahren war ihr Bauch runder geworden, und die Umrisse der Narbe erschienen dadurch aufgebläht. Der Mann beugte sich über sie. Mit unendlicher Sanftheit schob er trotz ihres Widerstands die aneinanderliegenden Hände beiseite. Widerstrebend ließ sie ihn gewähren. Aus intimen Gründen genierte sie dieses Mal, das bisher noch nie ihr Dasein beeinträchtigt hatte. Erst recht unter dem Blick des Mannes, den die Narbe merkwürdig zu faszinieren schien. Glücklicherweise fanden ihre ersten Liebesspiele nicht in vollem Licht statt. Die von einem leichten Frühlingswind bewegten Vorhänge aus feinem Tüll ließen die Beleuchtung der Promenade, die am Fluss entlangführte, kaum durchscheinen.
Der Mann, dessen Augen sich an das Halbdunkel gewöhnt hatten, lehnte sich, auf dem Bett kniend, zurück, um den Körper der Frau zu betrachten. Blitzschnell registrierte sein Blick die aufgeschwemmten Formen, die hier und da welke Haut, die zu schlaffen Brüste. »Du bist hübsch«, murmelte er mit kehliger Stimme.
Entzückt trotz des Tones, der ihr verlogen vorkam, begann sie, sein blaues Hemd aufzuknöpfen, und streichelte in diesem Ausschnitt eine unglaublich weiche Haut. Diese Berührung ließ sie erschauern. Eine Kinderhaut! Der Mann hatte die Haut eines Neugeborenen, ohne Haare, weder auf den Armen noch im Gesicht. Seine Wangen waren vollkommen glatt, und er hatte keine Augenbrauen, dafür waren seine Wimpern so lang wie bei einem Mädchen. Sie war sich fast sicher, dass seine kurzen, gewellten Haare ein Toupet waren, unter dem er eine Glatze verbarg. Doch dies Thema anzuschneiden hätte sie überfordert. Wie wichtig war das schon?
Dennoch fragte sie sich, wie sein übriger Körper beschaffen war. Sie nahm dann den Gürtel seiner Hose in Angriff, ein kompliziertes System, das sie nicht kannte, sie brach sich einen Fingernagel ab und zwickte ihren Partner, der zusammenzuckte. Seit vier Jahren kannte sie diese Situation nicht mehr …! Vier Jahre lang hatte sie keinen nackten Mann gesehen …
Und er half ihr kaum. Er hatte sie langsam entkleidet, jede seiner Gesten mit Liebkosungen und zärtlichen Worten begleitend. Jetzt schien er zu zögern. Er regte sich nicht, seine Augen blieben auf die Narbe geheftet. Die Frau konnte seinen Blick nicht recht erkennen, den die gesenkten Augenlider beschirmten, aber sein Gesichtsausdruck hatte sich verändert, dessen war sie sich gewiss.
»Du ekelst dich, stimmt’s? Du kannst es mir sagen, du weißt doch …«
Er wich etwas zurück, denn sie hatte laut geredet, und legte seine Hand auf den Mund der Frau.
»Pst!«, sagte er. »Du gefällst mir, und wir haben noch viel Zeit, nicht wahr?«
Ja, sie hatten noch viel Zeit. Sie schloss die Augen, um die Berührung dieser Männerhand zu genießen, die sich von ihren Lippen löste, um über ihren Hals und zwischen ihren ausgebreiteten Brüsten hindurch hinabzugleiten, bis sein Finger sanft auf den Windungen ihrer Narbe verweilte. Voller Ungeduld straffte sie sich. Ihr gefiel alles an diesem Mann: seine draufgängerische Art, sein Gesicht mit der markanten Nase, erhellt von einem intelligenten, sanften Blick, sein wohlgeformter, weicher Mund, seine kräftigen Hände, die zu zögern schienen, bevor sie sie berührten, als wären sie beseelt von der Furcht vor einer zu abrupten Geste, die den Zauber gebrochen hätte. Seine Stimme mit der gedämpften, fast verborgenen Klangfarbe verwirrte sie … Plötzlich unterbrach der Mann seine Liebkosungen, erhob sich und verkündete gespreizt, dass er sich zurechtmachen müsse.
»Natürlich!«, sagte die Frau beflissen, »das Bad ist im Flur, zweite Tür rechts.« Sie hörte, wie er in der Wohnung hin und her ging, Türen schloss, einen Wasserhahn aufdrehte. Um ihre Ungeduld zu dämpfen, ließ sie den Film ihrer Begegnung, ihres ersten gemeinsamen Ausgehens, ihres ersten Kusses noch einmal vor ihrem inneren Auge ablaufen. Ihre Aufregung und seine Empfindsamkeit, seine übertriebene Schüchternheit, die sie hin und wieder ins Grübeln brachte. Er legte eine Gewandtheit an den Tag, die gefühllos zu sein schien. Körperlich hielt er Abstand zu ihr, beschränkte seine Gefühlsäußerungen auf ein Minimum und entzog sich, sobald sie die Hände ausstreckte, um ihn zu berühren. Im Halbdunkel musste sie lächeln. Sie hatte sich unnötige Sorgen gemacht, vor ihnen lag ein ganzes langes Wochenende, um sich zu lieben. Die Gesichter im Büro, wenn sie es ihnen erzählen würde! … Ein schöner Mann, jünger als sie, und verliebt! Sie, die nach fünfundzwanzig Jahren gemeinsamen Lebens von ihrem Mann verlassen worden war! Sie, die Kummer, Demütigung und Jahre der Einsamkeit gekannt hatte. Hier war ihre Genugtuung, ein paar Meter entfernt, sie hieß Ben. Der Wasserhahn lief nicht mehr. Sie warf einen unruhigen Blick auf den Radiowecker: 1 Uhr 20. Da sie wenig daran gewöhnt war, so spät noch wach zu sein, wurde sie müde.
»Was macht er nur?«, murmelte sie.
Die Badezimmertür klappte, im Flur näherten sich die Schritte des Mannes, sie hallten seltsam. Die Frau gruselte sich, als der Lichtstrahl unter der Zimmertür, die langsam halb aufging, verschwand. Sie stützte sich auf einen Ellenbogen, ein zärtliches Lächeln erhellte ihr Gesicht. Sie blinzelte heftig, als die Deckenlampe sie blendete. Als die Blendung vorüber war, machte die Bestürzung sie für einen Moment stumm. Eine Kamera in der Hand, kam der Mann in einer unglaublichen Aufmachung auf das Bett zu. Die Frau schlug sich die Hand vor den Mund. Der Mann blieb stehen, stolperte auf seinen Absätzen von schwindelerregender Höhe und fluchte ganz leise. Die Frau glaubte sich mitten in einem Alptraum zu befinden. Der männliche Mann, der sie verführt hatte, stand direkt vor ihr. Nicht wiederzuerkennen und wortlos baute er an der Bettkante ein Stativ auf, um seine Kamera zu befestigen. Deshalb also die Tasche, die er überallhin mitschleppte! Sogar als sie essen gegangen waren, hatte er es abgelehnt, sich von ihr zu trennen.
Die Frau stieß eine unverständliche Frage hervor und machte sich daran, aufzustehen. Ihr Instinkt und die Panik, vor der sich ihr Magen gemein zusammenkrampfte, geboten ihr zu fliehen – schnell und weit weg. Der Mann ertappte sie bei ihrer Bewegung und durchbohrte sie mit einem Blick, als würde er sie nicht erkennen oder plötzlich ihre Gegenwart entdecken. Wie bezwungen stützte sie sich wieder auf einen Ellenbogen und zog ein Stück Laken heran – lächerlicher Schutz ihrer Nacktheit. Der Mann beugte sich über den Sucher der Kamera, um die Einstellung zu überprüfen. In diesem Moment rutschte das rote Stretchröckchen, mit dem er sich ausstaffiert hatte, hoch und enthüllte einen Stringtanga aus schwarzer Spitze, aus dem sein Geschlecht zum Teil herausgerutscht war. Er schien nicht darauf zu achten, richtete sich auf und verkündete mit lauter, hoher Stimme: »Motor ab!«
Außerstande, der Angst, die ihr die Brust zusammenschnürte und den Magen umdrehte, Widerstand zu leisten, brach die Frau in Gelächter aus. Ein hysterisches Gelächter, das ihr sogleich die Wangen rötete und die Tränen in die Augen trieb.
Der Mann schien zu erstarren. An seinen bis zum Zerreißen gespannten Armen ballten sich die Fäuste. Unter der Schminke nahm sein Gesicht einen wächsernen Farbton an. Der Mund der Frau weitete sich, öffnete sich übermäßig und enthüllte das rosabraune Innere ihres Kehlkopfs, das Zäpfchen, das wie ein kleines obszönes Geschlechtsteil in Erregung geriet, und die Zunge, die grauenhaft anschwoll und sich streckte.
Er schloss die Augen, und ihn überlief ein langer Ekelschauder. Unter seinen geschlossenen Lidern prallten andere Bilder aufeinander: der ekelhafte Mund und das dröhnende Lachen von Schwester Bernadette. Dieses Lachen, das ihn in Schrecken versetzte und beinahe ohnmächtig werden ließ. Ihm wurde schwarz vor Augen, die Bilder in seinem Kopf explodierten und versetzten ihn in die schlimmsten Augenblicke seiner Kindheit zurück. Er fuhr zusammen, hätte beinahe aufgeschrien, öffnete mühsam wieder die Augen. Unter dem schallenden Gelächter wurden die Brüste der Frau hin- und hergeschüttelt, ihre schlaffen Schenkel öffneten sich über einem Geschlechtsteil mit kurzen, roten Haaren. Der Mann glaubte zu ersticken, so wie er einst erstickte, das Gesicht zwischen den monströsen Brüsten von Schwester Bernadette vergraben und von ihrer energischen Hand zwischen die harten Falten ihres schwarzen Kleides und gegen ihren flachen Bauch mit dem strengen Geruch gepresst. Der Geruch der Heiligkeit … oder vielleicht der Schmutzigkeit, für ihn war es dasselbe. Übelkeit drehte ihm den Magen um, er atmete tief durch, um sie zu verdrängen, und hielt die Augen halb geschlossen.
Dieses unerträgliche Gelächter, dem offenbar nichts Einhalt gebieten konnte! Als er die Augen wieder weit öffnete, versuchte die immer noch lachende Frau sich aufzurichten. Sie streckte die Hand aus, um einen Halt zu finden, streifte das Gesicht des Mannes. Ihr abgebrochener Fingernagel blieb in den langen blonden Haaren hängen. Ben konnte es nicht ertragen, dass diese so gewöhnliche Frau ihn berührte. Nicht sie. Seine Faust traf sie mit einer gezielten Bewegung an der Schläfe. Das Lachen hörte auf der Stelle auf, der Kopf der Frau schlug heftig gegen die Wand, ihr Mund halb offen in einem letzten stummen Lachen. Der Mann beruhigte sich in der Stille, die nur das sachte Geräusch des Kameramotors störte.
Ein Auto fuhr die Promenade entlang, wurde langsamer, entfernte sich dann. Das Viertel war vollkommen still. In aller Ruhe zog der Mann seine Handschuhe, eine zweite Haut aus weichem Gummi, über und bereitete seine Instrumente vor. Bevor er anfing, betrachtete er ein letztes Mal sein Opfer, ein genießerisches Lächeln verzog seine so überaus weichen Lippen. Er verweilte bei dem gewundenen Verlauf der Narbe, wandte sich wieder dem Gesicht zu. Aus dem Fältchenmund der Fünfzigjährigen hing die Zunge heraus. Er konnte der in ihm aufsteigenden Lust nicht widerstehen, es Cora zu besorgen. Seiner Cora.
Er ließ sich rittlings auf der reglosen Frau nieder, zog mit seinen dicken Fingern die Lippen auseinander und beugte sich über sie, wie zu einem Abschiedskuss. Mit seinen Zähnen packte er die Zungenspitze. Er zog, damit sie noch weiter hervorkam, sicherte seine Beute, und als er sich seiner selbst sicher fühlte, biss er sie mit einem Mal ab. Die erste Lustwelle packte ihn in dem Augenblick, da er das verstümmelte Organ weit von sich wegspuckte.
Der unerträgliche, unbekannte Schmerz verzerrte Gesicht und Körper der Frau, riss sie unsanft aus ihrer Ohnmacht. Während aus ihrem Mund das Blut sprudelte, schrie sie ununterbrochen, ohne auch nur zu begreifen, was ihr geschah. Ein zweiter Faustschlag warf sie nieder und ließ im Zimmer wieder Stille einkehren. Der Mann seufzte, ließ sein pochendes Herz sich beruhigen und beugte sich abermals über sie.
Später, sehr viel später, von der Anstrengung und der Wollust erschöpft, baute er seine Kamera ab, klappte das Stativ zusammen und inspizierte peinlich genau die Wohnung, um jegliche Spuren seiner Anwesenheit zu beseitigen. Er wusch sich ausgiebig unter der Dusche, desgleichen seine blutbefleckte Kleidung. Die packte er dann, sorgfältig zusammengelegt, in seine große Sporttasche, nachdem er daraus frische Sachen hervorgezogen hatte, die er nun ohne Hast überzog. Er ging hinaus, ohne einen Blick für sein Opfer und ohne einer Menschenseele zu begegnen.
Es war drei Uhr morgens, und das lange Osterwochenende hatte begonnen.
II
»Kripo … Mordkommission, ich höre …«
Inspektor Talon hörte zu, runzelte die Stirn, stellte zwei kurze Fragen, unterbrach den Gesprächsteilnehmer. »Bleiben Sie dran, ich rufe Kommissarin Marion …«
Er legte den Hörer beiseite, drückte auf eine Taste, die es erlaubte, die Gesprächsteilnehmer bei Musik von Rachmaninow warten zu lassen – eine Idee von Kommissarin Marion –, und begab sich zum Büro 312, nachdem er mit den Fingerspitzen seine Frisur in Ordnung gebracht und mit einer mechanischen Geste seine Brille zurechtgerückt hatte.
Im Flur des dritten Stocks des Polizeipräsidiums standen eine Frau und zwei Männer vor dem Kaffeeautomaten. Die junge Frau, eine mittelgroße Blonde, schlank und hübsch, drückte mehrmals ohne Erfolg den Knopf, der den Becher auswerfen sollte.
»Drecksmaschine«, schimpfte sie.
Der jüngere der beiden Männer neben ihr nahm Anlauf und versetzte mit der Genauigkeit eines Fußballspielers dem Automaten einen derben Fußtritt. Daraufhin gab der Automat seinen Geist vollends auf.
»Die Centimes sind gefallen!«, frohlockte der andere Mann, ein Vierziger in vollem Saft mit lichtem Haar.
»Bravo, Lavot!«, sagte die junge Frau zweideutig. »Nun sind wir genauso schlau wie vorher.«
Talon kam dem Widerspruch seines Kollegen zuvor.
»Telefon, Chef! Die Führung …«
Edwige Marion wandte sich zu ihm.
»Ich komme. Und was Sie angeht, Lavot, so schauen Sie, wie Sie zurechtkommen, aber treiben Sie mir Kaffee auf. Das wird Sie lehren, was es heißt, Behördeneigentum zu beschädigen.«
Hauptinspektor Lavot – Typ gutgebauter Leinwandheld und in der Rolle des Bullen mit Erbsenhirn und Bizeps mehr als lebensecht – rief ihr hinterher: »Arabica oder Robusta?«
Kommissarin Edwige Marion, die jeder, einschließlich sie selbst, einfach Marion nannte, betrat ihr Büro. Fünf Minuten später hatte sich ihr Team eingefunden.
»Lavot, Talon, Cabut, auf die Matte! Wir fahren in das Bois-Joli-Viertel am Flussufer. Ein Mord. Das Bezirkskommissariat ist an Ort und Stelle, der Erkennungsdienst ist auf dem Weg, und der Vertreter des Staatsanwaltes fragt sich noch, ob er kommt oder nicht. Was den Gerichtsmediziner angeht, der fragt sich schon nichts mehr, er wartet dort auf uns.«
Sie wandte sich einem ergrauten, etwas gebeugten Mann mit kränklichem Aussehen zu.
»Joual, Sie bleiben hier. Halten Sie ein paar Burschen in Bereitschaft, vielleicht braucht man sie später noch. Wir nehmen den Renault 21 der Bereitschaft, meiner ist in der Werkstatt.«
Joual, der sich gerade erst von seiner Alkoholsucht losgesagt hatte, nickte wortlos.
Lavot saß schon am Steuer des weißen R 21, als Marion auf den Hof des Präsidiums kam, wo die Streifenwagen mit dem Kühler in Richtung Ausfahrt aufgereiht standen. Sie runzelte die Stirn beim Anblick des Blaulichts auf dem Dach, das jetzt schon in Aktion war, eine Manie von Lavot.
»Brauchen wir unbedingt dieses Ding da? Soviel ich weiß, wird unsere ›Kundin‹ nicht die Flucht ergreifen!«
»Man darf nicht aus der Übung kommen, Chef!«, wandte Lavot ein. »Und wenn schon mal eine Frau auf mich wartet …«
»Wie geschmackvoll!«, erwiderte Marion, während sich der Wagen mit heulender Sirene in den Verkehr einreihte.
Um den Lärm zu übertönen, sprach sie lauter.
»Das Opfer heißt Nicole Privat und ist zweiundfünfzig Jahre alt«, erklärte sie. »Die Frau lebte allein in einer Dreizimmerwohnung in der Mimosas-Anlage am Ufer und war nach dem Osterwochenende nicht wieder an ihrem Arbeitsplatz erschienen. Sicher ist sie seit ein paar Tagen tot.«
»Mein Gott, der Gestank! Immer trifft es mich!«, jammerte Cabut, der oft beim Anblick von Leichen und mehr noch bei deren Gestank ohnmächtig wurde.
»Wie ermordet?«, fragte Talon, während Lavot an einer roten Ampel hielt.
»Blankwaffe«, sagte Marion.
Sie wandte sich Lavot zu.
»Na, mein Lieber, mussten wir so viel Lärm machen, um wie der erstbeste Autofahrer bei Rot zu halten!«
Lavot ließ sich das nicht zweimal sagen, stieß einen kurzen Kriegsschrei aus und ließ den R 21 mit quietschenden Reifen anfahren. Ein kühner Fußgänger konnte gerade noch zur Seite springen; ein Überlebensreflex, der Lavot ein entzücktes ›Olé‹ sowie Protestrufe von Marion und Cabut entlockte. Kaum drei Minuten später blieb der Wagen sanft vor der Nr. 45 der Promenade des Lilas stehen, nachdem er zu seiner Rechten zahllose Straßen mit ebenso blumigen Namen hinter sich gelassen hatte.
»Es riecht nach Frühling«, murmelte Cabut, wobei nicht klar war, ob er auf das Viertel anspielte oder auf den Duft eines vorzeitigen Frühlings.
Kommissarin Marion überblickte die Uferpromenade, die mit Bänken und noch kahlen Blumenbeeten geschmückt war. Feuchte Schlammströme zogen sich bis hin zur Fahrbahn, die zwischen dem Kai und den anliegenden Gebäuden verlief, und zeugten vom jüngsten Hochwasser des Flusses. Ein Phänomen, verursacht durch Regengüsse, wie man sie in der Gegend noch nie erlebt hatte. Die Flussschiffahrt, die seit einem Monat eingestellt war, kam langsam wieder in Gang. Ein Frachtkahn, den Bug dicht über den Wellen, betätigte seine heisere Sirene, als er vor der reglosen jungen Frau vorbeifuhr.
Während Talon sich ein paar Notizen machte, schloss Edwige Marion flott zu den anderen Teammitgliedern auf, in deren Mitte Lavot Eindruck zu schinden versuchte, wohingegen Cabut, den Kopf abgewendet, sich auf das Schlimmste gefasst machte. Schutzmänner, Feuerwehrleute und aufgeregte Gaffer bevölkerten den Zugang zum fraglichen Wohnblock und traten zur Seite, um die Kommissarin und ihre männliche Gefolgschaft durchzulassen.
›Meine Prätorianergarde als Nachhut‹, dachte sie belustigt.
Sie sah die Gesichter der Bullen vom Bezirkskommissariat bereits vor sich, wenn ihre Truppe gleich am Tatort aufkreuzen würde. Lavot, der Playboy mit den langen braunen Haaren, zu engen Jeans, abgetragenem Lederblouson und zu dunkler Ray Ban. Cabut, ein eingepacktes Nichts, nachlässig in seine Klamotten gestopft, watschelnder Gang, der Kopf inzwischen vollständig kahl, nachdem er die wenigen graumelierten Haare, die ihm geblieben waren, abrasiert hatte, um aufzufallen. Seine spitzwinkligen Augenbrauen gaben seinem Gesicht einen ständig überraschten Ausdruck. Talon, der Kleinste und Jüngste von ihnen, Jeans – Blouson – Turnschuhe, gab sich wie ein Intellektueller mit seinen zurückgekämmten braunen Haaren und seiner schwarzen Schultasche, die er oft auf dem Rücken trug, wie die Schüler von früher, damit er die Hände frei hatte. Sie, schwarze Jeans, schwarzer Lederblouson, Lederstiefeletten, ohne Handtasche, die Hände in den Jackentaschen, verbarg hinter ihren wirren blonden Strähnen schwarze Augen, die vor Lebendigkeit blitzten.
Die anderen Bullen beobachteten sie aus dem Augenwinkel, auf der Zunge kritische Bemerkungen, überrascht und womöglich neidisch auf den Schwung, mit dem sie sich an diese abstoßende Arbeit machten, und auf die Freude, die sie daran zu haben schienen.
Im zweiten Stock des Hauses, vor der halboffenen Wohnungstür des Opfers, fiel der Gestank, den sie schon auf der Treppe wahrgenommen hatten, über sie her. Marion rümpfte die Nase und wandte sich Cabut zu, der ein Taschentuch unter die seine presste.
»Stecken Sie das weg«, sagte sie, »das nützt nichts! Wenn Sie ein Problem mit dem Gestank haben, dann zünden Sie sich eine Zigarette an und behalten Sie sie im Mund. Das hilft. Aber passen Sie auf die Asche auf, streuen Sie nicht alles auf den Boden.«
Cabut war als Letzter zu ihrer Truppe gestoßen.. Aufgrund seiner Leidenschaft für Kunst und seiner profunden Kenntnisse auf diesem Gebiet war er in Paris sechs Jahre lang in einer Spezialabteilung zur Bekämpfung von Kunstdiebstählen aktiv gewesen – eine Tätigkeit, bei der wohl kaum mit Leichen in Museumsgängen zu rechnen war.
Cabut hatte seine Versetzung zu Marion beantragt, um näher bei seinen Eltern zu wohnen, aber auch, um einer teuflischen Geliebten zu entfliehen, die ihn zur Heirat drängen wollte. In Paris hatte er sich auf den Kompromiss einer wilden Ehe eingelassen.Verglichen mit dieser Erfahrung schien ihm die Hölle ein beneidenswertes Los, weshalb er seine Rettung nur in der Flucht gesehen hatten. Eine Wahl, deretwegen er sich jetzt verfluchte, während er mit zitternder Hand eine Marlboro anzündete.
Bevor sie hineinging, atmete Marion tief durch. Lavot beugte sich zu ihr herab und schnitt eine Grimasse.
»Erinnert Sie das an etwas?«
Sie nickte. Vor einem Jahr hatten sie beide die Leiche einer Prostituierten entdeckt, die man in ihrer Sitzbadewanne erwürgt hatte. Zwei Monate lang hatte sie bereits im Wasser gesessen, wobei sie allmählich zerfiel. Um die Ermittlungen durchführen zu können, hatten sie zur Ausrüstung der Feuerwehrleute greifen müssen. Sauerstoffflaschen und Masken. Der Gestank war so unerträglich gewesen, dass das ganze Gebäude evakuiert werden musste. Selbst die Gegenstände, die man im Wasser gefunden hatte – ihre Fingernägel, einen Goldring und ein goldenes Collier –, konnten nicht in der Dienststelle aufbewahrt werden, da der Gestank durch die versiegelten Plastikbeutel drang.
Talon, dem die Unbequemlichkeit des Moments sichtbar gleichgültig war, notierte alles, was er sah, machte Skizzen, hielt die Daten der Wohnung fest: eine moderne Dreizimmerwohnung, bescheiden möbliert, aber sauber und schmuck.
Marion ging in den Flur, wo zwei Männer leise diskutierten, und schüttelte ihnen die Hand. Der Staatsanwalt, ein junger, geistesabwesend wirkender Mann mit zerzausten Haaren und aschfahler Hautfarbe, hatte sich schließlich doch in Bewegung gesetzt und erörterte den Fall von weitem mit einem Inspektor von der städtischen Sicherheit, den das Eintreffen der Kripo sichtlich befriedigte.
»Nicht gerade schön«, sagte der Inspektor zu Marion, den Mund vor Ekel verzogen.
»So ein Blutbad sehe ich zum ersten Mal … Das ist kein Mord, das ist Raserei. Wollen Sie wirklich reingehen?«
Der Inspektor täuschte Besorgnis vor. Marion zuckte fatalistisch mit den Schultern.
›Ich bin ein Weibsbild‹, dachte sie, ›und müsste eigentlich in Ohnmacht fallen … diesem Idioten würde das Spaß machen.‹
Im Zimmer stank es in der Tat fürchterlich, es war kaum zu ertragen, trotz der weit geöffneten Fenster. Talon lief vorneweg, dem Gerichtsmediziner auf den Fersen, einem kleinen Mann, dem das Wasser herunterlief, während er sich über die Leiche beugte. Die Männer vom Erkennungsdienst, »Techniker des Tatorts«, hatten ihre Utensilien ausgebreitet und arbeiteten, wobei sie abwechselnd ans Fenster gingen, um tief Luft zu holen. Anders als sonst wurde es Kommissarin Marion übel, als sie dies Schauspiel erblickte. Man hatte die Frau mit ausgebreiteten Armen an das Kopfende des Bettes gefesselt, und zwar mit einem in Streifen gerissenen, kunstfertig verknoteten Bettlaken. Ihr Rücken war an das Peddigrohr gedrückt, und ihr Oberkörper war von einer Unmenge aschgrauer, drei bis vier Zentimeter langer Schnitte durchfurcht; sie kreuzten sich und bildeten seltsame Zeichen, die durch den Verwesungsprozess angeschwollen waren. Der Kopf hing vornüber, das Kinn war auf die Brust gesunken. Man sah den Stummel einer schwarzen Zunge aus dem Mund herausragen. Aus dem Unterleib, den man mit einem langen vertikalen Schnitt geöffnet hatte, quollen die Gedärme hervor und verbreiteten einen abscheulichen Gestank. Die gespreizten Beine wiesen die gleichen seltsamen Einschnitte auf wie der Oberkörper. Marion wechselte mit Lavot einen ungläubigen Blick, während sie aus dem Augenwinkel Cabut beobachtete, der in den Flur zurückwich. Nachsichtig ließ sie ihn gewähren. Alle machten sich zu schaffen, ohne dass sie einen Ton von sich gaben, offenbar war ihnen kotzübel. Der Bezirkskommissar, der mit den Feuerwehrmännern als Erster zur Stelle gewesen war, machte sich Notizen für sein Protokoll; er war käseweiß, sein Gesicht bekam rote Flecken.
»Kommissarin!«, rief Doktor Marsal, der nicht im Geringsten unpässlich wirkte, »ich bin fertig, oder fast fertig. Ich lasse dieses hübsche Geschenkpaket abholen, um es im Gerichtsmedizinischen Institut bequemer – und im Kühlen –untersuchen zu können. Verflixt, stinkt die!«
Ohne jegliches Anzeichen von Widerwillen beugte sich Talon über die Frau und beobachtete die Maden, von denen es geradezu wimmelte. Er murmelte leise: »Calliphora vomitaria.«
»Was quasselst du da?«, krächzte Lavot um Selbstbeherrschung bemüht. »Bist du krank? Du wirst doch wohl nicht kotzen?«
»Das ist eine Fliege«, erklärte Talon mit einem leicht verächtlichen Seitenblick für seinen Kollegen. »Diese kleinen Tiere haben einen erstaunlichen Sinn für den rechten Augenblick und Fühler, die sie das tote Fleisch aus kilometerweiter Entfernung auffinden lassen. Bereits eine Minute nach dem Tod einer Person haben sie schon ihre Eier auf dem Leichnam abgelegt. Diese Maden stammen also zweifellos von der ersten Welle der Aasfresser ab. Man misst ihren Umfang, züchtet sie, damit man die Dauer ihres Zyklus kennt, die Zeit, die sie zum Schlüpfen und zur Entwicklung brauchen, und findet so den Todeszeitpunkt fast auf die Minute genau heraus …«
»Auch den Namen des Mörders?«, lästerte Marion. »Der nach der ganzen Zeit, die man mit der Aufzucht von Maden zubrachte, immer noch frei herumläuft!«
Talon ging nicht darauf ein. Vor zwei Jahren hatte er ein langes Praktikum in den Vereinigten Staaten, an der FBI-Schule in Quantico, absolviert. Er hatte ein unerschöpfliches Wissen und ein Interesse an der Untersuchung von Leichen mitgebracht, das Cabut für krankhaft und unangebracht hielt.
»Über den Daumen gepeilt«, gab Dr. Marsal naserümpfend von sich, »angesichts der Auflösung der Leichenstarre und der Anwesenheit dieser reizenden Tierchen hier, würde ich sagen, dass sie seit vier bis fünf Tagen tot ist.«
Er dachte nach, zählte mit Hilfe der Finger.
»Wahrscheinlich in der Nacht von Freitag auf Samstag, spätestens aber am Samstagmorgen, ich sage es Ihnen nach der Autopsie. Bedenkt man die Blässe des Körpers und die Menge des verlorenen Blutes, dann muss sie sehr langsam gestorben sein, da jede einzelne Wunde für sich genommen nicht ausreicht, sie ins Jenseits zu befördern, abgesehen vielleicht vom Heraustreten der Eingeweide … Schöne Arbeit.«
Er wiegte den Kopf mit Kennermiene.
»Messer?«, fragte Marion.
Marsal zog einen Flunsch.
»Rasiermesser, Skalpell … betrachten Sie die Form der Einschnitte und die Genauigkeit der Schnittführung. Obgleich in ihrem Zustand … Nein, ich bleibe dabei, Rasiermesser oder Skalpell. Eventuell Cutter.«
Er zog seine Handschuhe aus und sah Marion an, die mit einem tückischen Brechreiz kämpfte.
»Sie sollten es wie ich machen, Kommissarin, und nach Hause gehen. Sie sehen schlecht aus.«
Die junge Frau verzichtete darauf, klarzustellen, dass es aufgrund einer Verbrechenswelle in der Gegend ihre dritte Arbeitswoche ohne Unterbrechung war. Dieses hier war unbestreitbar das schönste Vorkommnis. Sie gab sich einen Ruck und näherte sich Talon, der die Hände des Opfers aus der Nähe betrachtete.
»Haben Sie eine weitere Käferart entdeckt?«
Mit ernster Miene richtete er sich auf.
»Nein, Chef, ›das‹ … Sehen Sie nur!«
Das fragliche »das« war ein langes, feines und helles Haar, das er soeben entdeckt hatte; es war am abgebrochenen Fingernagel der Frau hängengeblieben. Er hielt es behutsam in den Fingern, während Lavot sich ein Plastiktütchen nahm, um den Fund darin zu deponieren.
»He, Hände weg«, protestierte der TDT1, »das geht dich nichts an!«
Der andere grinste hämisch und demonstrierte das Haar, das in dem Tütchen fast unsichtbar war.
»Jedenfalls hast du das da nicht gesehen!«
Der TDT brummte eine unfreundliche Bemerkung und machte sich wieder ans Abtupfen, um nach Haaren, Spuren, organischen oder anorganischen Resten zu suchen, während sich sein Kollege mit der Abnahme der wenigen Fingerabdrücke befasste, die für die Untersuchung von Bedeutung sein konnten. Er stolperte über Talon, der auf allen vieren die Unterseite des Bettes und dessen Umgebung absuchte. Er explodierte.
»Das ist wirklich eine Manie von Ihnen, den Leuten auf den Wecker zu fallen! Chef, könnten Sie nicht Ihre Dupond-Dupont2 an die Leine nehmen, damit sie uns in Ruhe lassen!«
Marion tat so, als hörte sie nichts. Talon mit seinem Gehabe eines Pseudointellektuellen, eines Pseudospezialisten der forensischen Medizin,3 in Wirklichkeit aber ein Bulle in seinem Element, dem immer wichtige Dinge ins Netz gingen. Sie wandte sich Lavot zu.
»Sammeln Sie Cabut ein und fangen Sie mit der Befragung der Nachbarschaft an, wir sind hier zu viele. Ich behalte Talon bei mir.«
Während Letzterer, trotz der genervten Seufzer seiner Kollegen, weiterhin herumschnüffelte, folgte Marion den Technikern vom Erkennungsdienst auf ihrem Rundgang durch die Wohnung, wobei sie alles aufsammelten, was für die Ermittlungen nützlich sein konnte. Die bescheidene Behausung des Opfers offenbarte eine Sauberkeit und Ordnungsliebe, die nach dem Durchzug der Polizeihorden bald nur noch eine Erinnerung sein würden. In den Kleiderschränken nur Frauensachen. Auf der Ablage im Bad eine einzige Zahnbürste in einem Plastikbecher mit Rosendekor. Der Mülleimer in der Küche war geleert, in der Spüle kein schmutziges Geschirr. Auch keine Spuren irgendwelcher Vorbereitungen auf eine Wochenendreise. Marion suchte den Platz, wo die Frau ihre Post ablegte. Sie entdeckte ihn im Flur, in der Schublade eines Billigmöbels, auf dem auch das Telefon stand. Kein Anrufbeantworter, keine persönliche Post, nur ein paar Rechnungen. Madame Nicole Privat schien ein sehr ruhiges Leben geführt zu haben, bevor sie auf diese extravagante Art und Weise starb. Der Inspektor vom Kommissariat ging auf Marion zu, er war mit seiner Widerstandsfähigkeit fast am Ende.
»Ich habe mein Protokoll über die Leiche und das Zimmer abgeschlossen. Kann ich die Leiche abholen lassen?«
Wie alle, die von der immer beklemmender werdenden Atmosphäre in der Wohnung verstört waren, hatte er es eilig, zum Ende zu kommen. Marion nickte und verlangte, dass man sämtliche in der Wohnung aufgefundenen Papiere und Dokumente versiegelt zum weiteren Studium an sie weiterleite. Der Inspektor erklärte, dass er schon mit dem angefangen habe, was er im Zimmer gefunden hatte, einige persönliche Briefe und Fotos, die er in der Hand hielt. Neugierig griff Marion danach. Sie hatten alle dasselbe Motiv: eine dicke schwarzweiße Katze, aufgenommen in unterschiedlichen Positionen. Nicht ein Mensch war zu sehen, außer auf einem Foto, welches das Gesicht eines mürrischen, pickeligen Jugendlichen zeigte.
»Sonderbare Frau«, murmelte die Kommissarin, »… haben Sie Angehörige von ihr ausfindig gemacht?«
Der Inspektor machte ein unzufriedenes Gesicht.
»Ein gewisser Julien, der ihr schreibt, vielleicht ihr Sohn … obwohl …«
»Obwohl …?«
»Der Ton der Briefe ist dermaßen kühl und unpersönlich. Nun, Sie werden selbst sehen. Offenbar ist er Soldat in Pau, bei den Fallschirmjägern … Entschuldigen Sie mich bitte!«
Die Beamten vom Erkennungsdienst riefen nach ihm, damit er die Siegelzettel unterschrieb. Er trat zur Seite, um den Leichnam Nicole Privats durchzulassen, die zum letzten Mal ihre Türschwelle überquerte, eingewickelt in eine graue Hülle und unter den beklommenen Blicken einiger Nachbarn, die im Treppenhaus standen. Der Stellvertreter des Staatsanwaltes wartete auf Marion, um seinerseits abziehen zu können. Sie klärte ihn kurz über die Lage auf, ohne auf Lavot und Cabut zu warten, die nicht zu sehen waren. Sie waren mit der Befragung der Mieter der Mimosas-Anlage beschäftigt.
»Ich lasse ein Ermittlungsverfahren einleiten«, entschied der Staatsanwalt, der sich ein kariertes Taschentuch unter die Nase presste. »Schicken Sie am Nachmittag jemand zum Gericht, um das Rechtshilfeersuchen abzuholen.«
Marion war einverstanden, dann ging sie zu Talon, der mit dem Inspektor vom Kommissariat ein ausführliches Gespräch führte.
»Die Leiche wurde von der Feuerwehr entdeckt, die von einer Arbeitskollegin des Opfers, alarmiert wurde. Nicole Privat war seit zwei Tagen nicht zur Arbeit gekommen, das hat sie stutzig gemacht, sie kam nachsehen. Als sie durch die Tür den Gestank wahrnahm, hat sie sofort kapiert …«
»Wo ist sie jetzt?«, fragte Marion.
»Im Spital. Sie hat den Anblick nicht ertragen. Nervenzusammenbruch, Ohnmacht etc.«
Während sich der Inspektor entschuldigte, ließ Marion noch einmal ihren Blick über das Zimmer schweifen, um sicherzugehen, dass sie nichts vergessen hatte. Das Mobiliar aus weißem Peddigrohr, das blutdurchtränkte Bettzeug, das blutbefleckte Parkett, die schmuddeligen Tüllvorhänge: alles bot einen trostlosen Anblick und war mit dem Pulver für Fingerabdrücke beschmutzt.
»Trug sie Schuhe mit Stöckelabsätzen?«
Marion schreckte zusammen. »Wie bitte?«
Perplex sah sie Talon an, der ernst seine Frage wiederholte.
»Ich fragte Sie, ob Sie in ihrem Kleiderschrank Schuhe mit Stöckelabsätzen gefunden haben.«
Marion kombinierte fix: Wenn Talon diese Frage stellte, hatte er einen guten Grund. Sie schüttelte ihre blonden Strähnen.
»Nein, die Art Schuhe nicht«, sagte sie. »Flache Schuhe oder solche mit halbhohem Absatz. Warum?«
Talon machte die Hand auf und hielt seiner Chefin ein Scheibchen aus schwarzem Kunststoff unter die Nase.
»Ich fand das eingeklemmt in der Nähe vom linken Bettfuß. Wollen Sie sehen?«
Marion warf ihm einen finsteren Blick zu. Natürlich wollte sie sehen. Sie protestierte im Stillen gegen Talon, der sich seit seinem Übersee-Aufenthalt oft zu allzu großer Eigenmächtigkeit hinreißen ließ. Sie beugten sich über den Spalt zwischen zwei Parkettstäben, wo der Inspektor seine Entdeckung gemacht hatte. Einer der Stäbe überragte den anderen um mindestens einen halben Zentimeter, und unter dem Aufprall des Absatzes war das Holz an einer Seite eingedrückt worden. Marion verlangte eine Taschenlampe und betrachtete im flach einfallenden Licht den Fußboden.
»Haben Sie Fotos machen lassen?«, fragte sie.
Talon schüttelte verneinend den Kopf und senkte die Augen unter dem plötzlich streng gewordenen Blick seiner Chefin. Er beeilte sich, den TDT heranzuwinken.
Marion deutete mit einer knappen Geste auf den Boden.
»Vielleicht gibt es einen Abdruck vom anderen Teil des Schuhs.«
Wie um sich zu entschuldigen, fügte sie sanfter hinzu: »Glauben Sie dasselbe wie ich?«
»Ein langes Haar, die Spitze eines Stöckelabsatzes, vielleicht haben wir es mit einer Frau zu tun. Wenn dem so ist, muss sie schwer sein, denn das Absatzstück war tief in das Holz eingedrückt …«
Der TDT richtete sich mit betrübter Miene auf.
»Kein Schuhabdruck, Chef. Soll ich weitersuchen?«
»Nein«, seufzte Marion, »wenn es welche gegeben hat, sind sie schon lange zertrampelt. Wir bringen die Siegel an und packen unsere Sachen.«
Im Erdgeschoss traf sie auf Lavot und Cabut, die nichts Interessantes erfahren hatten. Sie bat sie, ihre Befragung mit Talons Hilfe weiterzuführen, während sie selbst sich hinter das Steuer des R 21 setzte, um über Funk die Leitung zu informieren und Joual Anweisungen zu erteilen. Nachdenklich beobachtete sie die Gaffer und die verschiedenen Einsatzkräfte, die sich einer nach dem anderen zurückzogen. Unwillkürlich heftete sie ihren Blick auf das Feuerwehrfahrzeug, das gerade kehrtmachte. Einer der Insassen starrte sie aus dem offenen Fenster an. Die Heftigkeit dieses Männerblickes riss sie aus ihrer Träumerei. Für einen Moment verwirrte er sie, aber gegen ihren Willen hielt sie ihm stand. Sie zuckte die Schultern, während der Kastenwagen mit einem ebenso überflüssigen wie ungebührlichen Sirenengeheul wegfuhr.
Die Zeitungen vom nächsten Tag machten ziemlich wenig Aufhebens um den Mord an Nicole Privat. Seit drei Wochen beherrschte eine kleine Serie von Delikten und Unfällen, die mit dem Unwetter in Zusammenhang standen, die Ausgaben. Das spektakuläre Hochwasser – und seine Folgen für das Wirtschafts- und Sozialleben – dominierte eines der beiden Regionalblätter, die sich wütend Konkurrenz machten. Allerdings nur zum Schein. Denn in Wirklichkeit verstanden sich die Journalisten bestens, und es waren meistens Kumpel, die in den Fluren des Polizeipräsidiums, des Krankenhauses oder der Feuerwache nacheinander oder gemeinsam, aber stets gerecht mit dem Klatsch, den Vorfällen und Ereignissen versorgt wurden, die eine nach vermischten Nachrichten begierige Provinzredaktion entzückten.
Ben war folglich kaum zufrieden mit den Medienberichten über sein Abenteuer mit der Frau, die er unter dem Namen ›Schwester Angélique‹ in seine Sammlung aufgenommen hatte. Angélique, weil wirklich arglos, geradezu leichtfertig. Ein bisschen blöd, offen gesagt. Er warf die Zeitung in den Papierkorb und murmelte: »Eine richtige dumme Kuh.«
Ihre extreme Naivität war die einzige Erinnerung, die sie in ihm hinterlassen hatte. Er konnte sich noch so sehr den Kopf zerbrechen, er erinnerte sich an nichts anderes. So unscheinbar, dass selbst die Presse kaum von ihr sprach. Es gefiel ihm sehr, wenn die Zeitungen ausführlich seine Glanzleistung kommentierten, und sei es auch durch eine, nun ja, Mittelsperson. Und es machte Cora Freude, ihr, die von Ruhm und Bekanntheit träumte.
»Egal, was«, hatte er zu ihr gesagt, »ich werde irgendwas machen, aber man wird von mir sprechen, du wirst schon sehen …«
Der Mann verzog das Gesicht zu einem Lächeln, während er sich an den Artikel in La République erinnerte, der die Möglichkeit in Betracht zog, das Verbrechen sei von einem Herumtreiber oder einem Sadisten begangen worden. Er lächelte ungezwungener: welch Mangel an Vorstellungskraft! Nicole Privat! Eine so banale Frau war kein großer Verlust. Er hatte sie mit ebenso großer Leichtigkeit gehabt wie die anderen. Er hatte sie fast zu rasch getötet. Aber Cora war ungeduldig gewesen. Schon vom ersten Moment an!
»Mach’s mir, Ben, mehr!«
Für ihn selbst kam das Danach so gewaltig wie eine Naturkatastrophe. Bei dieser Erinnerung ging sein Atem schneller, sein Mund öffnete sich halb. In seinem Kopf explodierten die Bilder, aus den Mundwinkeln seiner leicht wulstigen Lippen rann etwas Speichel. Er zügelte sein aufgeregtes Herz, fing sich wieder. Er konnte sich jetzt nicht gehenlassen. Er musste arbeiten gehen. Er zwang sich, mehrmals tief durchzuatmen, trank einen großen Schluck Wasser, direkt aus dem Hahn, und fuhr sich mit der feuchten Hand über die gewellten Haare. Rasch musterte er die Einrichtung seines Hauses, vergewisserte sich, dass alles in Ordnung war. Alles sah gut aus: jedes Ding an seinem Platz, ein Platz für jedes Ding. Wie man es ihm beigebracht hatte. Wie die Ordnung und die Sauberkeit.
»Im Nu machst du dich staubig«, spottete Cora.
Was das anging, Staub war nicht ihre Stärke. Glücklicherweise die Hygiene schon, denn er hätte es nicht ertragen, dass sie sich vernachlässigte. Wegen des Geruchs natürlich, aber auch wegen des Aussehens. Um der Reinheit willen. Ein überstehendes Haar, ein verlaufener Lippenstift, Haare an den Beinen. Das ließ ihn an die Narbe denken. Er zitterte. Ah! Die Narben! Nicht immer hatte er das Glück, schöne Exemplare anzutreffen, so schöne wie die von Cora. Lang und gewunden.
Als er gehen wollte, besann er sich anders, nahm die Zeitung wieder aus dem Papierkorb und legte sie träumerisch auf den Tisch. Heute Abend würde er den Artikel ausschneiden. Er würde ihn in die neue Akte einkleben, die er unter dem Namen ›Schwester Angélique‹ angelegt hatte. Er würde sogar L’Écho kaufen, den er wegen seiner Rechtslastigkeit nicht schätzte. Er würde den Artikel nebst dem aus La République neben die Kassette legen. Heute Abend würde er sie sich ansehen. Er hatte es noch nicht getan. Er wartete, bis seine Begierde auf dem Höhepunkt war. Schon konnte er es nicht mehr aushalten. Er musste sie wiedersehen. Ihre langen blonden Haare, ihre herrlichen Beine, glatt wie Samt. Ihm zitterten die Knie, wenn er nur daran dachte. Er wollte seine großen, breiten und geschickten Hände wiedersehen, die sich an dem Körper der Frau zu schaffen machten. An der Narbe. Die Zeitung schrieb darüber nichts. Aber morgen vielleicht, nach der Autopsie, würden sie mehr berichten. Er lächelte abermals. Die Bullen von der Kripo hielten sich für so schlau … Kommissarin Marion und ihre Inspektoren noch mehr als die anderen. Erstere mochte er nicht, sie war ein Luder. Einen Moment lang fasste er ins Auge, sie Cora anzubieten, verzichtete aber sogleich auf diese Idee. Es war lustiger, mit ihr Katz und Maus zu spielen. Es wäre immer noch Zeit, die Meinung zu ändern, wenn er es satthätte. Er gluckste vor Freude und gab sich wieder einen Ruck. Vor heute Abend durfte er nicht an die Kassette denken. Er musste einen kühlen Kopf bewahren, sich auf seine Arbeit konzentrieren und auf die Frauen, mit denen er bis in alle Ewigkeit zusammentreffen würde.
Schließlich ging er, nachdem er den Sitz seiner Kleidung korrigiert hatte. Tadellos. Er musste immer tadellos aussehen.
III
Marion stützte ihre Hände auf die Rückenlehne des Stuhls und schaute Joual über die Schulter.
»Was gibt das?«
Der Inspektor wich leicht nach rechts aus. Seine Hände zitterten unmerklich, und er verströmte zweifelhafte Gerüche. Sie gingen von seinen zu selten gewaschenen graumelierten Haaren aus, von seinem Hemd mit dem abgeschabten Kragen oder von seinem verschossenen Pulli, der Schweißränder unter den Armen aufwies und mit verdächtigen Flecken übersät war. Oder von allem zusammen. Verstimmt richtete sich Marion auf und ging um den Schreibtisch herum. Gereizt. Sie stand ihm gegenüber, kreuzte die Arme und starrte ihn an. Jouals Zittern wurde stärker, nervös verschränkte er die Hände, löste sie aus der Verschränkung, steckte sie dann in die Taschen. Er stammelte ein paar unverständliche Worte.
»Was für eine Sprache ist das?«, fragte Marion ironisch, um sich der Wut zu erwehren, die sie in sich aufsteigen fühlte.
Joual sah sie mit einem verzweifelten Blick an. Das Blau seiner Augen war zurückgewichen vor dem Rot der kleinen geplatzten Gefäße an den wimpernlosen Lidrändern. Eine Träne blitzte auf, quoll hervor und kullerte über seine Wange, die ihrerseits von erweiterten Äderchen überzogen war. Verblüfft musterte Marion ihn.
Als sie ihn vor einem Jahr in ihr Team aufgenommen hatte, hatte sich Joual auf dem Höhpunkt der Alkoholsucht befunden, war hohl wie eine alte Nuss. Ins Archiv abgeschoben, hatte er die Zeit damit zugebracht, seinen Whiskyrausch auszuschlafen, wenn er sich überhaupt noch aufraffen konnte, zum Dienst zu kommen. Um Unfälle zu vermeiden, die nicht wieder rückgängig zu machen waren, hatte man ihn ›entwaffnet‹. Diese überaus symbolische Geste hatte die Dinge beschleunigt. Ohne Waffe ist ein Polizist kein Polizist mehr. Kaum noch ein Mann. Joual hatte den Rhythmus beschleunigt, wurde nur noch ab und zu nüchtern, provozierte in den Bars Zwischenfälle, Reibereien mit anderen, die Säufer waren wie er. Er pfiff aus dem letzten Loch, belauert von einer Behörde, die, ohne mit der Wimper zu zucken, die Etappen seiner Höllenfahrt verfolgt hatte. Aber er hatte eine Frau und drei Kinder und stand kurz vor dem endgültigen Absturz, der Entlassung oder dem Selbstmord.
Cabut und er waren einst Kumpel gewesen, sie hatten dieselbe Schulbank gedrückt, dieselben Mädchen geneckt. Erschüttert über den Zustand, in dem er seinen alten Freund angetroffen hatte, hatte Cabut mit Marion gesprochen. Sie hatte einen guten Ruf als Chefin. Aufrichtig, gerecht, aufmerksam den anderen gegenüber. Sie hatte eingewilligt, ihn in ihre Abteilung aufzunehmen, unter der ausdrücklichen Bedingung, dass er vorher einen Entzug machte. Cabut hatte das begrüßt, und da er sich für Joual eingesetzt hatte, nahm er sich seiner mit Marions Hilfe an. Das Unternehmen war riskant, und Marion hatte weder von ihrer Dienststelle, die ihre Hände in Unschuld wusch, noch von Jouals Frau, die ihren Mann mit demonstrativer Verachtung bedachte, Unterstützung bekommen. Vier Monate später war er zurückgekommen, sauber, rosig, in Form. Um seine Rückkehr zu feiern, hatte die Gruppe einen Umtrunk organisiert. Ohne Alkohol. Joual war verklärt, Cabut bewegt, Marion zurückhaltend. Da sie im Rauschgiftdezernat gearbeitet hatte, kannte sie das Problem, die Anfälligkeit der Alkoholkranken, deren scheinbare Heilung und die echten Rückfälle sehr gut. Sie wusste, dass Joual nicht zwangsläufig aus der Klemme heraus war. Er hatte gute Kenntnisse auf dem Gebiet der Datenverarbeitung und im Zeichnen. Ein Bedächtiger, der mehr zur Analyse und Synthese von Informationen neigte als zum Handeln. Übrigens hatte er, gegen den Rat des Arztes, der ihn für geheilt hielt, den Revolver abgelehnt, den die Behörde – schnell bereit, ihre Meinung zu ändern – ihm wiedergeben wollte. Trotzdem hatte er in der Gruppe seinen Platz gefunden und füllte ihn aus.
Seit einigen Wochen hatte Marion ein erneutes Sich-gehen-Lassen bemerkt, Joual war überängstlich geworden. Er hatte noch keinen Rückfall, aber sie spürte, dass er kurz davor stand.
»Was ist denn?«, fragte sie sanft.
Als ob er auf dieses Zeichen gewartet hätte, um sich zu erleichtern, bedeckte Joual sein Gesicht mit den Händen und begann zu schluchzen – stumm, mit zuckenden Schultern und zu keiner Antwort imstande. Marion fluchte. Sie hasste es, sich in dieser Situation zu befinden: allein, verlegen und ohnmächtig angesichts des Kummers eines Mannes, der gut zehn Jahre älter war als sie. Sie wusste, wie sie mit den heikelsten, zweideutigsten Situationen fertig werden konnte: einem aufsässigen Ganoven Handschellen anlegen, einer Gruppe Unverschämter den Mund stopfen – was aber konnte sie mit einem weinenden Mann anfangen? Um eine Eingebung oder unverhoffte Hilfe zu finden, ging sie raus, um ihm ein Glas Wasser zu holen. Als sie zurückkam, war die Sache nicht besser geworden. Joual, der auf seinem angewinkelten Arm zusammengesunken war, weinte wie ein Schlosshund und durchnässte den Bericht, den er für Marion abgefasst hatte, mit seinen Tränen. Die junge Frau legte ihm die Hand auf die Schulter.
»Aber, aber, Joual, Kopf hoch«, knurrte sie. »Zum Teufel, Sie sind ein Mann! Los! Reden Sie! …«
Joual schüttelte den Kopf, richtete sich jedoch auf und stammelte unverständliche Entschuldigungen. Obwohl sie nichts verstanden hatte, blieb Marion gelassen.
»Ich vermute, nicht der Mord an dieser Unglücklichen versetzt Sie in diesen Zustand … Es geht um Ihre Frau, nicht wahr?«
Marion war Madame Joual nur einmal begegnet, eine kalte Lehrerin, die die Polizei ganz allgemein verachtete – in ihren Augen ein Haufen gewalttätiger Säufer und Faschos – und ihren Mann im Besonderen, den sie obendrein für einen verantwortungslosen Versager hielt. Die beiden Frauen waren sich wirklich nicht sympathisch gewesen, Madame Joual sah ihren Mann als einen nicht zu beseitigenden Schandfleck an, den sie gern weit von sich weg befördert hätte, wären da nicht die Kinder gewesen, die man aufziehen musste.
Joual nickte und trocknete sich mit den Ärmeln seines Pullis die Tränen. Marion reichte ihm ein Kleenex, sie fühlte sich immer noch unbehaglich.
»Sie will, dass wir uns trennen, sie will mit den Bälgern weggehen. Sie hat jemanden kennengelernt …«, stammelte er. »Sie erträgt mich nicht mehr, jetzt, wo ich wieder hochgekommen bin, weniger denn je. Sie interessiert sich für keine meiner Angelegenheiten … Ich weiß nicht, wie ich sie überzeugen soll, ich bin am Ende, habe Lust, ununterbrochen zu trinken, und sage mir gleichzeitig, dass ich erledigt bin, wenn ich es mache … Dank Ihrer Hilfe habe ich es geschafft. Aber ich fühle mich schwach und …«
»Lassen Sie sie machen!«, unterbrach Marion.
»Wie bitte?«
»Lassen Sie sie gehen! Verhandeln sie hart wegen Ihrer Kinder, aber lassen Sie sie machen, das ist Ihre einzige Chance, da herauszukommen. Ich wagte nicht, es Ihnen zu sagen, Joual, aber Ihr wahres Problem, das ist Ihre Frau. Sie verachtet Sie, und Ihr Alkoholismus kam ihr gut zupass, er erlaubte ihr, die Lage zu beherrschen. Heute haben sich die Dinge verändert, Ihre Kinder sehen Sie anders, und da Sie sich wieder hochgerappelt haben, versucht sie, Sie in einen Rückfall zu treiben. Und diese Geschichte mit dem Macker ist vielleicht nur ein Vorwand … Kennen Sie ihn?«
»Sie können sich denken, dass sie nicht wirklich mit mir darüber spricht. Manchmal frage ich mich, ob es ihn überhaupt gibt oder ob sie mich nur provozieren will. Vor zwei Monaten hat sie angefangen, mir wegen nichts Szenen zu machen, mich vor den Kindern zu demütigen. Einmal habe ich sie geschlagen … ich war mit den Nerven am Ende …«
Er machte ein zerknirschtes Gesicht und fuhr sich mit der Hand – deren Fingernägel unsauber waren – über die geröteten Augen. Da Marion nichts sagte, fuhr er fort.
»Sie hat die Funkstreife gerufen. Am Telefon hat sie denen erzählt, man hätte sie im Keller angegriffen. Sie hat es gesagt, damit sie schneller kommen, vor allem, um sicherzugehen, dass sie kommen. Ich schämte mich zu Tode, und genau das wollte sie. Ich weiß, dass sie sich am nächsten Tag ein ärztliches Attest ausstellen ließ …«
Auf seinem Stuhl zusammengesunken, breitete er die Arme aus.
»Was habe ich ihr getan?«
»Nichts«, sagte Marion. »Sie sind sicher einer der anständigsten Typen, die ich kenne, aber wie alle Ruhigen laufen Sie Gefahr, sich die Dinge aus der Hand nehmen zu lassen. Lassen Sie sie gehen, das wird für alle besser sein. Sie sollten ihr sogar dabei helfen …«
»Und meine Kinder? Wissen Sie, wie viel ich verdiene? Sie wird Unterhalt von mir verlangen … und wie ich sie kenne, fordert sie das Maximum!«
»Man muss manchmal Opfer bringen können, Ihre Kollegen werden Ihnen helfen, und Verwandte haben Sie auch. Kopf hoch, Joual, fassen Sie Mut, sehen Sie den Dingen ins Gesicht und entziehen Sie sich nicht länger. Sie werden sehen, dass Sie sich besser fühlen werden.«
Sie hielt kurz inne und wechselte dann das Thema.
»Gut, jetzt sollten wir über Nicole Privat sprechen.«
Joual ballte die Fäuste, zog nochmals die Nase hoch, brachte Ordnung in die verstreut liegenden Papiere, auf denen seine Tränen Spuren hinterlassen hatten, und warf einen Blick auf die Fotos vom Erkennungsdienst, die die Torturen im Einzelnen zeigten, die Nicole Privat zugefügt worden waren.
»Es gibt Momente, in denen ich die Verbrecher verstehe … die Frauen sind solche Biester, solche …«, murmelte er. »Ich bin sicher, dass ich fähig wäre, das mit der meinen zu machen.«
»Das reicht«, sagte Marion kühl. »Reagieren Sie sich ab, aber zählen Sie nicht mehr auf mich! Und versuchen Sie auch, an Ihre Kinder zu denken. Versuchen Sie, ihnen das Leben nicht endgültig zu verderben, und nehmen Sie sie zu sich. Schließlich sind Sie ihr Erzeuger!«
Da sie außer sich war, war sie lauter geworden. Durch die Tür kamen Lavot und Cabut.
»Wer will Bälger machen?« fragte Lavot mit seinem unnachahmlichen Akzent eines Pariser Straßenjungen, einem waschechten Belleville-Produkt. »Melde mich freiwillig, wenn Sie möchten, Chef!«
»Oh, darum mache ich mir keine Sorgen, Sie sind ja immer da!«, rief Marion aus, bereit, über das schalkhafte Aufblitzen zu lächeln, das sie in Lavots Augen entdeckt hatte.
Cabut hatte die geröteten Augen Jouals und die merkwürdige Atmosphäre im Büro sofort bemerkt.
»Alles in Ordnung?«
»Ja doch«, erregte sich Marion, »alles in Ordnung. Joual wird es Ihnen erklären, ich glaube, dass er Sie noch braucht … das heißt: uns. Jedenfalls hätte ich gern, dass wir arbeiten, falls das möglich ist. Vorwärts, Joual, und Sie beide kommen gerade recht, Sie werden aus seinem Bericht Nutzen ziehen.«
Lavot setzte sich auf eine Schreibtischkante, setzte seine Ray Ban ab und steckte sie in die Brusttasche seines Blousons, während Cabut sich an die Wand gegenüber lehnte, die Beine gekreuzt, seine übliche Haltung. Marion setzte sich auf den Stenotypistinnenstuhl, der seit langem ausgedient hatte, da Stenotypistinnen bei der Kripo nicht mehr benötigt wurden. Joual räusperte sich, setzte sich eine kleine Brille für Weitsichtige auf die Nase und begann.
»Nicole Privat, zweiundfünfzig Jahre, geboren am 21. Januar 1944 in Oran (Algerien), einzige Tochter von Émile und Léone Privat, beide verstorben. 1962 repatriiert, lässt sie sich mit ihren Eltern in Marseille nieder. Letztere sind Großkaufleute, die durch ihre überstürzte Abreise aus Algerien bankrott gingen. Sie stoßen sich jedoch im Bekleidungsgewerbe bald gesund. Studiert, ziemlich glanzvoll, Sprach- und Literaturwissenschaft, bricht nach zwei Jahren das Studium ab, um Michel Lambrosi zu heiraten, einen eingebürgerten Italiener. Nach meinen Quellen war das ein ziemlich ungehobelter Typ, aber schön wie ein Gott. Trotz der kulturellen und sozialen Unterschiede – er arbeitet als Lagerarbeiter im Hafen – ist sie verrückt nach ihm.«
»Liebe auf den ersten Blick … wie schön«, träumte Lavot laut.