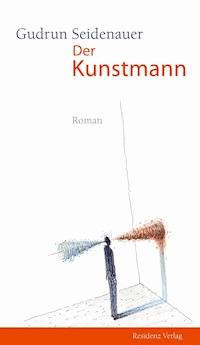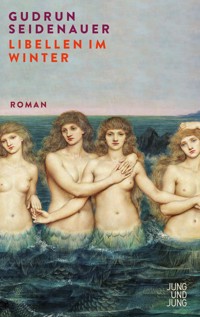Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Milena Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die ungewöhnliche Mella trifft auf Marie, sie werden in der Klasse nebeneinandergesetzt und gleich beste Freundinnen. Von nun an wird Maries kleinkariertes Leben bunt und tief. Zu träumen und zu tun, was man will: Das ist Mellas Zauberformel, mit der sie der immer bedrohlicheren Verrücktheit ihrer Mutter begegnet. Mella erfindet sich ihre Freiheit, liebt ihren Vater, einen Musiker, beflügelt die bravere Freundin und weigert sich, Opfer zu sein. Für Mella ist das Leben eine Geschichte, die wir selbst erzählen, ein Song, den wir unseren Träumen ablauschen. Im Laufe des Erwachsenwerdens gerät die Freundschaft der beiden, mit Wünschen überfrachtet, in eine gefährliche Schieflage: Begehren, Verrat und das Scheitern an Ungesagtem und Unsagbarem führen zum Zerwürfnis. Auch der Tod wird dabei ein Wörtchen mitreden. Wird es in einer zufälligen Wiederbegegnung zwanzig Jahre später gelingen, die nicht zu vereinbarenden Wahrheiten der jeweils anderen gelten zu lassen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
GUDRUN SEIDENAUER
WAS WIREINANDERNICHTERZÄHLTEN
ROMAN
Inhalt
1Cordula ist zurück
2Business-Class
3Mütter
4Mellas Augen
5Kind of blue
6Lügen
7Mono no aware
8Keine Wahl
9Schneekönigin I
10Schneekönigin II
11Schneekönigin III
12Engführung
13Shibuya
14Bleiben ging nicht
15Prisma
16Gespenster
17Nein
18Die Bücher
19Die Bücher II
20Lass ihnen alles
21Anagramme
22Gehen
23Lass mich in Ruhe
24Now or never
1
Cordula ist zurück
Wann begreift Marie, dass sie bei Cordulas Begräbnis nicht vorne neben Alex sitzen wird? Vielleicht erst, als ihre Mutter sie am Ellbogen fasst und neben sich schiebt, so wie man ein Kind auf den richtigen Platz rückt, nicht unsanft, aber mit Nachdruck. Alex in der Mitte, links Mella, rechts sie: Das ist die Vorstellung, an der sie sich festhält, wenn sie nicht einschlafen kann, weil die Augen zucken und die Hände ständig Wülste aus der Bettdecke formen. Acht Tage. Es kommt ihr länger vor, ein ausgedehnter Stillstand, ein hoffnungsloses Warten, dass alles wieder wird wie vorher.
Das Telefonat gestern mit Mella bestand fast nur aus Pausen. Atemgeräusche und ein Knacksen zwischen Halbsätzen, die aneinander vorbeischrammten. Wie macht sie das bloß, diese Frau da vorne in ihrem hellen Sarg, dass sie ihnen die Worte nimmt und auch die Gewissheit, die sie die letzten acht Jahre geteilt haben: dass sie einander verstehen, mit oder ohne reden. Wenigstens antwortete Mella am Ende »ich dich auch«, als Marie sagte, sie vermisse sie. »Später«, fügte Mella noch hinzu.
»Was meinst du?«, fragte Marie.
»Später erzähle ich dir alles.«
Mellas Stimme klang müde und zugleich sehr jung, fast wie die eines kleinen Mädchens. Alles? Mehr war aus Mella nicht herauszuholen. Das Wort machte Marie Angst, obwohl alles vielleicht gar nichts bedeutete.
Als Tote war Mellas Mutter nicht abwesend, wie man erwarten könnte. Das war sie ohnehin die ganzen letzten Jahre. Es war normal, dass sie nicht da war, nur als Bild, mit durchdringenden Augen, auf der Kommode im Wohnzimmer, gefangen in einer fernen Zeit, mit Mella als Baby auf dem Arm. Ein paar Kleidungsstücke im Schrank, die nach ihr rochen, das hatte Mella jedenfalls behauptet, wenn sie sich als Kinder verkleidet und im Schlafzimmer und auf dem Dachboden herumgestöbert hatten. Marie hatte nur Mottenkugeln und staubigen Lavendel gerochen. Cordula war ein Bild, eine Stimme vom Band und eine Figur in Geschichten mit Lücken, in denen Mellas Schweigen Marie manchmal Atemnot machte.
»Cordula ist tot«, sagte Alexander, als Marie vor genau acht Tagen spätnachmittags wie üblich von ihrem Schülerjob in der Konditorei mit übrig gebliebenen Kuchenstücken bei Mella vorbeikam. Marie hatte die Klinke noch in der Hand, seit einiger Zeit läutete sie nicht mehr, sondern machte einfach auf und rief, dass sie da sei. Er musste sie kommen gehört haben und hatte gleichzeitig mit ihr die Haustür geöffnet. Er stand da, als hätte er verloren, was ihn sonst drahtig und beweglich machte. Seine Arme baumelten neben dem Rumpf wie nicht dazugehörig. Für einen Moment wusste Marie gar nicht, wer das sein sollte, Cordula. »Mellas Mutter«, sagt er sonst, wenn er von ihr sprach. Er trat nicht zur Seite, um Marie ins Haus zu lassen. Sie wollte ihn umarmen, doch er wich einen Schritt zurück, streifte dabei ihre Hand vom Türknauf. Sein Blick zielte knapp an Marie vorbei auf die gegenüberliegende Straßenseite, wo zwei Nachbarinnen verstohlen herüberschauten.
Das Haus lag etwas abseits, wo die Straße in einen Feldweg mündet. Marie war früh dran heute, Mella würde erst in einer guten halben Stunde vom Volleyballtraining nach Hause kommen. Es war Mitte April, der Raps stand in diesem Jahr schon früh in voller Blüte, und seine leicht honigartige Süße verbreitete sich in der warmen Luft. Marie hatte sich auf das Kuchenessen mit ihrer Freundin gefreut, am Rand des Feldes, wo Mella und sie gerne saßen und in das berauschende Gelb schauten. Vielleicht könnten sie Alex zum Mitkommen überreden, hatte sie sich auf dem Weg hierher gedacht. Jetzt starrte er an Marie vorbei auf diese gelbe Fläche, während er mit ihr sprach, als wäre sie aus seinem Blick herausgerutscht.
Der letzte ernsthafte Versuch Cordulas, aus der Klinik heimzukehren, lag Jahre zurück. Es war nicht lange gut gegangen, damals, als sie Mellas Legosteine im Garten vergrub, einzeln, als wären es Samenknollen, und eines Nachts den halben Rasen vor dem Haus mit einer Blumenschaufel aufriss, um kleine Gräber für Mellas Stofftiere und Puppen auszuheben. Dann war Schluss. Marie erinnerte sich, wie Alexander die Puppen im Waschbecken wusch, abtrocknete und wieder anzog, mit leerem Gesicht und ohne ein Wort zu sagen, während sie auf dem Fußboden in der Küche stundenlang mit Mella Memory spielte, um sie abzulenken, und ein paar Mal absichtlich verlor, damit Mella sich freute, obwohl Marie dieses Spiel sonst gegen jeden gewann. Sie waren dreizehn und spielten schon eine Weile nicht mehr mit Puppen. Seitdem kam Cordula nur mehr hin und wieder für ein paar Tage nach Hause. Das Schlafzimmer wurde allmählich auch in Mellas Sprachgebrauch zu Alexanders Zimmer, Cordulas Bettseite war nichts als eine glatte weiße Fläche und Mella redete kaum mehr von ihrer Mutter. Wenn doch, dann war Marie da und wartete, bis es wieder vorbei war.
Marie reckt den Hals, um Mella und Alexander unter den Trauergästen zu erspähen. Von hinten ist das Geschiebe der Nachdrängenden zu spüren, darunter auch etliche Nachbarn und Leute aus dem Viertel, die Cordula gar nicht näher gekannt haben können. Seit Mella alt genug ist, ist Alexander als Musiker wieder viel unterwegs, Kontakt mit Nachbarn hält er kaum. Dies ist eine kleine Stadt, kein Dorf. Man muss nicht alles voneinander wissen, doch man tut einander kleine nachbarschaftliche Gefallen, die Frauen schenken einander Blumenzwiebeln, tauschen Tipps bei Kinderkrankheiten und gegen Schnecken im Erdbeerbeet aus, die Männer bessern zum Wochenende an Häusern und Autos herum, das Übliche. Man grüßt, ist nicht unfreundlich, doch von Alexander hätte man sich keine Stichsäge geborgt und von Cordula kein Salz. Aber wer will das schon, denkt Marie. Stichsägen, Laubstaubsauger und Autopolitur.
Warum ist die Sache mit Cordula genau jetzt passiert? Die Sache, so nennt Marie Cordulas Selbstmord gegenüber den anderen, die sie darauf ansprechen, die Sache oder das mit Cordula. Warum jetzt, das beschäftigt Marie noch mehr als das Warum.
Sie fühlt die Tatsache des Todes wie die Verkrampfung in der Sekunde, bevor einen ein Schlag trifft, den Moment, bevor der unausweichliche Schmerz einsetzt. Man weiß es und erstarrt. Nur dass die Sekunde jetzt schon acht Tage lang dauert. Die Schultern tun ihr weh, der Rücken tut weh. So muss es sein, wenn man fünfmal so alt ist. Cordula hat ihr Alex und Mella entrissen, vorläufig jedenfalls. Es ist egoistisch, so zu denken, tadelt sie sich. Aber war es von Cordula nicht auch egoistisch, jetzt einfach abzutreten, wortlos, ohne Brücke für die anderen, die zumindest hätten hoffen können zu verstehen? So aber wird sie sie nicht in Ruhe lassen, Mella nicht, Alex nicht und auch sie nicht. Cordula ist tot, und Cordula ist zurück. Was für ein Comeback, denkt Marie.
Nach der Schule wird Mella für ein Jahr nach England gehen, und Marie einen Monat später in die Hauptstadt zum Studieren: Sprachen und Psychologie fürs Erste. Ihre Eltern bestehen darauf, dass sie gleich mit der Uni beginnt: Ins Ausland solle sie erst, wenn sie bewiesen habe, dass es ihr mit dem Studium ernst sei. Die Eltern haben keine Matura und keine Ahnung. Marie hat ihren Vater erwischt, wie er das Wort Philologie im Brockhaus nachgeschlagen hat. Wissenschaften, von denen sie noch nichts gehört haben, sind ihnen unbehaglich, egal, wie bildungsbeflissen sie sich geben, wenn es um ihre Kinder geht. Nicht vor dem Studium hat Marie Angst, aber vor dem ganzen Rundherum:
Wohnen, Fortgehen, Meinungen, was, wer und wohin und wie. Zwei, drei entscheidende Fehler, und sie würde genau wie ihre Eltern niemals wissen, worauf es ankommt. Neulich hat sie sich mit Mella kaputtgelacht bei der Vorstellung, es gäbe irgendwo – »in einer anderen Dimension«, sagte Mella – ein Archiv der Zukunft mit der Abteilung »Spießigkeit«.
»Stell dir vor: Von oben bis unten vollgeräumt ist es da«, so Mella, »mit Autos, Ersatzteilen, Gartengeräten, Putzmitteln, Kochbüchern und Kostümen, was du willst. Immer ist etwas für dich dabei, bis du ins Gras beißt.«
Sie unterhielten sich eine ganze Weile damit, passende Objekte in alphabetischer Reihenfolge zu finden: Armaturenbrettnippfigur, Bügelbrettbezug, elektrische Citronenpresse, Dampfdruckkochtopf. »E wie Ehemann!«, rief Mella triumphierend. Sie lachten, die Arme um die Bäuche geschlungen. Sie hatten einen Joint geraucht, das machte es noch lustiger oder überhaupt erst lustig, das wusste Marie nie so genau.
»Und wie sieht es auf der anderen Seite aus? Im Archiv der Unspießigkeit?«
»Was meinst du?«, gab Mella die Frage zurück.
Diese Art Testfragen, die Mella gerne stellte.
Arrogant, dachte Marie manchmal, sprach es aber nicht aus.
»Leer«, sagte sie nach einer Weile, »einfach leer, ein großer Raum, eine Halle. Und ein Buch darin. Leere Seiten und Raum. Das wär’s.«
Ein Schulterklopfen von Mella, ein leises Grinsen, als ob sie die Antwort genau wüsste. Arrogant, aber das war eben Mella. Allerdings kam Marie nur mit ihr auf so etwas, und nur mit ihr bezwang sie alle Angst. Das wog die Überlegenheit auf, gegen die Marie manchmal gerne rebelliert hätte.
Inzwischen beginnt die Verabschiedung. Marie bekommt nur mit, dass sich alle setzen und jemand von der Bestattung den Programmablauf ansagt. Sie ist schon auf einigen Begräbnissen gewesen, zuletzt auf dem ihres Großvaters, der bei der Gartenarbeit an Herzversagen gestorben war. Marie konnte damals wochenlang kaum einschlafen, weil sie horchen musste, ob ihr eigenes Herz noch schlug.
Alex und Cordula waren nicht religiös, was damals, als Mella in Maries Klasse kam, zusätzlich für Aufsehen sorgte. Marie bekümmerte damals der Gedanke, dass Mella nicht in den Himmel kommen würde, aber ihre Mutter versicherte ihr, dass sich Gott ziemlich großzügig zeige, wenn man nur ein guter Mensch wäre. Bald darauf verschwanden Himmel und Hölle ohnehin von ihrem Horizont. Auf das Leben zu hoffen und Angst davor zu haben, war derart vereinnahmend, dass Sorgen über das Weiterleben danach keinen Platz mehr hatten. Trotzdem ist es für Marie seltsam, dass es hier kein Kreuz und keinen noch so kleinen Hinweis auf Gottes wohlwollende Zeugenschaft gibt, nicht auf dem Sarg, nicht in den Texten auf den Kranzschleifen, nicht ein einziges kleines Ewig.
Auf dem Podium hinter dem Trauerredner, einem kleinen Mann mit grauem Pferdeschwanz, der sein Manuskript mehrfach auseinander- und wieder zusammenfaltet, beziehen einige Musiker Position, Freunde von Alex, Marie erkennt den Bassisten, ein schweigsamer, langer Mensch, der sie intensiv ansieht, aber nicht so, wie sie es von anderen Männern kennt. Keiner der Musikerfreunde von Alex flirtete jemals in seiner Anwesenheit mit ihr. Mella und Marie spekulierten darüber, was er ihnen angedroht haben könnte, und protokollierten jeden Blick, den man vielleicht doch so verstehen hätte können. Unter den Freundinnen der Musiker, die Mella und Marie auf den Konzerten zu Gesicht bekamen, waren manche keine zehn Jahre älter als sie.
Maries Blick sucht Mella und Alexander in der ersten Reihe. Groß und schmal sind sie beide, Mella trägt trotz der Hitze einen schwarzen Blazer, der ihr ein bisschen zu weit ist. Sie sitzt völlig reglos da, während Alexander einige Male von seinem Platz ganz außen in der Reihe hochschnellt, Worte mit den Musikern wechselt, sich wieder auf den Sessel fallen lässt, mit dem Fuß wippt und die Ferse in den Boden dreht, als würde er sich festschrauben wollen. Sein Blick flattert über die gefüllten Reihen, er nickt nach hierhin und dorthin. Nur Marie schaut er nicht an. Als würde er geradezu um sie herumschauen. Soll er, sie weiß, was sie weiß. Wenn das alles nur vorbei ist. Sie geht davon aus, dass ihnen Cordula kräftig in die Suppe spucken wollte. Vor allem Alex, aber auch Mella und ihr. Das war nicht zu trennen, zurzeit jedenfalls nicht. Nach dem Englandjahr würde Mella auf jeden Fall zu Marie in die Stadt ziehen. Und Alex, wer weiß.
Erst neulich hat Marie ihn gefragt, warum er und Mella ausgerechnet hierhergezogen seien. Sie saßen nach dem Abendessen zu dritt in der Küche, aßen Kuchen, den Marie mitgebracht hatte, und Mella blätterte missmutig im Lateinwörterbuch, weil sie versprochen hatte, die Aufgabe für sie beide zu erledigen, Alex war bei der zweiten Portion Spaghetti. Auf ihre Frage fuhr er sich mit dieser Handbewegung, die sie so gern hat, über die Stirn, und tippte bei der Antwort spielerisch zwischen ihre Finger auf die Tischfläche. Keine große Sache, aber ihr wurde heiß vor Freude. Mella schaute nicht einmal auf, also war es in Ordnung. Tags darauf würde Cordula kommen, dann könnte Marie nicht mehr so viel Zeit hier verbringen. Cordula war leicht zu irritieren, man konnte es nicht voraussehen. Einmal konnte sie schon das Klingeln des Briefträgers aus der Fassung bringen, ein anderes Mal kochte sie für alle und lud außer Marie auch noch ihre Eltern zum Essen ein.
»Ich dachte, das hier wäre ein Ort, an dem Cordula vielleicht zur Ruhe kommt«, war seine Antwort, »an dem sie mit Mella einen Hafen hat, eine Heimat vielleicht sogar. Aber das hat nicht geklappt, wie du ja weißt.«
Er wusste also, dass sie wusste. Nur darauf kam es ihr an. Viel reden würde es verderben, also nickte sie nur ernst. Sie hörten Mella draußen, die ihr Heft geholt hatte, und er berührte Marie einen Moment an der Schulter. Da war es wieder, das offene Buch mit den leeren Seiten. Alles Mögliche könnte man hineinschreiben.
Jetzt winkt Alex irgendjemandem hinter ihr. Marie kennt die Leute nicht, die sich in eine der hinteren Reihen quetschen. So viele, die ganze Straße, alle Nachbarn. Tote in der Umgebung, das macht die Leute unruhig, das kitzelt irgendwo, wo man sich nicht kratzen kann.
Und auf diese Art. Schrecklich. Wie muss das nur. Vor ihren Augen, oder? Doch nicht. Die Flüsterer von vorhin sitzen genau hinter ihr. Ganz allein. Und Gebrüll manchmal. Wie ein Tier. Soll ja alles. Voll. Und überall. Alle Wasserhähne offen. Rauch? Trotz der Medikamente. Seit Jahren schon. Ja, die Ärzte!
Was wissen denn die! Feuer und Wasser. Davon hätte sie doch erfahren. Sie weiß nur, dass sie da vorne neben Alex und Mella sitzen müsste. Sie dreht sich zu den Flüsterern um, einem Mann und einer Frau aus den Wohnblöcken am anderen Ende der Straße. Der Mann ist Rentner, schwerhörig, das Arschloch. Die Frau arbeitet in der Wäscherei. Marie starrt den beiden ins Gesicht, sie bemerken es erst ein paar dumme Sätze später und verstummen blinzelnd. Jetzt wäre der Moment, es gut sein zu lassen, aber das kann Marie nicht, diese Idioten zwischen sechzig und scheintot sollen sofort den Mund halten, eher wird sie nicht mit dem Hinschauen aufhören. Ihr tut schon der Kiefer weh vom Starren und sie ignoriert das Verlegenheitslächeln der Frau. So hätte es Mella gemacht, Marie tut es für Mella, die nichts davon mitbekommt da vorne und der alle auf den Rücken starren: das arme Kind. Der Mann wedelt mit der Hand, wie gegenüber einem lästigen Tier. Marie hat plötzlich ein Bild im Kopf, wie die beiden im Park um die Ecke mit ihrem fetten Hund dahinstapfen, und zischt: »Ihr grottenhässlicher Hund sieht Ihnen so verdammt ähnlich! Aber wenigstens kann er nicht sprechen.«
Dann dreht sie sich um, langsam und würdevoll, die Schultern ein wenig dem Kopf voraus. Stille, nur von ihrer Mutter kommt ein seltsamer Laut, etwas zwischen Stöhnen und Husten, aber Marie sieht erst zu ihr hinüber, als ihre Schultern immer stärker zucken, und bemerkt, dass diese gegen einen heftigen Lachreiz ankämpft. Unmöglich, davon nicht mitgerissen zu werden, und so sitzen Maries Mutter und Marie beim Begräbnis der Mutter ihrer besten Freundin und schütteln sich auf ihren Metallklappstühlen, die jede Bewegung mit einem Knacksen begleiten. Nachdem die Mutter sich hinter einem fest auf die Lippen gepressten Taschentuch wieder zur Ordnung gebracht hat, gelingt es schließlich auch Marie irgendwie, das Lachen in ein angemesseneres Weinen übergehen zu lassen. Mit den Tränen fließt der Druck aus ihr heraus, nicht aber der Schmerz, ein kleiner, fester Knoten unter dem Brustbein. Warum kann sie nicht bei Alex und Mella sein? Die Reihenfolge hat sich umgekehrt, früher waren es Mella und Alex, noch früher nur Mella. Wie damals auf dem Heimweg von diesem Konzert hätten sich ihre und Mellas Hände an seinem Rücken getroffen. Das ist erst ein paar Monate her. Sollen sie es doch sehen. Sollen sie denken, was sie wollen. Wieso interessiert das denn keinen: was wirklich ist. Als hätten sie davor die allergrößte Angst. Erbärmlich. Dieser Typ da vorne redet von Erbarmen, obwohl er kein Pfarrer ist. Aber ohne gewisse Wörter kommt man nicht aus, wenn es um den Tod geht. Alex sagt immer, er könne Blabla nicht leiden.
Soweit Marie dem Redner folgen kann, ist sein Blabla nicht von der schlimmsten Sorte. So richtig bringt Marie den Sinn des Ganzen nicht zusammen, das liegt an den Wörtern, von denen zu viele so groß sind, dass sie jeden unter sich begraben, den sie beschreiben wollen. Jetzt spricht der Mann über Cordulas Studienzeit, von Mella, die sie mit achtzehneinhalb bekommen hat, das Kind, für das sie sich trotz aller Schwierigkeiten entschieden haben, so drückt er sich aus, als wäre es schon eine besondere Leistung gewesen, Mella nicht gleich wieder loszuwerden. Insgesamt klingt es für Marie so, als wäre Cordulas Leben mit Mellas Auftauchen quasi vorbei gewesen. Dann geht es um die Reisen nach Afrika und Asien, die Cordula und Alex mit Anfang bis Mitte zwanzig unternommen haben. Mella war dabei, aber natürlich kann sie sich kaum an etwas erinnern. An gewisse Farben und ein paar Düfte aber schon, hat sie erzählt. Bestimmte Geräusche, gewisses Licht, ein Geschmack und eine Kombination aus allem. Manchmal sagte Mella: »Ich glaube, das kenne ich aus Afrika«, ein Gewürz, etwas Gebratenes auf einem Fest, ein Stoffmuster.
Jetzt spricht der Redner von Cordulas Begabungen, sein Pferdeschwanz wackelt auf und ab. Das Wort, das sich gerade mehrfach wiederholt, ist vielversprechend. Was sie nicht alles konnte! Stepptanzen, komplizierte Schichttorten backen, Klavier spielen, ganze Musicalpartien singen, malen, verblüffende Scherenschnitte machen, Leute nachmachen. Marie hat einiges davon mitbekommen, von anderem gehört.
Dazwischen war sie leider verrückt. Nicht schräg, nicht eigen, nicht ein bisschen plemplem, sondern verrückt, narrisch, wie Maries Eltern sagen. Davon wird hier nicht gesprochen. Cordula hat gar nicht so viel Zeit gehabt für all ihre Talente, denn die Verrücktheitsphasen wurden immer länger. Sie hat Mella geboren, aber eine Mutter war sie nicht, findet Marie. Und auch nicht Alexanders Frau, nicht mehr. Marie macht sich kalt mit solchen Gedanken, dann fühlt sie sich besser.
Der Redner hat eine weiche Stimme. Er hat sich als Studienfreund von Cordula und Alex vorgestellt. Marie vermutet, er war irgendwann verliebt in sie, chancenlos. Und jetzt ist er froh, dass er sie damals nicht bekommen hat. Aber das darf er nicht zeigen, vielleicht ist seine Stimme deshalb so besonders sanft. Lange hält es Marie nicht mehr aus.
Allzu lang war die Ansprache tatsächlich nicht, bravo. Einmal noch flackert das Wort vielversprechend auf. Was Sache ist, ist Sache: Cordula ist tot. Und vielleicht ist das auch gut so. So. Jetzt hat sie es gedacht. Dafür wird sie irgendwann büßen. Instinktiv duckt sich Marie. Musik setzt ein. Alex spielt für die Frau, die nicht mehr seine Frau ist, blass, den Blick in einen Punkt auf dem Boden gebohrt. Die Rückverwandlung von Cordula in Mellas Mutter hat vielleicht schon wieder begonnen, nur sie, steif und dumm vor lauter Verrücktsein und Totsein, bemerkt davon nichts. Vielleicht wird ja doch alles wieder gut, denkt Marie, wie immer folgt sie seinen Fingern, die sich über die Saiten bewegen. Jetzt schaut er auf. Es macht nichts, dass er Marie nicht sieht. Er hat ihr erzählt, dass er meist nichts und niemanden sieht, wenn er spielt, und auch danach noch für ein paar Sekunden nicht. Er sieht aber auch Cordula nicht. Wie könnte er, wo sie doch tot ist. Falls Marie etwas anderes geglaubt hat, dann war sie nichts als verwirrt.
»Glaub der Musik. Musik ist ehrlicher, als Worte es je sein können.« Mella verdreht die Augen, wenn er so etwas sagt. Marie lauscht angestrengt, aber sie versteht nicht. Sie hat keine Ahnung, was die Musik ihr sagen und was sie ihr glauben sollte. Was sie hofft, weiß sie. Und mit einem Mal ist diese sanfte Unerbittlichkeit, dieses Unausweichliche auch in der Musik. Ihre Mutter, die eine richtige Mutter ist, hält ihr Papiertaschentücher hin. Dann endlich ist es vorbei, und sie darf gehen und draußen auf Mella warten, die ihr irgendwann mit grauem Gesicht in die Arme läuft.
2
Business-Class
Es wäre albern gewesen, sich das Taxi nicht zu teilen. Außerdem sind sie beide zu müde, um noch angespannt zu sein. Seit zwanzig Stunden sind sie schon unterwegs, Mella von München, Marie von Wien nach Frankfurt, von dort nonstop nach Tokyo. Zwei, drei Fahrzeuge drehen unwillig ab, während der Lenker eines ledergepolsterten Lexus unter einer Serie blitzschneller Verbeugungen unterwürfig und gierig zugleich Hand an ihr Gepäck legt. Nach der elektrisierenden Geschwindigkeit des Zuges macht das Schritttempo Marie unruhig, in dem sich der Wagen durch ein Netz enger Gässchen bewegt. Der Fahrer trägt weiße Handschuhe, die Kopfstützen sind mit Spitzendeckchen belegt. Als Mella geistesabwesend eines hochklappt und den Rand zwischen den Fingern aufzwirbelt, wirft ihr der Mann via Rückspiegel einen tadelnden Blick zu. Sie lehnt sich zur Seite, schließt die Augen, als sie über einen taghell erleuchteten Platz gleiten, vorbei an einer größeren Gruppe von Mädchen, die wie Manga-Figuren gekleidet sind: Rüschenschürzen zu Spitzenstrümpfen, Karo-Miniröckchen und Samtkäppchen, Fantasieuniformen und überdimensionierte Schnuller, die an langen Ketten baumeln.
Sie wollen Kinder bleiben, denkt Marie, das ist das Gegenteil von dem, was wir damals wollten.
Gelächter und Geschrei, unhörbar im Wageninneren, verzerrt die Gesichter. Marie wirft einen Seitenblick auf Mella. Das sirupartige orangefarbene Licht, in das alles getaucht ist, wischt das Vertraute aus ihrem Gesicht. Das Kinn ist spitzer als früher. Die scharfe, v-förmige Linie zwischen den Brauen war am Flughafen in Frankfurt noch nicht zu sehen. Jetzt könnte Mella irgendeine Konferenzteilnehmerin sein, die zufällig mit demselben Flugzeug gekommen ist.
Schon von Weitem erkennt Marie Mellas Umrisse, die schmalen Schultern, Kopfhaltung und Gang, das leicht nach innen gedrehte rechte Bein. Mit zwanzig hätte sie Mella besser beschreiben können als sich selbst. Nachdem sie sich auf dem Abflugterminal in Frankfurt schon gezwungen hat, nicht dauernd nach Mella Ausschau zu halten, ist sie froh, als sie endlich auftaucht, trotz eines kleinen, zittrigen Erschreckens, das sie jäh in der Kehle spürt. Heller Trenchcoat, Jeans, entschlossener Gang, Unisextasche, nichts Auffälliges, hochgezwirbeltes Haar in einem gesträhnten Aschblond. Nur die großen Kreolen, an denen filigrane silberfarbene Ornamente baumeln, erinnern an Mellas früheren etwas dramatischen Stil. Kleines Gepäck, keine Aufkleber. Vielfliegerin, beruflich unterwegs, gut situiert, so fiele die Einschätzung von außen wohl aus. Als sie Marie entdeckt, hebt sie die Hand, ein angedeutetes Winken, und in Marie blitzt der bösartige Gedanke auf, ob Mella die Situation in Gedanken durchgespielt und die Geste eingeübt hat. Dabei war sie es, die sich heute Morgen, als sie auf das Taxi wartete, gefragt hat, wie Mella sie wohl sähe. Was würde Mella über sie denken? Wen würde sie vor sich erkennen? Will ich es wirklich wissen, fragt sich Marie.
In letzter Zeit verliert sie ohnehin das Gefühl für ihre Wirkung auf andere. Sie ist jetzt Mitte vierzig, eine Tatsache, die ihr keine Probleme bereitet. Aber manchmal, wenn sie sich plötzlich in einer Glastür oder einem Schaufenster gespiegelt gegenübersteht, nimmt sie sich einen Moment lang wahr wie eine Fremde. Die selbstverständliche Kongruenz von Innen und Außen bekommt Risse.
Als Mella und sie einander schließlich gegenüberstehen, hat der Blick der Freundin von früher nichts Forschendes, verrät keine Neugierde. Nach einem Augenblick des Zögerns, unbestimmbar, von wem es ausgeht, geben sie einander linkisch die Hand, Mellas Nägel stoßen dabei an Maries Handfläche. Als Marie ihre Stimme hört, die sich nicht verändert hat, eine dunkle Frauenstimme mit einem kleinen Kratzen darin, verliert sich der Eindruck des Gealtertseins beinah vollständig. Marie antwortet nicht gleich auf Mellas Gruß. Die gegenseitige Versicherung, wirklich gut auszusehen, ist ein Zugeständnis an ihre offensichtliche Verlegenheit. Davon abgesehen stimmt es, Marie ist erleichtert darüber. Zu einer beschädigt wirkenden Mella Abstand zu halten, wäre schwieriger. Sie würde darüber nachsinnen, was ihr wohl widerfahren sein mochte, diese und jene Möglichkeit durchspielen und vielleicht auch gegen einen leisen, unschönen Triumph ankämpfen müssen.
Die Tagung, zu der sie unterwegs sind, ist international und interdisziplinär, obwohl die Zahl der asiatischen Teilnehmer überwiegt. Marie wird zwei Wochen in Japan bleiben, Mella hängt ein paar Tage an, habe aber noch weitere Aufträge, sonst hätte sie die Agentur kaum geschickt, fügt sie hinzu. Anschließend müsse sie nach Yokohama zu einem Treffen internationaler Wirtschaftstreibender und zu irgendeiner größeren Umweltsache.
Marie fragt nach Mellas beruflichen Projekten und kommt sich verlogen vor, weil sie sie längst gegoogelt hat. Sie arbeite nach fünfzehn Jahren in diversen Fixanstellungen endlich wieder als freie Journalistin, in den letzten Jahren mit Schwerpunkt Wissenschaft, erzählt Mella. Marie möchte nicht enttäuscht sein, dass Mella ihrerseits kaum Fragen stellt. In der Reihe vor dem Check-in schweigen beide. Einen Moment lang findet Marie es beengend, als würde sie durch einen Strohhalm atmen. Nichts ist übrig von der ruhigen Abgeklärtheit, die in den letzten Jahren ihre seltener werdenden Gedanken an Mella begleiteten. Aber nichts davon dringt nach außen. Zum Glück fliegen sie Business-Class, also ist die Schlange der Wartenden kurz. In der Maschine sitzen sie etliche Reihen entfernt voneinander. In den ersten Flugstunden geht Marie ihren Vortrag durch, wiederholt die englischen Schlüsselbegriffe, was nur mäßig gelingt, bevor sie nach einem doppelten Bourbon in den typischen unruhigen Halbschlaf der Reisenden fällt, voller verwirrender Traumfetzen, die nach dem Erwachen noch eine Weile an ihr kleben.
Da sie dem Morgen entgegenfliegen, wird es nach nur wenigen Stunden wieder hell. Marie beobachtet die dahinziehenden Wolkengebirge, und wo sich Lücken auftun, die zu Farbschattierungen und unregelmäßigen Flickenmustern reduzierten Landschaften, die vage und unhaltbar vorbeiziehen wie ihre um Mella mäandernden Gedanken.
Marie ist tatsächlich für ein paar Minuten im Taxi eingenickt. In dieser Straße gibt es kaum Aufschriften in lateinischer Schrift. Überall sind Menschen mit bonbonfarbenen Einkaufstüten und stoischen Gesichtern. Unvermutet blitzen hinter Maries Lidern ein paar Mal rasch hintereinander Bilder dieser absurden Holzverschläge voller Totenschädel und sorgsam geschlichteter Oberschenkelknochen auf, Aufnahmen von den kambodschanischen Killing Fields aus den 70er Jahren, die sie vor ein paar Wochen bei einem Vorbereitungstreffen zur Konferenz gesehen hat. Sie schaut nach draußen, um die Bilder zu verjagen. Die Augen offenhalten. Die japanischen Zeichen auf den Leuchttafeln wirken im Vorbeifahren wie unverständliche Zurufe, die sie beunruhigen. Im Auto riecht es nach Nadelbaum und Gummibärchen. Sie bemüht sich, flach zu atmen.
Die Einladung zur Tagung ist auf Vermittlung eines früheren Lehrtherapeuten zustande gekommen. Für einige Zeit führte Marie Interviews mit strafgefangenen Gewalttätern. Ihre Studien zu Tätern aus dem Balkankrieg Mitte der 90er Jahre, für die sie mehrere Male in Den Haag gewesen war, fanden Beachtung in Fachkreisen, vor allem das Folgeprojekt, bei dem sie die Ehefrauen und Lebensgefährtinnen der angeklagten Männer in den Mittelpunkt stellte. Vor einem Jahr erhielt sie das Angebot eines renommierten Verlags, ein Buch daraus zu machen, das mittlerweile fast fertig ist. Trotzdem ist sie unsicher, was ihr Referat betrifft. In Japan war sie noch nie. Hier ein Kongress zur Täterforschung würde vermutlich spannend werden. Immerhin ist dies ein Land, in dem hochrangige Politiker alljährlich einen Schrein zur Ehrung von Kriegsverbrechern besuchen, ein mit bemerkenswerter Sturheit eingehaltenes Ritual, das ebenso rituelle Proteste aus dem Ausland nach sich zieht.
Als Marie die Einladung annahm, kam ihr kein Gedanke an Mella. Sie wusste nicht einmal, womit sie sich gerade befasste. Seit neunzehn Jahren haben sie einander nicht mehr gesehen und seit Langem leben sie in verschiedenen Städten. Auf der Liste akkreditierter Journalisten sprang ihr plötzlich Mellas Name entgegen. Beim ersten Mal überlas Marie ihn sogar: Doch da war sie, Mella, eingeschlossen zwischen Doktortitel und dem Namen ihres Ehemannes, der sich zwischen den Vornamen in der prätentiösen Langform »Amelia« und ihren Mädchennamen hineingezwängt hat.
Abzusagen hätte sich Marie nicht durchgehen lassen.
Mella richtet sich auf, wirft ihr ein müdes Lächeln zu, das nichts Persönliches hat. Sie klammert die Finger um die Henkel ihrer Tasche, die Knöchel treten weiß hervor. Auch das erkennt Marie wieder: Nur Mellas Hände verraten die Anspannung. Während sie vor der Hoteleinfahrt auf den Boy warten, sieht Marie ihre Spiegelbilder in der Glasfront nebeneinander. Wie oft sind sie in ihrer Studentenwohnung so vor Spiegeln gestanden, um sich fürs Ausgehen zu schminken, oder in irgendwelchen Lokalen, wo sie sich in der Damentoilette trafen, um einander im Stakkato-Stil das Wichtigste des Abends zu berichten. Die Bilder sind mächtiger als jeder Vorsatz, Distanz zu wahren.
Sicher, sie tut ihr Bestes. Auch wenn man geübt darin ist, es kostet Kraft, und Marie weiß, dass die Leere vieler Gesichter, die einem tagtäglich begegnen, von dieser habituell gewordenen Beherrschung herrührt, ohne die wir meinen, nicht leben zu können.
Damals dachte Marie, sie würden voneinander jede Bewegung kennen, jede Geste, jeden Ton. Aber vielleicht lag gerade darin der Irrtum, wo sie ihren größten Schatz hatten: in ihrer angeblichen Geheimsprache, ihrer stillen Übereinkunft?
Ihrem Deutschlehrer im Gymnasium hat es gefallen, ihnen in den letzten beiden Schuljahren scharfzüngige Zitate großer Dichter und Denker vor den Latz zu knallen und sie zu schriftlichen Stellungnahmen von mindestens tausend Wörtern zu verdammen. Beide liebten sie solche Aufgaben und überschlugen sich in sophistischen Argumentationsketten, auch das verband sie. Sie waren damals sicher, dass jeder Mensch ein eigenes Alphabet war, eine unerschöpfliche Welt für sich, vielleicht niedergehalten von inneren und äußeren Grenzen, doch keineswegs nur ein Abgrund. Dieses Büchnerzitat über den Menschen war eine dieser Aufgaben, die sie fürchterlich ernst nahmen. Damals hatte Büchner noch nicht recht, trotz Cordula. Ihnen beiden, so versicherten sie einander, würde gewiss nicht schwindeln, wenn sie hinabblicken würden in sich selbst.
»Ich dachte, ich kenne dich,« hat Marie Jahre später gesagt. »Tust du ja auch«, war Mellas lapidare Entgegnung, was sie nicht verstand. »Wir haben uns beide getäuscht.«
Aber ja, wir kennen uns, weißt du nicht mehr? Wir haben uns nicht getäuscht, wir täuschen uns jetzt!
Was hätte Marie alles aufzählen können. Warum hat sie es nicht getan? Trauern, warten, kampflos aufgeben. Es wäre Mellas Sache gewesen, den ersten Schritt zu tun, das meinte Marie jedenfalls. Die Dinge verformen sich manchmal zu sehr beim Nachdenken, das weiß sie. Das Warten auf Mella, auf irgendetwas, auf eine Erklärung, ist nur sehr langsam ausgedünnt.
Als sich die Hoteltür öffnet, folgt eine kleine Serie lächelnder Verbeugungen, Begrüßungsworte in sanft zwitscherndem Englisch, alles zusammen ein irritierend automatisiert wirkender Ablauf. Fast beruhigend, dass die junge Hotelangestellte tiefe Augenringe hat und eine einzelne Haarsträhne aus der wie lackiert glänzenden Pagenfrisur springt. Das Lächeln verharrt wie festgeklebt, bis sie aus dem Horizont der Lobby in den Lift entschwinden.
Mellas Nackenlinie könnte Marie noch immer mit geschlossenen Augen zeichnen. An ihrem Hals zeichnen sich kantig die Wirbel ab und in ihrer aufrechten Haltung liegt etwas Bemühtes. Mella und bemüht! Mella, die sich überall laut gähnend fallen lassen konnte und einschlafen, im Sitzen, im Lehnen, auf Bahnhöfen, überfüllten Festen, auf Küchenfußböden. Damals in den Wochen nach dem Tod ihrer Mutter hat sie dauernd geschlafen, war morgens kaum wachzukriegen und nickte schon vor Mitternacht in irgendwelchen Lokalecken ein. Sie habe einfach keine Lust mehr wach zu sein, sagte sie, wenn Marie sie rüttelte, ihr Kaffee einflößte. Das sei eben ihre Variante von Augen zu und durch, und sie sollten sie doch endlich in Ruhe lassen. Mella trank und rauchte nicht viel nach Cordulas Tod, und in Gegenwart anderer weinte sie nicht. Da war nur dieses ständige Schlafenwollen. Sie sollten doch bitte ruhig eine Runde fahren, baden gehen, was immer, Alex müsse auch einmal hinaus. Nein, sie sollten sich keine Sorgen machen, wieso auch? Sie war ja schließlich nicht die Verrückte. Wenn sie dann nicht nachgaben, wobei Marie stets hartnäckiger war als Alex, konnte Mella giftig und gemein werden, bis sie sie schließlich zurückließen.
Es war einen Monat vor der Matura, als das mit Cordula passierte, vor dem Sommer, der der Sommer ihres Lebens hätte werden sollen, Mädchengerede, mit dem sie einander über das letzte Schuljahr halfen, wobei sie ironisch taten, an das sie aber ganz fest glaubten: Wohin sie fahren würden und was alles erleben! Vielleicht würden sie Alex irgendwo treffen. Das war sogar Mellas Idee gewesen, nicht ihre. Er war ein junger Vater, noch keine vierzig, und Mella hatte ihm gegenüber nicht die übliche augenverdrehende Haltung, mit der ihre Freunde und auch Marie Distanz zu ihren Eltern ausdrückten. Mella und ihr Vater, das war etwas ganz anderes. Jetzt ist Marie vierundvierzig, Mella ein Jahr älter, und Alex ist vierundsechzig, spielt noch da und dort, unterrichtet. Das weiß Marie, weil sie ihn von Zeit zu Zeit googelt. Dann studiert sie sein älter werdendes Gesicht, und wenn sie einen Anflug von unbestimmter Melancholie kommen spürt, klickt sie weg. Marie könnte froh sein, dass ihre Begegnung mit Mella so unspektakulär verläuft. Genau dieses Szenario erschien ihr in den Tagen vor der Abreise als das bestmögliche: bloß nichts Bedeutungsschwangeres.
Im japanisch eingerichteten Zimmer befindet sich kein Bett, stattdessen liegt eine zusammengerollte Tatamimatte in einem Schrank mit papierbespannter Schiebetür, daneben Laken aus feinem Leinen und eine zu dünne Decke. Das Telefon blinkt grün und gelb und sieht kompliziert aus. Wenn Marie die Augen schließt, ist da noch dieses tiefe Motorenbrummen aus dem Zug oder dem Flugzeug. Ihr tun die Beine weh vom langen Sitzen, und ohne ein Glas Wein wird sie nicht einschlafen können, also geht sie noch einmal hinunter. In der Mitte der Hotellobby steht auf einer halbhohen Säule ein stilisierter Schwan mit einem üppigen Blumenbouquet.
Mein lieber Schwan, denkt Marie, eine Zeitlang haben wir das doch dauernd gesagt. Sie hatten es von ihrem Biologielehrer, einem eigenwilligen, harmlosen Kerl, der sie zum Lachen brachte. Mein lieber Schwan! Mein liebes Huhn, mein lieber Dachs, Luchs, Fuchs, Ochs! Wenn man miteinander in der Morgendämmerung auf einem Fahrrad nach Hause fährt, ausgelaugt und überdreht zugleich, vom Eifer zu beeindrucken und sich zugleich zu amüsieren, dann noch stundenlang wachliegt und sich dabei langsam betrinkt. Mein lieberlieberlieber Schwan. Meine liebe Schwänin! Meine Liebste! Wiehastdu! Wiekonntestdunur und wiekannstdu. Am Ende ein Dröhnen in den Ohren, die hämmernden Beats aus den raumhohen Boxen waren dagegen gar nichts. Ich bin schon viel zu lange wach, denkt Marie.
Der Schlaf lässt trotz zwei Gläsern Wein auf sich warten. Marie zwingt sich ruhig zu liegen. Dicht an ihrem Ohr ein Geräusch, als würde jemand regelmäßig und tief atmen. Sie tastet nach der Fernbedienung, die neben dem Bett in einer Halterung steckt, erwischt aufs Geratewohl einen Knopf, der das Geräusch zum Verschwinden bringt. Etwas hier bringt einen dazu, sich leise und zurückgenommen zu bewegen, das Geräusch von Schiebetüren, die hin und her huschenden, sich routiniert verneigenden Schatten hinter papierbespannten Raumteilern, der Geruch nach Teepulver und aromatisierter Chemie. Das Haus schüchtert sie ein mit seiner fremden Ordnung, mit seinem getakteten Wasserdampffauchen aus elektrischen Luftbefeuchtern, auch die Stadt, von der sie nichts kennt außer ein paar Fakten aus dem Reiseführer. Mella liegt hinter ein paar dünnen Wänden im selben Gang, auf der gleichen Tatamimatte, aus der ein schwacher Geruch von Seegras aufsteigt. Zwei- oder dreimal auf dem langen Flug brachte sie Marie ungefragt von vorne etwas zu trinken mit, lächelte sie an. Manchmal ist etwas einfach das, was es ist, und bedeutet nichts weiter, begreif das endlich, sagt sich Marie, während sie sich hin und her dreht. Will sich Mella einfach unverbindlich durch diese Woche hindurchlächeln? Nein, Marie will doch kein Gespräch über vergangene Zeiten. Zumindest will sie keinesfalls, dass Mella über Reden oder Nichtreden bestimmt. Sie ballt die Fäuste unter dem Laken und scheut sich davor einzuschlafen, als wäre Träumen eine Gefahr.
3
Mütter
Das Wort Sanatorium hörte Marie zum ersten Mal von Mella. Das sei ein Krankenhaus für Leute, die wahrscheinlich nie mehr gesund würden, fügte sie hinzu, dort sei ihre Mama. Mellas Gesicht blieb dabei reglos. Gerne hätte Marie etwas Tröstendes gesagt, aber ihr fiel nichts ein.
Mella kam im Winter in Maries Klasse, im zweiten Gymnasialjahr kurz vor Weihnachten. Es roch nach den feuchten Mänteln und Wollsachen, die sie aus Platzmangel hinten in der Klasse aufhängen mussten, und Marie war müde wie immer, wenn sie noch im Dunkeln aufstehen und zur Schule fahren musste. Die Lehrerin schob das neue Mädchen an den Schultern in die Klasse und stellte es vor. Dabei dehnte sie das E in der Mitte des Namens Amelia in die Länge, als würde sie sich über ihn lustig machen. Da und dort flackerte ein Kichern auf, das die Lehrerin mit einer Handbewegung zum Verstummen brachte. Mit einem Mal war Marie wach. Die Neue hatte helle, große Augen, vielleicht blaugrün, sie trug eine schwarze Strickmütze mit Ohrenklappen, wie man sie seit Kurzem bei älteren Mädchen sah, und einen passenden Schal mit Silberfäden in den Fransen, genauso einen, den Marie brennend gerne gehabt hätte. Aber ihre Mutter war der Meinung, dass Schwarz keine Farbe für ein Kind sei. Ein Kind! Sie war doch schon zwölf. Entweder hatte die Mutter der Neuen andere Ansichten, oder sie konnte sich gegen sie durchsetzen. Beide Möglichkeiten waren hochinteressant.
Noch mehr aber weckte Maries Aufmerksamkeit, was als Nächstes geschah: Mit einer gewandten Bewegung entzog sich diese Ameeelia dem Griff der Lehrerin und trat einen Schritt nach vor, blickte in aller Ruhe in die Klasse, keineswegs schüchtern, eher als hielte sie nach jemandem Ausschau, der es wert wäre, genauer betrachtet zu werden. Als ihr Blick an Marie hängen blieb, freute die sich, fast fühlte es sich wie Erschrecken an, wie ein kleiner elektrischer Schlag. Gleich darauf wurde ihr klar, dass die Neue wahrscheinlich nur den leeren Platz neben ihr bemerkt hatte. Maries beste Freundin Hanna fehlte gerade wegen der Windpocken. Amelia glitt auf Hannas Sessel, nahm nach der Aufforderung der Lehrerin zwar die Mütze, nicht aber den Schal ab. Marie flüsterte: »Du heißt also Amelia?«
Ein fast unmerkliches Kopfschütteln folgte.
»Mella.«
Mella war mit ihrem Vater aus einer großen Stadt im Norden hergezogen, hatte zwei Katzen, tolle Kleider, eine Mutter im Sanatorium und noch etwas, wofür Marie keine Worte hatte. Was es war, würde sie herausfinden.
Als Hanna mit spitzem Gesicht und noch blass von der überstandenen Krankheit in die Schule zurückkehrte, zählte schon nichts mehr, was vorher für mindestens zwei Schuljahre unverrückbar gewesen war. Marie hatte ein schlechtes Gewissen, als sie der sanftmütigen, etwas plumpen Hanna mit den akkuraten Heften und dick belegten Jausenbroten sagte, dass sie leider nicht mehr neben ihr sitzen könne – außerhalb von Mellas Hörweite, denn Marie war sich keineswegs sicher, ob Mella überhaupt großen Wert auf den Platz neben ihr legte. Hannas zitterndes Kinn und die fantastischen doppelten Schmalzbrote ihrer Großmutter hatten einfach nicht mehr genug Gewicht.
Als Mella den neuen Schülerausweis ins Federpennal schob, den ihr die Lehrerin gegeben hatte, bemerkte Marie das Foto einer jungen Frau mit einem pausbackigen Kleinkind auf dem Arm, das Mellas leicht schräg stehende, helle Augen hatte. Mellas Mutter sah nicht wie eine Mutter aus. Sie war sehr jung. Mella nannte sie meist bei ihrem Vornamen, Cordula, wenn sie von ihr erzählte. Undenkbar für Marie, von ihrer eigenen Mutter als Johanna oder gar Hanni zu reden. Als Cordula Mella bekommen hatte, war sie gerade erst mit der Schule fertig geworden. Sie trug Lippenstift, trotz des Babys auf dem Arm große Ohrringe und offenes Haar, in das eine überdimensionale Sonnenbrille geschoben war. Sie hielt Mella, als wüsste sie nicht recht, wohin mit ihr. Die Mutter-Kind-Fotos, die Marie kannte, sahen jedenfalls anders aus. Die Mütter waren ungeschminkt, praktisch gekleidet, strahlten und hatten ein wachsames Auge auf die Kleinen im Planschbecken, Sandkasten oder in der Hollywoodschaukel, und wenn sie sie im Arm hielten, wirkten sie, als wären sie zusammengewachsen, eine Art glückliches Mutter-Kind-Tier, und fänden das auch völlig in Ordnung. War Mellas Mutter auf dem Foto schon krank gewesen? Marie getraute sich nicht, danach zu fragen.
Auf dem Heimweg dachte Marie über Kranke und Krankheiten nach. Einer ihrer Großväter war eines Sommernachmittags in seinem großen Obstgarten, wo sie und ihr Bruder oft gespielt hatten, plötzlich gestorben, ohne vorher krank gewesen zu sein. Noch kannte sie niemanden mit langer Krankheit und hatte daher auch nicht verstanden, warum die Erwachsenen den Tod des Großvaters als schön bezeichnet hatten. Sie hatte die Leere entsetzt, die seitdem nicht mehr aus dem Garten verschwand und mit kalten Händen in ihr Inneres zu greifen schien, selbst wenn dort alles bunt und blühend war und ihre Eltern, Tanten, Onkel und Cousinen um den Gartentisch saßen, den ihr Opa getischlert und in den sie mit einem Nagel ihren Namen geritzt hatte, sodass sie nicht mehr hinwollte, nie mehr.