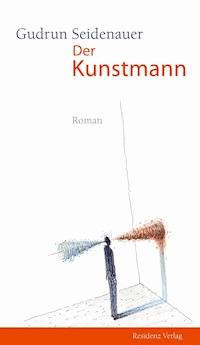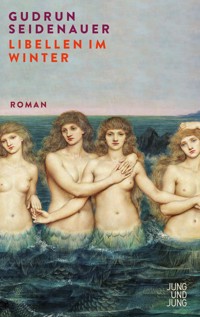
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jung und Jung Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was die drei Frauen zusammenführt und zu Freundinnen fürs Leben macht, sind Männer, der Krieg und ein Toter. Auf einem Feld unweit von Wien wird die Leiche eines amerikanischen Soldaten gefunden. Grete, die als Dolmetscherin für die US-Behörden arbeitet, findet Haare in der Hand des Getöteten, die sie bald auf die Spur von Vera bringen: Diese hat sich inzwischen nach Wien abgesetzt, wo sie Mali kennenlernt, die sie bei sich aufnimmt. Mali wiederum hat sich mit ihrem Sohn Robert vor der Roten Armee zu ihrer Tante in die Stadt geflüchtet. Davongelaufen ist sie auch vor dem Vater des Kindes, der Liebe ihres Lebens, den sie Robert verschweigt, auch dann noch, als er eines Tages vor ihrer Tür steht. Nur mit Vera und Grete teilt Mali ihr Geheimnis. Denn auch die Freundinnen haben welche.Libellen im Winter ist ein Roman über Freundschaft und Aufrichtigkeit, über das Beharren auf Selbstbestimmung und den Willen, sich treu zu bleiben, der Frauen dazu zwingt, sich außerhalb der Normen einzurichten. Damals wie heute.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2023 Jung und Jung, Salzburg
Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten
Umschlagbild: Evelyn De Morgan, The Sea Maidens
Umschlaggestaltung: BoutiqueBrutal.com
ISBN 978-3-99027-193-3
GUDRUN SEIDENAUER
Libellen im Winter
Roman
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
1
»Niemand«, sagt sie, »das ist niemand«, und schließt ihre Finger um sein Handgelenk, zerrt an seinem Arm. Ihre Stimme hat diesen gewissen Ton. Er weiß, er sollte jetzt besser still sein, doch er fängt trotzdem an:
»Aber der Mann da unten –«
Der Griff verstärkt sich zu einem Schraubstock. Sie hat kräftige Hände, obwohl sie klein und zart ist. Oft erzählt sie ihm davon, wie sie die Wäsche mit einem Stock im großen Holzzuber schwenkten, vom Brennholzsammeln, von den staubigen Ziegeln im Blechtrog, Tausende Male geschleppte Lasten, zwanzig Schritte hin und zwanzig zurück, zwanzig, genauso alt war sie damals. Zwölf Stück habe sie auf einmal genommen und die anderen höchstens neun. Beim Erzählen wandert ihr Blick so weit fort, dass es ihm Angst macht. Es hilft auch nicht, wenn er sie am Ärmel zieht. Erst wenn sie mit ihrer Geschichte fertig ist, schaut sie ihn wieder an, verwuschelt ihm die Haare, wovon er jedes Mal eine Gänsehaut bekommt, und sagt: »Das kannst du dir alles gar nicht vorstellen«, und er nickt, obwohl das überhaupt nicht stimmt. Er sieht alles vor sich, ohne auch nur die Augen schließen zu müssen: die dünne Eisschicht auf der Waschschüssel am Morgen, den Kalender mit den Alpenblumen im Haus gegenüber, in das man hineinsehen konnte, weil die Fassade von einer Panzerfaust getroffen worden war, die schuttbedeckten Straßen, durch die sie gelaufen ist, eine blasse Prinzessin mit ihm im Bauch. Er riecht die Mischung aus Kohle, Verwesung und Krautsuppe. Er sehnt sich nach dem großen Teddybären, der in dem zerschossenen Haus auf der Kommode lag. Seine Mutter kann nicht nur schwer tragen, sondern auch gut erzählen.
»Mama, der schaut immer noch zu uns herauf! Wer ist das?«
Wieder hat er es getan. Wo er doch genau weiß, ob er etwas fragen darf oder nicht. Er hasst sich dafür. Es wäre ihm sogar recht, wenn sie ihn schlagen würde, trotzdem zieht er den Kopf ein. Aber sie schlägt ihn nicht.
»Robert!« Mehr ist normalerweise nicht nötig. Auch wenn er auf den schmalen Balken, auf denen die Kinder über die Bombentrichter laufen, am wildesten von allen auf und ab wippt und beim Zielspringen vom Mezzanin eines Abbruchhauses immer der Erste ist. Kommt er mit einer Schramme vom Spielen, lacht sie, stößt ihn in die Seite: »Wir zwei, hm? Wir sind keine Weicheier, was?« Weicheier, das ist eines der Wörter, die sie aus ihrer Heimat mitgebracht hat. Es ist nicht so, dass sie ihn auslacht. Sie lacht, weil sie sich ihm nah fühlt, wenn er verletzt ist. So hat das Sich-Wehtun auch sein Gutes. Sie ist anders als all die Mütter, die beim kleinsten Kratzer mit Jodtinktur kommen, endlose Vorträge über die Gefahren da draußen halten und einen zu Hause einsperren. Was wollen die denn? Der Krieg ist vorbei. Die seine ist nicht so, Gott sei Dank. Obwohl er ihr nicht alles erzählt. Zum Beispiel das mit der Handgranate, die einer von ihnen in einem Keller gefunden hat und die sie ohne ein Wort im Kreis herumgereicht haben, immer schneller, bis sie sie einander zugeworfen haben, lachend, keuchend, das blitzende Weiß in den Augen der anderen, und ja nicht blinzeln, der eigene Herzschlag ganz oben im Kopf und Gänsehaut, die schönste, die er je hatte. Als es dunkel wurde, hat er das Ding dann in die Alte Donau geschmissen.
»Das ist niemand!«, sagt sie stur, und umso bestimmter, als es offensichtlich unwahr ist. Denn da steht einer schon ziemlich lange in der Gasse vor dem Haustor gegenüber und sieht zu ihnen herauf, raucht, dreht sich eine neue Zigarette, tut ein paar Schritte auf und ab, ohne ihr Fenster aus den Augen zu lassen. Er schleift den linken Fuß ein wenig nach.
Robert stellt sich auf die Zehenspitzen, um ihn besser zu sehen, erwartet eine zornige Reaktion der Mutter, aber die beachtet ihn gar nicht. Er hört, wie sie den Atem aus der Brust presst. Mit einem Ruck zieht sie den Vorhang zu, sodass die zerschlissene Stelle in der Mitte, wo man immer hingreift, mit einem Ratsch aufreißt. Sie, die sich aufregt, wenn er auch nur ein Eselsohr in ein Buch macht. Der Mann dort unten ist grau und braun wie die meisten Männer. Ist er alt? Erwachsene sind entweder alt oder sehr alt. Der ist nicht sehr alt, Stock und Buckel hat er zumindest nicht. Seine Haare sind unter einer Schiebermütze mit Ohrenklappen versteckt, und er bewegt sich, als wäre die Luft um ihn herum dickflüssig.
Viele machen es so, besonders Männer. Die Frauen mit ihren Taschen und Kindern, die sie hinter sich herzerren, sind viel schneller. Manche der Männer sitzen auf den Parkbänken, die es seit Neuestem gibt, starren in die Luft, rauchen, und die ganz Alten mit den Stöcken ärgern sich, dass die wenigen Plätze besetzt sind. Robert und seine Freunde werfen aus dem Hinterhalt im Gebüsch Kieselsteine nach den Starrern, und nicht selten schnellt so ein Halbtoter, der stundenlang mit grauem Gesicht dagehockt ist, plötzlich hoch, hechtet den Kindern mit rotem Schädel nach, und wenn er eines erwischt, verpasst er ihm eine, die sich gewaschen hat. Einmal ist das Robert auch passiert. Das war an dem Tag, an dem sie das alte Schild fanden, auf dem stand, dass Plündern mit dem Tode bestraft werde. Die Kleineren begannen zu weinen, weil sie Angst vor der Todesstrafe hatten, und er spöttelte, obwohl auch er sich fürchtete. Draußen vergaßen sie es schnell und liefen in den Park, wo sie den Starrer belauerten und schließlich mit einer Schleuder beschossen. Sie nahmen nur die runden Steinchen, nicht die spitzen, die mehr wehtun. Die Ohrfeige war dennoch gewaltig. Ein Zahn fiel ihm aus, zum Glück war es ein Milchzahn.
Ob der da unten auch so einer ist? Der Mann rollt sich schon wieder eine Zigarette, nachdem er die letzte mit spitzen Fingern zu Ende geraucht, an seiner Schuhsohle ausgedämpft und die restlichen Tabakkrümel in ein geknotetes Taschentuch geschüttelt hat. Er hat einen Rucksack, an den eine zusammengerollte Decke geschnallt ist. Es wird kälter, die Mutter bessert seit Wochen den Holzvorrat auf, und gestern in der Früh, als Robert sich auf den Schulweg machte, war der Atem schon eine Nebelwolke vor dem Gesicht.
»Mama, bitte!«
»Sei ruhig!«, zischt sie, ohne den da unten aus den Augen zu lassen, und gräbt ihre Finger an der empfindlichen Stelle zwischen Hals und Schulter unter Roberts Schlüsselbein, sodass ihm einen Moment lang schwarz vor Augen wird. Vielleicht ist es dieser blitzende Schmerz, der ihm ins Hirn fährt, warum er sich losreißt, sich mit seinem ganzen Gewicht gegen das angelehnte Fenster fallen lässt. Die Scheibe knarzt, bricht aber nicht, ein Stück grauen Kitts löst sich aus einer Fuge. Er fegt es von der Fensterbank und brüllt, so laut er kann:
»Niemand ist niemand! Niemand ist niemand!«
Die Mutter fährt herum, endlich, hat aber wieder diesen glasigen Blick, und ohne ein Wort holt sie weit aus. Obwohl nur mit der Linken – rechts wäre ihr das Fenster im Weg –, trifft sie ihn hart an der Schläfe. Seine Knie knicken ein. Er spürt nicht, wie er auf dem Boden aufschlägt. Als er wieder zu sich kommt, ist sie über ihm. Eine Strähne hat sich aus ihrer Frisur gelöst und kitzelt sein Gesicht, darüber ihr Trostgeflüster und der Geruch nach der Seife, die sie immer nur sonntags benutzt. Sein Gesicht ist nass, er weiß nicht, ob von ihren oder seinen Tränen. Heute ist Sonntag, fällt ihm ein, sie wollten ins Naturhistorische Museum, wo sie oft hingehen, wenn es regnet. Er liegt im Straßengewand auf dem braunen Samtsofa, auf dem sonst nur Besuch sitzen darf, und den haben sie nicht oft. Wenn er den Kopf nach links dreht, was weniger wehtut, sieht er, dass die Wohnungstür offen steht. Die Mutter drückt ihm das stumpfe Brotmesser, das sie draußen an der Bassena unters kalte Wasser gehalten hat, mit der Schneidefläche an die Wange.
»Ist er weg?« Jetzt wird sie ihn nicht mehr schlagen. Ihre Augen sind wieder so, wie er sie mag, klar, weich, auf ihn gerichtet. Sie streichelt mit ihrem Handrücken unablässig über seine heile Gesichtshälfte und nickt.
»Schau, ich hab noch ein Stückchen für dich. Das letzte.«
Sie wickelt die Blockschokolade aus dem Stanniolpapier und hält es ihm hin.
»Nein, nimm du es«, sagt er, seine Stimme klingt piepsig. Aber sie schiebt den Würfel an seine Lippen, der Duft ist betörend, es muss Wochen her sein, dass er Schokolade gegessen hat. Weil das Gesicht rechts so schmerzt, widersteht er der Versuchung hineinzubeißen. Er fühlt sich klebrig und feig. Er möchte nachsehen, ob der Fremde wirklich fort ist, aber er traut sich nicht, außerdem ist ihm schwindlig. Sie hat mit der Faust zugeschlagen, das tut sie sonst nie.
Das Hinken ist schlimmer, als es von oben ausgesehen hat, und größer ist er auch, als Robert gedacht hat.
»Mali?«
Die Wohnungstür. Als sie das Messer draußen unter dem fließenden Wasser gekühlt hat, hat sie sie offen stehen gelassen. Es ist die Wohnung der toten Großtante. Er erinnert sich daran, dass sie streng war und dick und dass sie die Mutter Mali nannte. Er hat sie geliebt. Wenn sie ihn an sich zog, war es, als umarmte man einen Gummiball mit Federkissen rundherum, und sie redete mit der Mutter in dem Singsang von früher, in der Sprache von dort, wo sie herkommen, davon hat ihm die Mutter erzählt. Die Tante würde dem Fremden sagen, dass er verschwinden soll. Die Tante hatte Magenschmerzen und Rheuma, aber Oberarmmuskeln wie ein Mann, vom Schuttwegräumen, sagte sie. Aber da sind nur Robert und die Mutter, die reglos dasteht. Sein Blick fällt auf das Küchenmesser, und mit einer schnellen Bewegung hebt er es auf. Weder seine Mutter noch der Mann achten auf ihn.
»Ich bin lang unterwegs gewesen.«
Der Fremde redet genau wie Mama, wenn sie nachmacht, wie Tante Ada geredet hat. Er muss einer von dort sein, aus der Heimat. Wenn Robert fragt, wo das ist, dann schüttelt die Mutter den Kopf. »Die Heimat gibt’s nicht mehr.«
Das versteht Robert nicht. Die Heimat ist doch ein Land. Kann ein Land sterben, verschwinden wie ein Mensch?
»Mali«, sagt der Fremde noch einmal.
Robert schiebt das Messer unauffällig unter die Fransenstola, mit der ihn die Mutter zugedeckt hat. Seine rechte Seite pocht noch immer. Der Fremde hat die Mütze abgenommen und dreht sie in den Händen. Als er den Rucksack von den Schultern gleiten lassen will, fragt die Mutter: »Wo ist deine Frau?«
Der Mann hält in der Bewegung inne, zieht die Schlaufen wieder über die Schultern.
»Tiefflieger. Sechs Wochen, bevor Schluss war.«
Die Mutter sagt nichts. Wenn die Frauen miteinander reden, kramen sie alle irgendwann ihre Toten hervor. Es ist, als würden sie sie in ihren Einkaufsoder Handtaschen immer mit sich tragen. Vielleicht werden die Toten in den Taschen unruhig, wenn man sie zu lange drinnen lässt. Dann muss man sie herauslassen, ihre Namen sagen, erzählen, wann, wo und wie sie zu Tode kamen. Der oder die andere antwortet:»Fürchterlich« und »Mein Beileid«, dann beruhigen sie sich und verschwinden wieder für eine Weile. Viele haben auch diese kleinen Bildchen zum Herzeigen, damit geht das Ganze noch besser. Aber der Mann zieht nichts aus der Tasche, und die Mutter sagt nicht, was man sagen müsste.
»Gut siehst du aus«, sagt der Fremde nach einer Weile und versucht ein Lächeln. Jetzt fällt sein Blick auf Robert.
»Der deinige?«
Die Mutter nickt, und als der Fremde ihn mit seiner kratzigen, tiefen Stimme fragt: »Wie heißt du denn?«, macht sie einen großen Schritt Richtung Sofa. Robert muss den Kopf verdrehen, um den Mann überhaupt noch zu sehen.
»Robert«, sagt Robert leise in den Rücken der Mutter hinein und die Mutter gleichzeitig laut zu dem Fremden: »Hier kannst du nicht bleiben.« Die Stimme der Mutter ist fest, aber ihre Knie beben, und ihr Atem geht flach und schnell. Sie verschränkt die Arme.
»Ich bin verlobt. Ein Engländer. Wir gehen bald weg.«
Was redet sie denn da? Onkel John mit den sanften Augen und dem hellen Schnurrbart, der immer Honig, Sardinen in Dosen, sogar Kaffee und Orangen brachte. Und natürlich Schokolade. Er lehrte ihn englische Wörter. Äppl. Sis is ä trie. Mei näm is Robert.
Wenn er auf Besuch kam, legte Ada immer die Kittelschürze ab und breitete das einzige ungeflickte Leintuch als Tischdecke im Wohnzimmer aus.
»Sei nicht blöd«, sagte sie zu Mali, »der würde dich sofort nach England mitnehmen, mitsamt dem Kleinen. Das ist ein Guter.«
Aber die Mutter wollte nicht. Dann wollte Robert auch nicht. Vera, die in dem kleinen Zimmer bei ihnen lebte, war ihnen lieber, auch wenn sie mit ihr nicht nach England fahren konnten.
»Wir können auch ohne Orangen leben«, flüsterte die Mutter abends, als sie ihn ins Bett brachte.
»Es gibt allein bei uns eine Viertelmillion mehr Frauen als Männer«, sagte die Tante, »du bist nicht bei Trost.« Mali zuckte mit den Achseln.
»Ich gebe dir was zu essen mit, und dann gehst du«, sagt sie jetzt, schiebt den Fremden kurzerhand ins Vorzimmer und schließt die Tür. Robert versteht nichts, obwohl er das Ohr fest an die Wohnzimmertür presst. Ein paarmal geht es hin und her, dann redet nur mehr der Fremde. Eine Schublade wird aufgezogen und wieder zugeworfen. Etwas klirrt. Robert rennt zum Sofa, schiebt das Messer unter sein Hemd und öffnet die Tür einen Spalt. Die Angel quietscht, aber sie bemerken ihn nicht. Er sieht, wie die Mutter dem Mann ein in Butterbrotpapier eingeschlagenes Päckchen in die Hand drückt und obenauf zwei Dosen Sardinen.
»Wenn es mit der Arbeit läuft, schicke ich Geld«, sagt er, macht eine Hand frei und streckt sie nach der Mutter aus. Obwohl er etwas verspricht, klingt es, als würde er bitten.
»Lass uns in Ruhe«, sagt sie gefährlich leise. Seine Hand fällt herab, das Gesicht ist noch grauer als vorhin. Er hebt mit einer müden Geste den Arm, als traue er sich nicht einmal mehr zu grüßen.
Die Mutter drückt die Tür hinter ihm zu, lauscht den sich entfernenden, schleifenden Schritten nach. Das Hinken, man kann es gut erkennen. Erst als nichts mehr zu hören ist, kommt sie ins Wohnzimmer zurück, sieht Robert mit dem Küchenmesser unter dem Hemd, nimmt es ihm weg, schimpft aber nicht.
»Mama, du weinst.«
»Aber nein«, sagt sie. »Und wenn, dann nur, weil ich so froh bin, dass ich dich habe. Komm her!«
Auf dem Sofa ist es ein bisschen eng für sie beide. Aber er muss stillhalten, er weiß, sie muss sich jetzt ausruhen. Das kennt er. Wenn sie so ist und keine Ruhe bekommt, steht sie nachts auf, wandert in der Wohnung umher und ist am nächsten Tag gelb und wortkarg.
»Wir haben keinen Platz für wen anderen«, sagt sie am nächsten Tag, ohne dass Robert gefragt hat.
Dabei haben sie mehr als genug Platz. Früher lebte Tante Ada mit ihrem Mann und zwei Kindern hier. Es gibt ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, eine Küche und zwei Kabinette. In einem wohnt Vera, die oft auf ihn aufpasst, wenn die Mutter zur Arbeit geht.
Das Ausruhen hat gestern besonders lange gedauert, Robert hat sich mindestens eine Stunde nicht rühren dürfen. Tante Ada hat der Mutter immer Tee und Umschläge gemacht, die geholfen haben, er kann nur still liegen, bis sie seine Hand nimmt und damit ihren Nacken oder den Bauch auf und ab bewegt. Auch das hilft offenbar. Sie seufzt dann mit geschlossenen Augen und irgendwann schläft sie ein. Wenn er sich aus der Kuhle herauswinden will, weil er es nicht mehr aushält, drückt sie seine Hand noch fester.
Als sie mit Roland auf der Mauer hinter dem alten Feuerwehrhaus saß, blühte der Löwenzahn und unentwegt rief ein Kuckuck, sie weiß es noch genau. Kinder aus der Nachbarschaft spielten mit Holzschwertern und schauten ein paarmal neugierig zu ihnen herüber. Roland schien das nicht zu kümmern, und Mali hielt das für ein gutes Zeichen. Der Frühling, das Aufblühen und der unbeirrbare Vogelgesang waren wie herausgeschnitten aus allem anderen. Die Jungen starben und die Alten blieben, es gab kaum anderes als Vergehen. Vergehen und Verrecken. Aber für eine Weile musste sie es nicht mehr sehen.
Rolands Gesicht, Rolands Worte, Rolands Berührungen: Jetzt wusste sie, wofür es sich lohnte. Sie und Roland waren oft miteinander verzweifelt gewesen. Dass darin etwas Schönes lag, wem hätte sie das erklären können? Dass es so viel besser war, etwas zu fühlen, nachdem ihr Leben seit dem Tod der Mutter in ein graues, flächiges Nirgendwohin verlaufen war. Roland und sie redeten stundenlang, aneinandergeschmiegt in der Kälte, die durch die Ritzen in den Heuschober drang, in dem sie sich nachts manchmal trafen.
»Es wird unser Unglück sein, was wir ihnen angetan haben«, sagte Roland.
»Wieso sagst du wir?«, fragte Mali. »Du und ich, wir haben doch niemandem etwas getan.«
Roland kannte Leute, die welche kannten, die. Seine Quellen waren verlässlich.
Mali wurde eine Meisterin darin, lautlos vom Hof zu schleichen, wo sie den Reichsarbeitsdienst leistete. Dass sie wenig redete und kräftig in der Schmiedewerkstatt zupackte, obwohl sie auf dem Gymnasium war und Latein und Englisch konnte, wurde ihr als sympathischer Zug ausgelegt. Die schwere Arbeit machte ihr nichts aus, sie tat sie nicht für diese Leute. Wenn sie arbeitete, musste sie nicht an die Mutter denken, nicht an die Todesmeldungen, die wöchentlich mehr wurden, nicht an die Flugzeuge, die jetzt noch über die Gegend hinwegzogen, und nicht an das Gemunkel über irgendetwas Ungeheures, nicht weit weg im Nordosten. Seitdem sie Roland kannte, glaubte sie es. Gesehen hatte sie schon vorher einiges, aber sie hatte es nicht verstanden, es schien zufällig zu geschehen, ohne Sinn, aus grausamer Willkür. Zuerst wurde den Zwillingen vom Uhrengeschäft, das Juden gehörte, der Hund vergiftet, dann die Scheiben eingeschlagen und der Laden verwüstet. Mali hatte die Gesichter gesehen, als sie mit dem Rad von der BDM-Stunde heimgefahren war, hinten den Korb mit der ekelhaft kratzigen Wolle, aus der sie Socken für unsere tapferen Soldaten stricken mussten. Als sie das Klirren gehört hatte, war es schon zu spät für einen Umweg gewesen. Den Mann hatten sie die Treppe hinuntergestoßen und den Verletzten einfach auf den Gehsteig gerollt. Die Frau hatte einer an den Haaren gezerrt. Von Mali hatte niemand Notiz genommen. Sie war noch in Uniform und trat in die Pedale, so fest sie konnte.
Roland erzählte sie alles. Auch dass ihr der Führer gleichgültig war und, seitdem die Mutter gestorben war, sogar Gott. Vor der Stimme des Führers im Radio hatte sie schon als Kind Angst gehabt, und dass ihre Schwester und ihr Vater sie deshalb auslachten, hatte es nicht besser gemacht. Auch Roland konnte den Führer nicht leiden. Außer Gott liebte er nur Mali, immer wieder sagte er es ihr. Wenn er es tat, war es wie Wasser, wenn man es dringender brauchte als alles andere auf der Welt. Sie hätte sich so etwas nie vorstellen können. Die Vorstellung von etwas Schrecklichem war immer viel einfacher als die von etwas Schönem.
Roland war zweiundzwanzig, sie achtzehn. Nachdem er als Achtjähriger von einem voll beladenen Heufuhrwerk gefallen und unter die Räder geraten war, war sein Knie steif geblieben, und er wurde nicht zum Wehrdienst eingezogen. Er arbeitete im Kreispostamt und las konfiszierte Bücher, die ihm ein Freund aus der Sammelstelle verschaffte. Roland war groß und muskulös, dennoch ein Krüppel. Einer, der seinen Dienst für Volk und Vaterland nicht an der Front leistete, war trotz des Geschwafels von der Heimatfront bestenfalls bedauernswert.
Weil sie hier sonst niemanden kannte, hatte sie an den freien Samstagnachmittagen den Halbbruder besucht, den sie erst ein paarmal gesehen hatte. Obwohl die Hausleute freundlich zu ihr waren und sie auch vor anderen als tüchtig und fleißig lobten, hasste Mali die Rotznasen der Bauernkinder, den von der Kernseife glitschigen hölzernen Waschzuber, den dampfenden Atem der Pferde und Kühe, ihre stumpfen, eindringlichen Blicke.
»Sie lassen alles mit sich machen, diese Tiere«, sagte sie zu Roland, während er ihr Heuhalme aus den Haaren zog und damit ihre Beine entlangfuhr. Sie gestand ihm, dass es ihr gefiel, wenn ein Pferd jemanden abwarf oder eine Kuh beinahe jemanden an der Stallwand erdrückte.
Roland küsste ihre Knöchel, ihre Knie. Beide waren überrascht von ihrem Hunger. Bisher hatte Mali mit Sex nicht viel mehr als ein heimlich mit anderen Kindern beobachtetes verschwitztes Ringen, Keuchen und Rangeln verbunden, bleich leuchtende Hinterbacken und hilflos zappelnde Frauenbeine, bei deren Anblick sie sich geschworen hatte, mit mir nicht, niemals. Jetzt erforschten sie einander Zentimeter für Zentimeter. Er ertastete die Stellen zwischen Nacken und Schulterblatt, zwischen Hüftknochen und Oberschenkel. Es vergingen Stunden, in denen sie einander nicht losließen. Sie kannten jeden Unterschlupf in der Umgebung.
Mali begann in der Bibliothek Geschichten über verbotene Lieben zu suchen. Sie las sie ihm alle vor: Heloïse und Abaelard, Tristan und Isolde, Romeo und Julia.
Romeo, Romeo, wherefore art thou, Romeo?
Deny thy father, and refuse thy name.
With love’s light wings did I o’er-perch these walls.
For stony limits cannot hold love out.
And what love can do, that dares love attempt.
Deny your father. Der Vater hatte Rolands Mutter regelmäßig Geld zukommen lassen. An den Geburtstagen hatte er ihn manchmal besucht, ihm Fragen gestellt und auf die Schulter geklopft, wenn er zufrieden war. Das Kind war schüchtern, verstockt, aber einmal, als der Vater gehen wollte, habe er sich an ihm festgeklammert, bis dieser ihm eine Ohrfeige gab und genauso erschrocken schien wie der Junge selbst.
»In deinen Geschichten gibt es kaum Überlebende«, sagte Roland. »Nicht ein einziges Mal kommen sie davon.«
Das sei doch nur Literatur, entgegnete Mali, daran zähle die Wahrhaftigkeit der Gefühle und die Schönheit. »Aber wir sind das wirkliche Leben«, sagte sie. »Das Leben ist stärker.«
»Du bist stärker«, antwortete Roland und zog sie an sich. Sie ließ ihre Hände über seine Oberarme gleiten, schüttelte heftig den Kopf.
Nach Amerika, Kanada oder Australien würden sie gehen, wenn das hier vorbei war. Dort wusste keiner und fragte keiner. Sie hatten nicht einmal denselben Familiennamen. Sie hörten BBC, lange konnte es nicht mehr dauern. In den Gasthäusern nahmen die Wirte nach und nach die Karten mit den beflaggten Stecknadeln ab, die den Frontverlauf markierten, mochte das Radio noch so laut vom Endsieg brüllen. Eine andere Zukunft als mit Roland war für Mali nicht vorstellbar. Sie malte sich das Leben, das sie führen würden, immer wieder bis in die letzte Einzelheit aus. Mithilfe zerschlissener Reclam-Ausgaben der Shakespeare-Dramen und einer Grammatik aus einer Reformschule der Zwanzigerjahre versuchte sie, ihr Englisch zu verbessern. Alles konnte sie sich vorstellen, nur nicht, dass es nicht wahr wurde.
Der Kuckuck rief immer noch. Heiraten? Das musste ein Missverständnis sein. Wen, um Gottes willen, und wann? Bis zum Warum drang sie gar nicht durch, dabei wäre das die einzige Frage gewesen, auf die es ankam.
Vielleicht damit sie sie nicht doch noch stellte, redete und redete er, aber seine Worte fielen allesamt durch sie hindurch. Sie verstand nichts, kein einziger Satz ergab auch nur irgendeinen Sinn. Schande. Blut oder Rasse: Sie waren sich doch einig, dass das nichts als strohdummer Aberglaube war. Und wenn es bei anderen tausendmal Sünde wäre: Doch nicht bei ihnen. Das zwischen ihnen war heilig.
Am schlimmsten war es, als sie an jenem Abend noch glaubte, die richtigen Worte, der richtige Blick könnten alles zum Guten wenden. Als käme es nur auf sie allein an.
Dabei hatte er sich längst von ihr verabschiedet, bevor er ihr von der Verlobung erzählt hatte, hatte sie weggeworfen, ohne dass sie eine Chance bekam. Ihr blieb nichts übrig, als dem Urteil zuzuhören, das er über sie beide gefällt hatte. Aber warum und wann? Sie weinte nicht und flehte nicht, wiederholte nur diese beiden Fragen wieder und wieder.
Irgendwann wurde er ärgerlich. Irgendwann schrie sie, und er hielt ihr den Mund zu. Irgendwann ging er.
Mali blieb auf der Mauer sitzen. Sonst hätte es gut sein können, dass sie zu Staub zerfallen wäre. Alles war möglich, so wie auch wenige Stunden zuvor alles möglich gewesen war, nur von der Seite des Glücks her. Sie rührte sich nicht. Alles verlachte und vernichtete sie: die blitzenden Sterne, die Windböen, das Käuzchen, die rauen Steine unter ihren Schenkeln, die milde Kühle der Nacht.
Wie sie nach Hause gekommen war, wusste sie nicht. Irgendwann im Morgengrauen auf ihrem Bett erschrak sie von einem hohen, klagenden, an- und abschwellenden Geräusch, bis sie erst mit Verzögerung erkannte, dass es ihr eigenes Weinen war. Es schüttelte sie tagelang immer wieder.
Dass Roland mit ihr auch sein Kind wegwarf, von dem sie seit ein paar Wochen wusste, war keineswegs ihr heimlicher Triumph und nichts, was ihr Macht verlieh. Mali hätte sich zu helfen gewusst. Doch irgendwann rollten die Stricknadeln klappernd unter das Bett und sie goss die Kräuterbrühe in den Ausguss.
Zu verschwinden war einfach. Kurz nach der Kapitulation passierten Abertausende zu Fuß und auf Pferdewagen ihre Heimatstadt, die an einer der großen Fluchtrouten lag. Eine junge Frau mehr, die sich alleine durchschlug, fiel nicht auf. Sie hielt sich in der Nähe von anderen, war aber vorsichtig und verschwiegen. Das Problem war nicht die Schwangerschaft selbst, sondern dass sie in einem schwachen Moment den Namen des Vaters aus ihr herausbekommen hätten. Unfassbar, es für mehrere Hundert Kilometer sogar in einen der notorisch überfüllten Züge geschafft zu haben. Mali erinnerte sich an Arme, die sie hinaufgezogen hatten. Nicht einmal bedanken konnte sie sich, da es unmöglich war, sich umzudrehen, wenn man einmal ein, zwei Abteile weitergeschoben worden war. Dass sie kaum sprach, erregte keine Aufmerksamkeit. Es gab viele Gründe zu verstummen, die meisten Menschen hatten mit den eigenen genug zu tun. Etwas schlug um in diesen zwei Wochen, und wenn Mali später Vera davon erzählte, sah sie ihr Leben nicht nur äußerlich in ein Vorher und Nachher zerfallen. Nicht Roland war es gewesen, der es in zwei schlecht zueinanderpassende Teile gespalten hatte, sondern das Kind.
Einmal mussten sie zu Fuß über eine Brücke mit beschädigtem Mittelpfeiler und fehlendem Geländer. Die Leute, mit denen Mali seit ein paar Tagen unterwegs war, diskutierten noch, was am besten zu tun sei, da war sie schon den halben Weg drüben. Tags darauf stießen sie auf russische Soldaten, kauerten stundenlang in einem Geräteschuppen. Draußen hörten sie die Russen lachen und singen, einer von ihnen hatte eine wunderbare Stimme. Durch ein Astloch beobachtete sie sie beim Kartenspielen und Trinken, und als einige von ihnen sich zum Schlafen unter einem Baum zusammenrollten, während zwei, drei andere noch grölten, trat sie offen aus dem Stadel und ging gleichmütig mit ihrem Bündel an ihnen vorüber. Als sie es später der Tante in Wien erzählte, glaubte die ihr zuerst nicht. Mali verstand das. Sie meinte keineswegs, dass die Russen von ihrer Furchtlosigkeit beeindruckt waren. Vermutlich hatten sie an jenem Tag bloß ihre Dosis Wut, Essen und Alkohol schon gehabt. Beide Male war ihr die Gefahr gleichgültig gewesen. Nicht dass sie sie direkt gesucht hätte, die Gelegenheit bot sich ohnehin täglich. Aber sie ging ihr auch nicht aus dem Weg.
Mali widersprach, wenn später immer erzählt wurde, wie sehr Kinder, ob geboren oder ungeboren, den Müttern die Kraft zum Weitermachen gegeben hätten. Das war nichts als Kitsch, fand sie. Sie hatte im Gegenteil unzählige Male gesehen, dass Kinder den Frauen den letzten Lebensmut geraubt hatten: Wenn sie krank wurden und starben, wenn die Frauen zu langsam vorwärtskamen, weil sie von den geschwächten Kleinen aufgehalten wurden. Auch wenn es gewiss welche gegeben haben mochte, auf die zutraf, was man später so gerne hörte.
»Weißt du, was ich nicht ausstehen kann?«, würde Mali Jahre später zu Vera sagen: »Dass man von allen Geschichten immer nur ein oder zwei mögliche Varianten erzählen darf.«
Hätte Vera nicht so viel gefragt, wäre Mali all das nie mehr eingefallen. Nicht in jenen Jahren, in denen Erinnerungen Gift waren, das man wegsperrte. Sie war nicht anders gewesen, das meinte sie schon ihrem Kind schuldig zu sein. Die Kinder waren die Zukunft, das sagte jeder. Sie verdienten es, unbelastet zu sein, das glaubte auch Mali. Jeder glaubte es. Je weniger Vergangenheit, desto mehr Zukunft: Das war die falsche Rechnung, die fast jeder für richtig hielt.
Jetzt erinnerte sie sich wieder daran, obwohl es nicht angenehm war: Das Kind zu retten war nicht ihr oberstes Ziel gewesen. Obwohl es dann alles für sie wurde, von Anfang an. Sie hatte fürchterliche Angst, nicht genug zu essen für ihn zu bekommen. Nur jeden zweiten oder dritten Tag ergatterte sie einen Viertelliter Milch. Als Robert ein paar Monate alt war, musste sie ihn mit zerdrückten Erbsen zufüttern. Die Erbsen waren Teil der sogenannten Stalin-Spende, einer Gabe der Sowjets für die hungernde Stadtbevölkerung. Nach dem Ausklauben und dem Einweichen musste man noch die auskriechenden Maden abschöpfen. Erbsen würde sie in ihrem ganzen Leben keine mehr essen, das schwor sie sich.
Das Anstehen vor den Geschäften zehrte fast Malis gesamte Kräfte auf. Einmal fiel sie in einer Schlange mit dem Kind auf dem Arm in Ohnmacht. Dass drei Frauen vor ihr sie dann vorließen und eine ihr sogar etwas von ihrer eigenen Milchration abgab, war eine unerhörte Ausnahme von der Regel, nach der Menschen in Not nicht besser, sondern härter und egoistischer wurden.
John steckte ihr immer wieder Nahrungsmittel zu und brachte auch einen Stubenwagen aus lackiertem Rattan. Mali spielte sogar kurz mit dem Gedanken, dem Rat der Tante zu folgen. »Er wäre gut zu uns gewesen«, sagte sie zu Vera, die nicht widersprach, aber hinzufügte: »Solange du dankbar gewesen wärst.«
»Und dir soll ich nicht dankbar sein?« Mali meinte es als Scherz, aber in solchen Dingen verstand Vera keinen Spaß. »Nur über meine Leiche«, antwortete sie in ernstem Ton, sodass sie beide in Gelächter ausbrachen.
Eine Viertelmillion mehr Frauen als Männer! Die Tante gab keine Ruhe. »Ist ohnehin besser so«, fauchte Mali mit dem Kind auf dem Arm. Die Tante verstand die Welt nicht mehr, und Mali tat es leid, sie angeschrien zu haben.
Als sie damals schwer erkältet und fiebrig in Wien angekommen war, hatte ihr Ada keine Fragen gestellt, Kohlblätter aufgelegt, unablässig Kräutertee und Essigwickel gemacht und ihr Suppen eingeflößt, gekocht aus dem, was sich gerade auftreiben ließ. Die schleimigen Graupen waren eine Wohltat für den entzündeten Hals gewesen. Hin und wieder brachte die Tante sogar ein mit Weißwein verschlagenes Ei. Sie habe eben ihre Verbindungen, sagte sie und lächelte stolz.
In Malis Brust saß wochenlang ein heißer Klumpen, der ihren Atem auffraß, während es sie verrückt machte, dass sie sich nicht mehr an Rolands Stimme erinnern konnte. Wenn sie sich zu sehr darauf konzentrierte, bekam sie Nasenbluten, das kaum zu stillen war. Nachts, wenn Mali die heiße Stirn am Fensterglas kühlte, nachdem sie aus dem Schlaf aufgeschreckt war, sah sie im Haus gegenüber schattenhafte Gestalten ein und aus huschen. Einmal stürzte krachend ein Holzbalken auf die Straße, und jemand schrie. Jede Woche kam in den Abbruchhäusern jemand ums Leben oder verletzte sich schwer. Seit ihrem Aufbruch hatte Mali Dutzende Tote gesehen. Für etwas anderes als Gleichgültigkeit und Schlaf war in den Wochen nach ihrer Ankunft keine Kraft.
John hatte sie gleich am ersten Tag kennengelernt. Der alte Stadtplan, den sie von zu Hause mitgenommen hatte, hatte sich als hilfreich erwiesen, trotz der vielen abgeriegelten Straßen, derentwegen sie große Umwege machen musste und sich ein paarmal verlief. Als sie sich irgendwo an einem Hydranten wusch, wo die Leute auch Wasser holten, denn straßenweise waren die Leitungen zerstört, sprach er sie an. Er war freundlich, zeigte sich begeistert von ihrem unsicheren Englisch und drückte ihr einen Zettel mit seinem Namen, einer Adresse in der britischen Zone, ein Stück Weißbrot und eine Tafel Schokolade in die Hand. Wenn sie Hilfe brauche, solle sie sich dort melden.
Der Tag war sehr warm, und die Fliegen stiegen in Schwärmen von den Bombentrichtern und aus den Abbruchhäusern auf, wo dem Gestank nach da und dort zumindest noch tote Haustiere liegen mussten. Auf den Straßen wurde gekocht und Schutt weggeschaufelt. Die zahllosen Ruinen machten Mali Angst. Wohin sollte sie, falls die Tante auch ausgebombt war? Wenig später stand sie vor dem vierstöckigen, weitgehend unbeschädigten Jugendstilhaus. Die Tante war nicht zu Hause. Mali lehnte sich sitzend an die Wohnungstür und war bald eingeschlafen. Die Schokolade und das Weißbrot hatte sie ungeöffnet unten im Rucksack verstaut. So hatte sie zumindest ein Geschenk dabei.
Dass die Tante auch das Baby als Geschenk betrachten würde, hätte Mali nicht erwartet. Ada, die alles zu wissen schien, was man zum Überleben brauchte, brachte ihr bei, wie man aus Knochen und Pottasche Seife machte, falsche Sahne aus Milchpulver und Weizenmehl, die nicht einmal übel schmeckte, sie zeigte ihr, wie man Rost mit einem Glassandgemisch entfernte und vieles mehr. Als Mali den Kleinen immer schlechter stillen konnte, wurde er mit Zitronen-Zweidrittel-Milch gefüttert, bei der die Milch ganz fein gerann, was für den Säuglingsmagen besonders bekömmlich sei, wie die Tante wusste. Da waren ihre Beine schon monströs geschwollen. Das selbst genähte Ausgehkleid aus Fallschirmseide war das Letzte, was ihr Ada schenkte. Sie starb im Park, auf dem Schwarzmarkt, im Rucksack ein paar Zitronen von John und sorgfältig in Zeitungspapier gewickelte Mokkatassen von Augarten, die ihr jemand stahl, nachdem sie zusammengebrochen war.
John brachte noch eine ganze Weile Lebensmittel, obwohl sie ihm bald nach dem Tod der Tante die Schachtel mit den neuen Damenschuhen aus hellbraunem Leder, die er ihr mitgebracht hatte, ohne ein Wort zurückgab. Eine ganze Weile standen sie da, den Karton zwischen sich. Es war nichts, was Mali geplant hatte, im Gegenteil, die halbherzigen Gedanken, sich mit ihm zusammenzutun, waren wieder aufgetaucht. Aber als er nun mit seinen gutmütigen Augen, hinter denen die Erwartung lauerte, vor ihr stand, da wusste sie, es käme nicht infrage, denn egal, wie freundlich er es meinte, eines Tages würde er sie für ihre Rettung zahlen lassen und dafür, dass sie ihn nicht liebte und nie lieben würde.
Sie erklärte nichts, ebenso wenig wie Roland es getan hatte. John verstand auch so, was er verstehen musste, und als er schließlich ohne ein Wort ging, zog er die Tür hinter sich behutsam zu, um das Kind nicht zu wecken.
Als sie im zweiten Stock ihren rasselnden Atem bemerkt, nimmt Mali der Fremden den Rucksack ab, der tatsächlich enorm schwer ist. »Was hast du da drin, Steine?«
Vera lehnt sich zum Luftholen an das Geländer, grinst. »Wart’s ab.«
Sie hat wache Augen, nicht aber dieses Huschende, Lauernde, das jetzt sogar die Todmüden an sich haben.
Man muss mit allem rechnen, sogar mit dem Wunderbaren, das hat Mali gelernt: John lässt sie nicht hängen, obwohl sie ihn auf Abstand hält. Als sich Mali wegen einer Arbeit an ihn wendet, hat sie die Wahl zwischen ihren einzigen Damenschuhen, schwarzen Raulederpumps mit schiefgelaufenen Absätzen, oder recht passabel aussehenden blauen Riemchenschuhen mit Zierstanzerei von der Tante, die aber eine gute Nummer zu groß sind. Sie entscheidet sich für Letztere, trägt sie in einer Tasche mit, da sie darin keinesfalls die zwei Kilometer zu Fuß zum Parkhotel Schönbrunn zurücklegen kann, das die Briten beschlagnahmt haben. Eine Straßenecke vor ihrem Ziel stopft sie die Schuhspitzen mit Papier aus und legt das letzte Stück gemessenen Schrittes und mit verkrampften Wadenmuskeln zurück. Der Kleine ist bei der Hausmeisterin, einer gutmütigen Person, die in ihrem Wohnzimmer eine improvisierte Schneiderei betreibt und vermutlich noch andere Geschäfte abwickelt, Mali will es gar nicht wissen. Robert ist ein unkompliziertes Kind, das sich begeistert und ausdauernd mit Knöpfen, Stoffresten oder anderem herumliegenden Zeug beschäftigen kann. Dennoch lässt ihn Mali nur dort, wenn es nicht anders geht.
Die Fassade des palastartigen Hotels scheint unbeschädigt, die Fenster sind intakt. Das Gesicht der Wache am Eingang wird sofort freundlicher, als sie Johns Namen nennt. So gut es geht, ignoriert sie das Bild, das ihr aus den raumhohen Spiegeln in den Gängen entgegenspringt, schäbig und steif in den zu großen Schuhen, der Hals faltig wie bei einer alten Frau. Sie späht durch einige offene Zimmertüren, John ist nirgends zu sehen.
Nachdem sie eine Weile gewartet hat, tippt er ihr auf die Schulter. Sie haben sich ein gutes Jahr nicht gesehen. Älter sieht er aus, ist schmaler geworden, aber er ist freundlich wie immer. Zwei Telefonate, dann schreibt er ihr eine Adresse auf. Ein befreundeter Arzt brauche eine verlässliche Sprechstundenhilfe. Sie müsste mit einem Teil der Patienten Englisch sprechen, anfangen solle sie, falls alles klappe, gleich nächste Woche.
»No problem«, sagt sie, schiebt ihr Erschrecken schnell hinter ein Lächeln. Morgen? Wohin so schnell mit dem Buben? Sie kennt niemanden, dem sie den Kleinen regelmäßig überlassen könnte. Dann fällt ihr die junge Frau mit dem Rucksack und dem Pappschild wieder ein, die sie auf dem Weg hierher vor der Ausgabestelle für Lebensmittelkarten gesehen hat. Suche Schlafplatz gegen Mithilfe im Haushalt.
Die Frau, fast noch ein Mädchen, hat Malis Blick einen Moment festgehalten, aufmerksam, weder flehend noch abschätzend. Das ist selten, die Menschen sehen einander kaum an. Wird man wie so oft wegen irgendetwas angesprochen, angebettelt und benötigt selbst nichts, vermeidet man den Augenkontakt möglichst, so hält es auch Mali. Veras Blick ist anders, das hat Mali registriert und gleich wieder vergessen.
Sie bedankt sich verlegen bei John, was wiederum ihn so verlegen macht, dass er sie rasch zur Tür hinausschiebt. Wie dumm von ihr, dass sie ihn nicht liebt, denkt sie. Dumm, komplett verblödet, aber nicht zu ändern.
Überall sind Leute, die eine Unterkunft suchen, normalerweise achtet Mali nicht auf sie. Viele Häuser sind zur Gänze oder teilweise unbewohnbar, die Stadt ist voller Flüchtlinge und Heimkehrer. Seit dem Tod der Tante ist Mali in Sorge, dass man ihr jemanden zur Unterbringung zuweist. Die Wohnung ist viel zu groß für sie und das Kind. Bis jetzt hat man sie aber in Ruhe gelassen, als würde es helfen, dass sie sich so unsichtbar wie möglich macht. Auch das war leichter, als Ada, die sich im Viertel bewegte wie ein Fisch im Wasser und alles besorgte, was sie brauchten, noch da war. Neben ihrem Faible für John drängte die Tante sie immer wieder dazu, zumindest mit den jüngeren Nachbarinnen zu reden, scheiterte aber an Malis schweigendem Widerstand. Wenn überhaupt, dann wechselt sie jetzt ein paar belanglose Sätze mit älteren Frauen, fühlt sich sicher in deren melancholischer Mütterlichkeit, mit der sie sie als alleinstehende Frau mit Kind behandeln. Sie sind meist zu erschöpft für tiefergehende Gespräche oder irgendwelche Verbindlichkeiten, freuen sich an dem Klang einer freundlichen Stimme und vielleicht der Erinnerung an die eigene Jugend.
Die Einsamkeit tut Mali gut. Wenn sie die Suchmeldungen des Roten Kreuzes im Radio hört, dreht sie ab. Obwohl sie sich alle paar Wochen vornimmt, wenigstens nach ihrer Schwester zu suchen, tut sie es nicht. Warum? Sie weiß es nicht. Mali gewöhnt sich ab, über sich selbst nachzudenken. Mit einem Kind ist das zum Glück nicht schwer. Es lenkt einen ab, immerzu will es etwas, immerzu ist es hungrig. Ada, die gut zu ihr war, fehlt Mali, dennoch ist da auch eine gewisse Erleichterung, für die sie sich schämt. Mit dem Tod der Tante, die eigentlich eine Cousine ihrer Mutter war, ist eine letzte Verbindung gelöst worden. Jetzt gibt es hier niemanden mehr, der bezeugen könnte, wer sie ist.
Die Frau mit dem Schild ist noch da. Als Mali sie anspricht, muss sie sich räuspern, sie ist so etwas nicht gewohnt. Das Zimmer, das sie ihr anbieten könne, sei groß und so gut wie leer, aber eine Rosshaarmatratze gebe es. Das Bettgestell hätten sie allerdings im letzten Winter verheizen müssen.
Die junge Frau will nur wissen, wie weit es ist. Sie deutet auf ihren Rucksack. Der sei richtig schwer, und sie habe heute keine Zeit zum Essen gefunden. Dann zwinkert sie Mali zu, die den Sarkasmus nicht gleich erfasst.
»Vera.« Sie streckt Mali die Hand hin. Kein Nachname, kein »Ich komme aus –«. Der Aussprache nach ist sie Österreicherin, ihre Stimme hat Kraft. Links vorne fehlt ihr ein Zahn, sie ist blass und über das Jochbein zieht sich ein Bluterguss. »Heute ist mein Glückstag«, meint sie noch, lächelt breit. »Ich kann gut umgehen mit Kindern.«
Als sie den Kleinen von der Nachbarin holen, krallt sich der in Malis Rock, bis sie ihn zwischen die Schulterblätter kneift. Vera wirft nur einen kurzen Blick in das Zimmer, das ihr Mali zeigt, und meint: »Alles bestens. Ich nehme es, wenn es dir recht ist.«
Mali schaut sie von der Seite an. Ihre Zahnlücke ist ziemlich groß, sodass die Wange auf dieser Seite etwas eingefallen ist. Sonst hat Vera feine Züge, aber sie stinkt ein bisschen nach Schweiß und Holzfeuer.
»Wo hast du denn in den letzten Tagen geschlafen?«
»Ach, mal da, mal dort. Meinst du, ich könnte mich dadrin waschen?«
Ihr Haar ist verfilzt. Sie hat Kleider in mehreren Schichten an, unter einem Blusenkleid trägt sie eine schmale Männerhose. Es gibt noch einen alten Waschtisch im Zimmer. Schon ist sie draußen zum Wasserholen an der Bassena.
»Das Wasser im Bad funktioniert!«, ruft ihr Mali nach. John hat ihr jemanden geschickt, der das beschädigte Rohr instand gesetzt hat, trotzdem holt sie das Wasser oft draußen, aus Gewohnheit und damit die Nachbarn nicht bemerken, dass die Leitung bei ihr repariert ist. Wegen John hat es ohnehin Gerede gegeben.
Mali wärmt die Suppe von gestern, verscheucht den Kleinen, der sich an Veras Rucksack zu schaffen macht. Das klebrige Brot bröckelt schon wieder, obwohl sie es ganz vorsichtig schneidet. Draußen hört sie Vera mit dem Wasser plätschern. Mali sucht fahrig nach dem Anzünder. Beinah lässt sie einen Teller fallen. Sie hat heute Arbeit gefunden und jemanden, der auf Robert aufpasst. Jemand Netten, obwohl sie das noch nicht wirklich wissen kann, sie kennt Vera erst seit einer Stunde. Malis Herz klopft. Es fühlt sich alles zu gut an, das macht sie unruhig.
Zehn Minuten später sitzen sie am Wohnzimmertisch, Vera in Adas Schlafrock und Adas Stricksocken, die ihr Mali gebracht hat. Erst jetzt sieht Mali, wie kurz Veras Haar ist. Die bemerkt ihren Blick und sagt achselzuckend: »Selbstgeschnitten. Nicht gerade elegant, ist mir klar.«
Die Suppe riecht gut, obwohl sie nur aus Gemüseschalen gekocht ist. Der Kleine bekommt ein paar Löffel von den feinblättrigen Haferflocken dazu, von denen sie fünf Kilo hatte, die nun langsam zur Neige gehen. Während Mali den Tisch deckt, flüstert und scherzt Vera mit dem Buben, der ihr nach ein paar Minuten zugeht, als würde er sie schon ewig kennen. Begeistert zeigt er seiner Mutter einen kleinen gelblichen Steiff-Bären mit richtigen Glasaugen und einem blauen Bändchen um den Hals. Er riecht genauso nach Holzfeuer wie Veras Kleider.
»Das war meiner, als ich klein war«, sagt sie.
»Den musst du doch behalten«, protestiert Mali, während Robert das Gesicht verzieht und das Stofftier an sich drückt.
»Ach was«, entgegnet Vera und schaut Mali dabei in die Augen. »Je weniger man behält, umso besser.«
Malis Kopf schwirrt. Sie möchte fragen, wie Vera das meint, bringt aber die Worte nicht heraus. Neugierde auf einen anderen Menschen ist Mali fremd geworden. Dabei möchte sie tatsächlich etwas über Vera wissen. Da ist etwas Halbvergessenes, das wehtut und sich steif anfühlt wie ein Muskel, den man lang nicht mehr benutzt hat. Sie taucht den Löffel in die Suppe, ihre Hände zittern. Die Gewissheit, dass sie etwas verloren hat, versetzt ihr einen Stich. Etwas Großes. Nicht Roland, nicht die alte Heimat, es ist etwas Grundsätzliches: die Fähigkeit, sich etwas nahegehen zu lassen. Sie kann es nicht ändern. Was bleibt einem auch übrig? Die anderen, die es nicht zustande bringen, sich zu beherrschen, wenn es nötig ist, das sind die, die wirres Zeug aus den Fenstern schreien, sich auf der Straße die Kleider herunterreißen oder in den Ecken kauern und aus ihren nie endenden Gesprächen mit sich selbst oder den Toten nicht mehr herausfinden. Die Stadt ist voll mit solchen Leuten. Die anderen meiden sie, als könnten sie sich anstecken.
Vera hat ihre Suppe ausgelöffelt, schiebt mit einem dankbaren Lächeln den Teller weg und weiß von nichts, dennoch liegt es an ihrem freimütigen Blick und an ihrer anziehenden Verletzlichkeit, dass Mali sich erinnert. Sie streckt die Hand nach dem Buben aus, er klettert auf ihren Schoß. Vera hangelt mit dem Fuß nach dem Rucksack und holt das größte Stück Speck, das Mali je gesehen hat, aus dicken Schichten von Zeitungspapier.
»Würde das reichen für die erste Monatsmiete?« Vera freut sich über die fassungslosen Gesichter. Der Rucksack ist voll mit Lebensmitteln: Roggenbrot mit Kümmel und ganz ohne Sägespäne, eingelegte Gurken, zwei große Gläser Marillenmarmelade, Mehl, Äpfel, Graupen, Zucker, Reis, Salz, getrocknete Zwetschken, Walnusskerne. »Damit kommen wir Wochen aus. Wir könnten auch etwas davon tauschen.«
»Woher hast du das?«
»Ich komm vom Land. Nicht weit weg. Bin aber abgehauen.«
Vom Land in die Stadt, wo fast alle zu wenig haben?
»Wie hast du das alles bloß durch die Kontrollen gebracht?«
Vera beugt sich vor. »Ist das wichtig?«
Nein, ist es nicht, in Wahrheit ist es Mali egal. Die Fragen gewähren ihr nur Aufschub, während sie sich bemüht, die Tränen zurückzuhalten.
»Wie alt bist du eigentlich?«, fragt Vera, während sie Robert ein kleines Stück Speck herunterschneidet. So etwas hat er noch nie gegessen.
»Fast dreiundzwanzig. Und du?«
»Zweiundzwanzig«.
»Siebzehn«, vermutet Mali. Da ist es wieder, dieses breite Grinsen. Und der offene Blick.
»Touché. Neunzehn. Ich hab sogar einen Ausweis, schau.«
Mali wehrt ab.
»Du hast doch bestimmt noch ein paar Gläser in dieser noblen Bude. Wir haben was zu feiern heute.« Vera zieht einen Flachmann aus der Tasche.
»Kein Champagner. Besser.«
Schließlich essen sie eine Menge Speck, fast den ganzen Brotlaib und löffeln ein Glas Marillenmarmelade aus. Dazu trinken sie aus böhmischen Kristallgläsern Wasser und den Obstler aus Veras Flasche, der wunderbar in der Kehle brennt. Irgendwann legt Mali den schlafenden Buben auf das braune Samtsofa ins Wohnzimmer.
Tot, hätte Mali auf Veras Frage nach Roberts Vater antworten müssen. Ein Wort, das den Fragenden fast immer zum Verstummen bringt. Vielleicht nicht Vera, vielleicht nicht in dieser Nacht, doch ein paar wenige Sätze lang hätte Mali durchhalten müssen. Nicht einmal lauter Lügen hätte sie erzählen müssen, eine Mischung aus Wahrem und Erfundenem lässt sich am leichtesten anbringen, vorausgesetzt man behält die Details. Sie stehen nebeneinander vor dem schlafenden Kind, als die Frage kommt, Vera mit einem Glas in der Hand, sie hat schon einiges getrunken und ist bestimmt nicht mehr so hellhörig wie sonst. Auch Mali spürt den Schnaps, obwohl sie nur ein paar kleine Schlucke genommen und so viel gegessen hat wie schon lange nicht mehr.
»Ich kann nicht darüber sprechen«, das hätte sie sagen müssen. Vera wirkt unbefangen, aber nicht taktlos. Außerdem ist es Malis Wohnung, sie könnte sie jederzeit hinauswerfen. Stattdessen erzählt sie Vera in den folgenden Stunden die ganze Geschichte. Flüsternd, um das Kind nicht zu wecken, brechen Details aus ihr heraus, an die sie nie mehr gedacht hat, Wichtiges und Unwichtiges, die Wolkenbilder, die sie und Roland einander beschrieben haben, das Tanzen unter dem Mond, er mit seinem steifen Bein, die englischen Sätze, die sie einander vorgesprochen haben für später, und schließlich die letzte Nacht auf der Friedhofsmauer. Die Kräutertees, die Stricknadeln, der Zug. John, und dass sie davon überzeugt ist, dass in ihr außer für das Kind keine Liebe mehr übrig ist, nicht einmal das, was es braucht, um sie einigermaßen vorzutäuschen. Vera unterbricht nicht, verzieht keine Miene. Malis Körper fühlt sich weich an, nachgiebig, sie könnte sich nicht auf den Beinen halten, wenn sie jetzt aufstünde. Sie muss verrückt geworden sein, aber es ist zu spät, es zu bereuen. Vera hält ihre Hand, es ist etwas Selbstverständliches. Sie spürt die schartigen, verhornten Stellen in Veras Handfläche.
»Und du?«
Vera fährt mit dem Zeigefinger das bläuliche Mal auf ihrem Gesicht nach, starrt auf den leeren Teller.
Ein Frühsommerabend, nicht lang her. Er habe sie wohl gesehen, als sie aus der Scheune gekommen sei. Sie habe noch die Hühner gefüttert und wegen des aufziehenden Gewitters Tore und Dachluken verriegelt. Der Himmel sei schon schwarz gewesen, sie habe nicht gedacht, dass noch jemand draußen sei. Normalerweise höre man die Soldaten, aber vermutlich war der Wind zu stark oder sie waren zufällig leiser gewesen als sonst.
Er ist allein, deshalb ist sie zunächst nicht beunruhigt. Er spricht sie an, lächelt sogar dabei. Als sie sich rasch abwenden will, im Kopf überschlägt, wie viele Schritte es bis zum Haustor sind, spürt sie schon etwas Hartes im Rücken, hört das Klicken der Waffe. Er deutet auf eine Baumgruppe in der Nähe, neben dem Feld. Der Wind tost, ein-, zweimal wehen Fetzen von Gelächter zu ihnen herüber. Er redet auf sie ein, sie versteht nicht, er wird lauter, dem Ton nach beschimpft er sie. Trotz allem kommt er ihr nicht sonderlich böse vor, eher so, als müsste er sich selbst davon überzeugen, dass er wirklich will, was er vorhat. Dass es kühl ist, hilft ihr beim klaren Denken. Sich zu wehren hat keinen Sinn, sie wird es aushalten, Angst empfindet sie keine. Sie kennt schon viele Geschichten. Sie bewegt sich langsam, er treibt sie zur Eile, sieht sich nervös um. Sie denkt, wie verrückt das ist, dass er Angst hat, während sie nichts fühlt, keine Panik, auch nichts anderes, absolut nichts. Sie sieht sich selbst, wie sie sich am Rand des Feldes hinlegt. Während er seine Hose öffnet, denkt sie, wie jung er ist, wahrscheinlich nicht älter als sie. Der Moment, in dem er seine Waffe zu Boden gleiten lässt, da flammt etwas auf in ihr. Ein- oder zweimal schlägt er sie ins Gesicht, nicht besonders fest.
»Die Wut kam seltsamerweise nicht von dem, was er mir gerade antun wollte. Nicht in dieser Sekunde. Sondern weil er sich so sicher gefühlt hat, dass er nicht einmal mehr die Waffe bei sich behalten hat.« Das erste Mal, seitdem sie spricht, sucht Vera Malis Blick.
Der Stein in ihrer Hand: reiner Zufall, dass sie ihn ertastet und dass er die richtige Größe hat. Zufall auch, dass es die Linke ist. Dass sie exakt die richtige Stelle erwischt. Der Mann gibt keinen Laut von sich, rollt von ihr herunter zur Seite. Sie bleibt noch ein paar Augenblicke liegen, zwingt sich dann, ganz langsam zurückzugehen, obwohl der Regen schon losbricht. Ihre Mutter sieht sie kurz vor dem Haus vom Fenster aus, hat aber nichts von dem Geschehenen mitbekommen. Sie schreit sie an, ob sie verrückt sei. Die Blitze zucken. Und der Regen. Am liebsten wäre sie gar nicht ins Haus, sondern ewig weitergegangen in diesem Regen. Sie sagt zu niemandem ein Wort, bringt die ganze Nacht mit offenen Augen zu. Ihre Zähne klappern so, dass sie meint, das würde nie mehr aufhören. Gegen Morgen schläft sie ein.
Kurz darauf finden Nachbarn den GI. Er liegt unter einem Baum, der im Gewitter umgestürzt war. Man nimmt an, dass der Stamm ihn erschlagen habe, während er betrunken am Feldrand eingeschlafen sei oder vor dem Gewitter Schutz gesucht habe. »Ich weiß nicht, ob ich ihn getötet habe. Oder der Baum. Oder beides zusammen.« Vera räuspert sich, flüstert noch immer. »Der Baum hat mich jedenfalls gerettet.« Sie nimmt einen Schluck Schnaps.
Irgendwann bewegt sich der Kleine und jammert im Schlaf.
»Du hast dich selbst gerettet.«
»Du dich auch«, sagt Vera.
Jetzt halten sie einander an den Händen. Für eine Weile sind sie ganz still. Als sie sich hinlegen, graut der Morgen.
Am nächsten Tag, übernächtig auf dem Weg in die neue Arbeit, ist diese Gewissheit wieder da: Es ist in Ordnung, sie werden nicht mehr darüber sprechen. Den ganzen Tag denkt Mail nicht mehr daran, konzentriert sich auf etwas anderes. Als sie nach Hause kommt, hat Vera gekocht, der Kleine strahlt. Sie tauschen einen Blick, das genügt.
Vera wohnt für mehrere Jahre bei Mali, danach zieht sie in eine Zimmer-Küche-Kabinett-Wohnung im Nachbarhaus. Sie sehen einander mindestens zwei Mal in der Woche. Robert liebt sie. Männerbekanntschaften meidet Vera. Außer Grete wird keine der beiden Frauen jemals jemand anderem diesen Teil ihrer Geschichte erzählen.
Lange Zeit ist es einfach: Wenn er nach seinem Vater fragt, erzählt sie Robert eine Geschichte, die ihr mit der Zeit so geläufig wird, dass sie beinah selbst daran glaubt. Dass er danach verlangt, ist zwar anstrengend, aber auch eine gute Übung darin, sie so flüssig und glaubhaft zu gestalten, dass sie sich sicher fühlt. Ihre Geschichte kommt ohne nächtliches Wachliegen aus, ohne Zittern, ohne Schuld und Verrat.
Foto hat sie keines mehr von Roland. Das einzige, ein Passbild, hat sie damals irgendwann verbrannt. Ein Foto hätte es leichter gemacht, denkt Mali. Vielleicht hätte Robert früher zu fragen aufgehört, wenn er ein Bild gehabt hätte. So muss sie ihm den Vater immer wieder beschreiben, Augen, Gestalt, Stimme. Natürlich auch alles, was er mochte und was nicht, welche Lieder er sang und was er gerne aß. Und was er gut konnte, vor allem das. In diesen Dingen hält sie sich an die Wahrheit. Sie erzählt Robert sogar von dem steifen Bein, und wie überaus geschickt sein Vater damit umgegangen sei, sogar Reiten und Klettern habe er gekonnt. Doch sie gibt ihm einen anderen Namen und einen schnellen Tod durch einen Tieffliegerangriff in den letzten Kriegswochen. In Roberts Geburtsurkunde steht in der Rubrik Eltern: Vater unbekannt. Sie hat sie gut weggeschlossen. Es dürfte nicht allzu schwer sein, den Eintrag ändern zu lassen. Sie hätte es schon vor Jahren tun sollen, als noch Hunderttausende ohne Dokumente waren, zahllose Akten vernichtet und die Überprüfungen kompliziert. Jetzt liegt die alte Heimat hinter dem Eisernen Vorhang. Eine tragische Angelegenheit, für Mali ein Vorteil. Eine Grenze wie diese sichert den Abstand, den sie braucht.
Nie hätte sie vermutet, dass Robert sich erinnert, Roland war so schnell wieder weg gewesen. Ein paar Wochen lang ist er ihr jeden Morgen beim Aufwachen wieder eingefallen. Jeden Morgen die sekundenlange Hoffnung, dass sie nur schlecht geträumt hat. Ein paar Wochen ist sie mit eingezogenen Schultern durch die Straßen gegangen, hat im Augenwinkel jeden Hinkenden registriert. Wer weiß, vielleicht hat ein winziger Teil in ihr sogar gehofft, dass er zurückkommt, sich nicht so schnell vertreiben lässt. Dass er kämpft um sie und den Buben. Hat er keinen Augenblick vermutet, dass der Kleine sein Kind sein könnte? Oder wollte er es gar nicht wissen? All die Fragen. Schlafende Hunde, denkt Mali. Jetzt bellen und knurren sie und lassen sie nicht mehr in Ruhe. Wie hat sie glauben können, dass das alles vorbei ist.
Aber das war es doch. Da war diese Nacht, nachdem sie Vera getroffen hat. Der Speck, der Schnaps, die Marillenmarmelade. Ein Wunder, dass sie sich nicht übergeben haben. Mali muss lächeln, wenn sie daran denkt. Ihre verschlungenen Finger auf der Tischplatte. Sie haben zusammengehalten.
Der kleine, wackelige Tisch ist noch derselbe wie damals. Vera drängt, dass sie endlich auch die Küche neu einrichten lässt, etwas Modernes, jetzt könnte sie es sich doch leisten, aber Mali will nicht. Einiges in der Wohnung ist renoviert, sogar das braune Samtsofa hat sie weggegeben. Aber die Küche muss so bleiben, wie sie war, hat Mali energisch gesagt. Vielleicht wegen dieser Nacht. Idiotisch eigentlich. Aber wenn ihr noch irgendetwas heilig ist außer dem Kind – die Gedanken kreisen.
Sie kramt nach der Zigarettendose. Eigentlich raucht sie nur im Büro. Die Küche hat nur eine Oberlichte in den Gang hinaus, aber das ist ihr egal. Als Roland damals vor dem Haus stand, war Vera gerade für ein paar Tage aufs Land zu ihrer Schwester gefahren. Mali hat sie vom Bahnhof abgeholt und ihr schon auf dem Weg nach Hause alles haarklein erzählt. Sie zieht an der Zigarette, als könnte sie damit die Scham vertreiben, die sie überflutet. Sie, die immer alles für sich behalten konnte, schon als Kind.
2
Das Holz, würde sie antworten, wenn irgendjemand sie fragen würde, was sie gerettet habe. Aber niemand fragt. Das ist ihr auch lieber. Reden ist für Vera immer mit einer gewissen Anstrengung verbunden. Mit der Arbeit in der Werkstatt ist das anders, die geht ihr leicht von der Hand. Auf dem Weg dahin sieht sie den Menschen ins Gesicht, einigen begegnet sie täglich. Vera weiß, wohin sie will, deshalb kann sie sie ansehen, grüßend die Hand heben, ein Lächeln riskieren, ohne das gewohnte Zittern in der Grube unter dem Kehlkopf. Die Obstfrau aus dem Banat steht zwischen den an die Mauer hinter ihr gepinselten mannshohen Lettern, die schon etwas verblasst sind: LSK für Luftschutzkeller und NA für Notausgang. Wenn Vera vorbeikommt, nicken sie und die Frau einander zu. Heute hat sie einen Kübel mit weißem Flieder und gelb-roten Tulpen vor sich stehen. Ihr Blick scheint sich darin zu verlieren. Seit Kurzem gibt es neben Kartoffeln, Steckrüben, Äpfeln hin und wieder Blumen zu kaufen.
Vera geht zügig durch Graugelb, Graubraun, Rötlichgrau, Grüngrau, Dunkelgrau. An vielen Tagen gibt es kaum andere Farben auf ihrem Weg durch die Innenstadt,