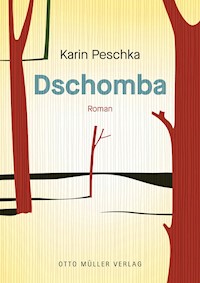Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Müller, Otto
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Nominiert für die Hotlist 2014 Wien, 1954. Die harten Nachkriegsjahre sind vorbei, Wiederaufbau und wirtschaftlicher Aufschwung prägen die Zeit. Doch nicht jeder findet Halt in einer Gesellschaft, die versucht, Krieg und Gewalt in die Vergangenheit abzuschieben. Lydia, Dragan und Heinrich gehören zu den Entwurzelten, die in einem Schuppen hausen und - jeder für sich - ein anderes Bild der Nachkriegsgesellschaft skizzieren. Der Serbe Dragan kämpft um eine Art Normalität, die er nicht findet. Lydia verliert sich in der Hoffnung, ihr Verlobter würde eines Tages aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehren. Heinrich, der "Watschenmann", hat sich eine eigene Gedankenwelt zurecht gelegt. Er zieht durch die Straßen und provoziert Passanten, ihn zu schlagen. Physische und verbale Hiebe steckt er ein, um den "Kriegswurm" freizulegen, der sich immer noch tief in den Menschen verbirgt. Heinrich entzieht sich Schmerz und Demütigung, indem er an ein Reptil oder einen Raben denkt, "an einen, der sich gegen den Wind stemmt." Mit ungeheurer Sprachwucht erzählt dieser Roman von der ambivalenten Beziehung dreier Menschen, die sich Stabilität und Halt geben, die sich schlagen und beleidigen, die an der Hoffnung festhalten. Karin Peschka fällt aus dem Rahmen der jüngsten deutschen Literatur. (Anton Thuswaldner, Salzburger Nachrichten)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 403
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Karin Peschka
Karin Peschka
Watschenmann
Roman
www.omvs.at
ISBN 978-3-7013-1220-7 eISBN 978-3-7013-6220-2
© 2014 OTTO MÜLLER VERLAG SALZBURG-WIEN Alle Rechte vorbehalten Satz: Media Design: Rizner.at
Jänner
„Psiću, wo warst?“, will Dragan wissen. Heinrich schüttelt den Kopf. Man wird nicht schlau aus ihm.
Kein Rabe für Heinrich. Die ersten zwei Regeln. Vielleicht auch die dritte.
An einen Raben will er denken, an einen, der sich gegen den Wind stemmt. Lydia meint, das stehe ihm nicht zu, das tauge nichts. „Warum?“ „Der Rabe ist zu hoch für dich, zu schön.“ Heinrich versteht nicht gleich. „Wirst schon verstehen“, sagt sie, sagt oft solche Sachen und erklärt sie dann nicht. „An was denkst du, Lydia, wenn du geschlagen wirst?“ Statt einer Antwort spuckt sie vor seine Füße. „Wirst wohl aufhören mit der Fragerei. Wochenlang redest nix, und dann.“
Heinrich weiß schon, dass es schwer ist am Anfang. Du wartest auf den Schlag, auf den Tritt gegen Arm oder Bein. Und weil du wartest, weil alles bereit ist, alle Nerven, weil die Haut sich hindehnt und die Synapsen im Kopf flimmern und zucken, weil das so ist, blitzt es. Wenn sich der Stiefel ins Schienbein bohrt. Oder der Absatz von Damenschuhen in die Rippen. Auch das gibt’s. Dann blitzt es vor den Augen, du gehst in die Knie, windest dich auf dem Boden. Wie ein Wurm, zwischen Hundehaufen und Dreck. Windest dich und stöhnst. Oder wimmerst. Noch schlimmer. Dann treten sie stärker, damit du aufhörst. Das hat keine Logik. Und weil es keine hat, hat es eine.
„Da capo!“ Lydia kreischt vor Lachen, hässlich ist sie, als sie es Dragan erzählt. Da liegt einer auf dem Boden und bittet höflich, noch einmal hinzutreten. Heinrich hasst sie in dem Moment. Na, weil sie Recht hat. Daher auch das Humpeln. Zu viel Zugabe bekommen. Klappe nicht halten können. So schaut’s aus.
Also kein Rabe. Über dem Sturm, nein, über dem Platz. Heinrich hat da so einen Vogel gesehen, kurz vor dem Sturm. Er flog über den Platz, die Bäume griffen in der Luft herum. Die war voller Staub und Sand, von der Baustelle beim Schottenring, wo sie das Hochhaus vom Boltenstern hinstellen. Am Sonntag gehen die Familien Bagger und Baugrube schauen. Die Büro-Väter erklären Bewehrungen und Verstrebungen, und die Hausfrauen-Mütter nicken und sagen, man solle aufpassen, was der Vati erzählt. Und sich nicht schmutzig machen am Bauzaun. Danach gibt es ein Eis am Schwedenplatz. Schöne neue Welt.
Der Vogel flog gegen den Wind. Er stemmte sich quer über die Leute, die ihre Kinder und Taschen packten und gingen, aber Heinrich blieb sitzen und sah dem Raben zu. Weil der so aussah, als würde er schwitzen. Das waren nur seine Federn, die glänzten blauschwarz.
Spät im Sommer war das gewesen. Jetzt liegt Schnee, es ist Jänner. „Warum soll er nicht an einen Raben denken, Lydia? Ein Rabe ist so gut wie jedes andere Tier.“ Dragan zeichnet mit seinem Stock Linien in Lydias Spucke. Dann steht er auf, putzt sich den Dreck von der Jacke, gähnt. „Ich bin hungrig“, sagt er. „Woran denkst du, Dragan, wenn man dich schlägt?“ Dragan sieht ihn an, die hellen Haare, das schmale Kinn. „Hm. An meine Eier, wenn es den Kopf erwischt. An den linken Daumen, wenn es die rechte Hand treffen wird. Wenn sie mir in den Arsch treten, denke ich an dich, psiću.“ Psiću. Kleiner Hund. Er lacht. Und geht. Abgang, Abmarsch. Weg. „Pazzo“, murmelt Lydia.
Lydia und Dragan. Das ist so eine Sache. Seit Heinrich bei ihnen lebt, denkt er über sie nach. Was er halt nachdenken nennt. In seinem Nachdenken sind die beiden ein Paar. Sind Mutter und Sohn, Vater und Tochter. Sind gar nichts. Lydia war zuerst da. Heinrich ist in ihr Versteck gestolpert, wäre ihr fast in die Arme gefallen. Versteck darf er nicht sagen. Dragan meint, es ist andersrum. „Draußen versteckt sich die Welt vor uns.“ Wie er uns gesagt hat, hat Heinrich gewusst, er meint ihn auch. Und ist geblieben. Dragan nennt den Verschlag palata. Lydia sagt, es wäre nicht mehr als eine Bruchbude, eine versaute Dreckshöhle, ein paar Bretter hinter der kleinen Schusterwerkstatt. Wahrscheinlich war das früher ein Schuppen. Wahrscheinlich ist der Schuster tot. Zerschossen. Oder bei den Russen. Heinrich ist das gleich. Es ist ruhig und trocken. Mehr braucht man nicht.
Die Werkstatt ist versperrt. Heinrich presst die Nase so fest an das kalte Glas, dass es knackt. Brich, denkt er, brich einfach. Dann komme ich rein in deine Zeit. Lydia erwischt ihn vor den Fenstern. „Verschwind“, schimpft sie, „das gehört dir nicht.“ Dass das niemandem mehr gehört, ist ihr egal. Dann gehört es sich selbst. Lydia, könnte er sagen, ich tu’ doch nichts. Ich nehm’ keinem etwas weg. Aber er schweigt. Er wartet, bis sie mit dem Stock droht. Bis sie damit auf seine Beine drischt. Bis sie ihn fortschwemmt mit ihren Flüchen. Dragan hat viele Namen für Lydia. Dušo moja. Meine Seele. Hajdraža moja. Meine Liebste. Srećo moja. Mein Glück.
Wenn er das Fluchen und Lachen, den Schuppen und die Werkstatt mit ihrer stillen Zeit hinter sich lässt, erzählt sich Heinrich eine Geschichte: Dragan kommt in die Stadt. Wie John Wayne als Ringo nach Lordsburg, langer Mantel über den Schultern. Das geht leicht. Lydia. Lydia geht schwer. Heinrich grübelt. Stellt sie in eine Bar. Macht sie jünger, ein wenig. Lässt sie hart arbeiten. Lässt sie allen, die sie ansprechen auf eine Art, vor die Füße spucken. Also Dragan, der steht in der Bar. Jeden Abend. Muss Lydia anschauen, immerzu. Er stellt ihr Fragen. Woher sie kommt. Was sie nach der Arbeit macht. Ob er sie einladen darf. Nicht interessiert. Dragan lässt sie spucken. „Du kommst schon mit“, sagt er. „Wenn du dich leergespuckt hast, gehst du mit mir mit.“
Heinrich macht wieder die Augen auf und schaut, wo er ist. Gibt er beim Nachdenken nicht Acht, landet er an Orten, die nicht gut für ihn sind. Er wird gelandet. Manchmal stößt ihn jemand. Je dichter die Menge, umso eher wird man angerempelt: Das ist die erste Regel des Watschenmannes. Die zweite: Du musst das Mittelmaß finden zwischen Schmutz und Nichtschmutz. Bist du zu schmutzig, wird dich niemand anrühren. Bist du zu sauber, ebenfalls nicht. Es gibt noch mehr Regeln, aber als Heinrich Dragan davon erzählen wollte, meinte der: „Für heute ist’s genug.“
Heinrich möchte der beste Watschenmann Wiens werden. Aber dazu muss man vorbereitet sein. Nicht tagtraumgetrieben an Unorte kommen und erst durch den Rempler oder einen Tritt aufwachen, oder durch jemanden, der dir den Weg versperrt, und das Letzte, das du siehst, ist eine Faust, und das Letzte, das du hörst, sind Worte wie Gesindel oder Mauthausen oder, harmloser, Watschengesicht, und dann kriegst du noch was drauf, weil du dem Blutdreck, in den dein Mund deine Nase deine Augen gepresst werden, erzählst, dass es Watschenmann heißt, nicht Watschengesicht.
Das ist der Grund, warum seine Geschichten kein Ende haben. Meistens reicht es kaum für den Anfang, dann wacht er auf. Entweder auf die brutale Art. Oder so.
Von Lydia weiß Heinrich: Wenn man verprügelt wird, darf man nicht da sein. „Stell dir ein Tier vor und verschwinde mit ihm.“ „Welches, Lydia?“ „Keine Ahnung“, sagt Lydia. „Bin ich du? Pazzo.“
Wenn man verprügelt wird, darf man nicht da sein. Ist das die dritte Regel? Dragan fragen, denkt Heinrich. Wird schon stimmen.
Einschub: Vorher. Jetzt.
1953, im Sommer, ist Heinrich aufgetaucht. Man sagt, er stammt aus der Provinz. Rund um Wien ist aber viel Provinz. Die ist in den Nachkriegsjahren in die Hauptstadt eingesickert mit Vehemenz. Gestrandete, die weder vor noch zurück konnten und geblieben sind. Hungergestalten aus den Lagern. Kriegsgefangene und Soldaten, denen der Friede die Arbeit genommen hat. Alliierte, einfache Burschen bis hohes Militär, die wichtig die Stadt besetzen und Anspruch erheben auf Aufmerksamkeit. Der Rest, dem der Krieg das Leben zerbombt hat.
Vom Alter her könnte Heinrich vom Spiegelgrund gekommen sein, aus der Psychiatrie. Ein junger Bursch, grad Anfang zwanzig. Blass und knochig, redet fast nix und die Schultern viel zu schmal für seine Läng’. Das sagt Lydia, und dass er nicht ganz dicht sei und etwas Lauerndes habe, aber der soll ihr nur dumm kommen, der Heinrich! Er kommt ihr nicht dumm. Er ist froh, ein Dach über dem Kopf zu haben, auch wenn es schadhaft ist. Ein Dach kann man flicken. So wie man alles flickt, was Schaden genommen hat. Mit Dragan ist er auf den Schuppen gestiegen, sie haben die kaputten Schindeln leidlich ersetzt, durch alte Bretter, Kisten und eine Autotür, auf die es blechern klopft bei Regen.
Dann liegt Heinrich wach. Mitten in Wien, in einem Bezirk, wo zwischen den großen Häusern niedrige stehen und die Straßen frisch gepflastert sind. Wo man sie duldet, die drei, die hinter der Werkstatt leben, weil, es wird geredet, ein Amerikaner hält seine Hand über Lydia. Zu dem geht sie, neidet man ihr den Schuppen. Oder ist es gar Angst vor dem Serben, mit dem sie ein wildes Verhältnis hat? Soll sein, die Leut’ sind beschäftigt mit anderen Sachen. Ist sowieso alles noch immer beengt und begrenzt. Jedes Zimmer, jedes Kabinett war lange genug dreifach belegt, man wohnte aufeinander und hatte keinen Platz. Zeit, dass die letzten Ruinen verschwinden. Mit Eifer wird aufgebaut, werden Lücken geschlossen, und wo sich der Tod noch vor ein paar Jahren die Leichen zu einem fröhlichen Stoß gestapelt hat, wachsen Büsche zur Erbauung. Dort sitzen die Bürger, füttern die Tauben mit Brot, freuen sich am Gurren und Picken und daran, dass ein wenig zum Verfüttern übrigbleibt.
Heinrich besitzt fast nichts. Am Anfang nicht einmal Worte. Man könnte fragen, warum. Nur, was nützt es, einen zu fragen, der keine Antworten gibt? Gut, Dragan ist neugierig wie ein Kater und dann, im Lauf der Zeit, lernt Heinrich auch wieder zu sprechen. Aber der Serbe ist klug. Und weiß, wie Lydia, man kratzt nicht an frischen Narben.
Gefragt wird generell wenig in den neuen Parks, in den Kaffeehäusern oder in den Wohnungen, die größer werden. Geräumiger. Will man eine Geschichte hören, dann eine schöne. Dafür gehen die Leut’ ins Kino, in einen Film vom Marischka oder vom Antel. Saison in Salzburg, Hallo Dienstmann, Kaiserwalzer. Darüber verblasst Erlittenes, verlieren sich Entbehrungen und Kummer der vergangenen Jahre. Und dass die Stadt besetzt ist und Österreich noch immer nicht frei. Aber lang wird’s nicht mehr dauern.
Alles fesch und g’sund, sagen die Filme. Sagen die glänzenden Auslagen in den zahnlückigen Häuserreihen. So soll’s sein. Und ist es nicht.
Heinrich hockt drinnen in sich so tief, dass er klarer sieht, seiner Verwirrtheit ganz zum Trotz. Für ihn hat der Krieg noch kein End’ gefunden, der tobt sich weiter aus. Und wenn sonst keiner kratzt an seinen Narben, Heinrich macht es selbst, bevor sie zuwachsen. Er glaubt den anderen den Frieden nicht. Späht hinein in ihre Seelen, wo Gewitter leuchten, die man nicht hört.
Der Zirkus war in der Stadt. Heinrich wird verprügelt. Lauter kleine Weltkriege.
Krüppel sind viele unterwegs. Invalide, nennt sie Lydia, oder Kriegsversehrte. „Letztes Jahr, wie der Bürgermeister an der Marienbrücke das Band durchg’schnitten hat, und die Menschen drüber g’laufen sind, ist einer in die Donau g’stiegen. Der Jonas ist ein feiner Herr“, sagt Lydia. Wie immer, wenn sie vom Bürgermeister schwärmt, sitzt sie ganz aufrecht und spitzt das Gesicht schräg nach oben, dabei kippelt der Kopf leicht nach links. Heinrich sitzt ihr gegenüber. Er legt den Kopf auch schräg beim Zuhören, stülpt den Mund vor, hält sich kerzengerade. Wenn man die Haltung von jemandem annimmt, dann fühlt man, was der fühlt. Das hat sein Vater gesagt, der war Nervenarzt. Bis ’45. Aber das weiß hier keiner. Braucht keiner wissen.
„War Oktober bei der Brückeneröffnung“, sagt Dragan. „Kann mich erinnern, gutes Wetter. Aber die Donau war schon kalt. Lydia, mače, Kätzchen, was war mit dem Krüppel, ist der ersoffen?“ Lydia nickt. „Gleich untergegangen, wie ein Sack. Hat keiner g’sehn, außer mir.“ Etwas spannt sich in ihr, dreht sich, bewegt sich. „Und?“ Gleich haut sie wieder mit dem Löffel auf die Erd’, pass auf, Heinrich, pass auf, Dragan. Die Männer kennen den Zustand, erst noch vom Jonas reden mit spitzem Gesicht, und dann kommt die Wut, wegen nix kommt die Wut, ist nicht eingeladen und kommt doch. „Was ist“, knurrt es aus Lydia, tief schäumt es in ihr, „was ist, hätt’ ich schreien soll’n? Der hat eh nix mehr g’habt vom Leben! Auf zwei Krücken im z’rissenen Mantel und die Schuh z’sammbunden mit einer Schnur, nix hat der mehr g’habt, ganz mager war er, nix dran. Der ist beim Ufer g’standen. Ein Schritt, ich hab’s gesehen. Der wollt’ nicht mehr.“
„Der nicht mehr“, sagt Lydia noch einmal leiser, und die Wut zögert beim Aufstieg, soll sie, oder nicht? Will sie?
Dragan will. „Ach“, brummt er in seinen Bart, „kann mich gut erinnern. Zwei Tage später war der Zirkus Williams in der Stadt. Weißt noch, der Elefantenumzug?“ Lydia schaudert’s: „Die Drecksviecher werd’ ich vergessen haben.“ Dragan dreht sich auf seinem Platz, macht es sich bequem zum Finale. „Dušo moja, die haben jeden Tag 300 Krüppel eingeladen.“ Er kratzt sich am Ohr. „Alle Dauerbefürsorgten von Wien waren im Zirkus.“ Lydia schaut. „In der Zeitung hab’ ich gelesen, das waren 8.000 Leut’.“ Lydia schaut. „Unter den 8.000 wär’ dein Krüppel schon dabei gewesen. So ein Zirkus hebt das Gemüt. Das hätt’ er noch haben können. Hätt’ er noch gelebt.“ Dragan stochert weiter, fischt, angelt nach der Wut: „Ich war selbst im Zelt. Am Südbahnhof. War schön.“ Lydia schaut. Dem Heinrich ins spitze Gesicht. Ins gekippelte Gesicht hinein. Und dann kommt die Wut. Verprügelt Heinrich. Aber wie. Lässt nix aus. „Der Jonas“, keucht Lydia zwischen den Schlägen, wobei sie alles nimmt zum Schlagen, was sie kriegt, was ihr Dragan in die wirbelnden Hände drückt, in die blinden, „der Jonas“, keucht sie, „ist ein feiner Herr“.
Heinrich krümmt sich am Boden. Lydia schlägt, drischt Korn, fährt die Ernte ein. Der Rabe, denkt Heinrich, er stemmt sich. Gegen. Den Sturm. Lydia drischt, zischt. Die blauschwarzen Federn, denkt Heinrich und sieht sie nicht. Ein Hieb trifft ihn am Arm, der nächste am Hals. Ein Striemen, ein Blut, ein Weh, der Rabe stemmt sich, weg ist er. Ohne ihn. Er bleibt, stemmt sich allein. Lydia ist stark im Zorn, eine Furie. „Tisiphone“, flüstert Dragan und schaut ganz zart. Die den Mord Rächende, Rachegöttin. „Wo. Ist. Der. Rabe. Jetzt? He.“ Jeder Punkt ein Schlag. Jedes Wort gespuckt. „Weg ist er“, wimmert Heinrich auf dem Boden. Dragan legt den Finger vor die Lippen: „Nicht wimmern, weißt eh.“ Lydia tritt gegen Heinrichs Rücken, verliert ihre Schlapfen, tritt sich müde, keucht, hört auf.
Setzt sich. Wischt sich Schweiß von der Stirn. Flecken unter den Achseln. Tellergroß. Stinken wird sie wieder. Wo man sich doch hier nicht g’scheit waschen kann, und für das Volksbad in der Hermanngasse reicht es grad nicht.
Dann steht sie auf und geht. Lässt Dragan zurück, lässt Heinrich und den Zorn zurück. In der Luft bebt er noch. In der Luft schwebt er noch. Webt noch sein Netz und sinkt herab auf den Verprügelten, legt sich auf seine Brust, auf seine Lider, bald wird er einschlafen, auf dem Boden, die Hand verdreht. Dragan hockt sich neben ihn. „Na“, sagt er. „Na“, murmelt Heinrich, die Augen geschlossen. „War nichts mit dem Raben, hm?“ „Ja“, sagt Heinrich, „war nichts.“ „Zu weit weg“, sagt Dragan, „zu schnell?“ „Zu hoch“, sagt Heinrich.
Heinrich beginnt zu wispern, hastig wie ein Schulbub, der etwas lernt und aufsagt, aber ganz leis’, für sich: „Wenn man verprügelt wird, darf man nicht dabei sein. Sobald einer ansetzt mit dem Fuß oder der Faust, muss sich der Watschenmann vorstellen, er ist woanders. Er kann ein Tier sein, eine Katze…“ – „ein Kätzchen, mače“, sagt Dragan – „… über Mauern laufen, über Dächer, runter schauen auf den, der da liegt und zuckt, der er selber ist, und auf die, die um ihn rumstehen und reinschlagen. Wenn sie dann fertig sind…“ – „… leckt man sich das Pfötchen…“ – „… und kommt zurück“. Heinrich wispert weiter, immer tiefer in sich hinein, aus sich heraus. „Meistens bereut jemand, weil jetzt, nach dem Krieg, da soll doch alles gut sein. Alles sauber und heil. Niemand liegt im Dreck. Österreich baut auf. Die Narben vergehen. Der Krieg verschwindet. Die Besatzer gehen auch bald, sicher. Mitten drin in der heilenden Welt kann doch keiner liegen und wimmern und bluten. Und sich in die Hosen machen.“ Dragan hebt die Schultern. „Das passt schon. Ziehst einfach die ganz alten an. Die du noch vom Vater hast.“
Er hockt neben Heinrich. Mit dem Finger schiebt er ihm eine Strähne aus der Stirn. Blutstirn. „Wird schon wieder, psiću. Ein Watschenmann muss einstecken lernen, nicht nur Schläge, hast mir erzählt. Dass das sein Geschäft ist.“ „Was noch?“ Man hört Heinrich fast nicht mehr, ist gleich weg, Dämmer steigt auf von ihm, Abend, Nacht. „Der Krieg“, jetzt flüstert Dragan, über den Jüngeren gebeugt, „ist nicht vorbei. Neun Jahre sind keine Zeit. Die Leute tragen lauter kleine Weltkriege mit sich herum. Das wissen sie und tun so, als ob’s nicht wahr wär’.“ Heinrich dreht den Kopf, lauscht. Von Dragans Nase zum Mund gräbt sich ein Tal. „Inwendig, da sind auch Trümmer. Und Leichen.“ „Und.“ Heinrich schmiegt die Wange in Dragans Hand, ein Zittern läuft über seinen Körper, läuft zur Tür hinaus. „Und.“ Vergisst sich, murmelt in sein Vergessen hinein. „Und der Watschenmann erinnert die Leut’, es ist nicht vorbei. Hast g’sagt. Wird sich immer wer finden, der ihn schlägt. Und zahlt.“
Speichelnass ist Dragans Handschale. Er lässt Heinrichs Kopf auf den Boden gleiten, wischt sich am Jackenärmel ab. Richtet dem Jüngeren die verdrehte Hand. Greift. Deckt ihn zu mit irgendwas. „Genau“, sagt er und streckt sich daneben aus. „Es findet sich immer wer, der zahlt für seine Schuld und Scham. Du hilfst den Leuten, den Krieg auszutreiben, den inwendigen. Um den äußeren kümmern sich der Jonas und der Raab. Für den inneren gibt’s dich.“ Ein gutes Geschäft, denkt Dragan noch. Ein sauberes. Bald schläft auch er.
Spätnachts kommt Lydia zurück. Mit dem Mond, mit den Katzen. Ein Geruch begleitet sie, ein Gesang. Ein Geklimper von Groschen in der Tasche. Sie weiß einen Ami-Leutnant, der mag frischen Schweiß. Er hat sein Quartier in der Garelligasse. Der Ami hat ihr das Verprügeln wieder ausgetrieben, gleich im Hof, hat ihr Absolution erteilt, ihr sein Gesicht in die Achseln gedrückt und sich selbst zwischen ihre Röcke. Te absolvo. Sie steht im dunklen Verschlag, schwankt ein wenig. Auf dem Boden zwei Schatten. „Te absolvo euch auch“, sagt sie und schlägt ein krummes Kreuzzeichen in die unbestimmte Luft.
Dann legt sie sich hin. Wie sie ist. Auf die Erd’. Neben Heinrich. Eingeschlossen ist er, verprügelt, geborgen. Zugedeckt mit einem Mantel. Lydia schlüpft unter den Mantel, schmal ist der Bub. Legt den Arm um ihn. Murmelt noch: „Ein Rabe will er sein. Ein Vogel. Ausg’rechnet.“ Dragan lacht leise. „Laku noć, dušo moja. Gute Nacht.“
Lydia wäscht sich im Schnee. Dünnes Hoffen. Ungebührlicher Lärm.
Am nächsten Morgen. Heinrich wacht auf, zittrig, frostig bis in die Knochen hinein. Er dreht sich und spürt. Mit dem Spüren kommen Lydias Schläge zurück. Also bleibt er, lässt sie vorüberziehen, in die Erinnerung. Seine Seele, ein hoher, karger Raum. Leise muss man dort sein, damit es nicht hallt. Dušo moja, denkt er. Meine Seele.
Im Eck liegen Säcke und Stroh. Dort sollte er schlafen, nicht am Boden. Dort liegt Dragan halb aufgerichtet und späht aus dem Fenster mit schmalen Augen. Heinrich steht auf, mit ihm erhebt sich die Kälte, um sich zu dehnen ins Halbdunkel.
Er lugt zwischen den Brettern nach draußen, helle Sonne, verstärkt vom Schnee, vertausendfacht. Mitten in dieser quälenden Helligkeit ist nackte Haut. Ist mehr, ein nackter Hintern, der sich dem Verschlag entgegenstreckt. Die weiche Haut der Oberschenkel, ohne jede Spannung, weiß, nie gedachter Körper, nie vorgestellt.
Zwischen den Beinen, die von Schneehänden abgerieben werden, liegt, wie eine Kette, Lydias Zopf. Ihre Haare sind lang, seit Jahren nicht geschnitten. Erst, wenn der Schuster zurückkommt, dann. So sagt sie. Und flicht jeden Morgen den Zopf aufs Neue, flicht sich dünnes Hoffen ins Haar. Dass es ein Hoffen ist, weiß Heinrich. Mehr weiß er nicht, er fragt nicht danach.
Heinrich tritt einen Schritt zurück, stellt sich quer zum Raum. Sieht aus dieser Distanz durch den Spalt zu Lydia, aus einem fremden Winkel auf etwas Verbotenes, das zu sehen sich nicht vermeiden lässt. Lydia steht aufrecht, verknotet mit einer Schnur den Hosenbund. Ohne innezuhalten beugt sie sich wieder, schlüpft aus einem Schuh, stellt den Fuß in den Schnee, reibt Rist, Sohle, Ferse, fährt mit den Fingern zwischen die Zehen.
Heinrich sieht: ihr Gesicht, vor Anstrengung gerötet, den halb offenen Mund, Atemstöße. Der zweite Fuß. Heinrich sieht: einen blaugeschlagenen Knöchel. Die große Zehe, die sich nach innen dreht. Heinrich sieht, den Kopf wendend: Dragan.
Dragan im Schatten seines verfallenden Holzpalastes, im Eck, auf Lydias Lumpen. Viele Säcke hat sie schon gesammelt, man darf sie nicht anrühren. Trotzdem liegt Dragan dort, späht durch das halbblinde Fenster. Nur Dunkel ist im Raum und Staub, Restschlaf und schaler Atem. Durch die Ritzen und Spalten, durch das trübe Glas sickert Tag herein, sickert Lydias Schneewaschung, etwas Helles, Lichtes.
Mit einer Bewegung der Augen wechselt Heinrich von Dragan zu Lydia, vom Verschlag in den Hof, wo die Frau erst die Jacke aufknöpft und über den Strauch hängt, dann die Bluse. Mit einer Hand greift sie Schnee, mit der anderen hebt sie die Brust, wäscht sich darunter, den Mund nun fest geschlossen, die Lippen zu einem Strich gepresst. Der Zopf zieht Linien in den Schnee, ein undeutbares Muster. So lang ist er, man könnte sie damit erwürgen. Ach, denkt Heinrich, sie könnte sich damit aufhängen.
So wäscht sich Lydia. Schnee in den Nacken. Schnee ins Gesicht. Sie reibt und reibt. Steht einen Moment still. Ihr Körper dampft in der Kälte. Zieht dann Bluse und Jacke an. Nimmt ein Tuch aus der Tasche, wickelt es um den Kopf, wickelt den Zopf hinein. Murmelt. Spuckt.
„Psiću, komm her.“ Dragan winkt Heinrich zu sich. „Komm schon, kleiner Hund, komm.“ Sein Hemd starrt vor Schmutz. Geh in den Schnee, denkt Heinrich, wasch dich. Reib dich ab innen und außen. Innen. Reib dich innen ab. „Du sollst herkommen, schnell!“ Dragan sitzt nun aufrecht, hält den Kopf gesenkt, eine Drohung im Blick, die nichts duldet.
Durch das dunkle Zimmer geht Heinrich, durch das mit kalter Frische getupfte Zimmer, bleibt stehen vor Dragan. Der sieht ihn an, in ihn hinein, greift dann in Heinrichs Schritt. Der Jüngere zuckt zusammen. „Gut“, sagt Dragan, „gut. Wärst du geil geworden, hätt’ ich dich erschlagen.“ Dragan hält den Griff. Dann lässt er los. „Verschwind“, sagt er.
Und Heinrich geht, natürlich. Schiebt die Brettertür auf, dabei schneidet sich ein Dreieck Licht in den Verschlag. Lydia steht vor dem Strauch, deutet auf dessen knotige Spitzen. „Zu früh“, sagt sie, mehr zu sich als zu Heinrich, „der will schon knospen.“ Heinrich muss warten, bis der Schmerz im Schritt nachlässt. Mitten in der Nacht war er wach geworden. Stunden vor dem Morgengrauen hatten Vögel gesungen. Lydia beachtet ihn nicht, tritt an ihm vorbei. Schließt die Tür, schließt ihn aus.
Die Werkstatt liegt still. Ans Fenster stellt sich Heinrich, mit der Stirn am kalten Glas, der Frost soll sich in sein Denken fressen. Lydia hat den Schlüssel, er weiß es. Er hat sie beobachtet im Herbst, da war er genauso gestanden wie heute, mit der Stirn am Glas. War kurz zuvor aufgewacht und hatte Dragan gerufen, der ihn ein paar Brocken Serbisch lehrte: „Dragan gde si?“ Hatte sich damals – wie jetzt – vor ein Fenster der Werkstatt gestellt, die Stirn am Glas gekühlt. Und wie er die Augen öffnete, saß drinnen Lydia, auf dem Sessel neben der Tür. Saß sehr aufrecht, die Hände im Schoß. Die Beine ordentlich nebeneinander. Sah nichts. Sah vielleicht dem Schuster zu in einer anderen Welt, in der er eine Ahle nimmt, den Schuhleisten in seine Schürze presst, werkt und arbeitet mit krummem Rücken.
Ganz unbewegt ist sie gesessen, und unbewegt war auch Heinrich vor dem Fenster geblieben eine Zeit. Seine Seele, das wusste er, hätte gelitten unter Lydias Wut über ein Maß hinaus, über eine Grenze zum Wahnsinn. Wie soll man das erklären. Unentdeckt war Heinrich zurück in den Verschlag gegangen.
Auch später hat Heinrich Lydia beobachtet: Nie geht sie tiefer in diesen Raum. Schlüpft nur durch die Tür, presst sich auf den Sessel daneben. Atmet kaum. Als gehörte diese Luft nicht ihr. Wie gern würde Heinrich wissen, was es mit der Werkstatt und dem Schuster auf sich hat. Möchte es wissen und fragt nicht.
Was macht eine Werkstatt aus, Heinrich? Hinter den dicken, viergeteilten Fenstern sieht er in den winzigen Raum. Dort stehen Werkbank und Dreibein, sind Regale vollgestellt mit Dosen, Leisten und Schuhen, kaputt, mit offenen Nähten, abgerissenen Sohlen, in Zwingen geklemmt, damit etwas Geleimtes trockne, vertrocknet ist es schon lang. Fleckige, halbgeputzte, aber auch gute Schuhe sind darunter. Während Heinrich draußen in zerrissenem Schuhwerk an den Füßen friert, starren ihn aus der Werkstatt elegante, zweifarbige Schnürschuhe an. An den Wänden hängt das Werkzeug, hängen Querahlen, Ösen, Zwickzangen, Aufrauer, Risskratzer und Putzholz. Hängt die Lederschürze des Schusters und ein Arbeitsmantel. Den Boden bedeckt, wie die Schuhe, wie Werkzeug, Tisch, Dreibein, Werkbank, Regale, wie alles, Staub. Nur Lydias Sessel neben der Tür ist ein Rot im Grau. Dort, wo sie sitzt, ist der Staub weggewischt, leuchtet die Farbe, ein Signal. Das ist eine umgekehrte Zeit, denkt Heinrich, eine Negativzeit, in der die Vorzeichen wechseln.
So steht er am Fenster, allein im Hof. Das Stechen im Schritt ist vergangen. Im Verschlag Lydia und Dragan. Nein, nur Lydia. Dragan packt ihn plötzlich am Arm und reißt ihn aus der Werkstatt heraus, in der er gar nicht ist, in die er sich ja nur hineingedacht hat ein wenig, auch das ist verboten, auch das Denken über die Werkstatt gehört Lydia, wer kann schon so leben. Dragan reißt Heinrich vom Fenster weg, der stolpert in den Busch, ein paar Zweige brechen, die waren am Knospen, jetzt sind sie gleich tot. „Komm“, sagt Dragan, es schnauft Wut in ihm, Enttäuschung ist es, Lydia wollte nichts wissen von seiner Geilheit. Die ist aber da und will weggemacht werden, wenn nicht von Lydia, dann von einer andern, und wenn Dragan keine andere findet, was dann?
Dragan zieht Heinrich aus dem Hof, drängt ihn auf die Straße, drückt ihn in einen Hauseingang. Ziehen, drängen, drücken, das geht alles in einem, noch ist die Stirn kühl vom Fenster, wo doch die Hitze schon aufsteigt bei den Ohren und die Angst dazu. Viel Schlimmeres als Tritte und Schläge drängt sich hoch und macht das mit Heinrich, was er nie darf, weil er sonst Zugabe kassiert. Er schiebt Dragan zurück, beginnt sich zu wehren, wimmert, sinkt, bis er im Hauseck kauert, wo der Schnee dreckiger ist als im Hof, die Hände vor den Kopf gepresst, ein Bündel Mensch. Dragan greift hinein, will die Arme wegziehen und Heinrich in die Augen sehen. „Psiću, was ist?“, sagt er dabei. „Was ist?“ Und hockt vor ihm, berührt ihn nicht mehr. „Dich haben s’ mal g’nommen.“ Das war nicht gefragt, also kommt auch keine Antwort aus dem Menschenbündel. Dragan schüttelt den Kopf, fasst Heinrich an den Knien. Hinter ihm ein Pferdeschnauben, ein breites Fuhrwerk holpert vorbei.
Scharfer Geruch steigt Dragan in die Nase, ihm und Lydia, die auf einmal neben den beiden ist und feststellt: „Die Hosen hat er voll.“ „Ja“, sagt Dragan, „hat geglaubt, dass ich…“ Lydia fährt ihm übers Maul: „Still bist. Machst es nicht besser, wenn’st es sagst.“ Was weiß die Frau schon. Viel weiß sie. Zu zweit heben sie das Bündel hoch, leicht ist es und schwer, tragen es zurück in den Verschlag. „Du gehst jetzt“, bestimmt Lydia und schickt Dragan fort, Holz soll er holen, Essen besorgen, was Warmes wird Heinrich brauchen. Zieht ihm, der auf dem Stroh liegt, die Hosen aus. Wischt Tränen weg. Holt eine Schüssel, füllt sie mit Schnee. Reibt Heinrich ab, der zittert unter der Kälte. Lydia nimmt einen Fetzen, trocknet ihn, deckt ihn zu. „Schhh“, macht sie, bis das Zittern aufhört, bis Heinrich schläft.
Später kommt Dragan zurück, wirft Holz in die Ecke beim Ofen, ist nicht viel, er muss noch einmal gehen. Legt einen Laib Brot auf den Tisch, noch warm ist der und duftet, stellt ein Gläschen voll Rahm dazu. Lydia fragt nicht, woher er das hat. Sie nimmt einen Topf, kocht Suppe. Viel haben sie nicht in dem Schuppen, geteilt wird, was da ist, und mit Heinrich bleibt weniger für alle. Dragan betrachtet den Schlafenden. Ein Wurm, ein Embryo, mit nackten Beinen, die aus der Decke geschlüpft sind. „Mager ist er wohl“, sagt er zu Lydia, die sich neben ihn stellt. „Ich hab’ keinen Kümmel für die Rahmsuppe.“ Das ist alles, was sie antwortet. „Was wär’, mače“, fragt Dragan und schaut nicht weg von Heinrich, „wär’ das unser Bub.“ „Besorgst noch welchen?“ Lydia geht wieder zum Ofen. Dragan zieht Heinrich die Decke über die Beine. „Ist schon fast normal geworden, weißt noch, was für dummes Zeug er geschwätzt hat im Sommer, wie er auf einmal mitten im Schuppen gestanden ist, der psić?“ Lydia murmelt. „Was sagst, ljubavi?“ „Kümmel brauch’ ich.“ Mehr nicht. Dragan wendet sich ab, mit einem letzten Blick auf Heinrich, dem im Schlaf die Lider zucken. „Meine Seele, was meinst?“ Lydia blickt auf von ihrem Topf, schaut Dragan an, gar nicht bös ist sie, nur müde. „Was meinst?“, wiederholt der. „Ich bin mir oft nicht sicher, ob er immer weiß, wo er ist. Oder wer.“ Lydia lacht. „Hörst eh, was er sagt, was er ist. Ein Watschenmann.“ Dragan schüttelt den Kopf. Er räuspert sich, geht zur Tür. „Mače, Kümmel, ist gut.“
Februar
Lydia beim Fenster. Wie es leuchtet im Hof. Wie still der Schnee ist. Dreht sich um zu den schweigenden Männern.
Die drei Grazien. Kriegsaugen. Dragan liest.
Und dann? Über nix wird geredet in dem Verschlag. Na schon, über alles andere vielleicht. Es tropft im Halbdunkel. Das ist die Hose, sie hängt beim Ofen, in dem ein Feuer knackt und im Ofenrohr der Luft entgegen faucht. Sonst ist es still. Die Kohle im Eck wird reichen für ein paar Tage, dann muss wieder wer raus mit dem Sack. Kaputte Holzsessel hat Dragan gefunden. Mit dem Beil geschlachtetes Holz, damit Heinrichs Hose trocknet.
Er starrt auf Dragan, der auf Lydia, Lydia steht am Fenster. Draußen schneit’s. Das ist so ein Moment, denkt Heinrich, der könnt’ immer gewesen sein. „Das Wetter hat sich an den Winter erinnert“, sagt Dragan, dann: „Winter heißt zima.“ „Und Schnee?“ Lydia dreht sich vor dem Schleier der fallenden Flocken zu Dragan. Sie schimmert, sie trägt ein gelbes Tuch. Beide Männer schauen, beide denken vielleicht zu gleicher Zeit, dass das nicht geht. Dass man nicht schimmern kann an einem grauen Tag. Dass man nicht wie ein Mädchen aussehen kann unter solchen Umständen. Lydia wird über vierzig sein, sie sagt es nicht. „Sneg, mače, sneg.“ „Sneg“, sagt Lydia. Das Wort schmilzt eisig auf der Zunge. Draußen füllt sich der Hof mit Worten, die eisig auf der Zunge schmelzen.
Wenn heut keiner mehr rausgeht, ergibt das über Nacht ein schönes Bild. Dann wölbt sich dir am Morgen Schnee entgegen, knietief oder tiefer, beim ersten Öffnen der Tür. So überlegt Heinrich, und ob denn alles getan ist, jetzt am späten Nachmittag. Ob es eine Veranlassung gäbe, den Verschlag zu verlassen vor dem Abend. Nein, er kommt auf keine. Zum Abort vielleicht. Sie pinkeln in Töpfe, wenn es zu kalt ist. Aber nicht nur das Weggehen macht Spuren, auch das Kommen. Daran denkt Heinrich erst, als er im Hof Schritte hört.
„Die Fenster von der Werkstatt werden s’ einhau’n, irgendwann.“ Lydias Schimmern verschwindet. Mit einem Ruck zieht sie den Lumpen vor, der als Vorhang dient. Ein Tasten an der Tür, dann klopft es laut. „Dragan“, ruft eine Stimme ganz rau, wird einem selbst ganz rau in der Kehle nur vom Zuhören. „Ist nicht da“, schreit Lydia. Vor der Tür erst nichts, dann Flüstern. Wieder klopft es, wie mit einem Stock geschlagen. Dragan wird verlangt und wann er wiederkommt. „Weiß nicht“, schreit Lydia, „geht weg.“ Dragan lacht. „Mače, die gehen nicht weg“, sagt er in ihr Funkeln, „lass sie rein.“ Schnell schlüpft Heinrich in die Hose vom Vater, im Koffer sind noch mehr Sachen von ihm, Hemden, eine Schachtel mit Zündhölzern, ein Gürtel. Den braucht Heinrich, der Vater war breiter als er. Er werkt mit der Schnalle, da stehen sie schon im Raum: drei Menschen. Zwei Männer und eine Frau sind es, alle baumlang und hager, hintereinander in einer Reihe, die rechte Hand auf der Schulter des vorderen.
„Vorsicht, alles zurücktreten, Zug fährt ein!“ Mit offenen Armen empfängt Dragan die drei, man weiß nicht recht, ob Spott seine Stimme heller macht oder Freude. Er umarmt die Männer, sie müssen sich leicht beugen, um die Umarmung zu erwidern, so groß sind sie. Vor der Frau, die den Zug anführt und nun lose steht mit Gram im Gesicht, verbeugt sich Dragan seinerseits. „Willkommen, Schwester“, sagt er zu der Frau, die dünn ist wie ein Besen. „Deine Schwester bin ich nicht“, erwidert sie und reicht ihm die Hand. „Aber ihre Schwester bist du“, sagt Dragan und deutet auf die Männer, „und sie sind meine Brüder, also bin auch ich deiner, Helene.“ Nichts bewegt sich im Ausdruck der Frau, sie schaut nur schnell zu Lydia, weil die schnaubt. War das Verachtung? Heinrich schließt die Seele zu, er mag Helene und ihre Brüder nicht, die drei Grazien, wie Dragan sie nennt. Er verbirgt sich vor ihnen, hat Angst dabei, dass Dragan zu reden beginnt, vom Watschenmann erzählt, von ihrem Geheimnis. Seltsam ist Dragan, wenn die drei kommen, noch seltsamer ist Lydia. Sie duldet keine Fremden im Hof und im Verschlag. „Ich wollt’ nicht her“, antwortet Helene auf Lydias Schnauben. „Die beiden wollten, weil sie ihn nicht gesehen haben ein paar Tag’.“
Jetzt ist es an Lydia, bös zu sein. Sie sagt: „Was redest, die haben ihn noch nie gesehen, nicht vor ein paar Tag’ und überhaupt nie.“ Weiter will sie schimpfen, in Wunden graben und stochern gegen die blinden Männer. Die gemeinsam nur mehr ein kaputtes Auge haben, das silbern in seiner Höhle zuckt, als würde es ein Licht suchen, und zwei gesunde, die aber Helene gehören, der Schwester. Narben dort, wo Augen sein sollten. „Lydia, dušo moja, schimpf nicht, sei lieb. Slepa braća sind da, die blinden Brüder. Kaffee, schnell.“ Heinrich schaut von einem zum anderen. Nie schafft Dragan über Lydia, nie hört Lydia auf Dragan, wenn sie allein sind. Doch so lässt sie es geschehen. Nimmt einen Topf, geht, um Wasser zu holen aus der Bassena im Nebenhaus, durch den Hof, dessen dünne Schneedecke schon jetzt zerstört ist und weiter zerstört werden wird heute, da kann sie noch so wachsen.
Den Topf zum Pinkeln hat sie genommen, war es Absicht? Heinrich will ihr nach, es ihr sagen, lässt es bleiben. Will nicht an Helene vorbei. Sie trägt Handschuhe mit halben Fingern. Und setzt sich hin, auf eine der Kisten, ohne den Mantel abzulegen, ohne sich um die Brüder zu kümmern. Setzt sich hin und macht die Augen zu. „So ist es recht, Helene“, sagt Dragan. „Schone dein Augenlicht, es gehört dir nicht mehr allein.“ Kommt Besuch, ist er geschäftig, ein anderer Dragan wacht auf, ein munterer, fröhlicher. Bald sitzen die Männer beim Ofen, der einen Sessel frisst und glüht. Bald kocht das Wasser im Topf, bald riecht es nach Ersatzkaffee, Zichorien und Eicheln, obwohl es echten gibt.
Der Topf zum Pinkeln, der falsche Kaffee, Lydias Schweigen, das wird noch was geben, man muss sich nur Zeit lassen, dann gibt es immer was.
Peter und Paul heißen die Blinden, achtunddreißig Jahre der eine, vier Jahre jünger der andere, wie Zwillinge sehen sie aus. „Eure Eltern waren faul“, sagt Dragan, „sie haben nur eine Form genommen für euch beide.“ „Erzähl“, sagt Paul, ohne zu lachen, „was gibt’s Neues in der Stadt?“
Das ist so mit den Geschwistern: Peter und Paul waren im Krieg, der eine an der Ostfront, der andere im Süden mit Rommel unterwegs. Sind freiwillig in den Kampf gezogen, obwohl die Mutter gefleht hat zur Heiligen Maria Mutter Gottes bitte für uns Sünder. Obwohl sie sich vor die Tür gelegt hat, als die beiden sich melden wollten, sich an ihre Beine klammerte und zwei Straßen weit mitgeschleift wurde, so sagt man, wo sie dann liegenblieb. Helene hat sie aufgehoben. Hat sie nach Hause gebracht, als Peter und Paul an Karabiner dachten und an neue Stiefel. Hat sie nach Hause gebracht und der Mutter den Gassendreck aus den Haaren gebürstet, die Messer weggenommen, damit sie sich nichts antut in ihrer Verzweiflung. Der Vater war auch keine Hilfe, weil innerlich ein Krüppel geworden im ersten großen Krieg, da ist was zerbrochen in Flandern. Was war mit dem Vater passiert, mit dem kleinen Beamten? Er verließ das Haus nicht mehr und zitterte, sobald ein Fuhrwerk in der Gasse übers Pflaster rumpelte. Versteckte sich im Kasten, misstraute seiner Frau und auch den Kindern. War verloren für die Welt. Sein nächtliches Weinen galt den Söhnen als Vorwand, um auszuziehen und das Verbrechen zu sühnen, die Schmach und Schande des deutschen Volkes.
Während die Brüder kämpften für eine Ehre, schob Helene knapp dreizehnjährig den Rest Kindheit, der ihr geblieben war, grob zur Seite und kümmerte sich um die Eltern.
Nach drei Jahren Krieg ist Paul, der jetzt da sitzt so nah beim Ofen, dass es ihm fast die Haare versengt, nach drei Jahren ist er heimgekommen, mit einer Binde um den Kopf, mitten in der Nacht. Dem Vater haben sie erst nichts gesagt. Haben die Lampen gelöscht und gemeint, der Bub muss seine Augen schonen. Nur, dem Vater hat man nichts sagen brauchen, der hat hineingegriffen ins Gesicht von seinem Buben und war weg am nächsten Morgen. Hat sich zum Kanal getastet. Warum nur jeder ins Wasser geht, das versteht Heinrich nicht. Er stellt sich den Alten vor, wie er gewartet hat auf den Schlaf der anderen. Wie er raus ist, die Häuserwände entlang, die Hand am Verputz. Sind nur zwei, drei Gassen, die er gehen musste. Hat immer dort gelebt, als Kind am Wasser gespielt. Möglich, dass er daran gedacht hat, der Alte. Und sich gesehen mit dem Poldi vom Greißler gegenüber. Geht zum Sterben und sieht noch die Wellen in der Sonne glänzen und dreckige Kinderfüße und wie sich das anfühlt.
Dragans Lachen holt Heinrich in die Gegenwart zurück. Würde er sterben wollen, dann anders. Er würde sich totprügeln lassen.
Helene war bald alles gleich. Stirbt der Vater? Na, soll er. Wer weiß, ob sie geschlafen hat damals. Oder nur tief geschnauft, als der Alte an ihr vorbeigeschlichen ist. Ein Krüppel weniger, hat sie der Mutter gesagt. Paul hat’s erzählt, von Anfang an. Dragan säuft solche Geschichten wie Schnaps. Dem rinnt das Geile in den Geschichten wie Gold durchs Ohr in sein Gehirn, wo er es sammelt und aufhebt und verwendet, wie er’s grad braucht. Da ist also Helene, die Harte, die den Vater begraben und wieder die Messer versteckt hat vor der Mutter. Die aber nicht ans Adern aufstechen dachte, sondern nur an den Peter, der mit der Feldpost Briefe schickte vom nahen Sieg. Der Pläne machte, ein Maleratelier wollte er haben. „Sehr talentiert ist er gewesen“, sagt Paul über ihn. Vorher hinaus in die Welt. Die Ferne sehen, erobern, als Held zurückkommen. Die Weiber des Feindes besteigen. So hatten die Pläne der Brüder gelautet, vor dem Krieg hatten sie keine Angst. Dann wurden sie getrennt.
Paul verlor seine Augen in Afrika, bei Tobruk. Wie? Das muss man noch rauskitzeln aus ihm für Dragans Ohren. Peter wurde an der Ostfront das rechte Auge aus der Höhle gestochen von einem Granatsplitter, der auch den Hals erwischt hat und den Kehlkopf zerschmettert. Dort hilft jetzt ein Loch beim Atmen, ein Stoma. Das linke Auge verätzte ihm gleich darauf ein Sanitäter im Lazarett. Ein Versehen. Seither schwimmt es in seinem Gesicht herum.
Als keine Briefe mehr kamen, hielt man Peter für tot. Besser wär’s gewesen, hat Helene gesagt, als sie ihn brachten. In die Küche gestellt, die sie sich teilen mussten mit zwei Familien seit den letzten Angriffen. Was soll ich mit ihm, soll sie gefragt haben, ins Eck lehnen? Unters Bett schieben, wo schon drei Leute drin schlafen und ein Bettgänger, wenn Platz ist? Der Bettgänger zahlt fürs Schlafen, der Bruder zahlt nix. Hat dann auf den Klopfbalkon einen Hocker rausgestellt und gemeint: „Setz dich. Bleib sitzen. Fall nicht runter.“ Drei Wochen musste er da hausen.
Dann haben sie die Mutter begraben. Die Messer weggeworfen, Helene grauste vor dem Blut. Peter zog vom Balkon in die Wohnung. Man lebt von der Kriegsblindenhilfe, man hat Chancen vielleicht auf eine Trafik, die Schwester kann sie führen, die Brüder die Tschickpackerl ertasten und Kunden begrüßen.
Tschick. Paul zieht ein Packerl Dreier aus dem Rock, er und Dragan rauchen. „Komm, Dragan“, sagt Paul und hält dabei die Zigarette im Mund. „Lies“, sagt er.
Was geht Paul am meisten ab, außer den Weibern, die mit einem Invaliden nichts zu tun haben wollen? „Manche schon“, meint Dragan, weil sie auf die Rente spekulieren. Über Peters Gesicht, dieses verkleinerte Schlachtfeld, Trichter, Gräben, totes Gewebe, glänzt es traurig. Heinrich sieht’s wohl, kann starren, ohne bemerkt zu werden, das heißt, er könnte: Helene entlässt ihn nicht aus ihrem Blick.
Was Paul am meisten fehlt, sind die Zeitungen. Vor dem Krieg war er nichts ohne sie, danach noch weniger. Die Presse, den Wiener Kurier und die anderen Blätter nicht lesen können, das ist ihm eine furchtbare Straf’. Lydia höhnt: „Dragan, lass gut sein. Helene liest ihren Brüdern vor, oder kann sie nicht lesen?“ Helene wehrt sich, ohne die andere anzusehen: „Was will man von mir, ich wasch’ sie und ihr dreckiges G’wand, ich koch ihnen und schneid das Essen klein. Ich kratz’ dem Peter den Eiter aus den Wunden. Ich putz’, ich bring sie her. Das reicht.“ Dragan beugt sich. Legt die Hand auf Helenes Arm, der zurückzuckt, als wär die Haut verbrannt unter dem dicken Mantelstoff. „Schone deine Augen, sag’ ich. Tust genug für slepu bracu. Du kratzt den Eiter, ich les’ vor.“ Er nickt zu Lydia. „Und Lydia, mače, du schaust, dass unsere Gäste sich wohlfühlen in unserm Palast. Bring mir die Zeitungen.“
Heinrich spürt die Eifersucht, da braucht er keine Miene spiegeln. Lydia dreht sich, rempelt an den Brüdern vorbei. Eng ist es hier mit den vielen Leuten. Neben den Lumpensäcken wird das Papier gesammelt, für den Abort und zum Ofenanzünden. Alte Zeitungen, was man so findet. Manchmal auch eine neue. Lydia nimmt sie, drängt sich zurück, weicht Helene aus dabei. Streift Peter an, der den gesenkten Kopf hebt und Luft einzieht durch die Nase, ihren Geruch einfängt. Sie schmeißt Dragan einen Packen hin, was noch dazu kommt zum falschen Topf, dem unechten Kaffee und dem Schweigen. Na wart’, denkt Heinrich, das rächt sich.
Das Feuer im Ofen, das Rascheln der Zeitungen, Peters Atemgeräusche, ein dünnes Pfeifen aus dem Loch im Hals. Das Tuch dort bauscht sich, fällt ein und bauscht sich.
„Lies“, sagt Paul wieder. Er setzt sich bequem, lehnt sich zurück. In den Händen den Kaffee. Und Dragan liest. Vom Großbrand bei den Werkstätten der Bundesbahn in der Brünner Straße. Gefährliche Sache, Sauerstoffflaschen sind explodiert und Öl hat gebrannt. Der Schaden sei nicht groß gewesen, weil die Halle ohnehin stark bombengeschädigt, liest Dragan, und weiter: „Es war eine Glanzleistung der Wiener Feuerwehr.“ Dragan blättert um: „‚Rund 13.000 Schneearbeiter sind vom 12. auf 13. Jänner eingesetzt worden. Es handelte sich um die größte Schneeräumung seit 1945.‘“ Paul grunzt anerkennend.
Die Zeitungen rascheln, Dragan wirft eine hinter sich und greift nach der nächsten. „Da, hör, Lydia, das ist was für dich: ‚Bürgermeister Jonas spendet 100.000 Schilling für die Lawinenopfer.‘“ Lydia, die am Fenster steht, nickt beifällig und wirft Helene einen Blick zu, sagt: „Ist ein feiner Herr.“ Helene ist wohl aufgetaut in der Wärme hier beim Ofen. Sie schnappt hin auf Lydia, von wegen, der Jonas zahle das wohl sicher nicht aus der eigenen Tasch’n. „Eh nicht“, sagt Dragan, den ein Spiel kitzelt, ein Teufel zwickt, der zündeln möchte zwischen den Weibern, die sich nicht ausstehen können. „Eh nicht“, sagt er, „hört: ‚Auf Anordnung von Bürgermeister Jonas hat die Gemeinde Wien für die Opfer der Lawinenkatastrophe in Vorarlberg eine Spende von 100.000 Schilling zur Verfügung gestellt.‘“ Er murmelt über die nächsten Zeilen: „Jonas… Aufruf… tief erschüttert… entsetzliche Naturkatastrophe… Selbstverständlichkeit… Die Stadtverwaltung fordert daher die Wiener Bevölkerung auf, sich einer Sammlung anzuschließen.“
Dragan lässt die Zeitung sinken, hinter ihrem Rand leuchten seine Augen vor Spannung. „Dein Jonas“, sagt Helene, „ein feiner Herr, muss man schon zugeben. Ist leicht nobel sein mit dem Geld der anderen.“ In Lydia blitzt es, in ihr drinnen wartet schon wieder die Wut, ob sie raufklettern soll und Helene zerschmettern mit einem Schlag.
Auch Peter lauscht jetzt in den Raum. Heinrich fragt sich, ob Peter besser hört als die anderen, da ihm doch auch das schnell Hingesprochene fehlt, um wegzureden, was er nicht mag. Er muss das Ventil im Hals mit einem Finger verschließen, um ein paar Worte aus der Kehle zu pressen. Das fällt ihm schwer und er schweigt somit tagelang. Obwohl, Heinrich selbst könnte den Mund aufmachen, etwas sagen zur Ablenkung. Ein paar Worte zwischen Lydia und Helene werfen. Nur, er tut es nicht. Was ist er besser als ein Stummer? Schlechter ist er. Siehst du, Heinrich, sogar Peter versucht auf seine Weise, die Frauen zu trennen, bevor sie sich an die Gurgel gehen. Peter röchelt, fasst sich an den Hals, als wär’ das Loch verklebt, was manchmal vorkommt. Helene steht still. Aber Lydia ist nicht Helene. Sie kümmert sich um den Blindstummen, schlägt auf seinen Rücken, kühlt seinen Nacken mit einem nassen Tuch, bis er ruhig ist. Bis sich die an Lydias Ärmel festgekrallte Hand entspannt. Sie nimmt die Hand und drückt sie. Schaut Helene an. Sagt: „Helfen muss man, ob man was hat oder nicht. Verrecken soll keiner müssen.“ Greift in die Tasche, gleich drauf rollen drei Münzen über den Boden. Eine davon fällt in den Spalt zwischen zwei Brettern. Die anderen beiden vor Helenes Füße. „Die geb’ ich dem Jonas für die Lawinenopfer“, sagt Lydia.
Eine Liste macht Heinrich im Kopf. Von Fragen, die er bedenken muss, wenn Zeit ist. Nämlich: Ob Helene wirklich Peter verrecken lassen würde, wenn die andere nicht geholfen hätte. Ein Blinder weniger, kein Eiterkratzen mehr. Aber auch weniger Geld von der Fürsorge. Vielleicht hat sie gewusst, dass Peter simuliert. Und: Ob Lydia wirklich gut ist. Ob sie dem Peter das Leben retten wollte, oder Helene die Freud’ nicht machen, ihn sterben zu lassen. Wie ein Buchhalter notiert sich Heinrich einen Gedanken nach dem anderen und legt ihn ab, für spätere Bearbeitung aufgehoben. So auch die Frage, ob Peter froh ist über die Rettung, sofern es eine war. Oder lieber hätt’ ihm wer den Hals zudrücken sollen statt das Loch darin freizulegen. Und Dragan? Heinrich sieht hinüber zu ihm. Wie er dort kauert auf seiner Kiste. Die Zeitung zwischen die Knie gesunken. Schultern nach vor und der Blick von unten nach oben lauernd. Kann man das spiegeln, die Haltung annehmen? Als wüsste er’s, droht Dragan Heinrich mit einer winzigen Bewegung, ruckt nur das Kinn in seine Richtung. Ist er jetzt bös, weil Lydia gut ist, oder ist er stolz auf sein mače?
„Kätzchen, Kätzchen, schnurr auf dem Plätzchen. Hier ist dein Kater, dein alter Vater. Er streichelt dein Köpfchen und steckt sein Tätzchen in dein Honigtöpfchen.“ So, wie Paul das singt in diese Spannung hinein, klingt das nicht nach einem Kinderlied. So, wie Dragan lacht, schon gar nicht. Er schnitzt sich mit seinem Taschenfeitl einen Span von einem Stuhlbein, rundet das Ende ab und stochert in seinen Ohren. Damit mehr reingeht von den Geschichten. Lydia lacht auch über Pauls schmutzigen Vers, hebt die Münzen auf und sortiert jetzt ihre Lumpen, hält sie ans Licht. So, dass Helene sie sehen könnte, wenn sie hinschauen würd’. Aber die hat den Platz am Fenster eingenommen und steht dort, ganz ohne zu schimmern.