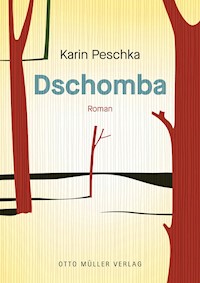
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Otto Müller Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein halbnackter Fremder tanzt zwischen den Gräbern des Eferdinger Pfarrfriedhofs. Es ist November 1954, ein nasskalter Tag, und Dragan Džomba ist auf der Suche. Vor dem Friedhofstor stehen die Bürger – aufgebracht, misstrauisch, neugierig. Nur der Dechant nähert sich dem Serben und gibt ihm schließlich Quartier im Pfarrhof. Dragan spricht nicht viel, immer wieder zieht es ihn hinaus zum Lagerfriedhof nahe der Donau. Dort, wo es kaum Spuren der Vergangenheit gibt, sucht Dragan aber genau diese. Er bezieht die Hütte auf dem "Serbenfriedhof", schließt Freundschaften, erlebt Anfeindung und Argwohn. Jahre später, alt geworden, sitzt er im Gasthof "Zum roten Krebs" am Stammtisch. Dem Fremden bleibt das Fremde haften, das Seltsame. Ab und zu stellt ihm die zehnjährige Wirtstochter ein Bier hin. Sie ist in ihren Tagträumen daheim und fühlt eine Verbindung zu dem Mann, der nach Wald und Erde duftet, der vor ihr da war und weiß, welche Geschichte sich unter den Feldern verbirgt. Mit "Dschomba" schreibt sich Karin Peschka das Wissen um die Vergangenheit jenes Ortes, in dem sie aufgewachsen ist, in die eigene Biografie. Sie erzählt vom Leben in einer kleinen Stadt, von Begegnungen, von Lebenswegen und -wendungen, und ein wenig davon, wie es ist, als Wirtstochter aufzuwachsen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Karin Peschka
Dschomba
Roman
Karin Peschka
DSCHOMBA
Roman
OTTO MÜLLER VERLAG
Die Drucklegung dieses Buches wurde gefördert durch:
www.omvs.at
ISBN 978-3-7013-1303-7
eISBN 978-3-7013-6303-2
© 2023 OTTO MÜLLER VERLAG SALZBURG-WIEN
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Christine Rechberger, Ludwig Hartinger
Satz: MEDIA DESIGN: RIZNER.AT
Druck und Bindung: FINIDR s.r.o. (Český Těšín)
Coverbild und Umschlaggestaltung: wir sind artisten
Grafik Lageplan: Taha Alkadhi
FürToni
Inhalt
Der Serbe tanzt
Dechant
Mann
Uhr
Friedhof
Erzählung
Tür
Füße
Margerite
Dämmer
Pfarrhof
Agnes
Grab
Bank
Kern
Schirm
Abfuhr
Dachboden
Kreuz
Kammer
Dieb
Schlüssel
Fisch
Brief
Aschach
Praktikant
Eferding
Elf
Deinham
Gruberin
Irrlicht
Postkarten
Silvester
Gold
Kraut
Mai
Pavle
Land
Kalbskopf
Baracken
Auto
Boxen
Hanslglas
Buben
Nacht
Brandstatt
Schuss
Fuchs
Bienen
Schanktisch
Ruine
Wetter
Hahn
Galgen
Hilfe
Diagnose
Trauerzug
Bericht
Susanne
Vergleich
Zehrung
Baum
Heimat erkunden
Regen
Räucherwerk
Mutter
Siehst du, Devojka?
Nachwort
Glossar der serbischen Wörter und Sätze
Dank
Der Serbe tanzt
Steig mir aufs Grab, mein Freund, tanz zwischen den Toten, es regnet oder es regnet nicht, wen kümmert’s.
Seht euch diesen Mann an. Ob er immer noch so verrückt ist wie vor dreiundzwanzig Jahren, als er ankam in Eferding? „Das soll eine Stadt sein?“, soll er gerufen haben. „Und das soll ein Friedhof sein?“ Und gleich den Pfarrer beleidigt, der kein einfacher Pfarrer war, sondern ein Dechant, und das ist mehr.
An der Großmutter lehnen, sie fragen: „Was für ein Dechant?“ Sagt sie, dass es ein richtiger war, einer, der die Predigt auch für sich hielt, nicht allein für die Gemeinde. Die lauschte in den Bänken. „Kalt war’s in der Kirche damals schon, aber was weißt du. Gehst ja nie.“
„Stimmt nicht, Oma.“ (Die Großmutter trägt eine Schürze über dem Kleid, hat die Hände im Schoß, unter dem runden Busen.) „Warum war der Dechant beleidigt?“ – „Weil er ihn einen Pfarrer genannt hat, als der ihn vom Friedhof …“
Bricht ab, die alte Frau, schaut nur.
„Sag, Oma, erzähl, was hat er gemacht, der Verrückte?“
„Schht, wirst still sein. Hast nicht gelernt, dass man nur gut reden soll über Fremde und über Nichtfremde auch?“
„Erzähl, Oma.“ Stur bleiben, an der Schürze zupfen, kariert ist sie, mit frischen Flecken vom Kochen. Sehen, dass die Hände müd sind.
„Lass. Getanzt hat er auf dem Friedhof.“
„Nur getanzt, das war doch …“
„Du Quälgeist. Nackt soll er gewesen sein. Komplett nackt, mitten im November. Genieselt hat’s und die Gräber alle aufgeputzt von Allerheiligen her, war nicht lang danach.“
„Nackt!“ Über die Erzählung jubeln, die immer wieder aufkommt und jedes Mal anders ausgeschmückt wird, oder ist es wahr? Leibhaftige Augenzeugen gibt es wenige, sagt die Großmutter, die meisten Leute kennen die Szene vom Hörensagen, vom Weitersagen, vom Hingehörthaben, und nichts Genaues weiß man nicht.
Aber das: Wer den Serben (oder den Jugo, wird so oder so genannt) ärgern will – er soll im Herbst 1954 nackt auf dem katholischen Friedhof zwischen den Gräbern herumgesprungen sein, barfuß auf dem Kies, mittelalt, nicht dünn, nicht dick. War ein gestandenes Mannsbild, sagt die Großmutter. Wenn ihn jemand ärgern will und zum Beispiel ruft: „Na, Dragan, hast deine Toten heut schon durchgezählt? Nicht, dass d’ einen übersiehst!“ Dann antwortet er, der andere möge ihm aufs Grab steigen, es kümmere ihn nicht.
Zufrieden sein für den Moment, sich lösen von der Großmutter, die eine Arbeit wieder aufnehmen will, die vor allem das Enkerl loswerden will und es verscheucht: „Geh jetzt.“
Damit wir Kinder uns zusammenfinden, hinten, wo der Konsum gebaut wurde, daneben liegt brach ein Stück des Inneren Grabens. Wird ein Parkplatz draus werden, noch ist es ein Wäldchen voller Stauden, gerade hoch genug, um uns zu verbergen. Wir treffen uns in der Mitte, bei der Königskerze ist unser Altar, zu ihr tragen wir Geschichten, wie jene des nackten Serben.
Mag sein, die Zeit hat ihn ausgezogen, und alles, was er, dieser Dragan, dieser Fremde, sich tatsächlich vom Leib gerissen hatte, waren die Schuhe. Wir könnten ihn fragen, er hat einen Mund, er spricht unsere Sprache sogar im Dialekt. Wenn er sprechen will. Aber wer von uns traut sich? Nein, nein, lieber spielen wir die Szene nach; wer den kürzesten Grashalm zieht, muss der Jugo sein. Muss verrückt herumtanzen und barfuß auf spitze Steine steigen.
Dechant
Als sich Herbert Genzl am neunten November 1954 in seinem Arbeitszimmer im Pfarrhof zum Kaffee setzen wollte, klopfte es an der Tür. Herein kamen, ohne die Aufforderung zum Eintreten abzuwarten, ein Gendarm und der Bestatter, es gab damals nur einen in Eferding. Kurz darauf eilten die zwei Männer mit dem Dechant in die Bahnhofstraße zu einem der beiden Seiteneingänge des Friedhofs, weil dessen Haupteingang beides war: verschlossen und belagert. Eine Menge drängte sich ans schmiedeeiserne Gitter, jeder wollte sehen und staunen, die Hinteren stießen die Vorderen und fragten: „Sagt, was tut der, randalieren? Wo bleibt die Gendarmerie?“
Die Vorderen machten die Sache nicht besser. „Unglaublich, unglaublich!“, wiederholten sie. Und: „Schau dir das an!“ Was die Ungeduld und Neugier der anderen steigerte.
Währenddessen standen Bestatter, Gendarm und Dechant bei der schlichten hölzernen Tür, die damals oft benutzt wurde, weil weniger Verkehr auf der Straße. Im Herbst 1954 konnte man dort gut stehen, die Tür einen Spalt öffnen und hineinspähen, sehr vorsichtig, denn zum Schluss hat der Wahnsinnige ein Messer eing’steckt und ist ein Mörder, der einen anfällt und aus ist’s.
„Ich hab mir gedacht, Herr Dechant, weil es doch ein Friedhof ist, also Ihr Friedhof ist.“ Fing der Gendarm an. Und dass der Bestatter auch dieser Meinung sei. Und da der Friedhofswärter krank im Bett liege, von ihm habe man nur die Schlüssel geholt, sei man direkt zu ihm. Unterbrach der Dechant gröber, als er wollte (im Pfarrhof wurde der Kaffee kalt), was er sich dächte. Dass das Gesetz auf Gottesäckern anders laute als rundherum? Dass ein Wahn, weil er zwischen Kreuzen und Gräbern stattfinde, ein göttlicher wäre? Lauschte dann aber doch, denn zu sehen war nichts durch den Spalt. Kam ihm vertraut vor, das Gehörte, das, was dieser Mann mehr schrie als sang. Man hatte ihn vorsorglich durchs Versperren aller Türen und Tore eingeschlossen, er hatte es nicht bemerkt oder es war ihm bewusst. Der Fremde brüllte ein Lied, das dem Dechant bekannt vorkam. „Das ist Serbokroatisch. Hört ihr? Das ist ein serbisches Wiegenlied.“
Summte ein paar Worte mit.
Und öffnete die Tür ein Stück weiter. Bestatter und Gendarm wichen zurück. Der eine schob sich die Dienstkappe zurecht, der andere den Hut. An dessen Rand sich Tropfen sammelten, es nieselte stärker, und als ein Vogel schwarz und zeternd aufflatterte, erschraken beide.
Dem Dechant, der ohne Kopfbedeckung aus dem Haus geeilt war, wurde der Regenschirm lästig. Ein graues Unding und wirklich zu groß, er sperrte sich in der Öffnung der Tür. Der Geistliche beugte sich tiefer hinein in seinen Friedhof, den Griff des Schirms fest in der Hand: Der dünne Stoff blieb an einem Nagel im Holz hängen. Ein Rucken, ein feiner Riss. Weg damit.
„Obacht!“, rief einer, dem der Schirm vors Rad gefallen war. Der Mann fluchte, kam ihm das Fluchen überhaupt leicht an. War bekannt dafür. Er sollte von diesem Moment an behaupten und die Behauptung bei jeder Gelegenheit noch Jahre und Jahrzehnte später wiederholen: Der Serbe habe stets nur Unglück bedeutet, er hätte sich wegen ihm fast das Genick gebrochen. Der Dechant könne nichts dafür, ihn träfe keine Schuld, aber dem Fremden, man wisse eh. Und wusste es wieder nicht genau. Dabei musste der Mann lediglich abbremsen, wobei ihm ein Paket vom Gepäckträger sprang und auf den nassen Boden fiel.
Das Fluchen erreichte den Dechant nicht, der nun voll im Eingang stand, wie in einem Rahmen, ein lebensgroßes Heiligenbild. Ein Heiliger im Moment der Erscheinung, und erschienen war ihm das: Da tanzte einer mit offenem Hemd und aufgekrempelten Hosen, ohne Schuhe, ohne Hut, ohne Jacke, ohne Scham gleich neben den Kindergräbern. Das ist nicht der beste Teil, nicht dort, wo die Reichen liegen, die Wohltäter und Ehrenbürger. Nein, bei den einfachen Grabstätten und den puppenstubenkleinen Gräbern schwang der Unbekannte seine Arme und stampfte mit den Beinen und drehte sich und brüllte dabei jenes Wiegenlied in den dunkler werdenden Himmel.
„Herr, hilf“, flüsterte der Dechant. Ob er ein Kreuzzeichen schlug? Ist nicht überliefert. Gendarm und Bestatter warteten hinter ihm. Vor ihm der Friedhof, tot und leer bis auf den Wahnsinnigen, weil, so einer musste das sein. Kerzen flackerten in den Laternen neben den Allerheiligen-Gestecken, ein Grabstein hatte einen schweren Mantel umgehängt, ein anderer eine Jacke, eine Kappe obenauf.
Wo wohl die Schuhe sind, fragte sich der Dechant und hielt Ausschau. Die Schuhe und die Socken, sie müssen doch. Spähte, als wäre es im Moment die dringlichste Sache, die fehlenden Stücke zu finden, ohne sich weiter in das Geschehen einzumischen oder auch nur einen Schritt auf den Mann zuzugehen. Als könne man dies erst dann tun, wenn die Kleidung komplett zusammengefunden war, eine Ordnung wiederhergestellt. Eine Verzögerung vor der Handlung, die er zu setzen hatte.
Das wusste der Dechant, kannte sich gut. An manchen Tagen, bevor er aus der Sakristei in den Altarraum schritt, draußen raunte die Gemeinde und rückte auf den harten Bänken. Die Ministranten standen bereit zum Einzug. Da war es nicht viel anders. Da war das Herumnesteln am Ornat auch so ein Hinausschieben. Es freute ihn einfach nicht.
Mann
Heute ist Dragan Dschomba ein alter Mann. Alt, aber kein Greis wie unser Großvater, mit dem er manchmal am Stammtisch sitzt, immer an der schmalen Seite, im Rücken den grünen Kachelofen. Im Winter knackt das Holz darin, ab und zu kommt jemand und strottet mit dem langen Eisenstab in der Glut. Dazu muss man sich hinhocken, weil dem Kachelofen ein kleiner Tisch vorgebaut ist, eine Ablage für Zeitungen und Brotkörbe. Ohne sich kleinzumachen, ist das Türchen nicht zu erreichen, durch das wir Geschwister Holzscheite in den Ofen schieben dürfen, aber nur, wenn der Vater es anschafft. Und hinter uns steht, zusieht.
Der Kachelofen hält die Hitze so gut, dass er immer erst am nächsten Vormittag hergerichtet werden kann. Das zerknüllte Zeitungspapier würde sich von selbst entzünden, die Späne, die kurzen Scheite verbrennen. Alle paar Tage räumt ihn der Vater aus. Dann klappt er die kleine Tischplatte hoch und kehrt die Asche recht vorsichtig in den Ascheneimer, weil es sonst staubt.
Am Morgen knarrt die Großmutter um sechs Uhr die Stiege hinunter, kümmert sich nicht um den Lärm und unseren Schlaf, aber um alles andere. Schneidet das Gemüse, keiner kann es besser als sie, die Fisolen schräg für den Salat, schält Erdäpfel, arbeitet bis um zehn Uhr, das ist ihr Tagwerk.
Und Herr Dschomba? Das ist keiner, dem man vors Gesicht springt und sagt: „Erzählen Sie uns etwas.“ Und darum geht’s doch, dass jemand erzählt. Nicht von dem, das wir kennen oder kennenlernen könnten von selbst, sondern vom Unerreichbaren, weil zu weit weg, zu lang vergangen. Kommt ein Fremder ins Gastzimmer, oder einer, der zwar kein Fremder ist, weil ewig hier, aber dem das Fremde anhängt (schau, wie er aussieht, wie er sich bewegt), dann weiß der mehr. Dann wird’s interessant, vorausgesetzt, er redet.
Warten müssen. Ist der Ofentisch frei, dort auf der Bank knien und probieren, wie lange sich die Hand oder die Wange an die heißen Kacheln drücken lässt, und hoffen, nicht vertrieben zu werden von Gästen, die den Tisch brauchen. In Zeitungen blättern, Schlagzeilen lesen und sie kaum verstehen (Unfall im Kernkraftwerk Gundremmingen, Jimmy Carter neuer Präsident, die USA ist weit weg, Deutschland auch), aber in Wahrheit lauschen. Alles aufsaugen, wie der gelbe Schwamm im Badezimmer der Großeltern. Ein kleiner Schwamm sein.
Auf der anderen Seite des Kachelofens sitzt Herr Dschomba. Es ist sein Stammplatz. Sitzt ruhig, wo hinter ihm herumgewetzt wird, wo Bierdeckelhäuser gebaut werden und einstürzen.
Sehr selten allein sein mit ihm. Weil die Mutter Wäsche aufhängt, der Großvater fort ist; der Vater oben im Wohnzimmer schläft bis halb vier, dann geht die Mutter hinauf und ruht sich aus bis fünf.
Kurz aufs Geschäft aufpassen, falls jemand kommt. Und kommt ausgerechnet Herr Dschomba, grüßt, setzt sich auf seinen Platz. Dann ist er ein freundlicher Mann. Stolz sein zu wissen, was er trinken will, es ändert sich nie: ein Schnitt Bier. Kein Seiterl, keine Halbe. Ein Schnitt.
Wir sind Wirtskinder und kennen keinen anderen Gast, der nicht zuvor mindestens eine Halbe trinkt, meistens zwei oder mehr, bevor er zum Schluss einen Schnitt Bier bestellt, ins schon benutzte Glas hinein. Das fast gerade unter den Zapfhahn gehalten wird, sodass es mehr Schaum gibt als sonst, und erst wenn der Schaum sich senkt, steht fest: Es ist ein guter Schnitt geworden oder ein schlechter.
Der Großvater hat erklärt: Herr Dschomba spielt nicht, weder Karten noch etwas anderes. Es gibt nur ein einziges Spiel, auf das er sich einlässt: jenes, einen guten oder einen schlechten Schnitt zu erwischen. Daher dürfen wir nie schwindeln und das Glas schräger halten, denn wir Schwestern und unser Bruder, wir können sehr wohl ordentlich Bier einschenken.
Der Großvater sieht alles, ist still und schaut.
Von ihm um die Schnapskarten und den Bummerlzähler geschickt werden. Ein kleines Gestell mit verschiedenfarbigen Kugeln. Verstehen wollen, was damit gemacht wird. Der Bruder behauptet, es zu wissen, aber ob das stimmt?
Uhr
Hinter der oberen Tür der hohen Standuhr, die zwischen den beiden Fenstern des Gastzimmers steht, verbirgt sich kein Pendel. Die Uhr ist aus Lärchenholz wie die Wandvertäfelung. Die Tische tragen Birnholzplatten, unter ihnen der Schiffboden mit seinen breiten Brettern, war schon da, bevor die Großeltern das Haus gekauft hatten und hier noch zwei ihrer sieben Kinder zur Welt kamen, der Vater als jüngstes.
Hinter der oberen Tür der Standuhr sind die Bierblöcke und die Packungen mit Bierdeckeln. Vorräte an Zahnstochern, frisch gefüllte Maggi-Fläschchen (braunes Glas, roter Verschluss), volle Salz- und Pfefferstreuer. Außerdem die Schnapskarten und Bummerlzähler.
Eintauchen in den Geruch des Uhrkastens, eine Mischung aus Kork, Holz und Pfeffer.
Hinter der unteren Tür der Standuhr, das wissen nur wir und die Gäste, die zufällig einen Blick auf uns werfen, wenn wir sie öffnen, stapeln sich grüne und rote Tischtücher und weiße Deckservietten. Den Duft von frisch Gewaschenem in der Nase, das Bild vor Augen, wie es auf dem Trockenboden hängt und weht, und der Trockenboden ist die offene Terrasse über der Garage.
Lieber von außen hinaufklettern, statt die grob gezimmerte Stiege in der Holzhütte zu nehmen. Sich fürchten vor der Dunkelheit, von der Schwester dafür ausgelacht werden. Mutiger ist sie, verwegener. Wenn doch ein Korb mit nasser Wäsche durch die Holzhütte hinauf auf den Trockenboden getragen werden muss, dann schnell. Schnell an der Kohlenschütte und dem Hackstock, in dem die Axt steckt, vorbei, nicht nach links sehen (dort könnte sich im Dämmer alles verbergen), gestreift werden vom Licht, es kommt durch die Spalten zwischen den Latten, und flimmert es in diesen Lichtstreifen; Sägespänestaub atmen und erlöst in die Sonne treten. Sich Zeit lassen beim Wäscheaufhängen oder dabei, auf der Mauer zu sitzen und nichts zu tun.
Bis jemand ruft. Im Gastzimmer vor der Uhr hocken.
„Der Großvater braucht die Schnapskarten, bring sie ihm endlich.“
Herr Dschomba sitzt ihm gegenüber, noch drei andere Männer haben Platz genommen, zwei davon spielen mit, einer spechtelt. Herr Dschomba schweigt und trinkt erst einen Schnitt, dann einen Großen Schwarzen.
Wissen: Der Großvater riecht nach Küche, seinem Rasierwasser und Zigaretten. Und Herr Dschomba riecht nach Wald.
Wissen: Nach einiger Zeit fängt eine Erzählung an, wird über das Abenteuer Krieg gesprochen, das jetzt auch schon wieder lang her ist.
Dem einen ein Achterl Roten bringen, dem anderen einen gespritzten Weißen, dem dritten einen Bierwärmer und dem, der nichts redet an den meisten Tagen, einen Kaffee. Ohne Milch, ohne Zucker.
Den trinkt er so schnell, wie er das Bier langsam getrunken hat, und geht. Steht auf, rüttelt sich zusammen, dieser Mensch, nimmt seine Kappe und nickt zum Abschied in die Runde. Ihm nicht im Weg sein wollen, ihm die Tür aufhalten wollen, aber zu feig sein dafür. Ihm den Kaffee serviert haben, auf dem kleinen ovalen Tablett liegen abgezählt die Zeche und immer ein paar extra Schillinge. Die Münzen in die rote Sparkasse bei der Schankabwasch werfen. Jeden Sonntag teilt die Mutter nach dem Mittagsg’schäft das Trinkgeld unter uns auf.
Manchmal, wenn nichts los ist, nicht gleich abräumen, sondern auf Herrn Dschombas Platz sitzen, die Wärme des Ofens spüren (wenn Winter ist), auch die Bank ist noch warm, aber das ist die Körperwärme des alten Mannes. Das Tablett mit der leeren Kaffeetasse, der nie benutzte Kaffeelöffel, die Münzen, die Männer, die lachen oder schimpfen, das Klackern der Bummerlkugeln, das Klatschen der Karten auf den Tisch, dazwischen die zurückgebliebene Stille und Bäume und Moos und etwas, das sich schwer benennen lässt.
Friedhof
Der Dechant hatte einen halben Schritt in den Friedhof hineingetan, stand mit einem Fuß auf dem Kies, mit dem anderen noch auf der Schwelle der Seitentür. Hinter ihm nach wie vor Gendarm und Bestatter und der Mann, dessen Paket vom Rad gefallen war. Ein Querulant, im Kern kein schlechter Mensch, aber unzufrieden und streitlustig. Auch jetzt, nachdem er sich ein Bild gemacht hatte von der Situation. Der Dechant hörte ihn schimpfen, wenn sich keiner traue, dann ginge er hinein, dann würde er dem Verrückten die Leviten lesen und Anstand beibringen, das könne wirklich nicht sein, dass einer die Grabesruhe störe, die. Er suchte nach dem richtigen Wort, der Geistliche wusste es. „Pietät“, murmelte er, drehte sich um, befahl Ruhe, befahl, die Tür zu schließen, nein, er würde rufen, wenn. „Lasst mich mit ihm allein“, sagte er.
Und war es. Am Haupttor, wo ein Rumor entstanden war, als Genzl in der Seitentür erschien, wurde es still, hielten die Leute den Atem an, wurde geflüstert und beschlossen, gemeinsam den Fremden zu überwältigen, sollte er dem Dechant auch nur ein Haar krümmen. Sie hatten einen guten Blick auf die Szene, was sich heute noch beweisen lässt: Vom Tor aus sieht man einen großen Teil des Friedhofs, auf jeden Fall bis hinüber zu jener Stelle, wo im November 1954, an einem nasskalten Tag, ein Mann in Hemd und ohne Schuhe herumtanzte und brüllte und sich wohl den Tod holen würde oder Schläge oder Gefängnis.
Einer der Schaulustigen am Haupttor deutete auf die Aufbahrungshalle gleich links hinter dem Gitter. „Schad, dass sie nicht frei ist“, meinte er, für den Kerl da. Ein paar lachten, ein paar aber dachten an die Frau, die in der Halle aufgebahrt worden war am Vorabend, vielleicht dass es eine Verbindung gäbe. Fragten sie erst sich selbst und dann die Umstehenden. Hinter dem gelben Glas der Tür, auf der die Parte in einem Rahmen steckte, flackerte Licht, und wussten alle, wie es drin aussah und wie kalt es war, wenn man neben dem Sarg stand, seine letzte Aufwartung machte und fröstelnd hoffte, der Deckel wäre zu und im Deckel kein Guckfenster, durch das man der Toten ins wächserne Gesicht sehen könnte, müsste, wollte. (Weil man einmal ein Kind gewesen war und gezwungen wurde, mitzugehen, zu tun, was sich gehörte.)
Man blieb lieber draußen und lebendig und reckte sich, war versucht, auf das Gitter zu steigen, sich hinaufzuziehen ein Stück, tat es sogar, dennoch: War nichts mehr zu sehen vom Dechant und dem Verrückten, keine Spur von beiden, bloß der leere Friedhof und nichts.
Jetzt erst legte sich eine Ruhe über alles. Tropfte es und fuhren Autos und Mopeds durch den späten Nachmittag, bellte ein Hund und ein anderer antwortete, natürlich außerhalb der Friedhofsmauern, von drinnen kam kein Laut.
An den Rändern wurden die Männer nervös, auch bei der Seitentür, an die der Gendarm im Wechsel ein Ohr presste (was unangenehm war, das Holz war nass) und versuchte, durch einen Spalt zu erkennen, ob er eingreifen müsste, die Tür aufreißen, die Waffe gezogen, um den Dechant zu retten. „Ksch“, machte er, brachte den Streitlustigen zum Schweigen, der ansetzen wollte zur nächsten Tirade und nun gekränkt war. Der Bestatter, bei dem sich der Radfahrer beschweren wollte, schüttelte den Kopf und legte den Zeigefinger an den Mund. Wobei ihm einfiel, die Uhr am Handgelenk, Himmel, so spät, es war vereinbart, die Kränze zu richten und die großen Kerzen anzuzünden in der Aufbahrungshalle.
Denn die Angehörigen der Verstorbenen standen bereits in ihren Vorzimmern, kämmten den Kindern die Haare, obwohl darüber eine Haube kommen sollte, richteten Krägen und Schals und steckten saubere Taschentücher ein. Das war die Pflicht. Die Totenwache beim Sarg (mehr ein Besuch als eine Wache), das Totenbeten am Vorabend des Begräbnisses in der Seitenkapelle der Kirche. Die Kränze bestellen, die Parten verteilen, die Zehrung reservieren, überlegen, sollen die Sargträger eingeladen werden, gibt man ihnen ein Trinkgeld, falls ja, wie viel.
Die Angehörigen der Verstorbenen waren vom Tod überrascht worden. Zwei Wochen zuvor war die Mutter guter Dinge gewesen. Schlecht auf den Beinen und allein in ihrem abgelegenen, ärmlichen Sacherl, das nur über den unbefestigten Forstweg zu erreichen war, das jetzt, obwohl ihrer aller Elternhaus, endgültig verfallen würde. Aber hatte nicht und nicht zu einer der Töchter oder zum Sohn ziehen wollen, die sture Alte, man hatte es ihr angeboten. Werden sie sich wiederholt versichern, wütend auf die Mutter, die keinem zur Last fallen wollte und so zur größten Last geworden war. (Sie hatten sie tot gefunden, winzig in ihrem Federbett, das Schlafzimmer – zum Glück – eiskalt, weil unbeheizt, was die Verwesung aufgehalten hatte, sie war aufgespart worden für den Sarg.)
Jahre später wird man sich erzählen, die Frau wäre in ihrem vergilbten Hochzeitskleid gestorben, mit dem Kruzifix in den Händen, und wäre alles vorbereitet gewesen, als hätte sie ihr Ende vorhergesehen oder herbeigeführt.
Jahre später werden die Erzählungen immer eigener, werden sich kreuzen jene der Toten in der Aufbahrungshalle und jene des Serben, der zwischen den Gräbern tanzte. Werden sich kreuzen und in einen Zusammenhang gebracht, den es nie gab. Behaupten die einen und die anderen glauben es nicht.
Dass Dragan Džomba Totenwache gehalten hatte für die Frau, hat kein Mensch je erfahren. War vor dem Sarg gestanden, vom Licht hineingelockt in die Aufbahrungshalle, ein leerer Tag, an dem er kurz nach Mittag angekommen war in der Stadt. War ein Lastwagen stehen geblieben, hatte sich die Tür geöffnet, hat der Fahrer gemeint: „Das hier ist der einzige Friedhof, den ich kenne in Eferding.“ Aber: „Du kannst ja fragen, prijatelju, wenn’s der falsche ist.“ Und der Freund, der prijatelj, war ausgestiegen, ließ sich seinen ranac reichen, seinen Rucksack, sich Glück wünschen, und schlug die Tür zu, Blech auf Blech. Der Lastwagen fuhr weiter, Richtung Passau, entlang der Donau stromaufwärts.
Und dann, im Eingang, unter dem Torbogen. Neben der hohen Tür mit gelbem, undurchsichtigen Glaseinsatz. Dragan, unschlüssig, fühlte, dass er hier noch nicht angekommen sein konnte, las den Namen auf der Parte – Erna Zeisig – und trat, um etwas zu tun, um den Schritt in den Friedhof hinauszuzögern, in die Halle. Die Luft drinnen seit jeher kälter als draußen. Der Sarg dunkles Holz, am Kopfende leicht erhöht. Rechts noch ungeordnet: die Versammlung der Kränze. Schöne Kränze, mit Rosen und Lilien und Erika und Schleierkraut und Schleifen. Stand starr, der Serbe, die Kappe in den Händen. Die breiten Schultern gesenkt, leicht gebückt vor dem da. Vor dem, was da vor ihm stand. Sah im Sargdeckel das Fensterchen, sah gleich weg.
Die Namen auf den Schleifen waren nicht zu lesen, derjenige, der sie geliefert hatte, musste in Eile gewesen sein oder kein Herz haben oder Angst vor der Leiche. Ein Lehrling vielleicht, überlegte Dragan. Er hatte seine Kappe auf dem Sarg abgelegt, ganz unten, am Fußende. Hockte vor den Kränzen, befühlte die Blumen, die Zweige, die Buchstaben auf der Seide. Las laut vor, tatsächlich las er der Verstorbenen vor, wer sich von ihr verabschiedete. „Erna“, sagte er in Richtung Sarg, und sagte es in einwandfreiem Deutsch, „hier grüßen ein Franz und eine Gerhilde samt Kindern. Ein hübscher Kranz ist das, schaut teuer aus, sogar in Wien hab ich selten so einen gesehen. Ich werde ihn, wenn es dir recht ist, dort hinhängen.“ Er war aufgestanden, um einen der hölzernen Kranzhalter, die neben der Tür lehnten und die der Bestatter vorbereitet hatte für ihren Einsatz, um eines dieser Gestelle rechts neben dem Sarg aufzustellen. Dann hob er den Kranz von diesem Franz und seiner Gerhilde und den namenlosen Kindern auf den Halter, rückte ihn zurecht.
„Wenn du einverstanden bist, Erna“, wandte sich Dragan Džomba erneut an die Verstorbene, „dann mache ich weiter, jetzt, wo ich damit angefangen habe.“ Und sah hinüber zum Fenster im mahagonibraunen Deckel, der fest verschraubt war mit dem letzten Bett, das nicht so weich sein konnte wie jenes, das die Frau gewohnt gewesen war, unmöglich. Man lebte karg, aber schlief üppig und weich.
Solche Gedanken hatte der Serbe, mit solchen Gedanken musste er sich plagen, sie fingen an zu kreisen und fanden kein Ende, verwirrten sich, wenn er nicht achtgab. Da war es gut, etwas zu tun zu haben. Nach und nach, die Finger wurden ihm klamm, füllte sich der Raum, war eine Ordnung eingebracht, waren die Kränze verteilt, die Schleifen geglättet, ein einzelnes Gesteck in Form eines Kreuzes auf den Sarg gelegt, die Kerzenständer mit großen Kerzen bestückt, man müsste sie nur noch anzünden. Sagte Dragan zum Abschied, die Kappe wieder in der Hand, über das Guckfenster gebeugt. „Spavaj, sestro! Schlaf“, flüsterte er, und die Schwester, die keine war, schlief, die Augen fast ganz geschlossen, zwei kleine Halbmonde, die ein wenig glänzten. „Wahrscheinlich hat der Lehrling grüßen wollen“, sagte Dragan, „und hat sich geschreckt. Was musst du auch blinzeln. Sei ihm nicht bös.“
Erzählung
Beobachten, wie Herr Dschomba geht. Sobald er seine Schillinge auf das kleine Tablett gelegt hat und sich aufruckelt, erhebt er sich gebückt. Erst nach zehn bis zwanzig Schritten geht er aufrecht. Bevor er in die Schlossergasse einbiegt, dort, wo sich die Schmiedstraße leicht windet und über dem Juwelier die große Uhr die Zeit anzeigt. Lässt er den Kopf kreisen, dehnt die Schultern, manchmal knackst er mit den Fingern.
Sich nicht trauen, ihm weiter zu folgen als bis vor die Haustür.
Nachdem er dem Großvater zugenickt hat und die Tür sich hinter ihm schließt, weil sie zufällt, wenn man sie nicht extra aufspreizt. Dann (obwohl er gegangen ist) ist er immer noch da.
Eine Entscheidung treffen: Draußen einen Blick auf seine Schultern, den breiten Rücken und das Kopfkreisen werfen, oder lieber hierbleiben und auf Geschichten hoffen.
Wenn der Großvater beschließt, für den Tag genug zu haben vom Stammtisch, oder hinausgeht, um eine Smart oder eine Dames zu rauchen und dabei das Treiben in der Schmiedstraße zu betrachten. Ein alter Mann (älter als alles), so schmal, dass man sich in seiner Größe täuscht. Dann ist die Luft rein, sind die Männer am Stammtisch unter sich. Was werden sie reden?
Geschäftig sein. Mit dem kleinen Tischbesen die Tischtücher von unsichtbaren Bröseln befreien, die Aschenbecher leeren oder leere besser ausputzen über dem Mistkübel in der Schank. Zahnstocher nachfüllen, kontrollieren, ob genug Weinflaschen da sind. (Aber nicht in den Keller gehen, um welche zu holen.) Auf das Gerede der Männer lauschen, über Herrn Dschomba reden sie. Einer meint, Herr Dschomba wäre der uneheliche Sohn einer Frau namens Erna Zeisig gewesen, er selbst habe die gekannt, weil mit einer ihrer Töchter verbandelt, wovon die Zeisig, eine seltsame, sicher nicht normale Frau, wenig gehalten habe. Sie hatte sich einen Reichen als Schwiegersohn gewünscht, und die Tochter wäre dann.
Von der Tochter nichts wissen wollen, von Herrn Dschomba hören wollen, von seiner Ankunft in der Stadt. Mit dem Trinkgeld klimpern, es laut zählen, vielleicht hilft’s.
Ein anderer fragt nach. Ob das stimmen könne, er selbst lebe erst seit fünf Jahren in der Stadt, da höre man die verschiedensten Gerüchte.
Wahrheit und Märchen. Einer tötet eine neunköpfige Schlange und mistet riesige Kuhställe aus allein. Hexen sperren kleine Kinder in Käfige und essen sie auf, sobald sie fett sind. (Die Finger prüfen.) Einer taucht auf am Tag nach dem Tod der Frau, die seine Mutter gewesen sein könnte. Oder es war anders, nämlich ganz anders. Schweigen am Tisch.
Hinter der Schankvitrine zu keinem Laut erstarren. Ahnen, was kommt, und das kommt selten genug. Dazu muss vieles passen. Herr Dschomba außer Sicht- und Hörweite. Der Großvater ebenfalls. Von den Stammgästen jene Männer da, die Herrn Dschomba übersehen, solange er mit am Tisch sitzt. Deren Augen eng werden, sobald er gegangen ist und sein Platz vor dem Kachelofen leer und doch nicht. Setzt sich lange keiner hin, auch wenn man auseinanderrücken könnte. Muss erst Zeit vergehen. Wenn das alles passt, die Tür zugefallen ist und unter den Männern der Querulant, dann wird es spannend.
Richtung Küche schauen, ist der Vater hier? Auch der hat gute Ohren, von ihm wissen wir Wirtskinder den heimlichen Schimpfnamen für den Gast, wissen, was ein Querulant ist. Einer, der Unruhe stiftet. Der nur Ärger bringt. Dem wir auf keinen Fall das eine Bier zu viel geben dürfen. Wir müssen dem Vater versichern, das verstanden zu haben: Im Zweifel sollen wir ihn holen. Er würde ihn dann hochkant.
Aber der Vater ist beschäftigt und der Großvater raucht seine Zigarette.
Sich auflösen, eins werden mit der braunen Gastzimmereinrichtung, zum Möbel werden. Dann redet der Querulant. Schlohweiße Haare, die Augenbrauen buschig, die Augen eisblau. Kein Kartenspieler. Ganz anders wäre es gewesen, behauptet er, das hätte er damals schon gewusst und auch jedem gesagt, damals, als der Verrückte am Friedhof getanzt hatte, nackt.
Im Ofen knackt ein Holz. Über den Köpfen der Männer blaugrauer Rauch. In den Rauch hinein fällt das Wort „Mörder“. Eh leise, eh so, dass es mehr geflüstert ist als gesagt. Aber weil einer (der vor fünf Jahren Zugezogene) den Kopf schüttelt und sich dabei zum Nachbarn dreht, so eigenartig lächelnd. Muss das Wort wiederholt werden, lauter dieses Mal. „Ein Mörder, glaub’s ruhig.“ Und ob der Stammtischkollege denke, als Zuagroaster mehr zu wissen als einer, dessen Vorfahren schon vor zweihundert Jahren Bauern waren hier?
Es knistert. Ob der Vater? Nein, kein Vater, ob vielleicht die Mutter? Sie kann umgehen mit allen. Sie bringt Randalierer hinaus, bevor sie zu solchen werden können. Bevor der Vater kommt mit seinem Hochkant.
Aber die Geschichte hören wollen. Auch der Zugezogene ist ein Beruhiger, lässt sich nicht aufgansln. „Na gut“, sagt er, „dann erzähl von deinem Mörder.“ Wischt sich gerade so viel von seinem eigenartigen Lächeln aus dem Gesicht, dass der Querulant anfängt zu reden.
Er wisse aus sicherer Quelle, dass dieser Dragan Dreck am Stecken habe. „Und irgendwann krieg ich ihn dran.“ Wofür? Für Körperverletzung, Raub, Mord. „Sucht’s euch aus.“ Es könne kein Zufall sein, dass die alte Erna gestorben ist, als der Serbe, der Jugo, in der Stadt aufgetaucht war, seit damals sammle er Beweise für dessen Schuld am Tod der Frau, die für ihn war wie eine Pflegemutter. (Werden Augenbrauen hochgezogen am Tisch, in Verwunderung. Das ist neu.)
„Ich sag: Wie eine Pflegemutter war sie für mich!“
Wagt einer zu fragen, ob das wohl stimme, aber neugierig fragt er das: „Wie kommt’s? Du bist doch auf eurem Hof aufgewachsen.“ Und zum Zugezogenen: „Ein Bauernhof in der Nähe von Pupping. Ein Bruder vom Hans hat ihn übernommen.“
Der Querulant, der eigentlich Johann heißt und als Hans angesprochen wird, gibt keine Antwort. Schafft noch ein Bier an. Die Männer am Stammtisch wenden sich zur Schank und ein zweiter sagt: „Mir bringst auch eins, bitte.“
Die Gläser holen und neu befüllen, schnell, aber nicht zu schnell, denn ist das Bier schlecht eingeschenkt, beschwert sich dieser Hans und kommt ins Schimpfen. Aufs G’schäft aufpassen und gleichzeitig in der Obhut der Männer sein. Die uns Kinder kennen von klein auf. Sie sind mit dem Großvater alt oder mit dem Vater erwachsen geworden. Der Querulant kann uns nichts tun, nicht mit Worten und nicht tatsächlich. Wir müssen ihm nicht einmal nahe kommen, man nimmt uns das Bier ab und reicht es über den Tisch.
„Danke.“ Ob noch jemand etwas? Wieder hinter der Schank verschwinden, den Zapfhahn abwischen und Ordnung machen in der Vitrine.
Er trinkt, setzt das Glas ab, fährt fort. „Ich kannte die Erna und sie kannte mich, das muss euch reichen.“ (Tut es das?) Spürt wohl selbst, die Zeit wird knapp, das Mördertum will untergebracht werden, man darf sich nicht aufhalten mit Geschichten aus der Jugendzeit. Die er vielleicht für sich behalten will, wirkt unzufrieden, wie einer, der eine Tür geöffnet hat, die zubleiben sollte.
In der Küche läutet das Telefon und verstummt, jemand hat abgehoben. Die Stimme der Mutter im Vorhaus, sie grüßt auf die Straße hinaus. Schnell, mach, red vom Mord. Der sich als keiner herausstellt, denn: „Ob er sie erstickt hat und sich dann versteckt im Haus für ein paar Tag?“ Er behauptet etwas und schwächt es ab, dumm ist er nicht. Es hätte gereicht, sagt er, und so wird’s gewesen sein, dass der Jugo bei der Erna auftaucht und sich vorstellt als ihr verlorener Sohn. „Ihr Herz war schwach, gut ist es ihr nicht gegangen damals, der Schock war zu viel. Hat sich hingelegt und ist gestorben. Und der Dschomba trägt die Schuld bis heute.“
Enttäuscht sein, die Geschichte kennen, ändert sich nie, wird immer so erzählt, als wäre es das erste Mal. Immer auf den Mord hoffen, immer wird er angekündigt und abgeschwächt und übrig bleibt am Schluss: So wird’s gewesen sein oder doch anders.
Tauchen nach und nach kleine Wahrheiten auf, dann betreffen sie den Querulanten und andere, aber niemals Herrn Dschomba.
Ihm ein Verbrechen zutrauen wollen und gleichzeitig hoffen, es wäre gelogen.
Unruhe am Tisch, die Männer rücken auseinander, nehmen den Platz vor dem Ofen ein, Auslöser dafür ist der Großvater: Zurück vom Rauchen, vom Leuteschauen vor dem Haus, setzt er sich schweigend hin und fordert Raum.
Tür
Es gab einen Grund, warum die Spechtler am Friedhofstor weder den Dechant noch den Fremden entdecken konnten. Warum der Gendarm an der Seitentür vergeblich sein Ohr an das Holz presste oder durch einen Spalt spähte, da nichts zu hören war von den beiden, kein Gerede, kein Geschrei, auch der seltsam gebrüllte Gesang war verstummt. Ein paar Krähen, der Straßenverkehr, sein eigenes Schnaufen und der Bestatter, der sagte, dass die Angehörigen der Erna Zeisig gleich kämen, er müsse die Kränze richten und ihnen Bescheid geben, warum das Tor versperrt wär.
„Gehst halt,“, sagte der Gendarm. Blieb der Querulant mit seinem schwarzen Fahrrad und dem Paket, das er wieder auf dem Gepäckträger festgebunden hatte. Er schimpfte, es war beschmutzt.
„Was willst, dir ist wenigstens keiner drüberg’fahren. Hätt passieren können. Ist was Zerbrechliches drinnen?“, fragte der Gendarm, der Stephan Hintersteiger hieß. Der Fahrradmann meinte mit böser Stimme, er solle sich lieber um den Verbrecher kümmern als um Sachen, die ihn nix angingen.
„Aber wenn’s kaputt ist, dann wirst Anzeige erstatten, oder?“ Antwortete nicht, der andere. „Spätestens dann soll’s mich was angehen, oder?“ Wieder keine Antwort, spuckte statt einer solchen auf den Boden. „Ich schlag vor, Hans, du verschwindest jetzt.“
Weil, es reicht einmal. Und kalt und ungemütlich war dem Hintersteiger auch. Sah dem Querulanten nach, war vor Kurzem eine Beschwerde eingegangen über ihn, hatte gute und schlechte Tage.
Heut war für alle ein schlechter Tag. Einer, an dem ständig etwas übersehen oder vergessen wurde. Der Gendarm tastete in der Tasche, drinnen waren die Schlüssel vom Haupttor und von den Seitentüren des Friedhofs. „Fix Teufel“, fluchte Hintersteiger. Nun ja. Der Bestatter würde es schon merken und jemanden schicken. Räusperte sich und drückte, die rechte Hand an der Waffe, mit der linken den Türgriff hinunter, atmete durch und.
Weit offen stand die Tür. Viel weiter, als er es geplant hatte, hing leichtgängig in den Angeln, dieses Mistding.
Füße
Die Wahrheit über das, was tatsächlich geschehen war auf dem Eferdinger Friedhof im November 1954, sollten zeit ihres Lebens nur zwei Menschen kennen: Herbert Genzl, Dechant, ursprünglich aus Steyr stammend, vor Jahren seitens der Diözese nach Eferding versetzt. Und Dragan Džomba, aufgewachsen in einem kleinen Ort, am Ufer der Save gelegen und in der Nähe Belgrads, aus freien Stücken in Eferding gelandet, die so frei nicht waren.
Als Genzl die Tür des schmalen Seiteneingangs hinter sich ins Schloss drückte, gab das einen kleinen Laut, ein metallisches Klicken. „Herrgott, Herbert“, sagte er zu sich; das Geräusch hatte den Brüllgesang auf der Stelle unterbrochen. Es hatte die Aufmerksamkeit des Fremden auf ihn gezogen. Dabei war der Geistliche noch unsicher, wie den Mann ansprechen, sanft, streng?
Genzl schloss die Tür, das Klicken unterbrach Gesang und Regen: Es hörte auf zu nieseln. Džomba, die Arme in die Höh gestreckt, stoppte in der Tanzbewegung, drehte sich um, der Bart wirr, das Haar wirr, Augen und Mund aufgerissen, der Blick so traurig, das Gesicht so voller Verzweiflung, dass dem Geistlichen das Herz wehtat, es sich mit Mitleid füllte, es zum Bersten brachte und er zu Boden stürzte.
Er fand sich auf der niedrigen Umrandung eines Grabes sitzend wieder, der Fremde neben ihm, ihn stützend, der schwere Mantel – jener Mantel, der einen Grabstein verziert hatte – war ihm über den eigenen Mantel um die Schultern gelegt worden. Der Dechant, er saß gebeugt, den Kopf zwischen den Knien, spürte eine Hand im Rücken und betrachtete seine schwarzen Schuhe. Die man putzen musste, dachte er, polieren. Schade drum, waren schön sauber gewesen. Sah neben seinen Schuhen nasse Männerfüße mit Haaren auf Zehen und Rist, sah, den Kopf vorsichtig zur Seite neigend, die dazugehörigen Beine, ebenfalls gut behaart, darüber den Rand der bis zu den Knien aufgekrempelten Hosen. Arme, schäbige Hosen. Das ist kein Reicher nicht. Doppelte Verneinung, dachte er. Und an den Deutschunterricht, den er in der Kaiser-Franz-Josef-Schule manchmal supplierte, wenn der Lehrer ausfiel und er Zeit hatte. Wäre gern ein Lehrer geworden, ein weltlicher. (Aber die Familientradition.)
Weiter sah er nicht. Um weiter sehen zu können und den ganzen Mann in Augenschein zu nehmen, hätte Genzl sich aufrichten müssen. Gott bewahre. Wenn nun tatsächlich das Herz? Hatte er seine Tabletten genommen, lagen sie im Pfarrhof auf dem Tisch in der kleinen Schüssel? Hatte ihn nicht der Arzt erst kürzlich gescholten, er solle seine Medizin gleich beim Frühstück einnehmen und nicht den ganzen Tag liegen lassen? Herrje. Genzl stöhnte kurz und legte sich in deine Hände, mein Herr. Verbarg sein Gesicht und schüttelte den Kopf.
„Atmen Sie, pope“, forderte der Halbnackte auf, die Stimme nicht so tief, wie Genzl es erwartet hätte von so einem Mann. So einem präsenten Mann. Der leise nach Schweiß roch (ja, leise!) und vor Hitze dampfte. Glaubte der Dechant zu wissen. Genzl krächzte: „Dechant, bin kein Pope, kein Pfarrer, sondern ein Dechant.“ Und dann, weil der andere nicht reagierte, sagte er zur Sicherheit: „Dolazim u miru.“
„Dobro“, lachte der Fremde, er lachte tatsächlich, sagte auf Deutsch und ohne auffälligen Akzent, dass er sehr froh sei, dass der Herr Pfarrer, entschuldige, der Herr Dechant in Frieden käme, sonst hätte er ihn womöglich erschlagen müssen und hier, bei den Kindern, begraben.
Und griff nach der Hand des Dechants, einfach so. Nach jener, die ihm am nächsten war. Der rechten. Denn er saß zu seiner rechten Seite. Rechts mortalitas, links immortalitas? Nein, genau umgekehrt. (Jesus saß zur Rechten des Herrn.) Genzls Geist war ein unruhiger, nichts wollte gelingen. Aufstehen? Seine Hand aus der des Fremden ziehen? Es stach in der Brust allein beim Gedanken daran.
Zudem war die Berührung angenehm, wenn er sie zuließ. War ein gutes Gefühl, das andauern durfte. Sollte aber nicht, er wurde etwas gefragt. „Was?“ Musste den Kopf heben. Und dem Mann ins Gesicht sehen, der ihm nicht mehr zur Seite saß, sondern vor ihm hockte. Ihn musterte mit dunklen Augen, die sich nicht deuten ließen. Griff auch nach der linken Hand: „Der Friedhof ist kein Platz für einen, der krank ist.“ Kam noch näher an ihn heran, im Atem kein Alkohol, dabei hätte ein Rausch vieles erklärt, wäre von allen akzeptiert worden, ein wenig Entrüstung, ein wenig Getue. Aber mit der Zeit.
Fühlte ihm gar die Stirn. Verdunkelte die Handfläche des offenkundig um ihn Besorgten Genzl die Sicht. Ein seltsamer Mensch. Hockte ruhig vor dem Dechant. Sagte nichts, tat nichts, tröstete nicht, beschwichtigte nicht. Überlegte, schürzte die Lippen und kratzte sich schließlich am Hals, das Kinn gereckt. „Warte“, sagte der Fremde. Der ein serbisches Wiegenlied gebrüllt hatte mit einer Stimme, die das Blut in den Adern.
Ach, Blödsinn, dachte der Pfarrer, Verzeihung, der Dechant. Er richtete sich im Sitzen auf und streckte die Beine in den Kies. So konnte er den anderen beobachten und dabei sein Herz vergessen. Was tat der da? Bückte sich von Grab zu Grab, rüttelte sacht an den Laternen, aber nur an solchen, in denen Kerzen brannten, ging von einer zur anderen. Ja, fror der Mensch nicht?
Genzl zog sich den Mantel enger um den Leib. Für seinen Teil: Ihm war so kalt, dass er zitterte. Das Zittern hatte er nicht wahrgenommen, oder war es erst jetzt gekommen? Sollte gerade eintreten, was ihm der Arzt prophezeit hatte, früher oder später bei gleichbleibender Lebensweise? Zu sterben, nein, auf dem Friedhof zu sterben, das wäre ein prosaischer Tod für einen Geistlichen. Genzl musste lächeln. Ob sie ihn im Pfarrhof aufbahren würden oder seinen Leichnam der armen Erna Zeisig in der Aufbahrungshalle als Gesellschaft beistellen? Beim Sarg hatten ihre Kinder sicher tief in die Tasche gegriffen; das schlechte Gewissen, das durch Ernas Familie zog, war ihm vertraut. Seiner wäre daneben eine Schande. Lächelte wieder, dachte an sein Testament, in dem er sich – ausdrücklich! – einen Arme-Leute-Sarg bestellt hatte und ein Begräbnis zweiter Klasse. Damit sie etwas zum Reden haben, seine Schäflein, und zum Streiten auch.
„Na siehst du, es muss dir besser gehen, wenn du lachen kannst.“ Der Fremde stellte ihm eine Grablaterne zwischen die ausgestreckten Beine, in der ein Licht flackerte. Hockte sich hin, nahm wieder Genzls Hände in die seinen, dann legte er sie auf das gewölbte Dach der kleinen Laterne. Warm war es, fast heiß, gerade so, dass man sich nicht verbrannte.
„Aber“, fing Genzl an, den Tränen nahe, weil das Zittern nachließ und mit ihm die Angst.
„Keine Sorge, ich richt’s wieder. War schlecht angeschraubt, das Ding. Ist vieles hier nicht gut angeschraubt.“
Hockten zwei Männer auf einem Friedhof vor einer Laterne, wie ums Lagerfeuer in einer anderen Welt. Kannten sich nicht, aber kümmerten sich. Der eine war alt, der andere im Vergleich noch jung. Der eine hatte schmutzige Schuhe und waren ihm auch Hose und Mantel dreckig geworden vom Sitzen auf der bemoosten Grabumrandung. (Und wie viele Farben das Moos hatte, Genzl nahm es wahr.) Der andere hatte nur Hosen an und ein offenes Hemd, war barfuß und barhäuptig. Und sagte: „Was machen wir? Soll ich dich nach Hause bringen oder noch mehr Laternen holen?“ Er sah zur Seitentür hinüber. „Oder wird mich dein Polizist da wegen Grabschändung verhaften?“ Spannten sich ihm die Muskeln an, bei aller Gelassenheit war das nicht zu verbergen.
Blieb ruhig, aber bereit.
Blieb dem Dechant zugewandt.
Behielt dabei den Gendarmen im Blick.
„Herbert Genzl“, sagte Genzl und streckte dem Fremden seine angewärmte Rechte entgegen. „Hilf mir auf, bitte, und hilf mir heim.“ Winkte dann auch dem Gendarmen, er solle kommen, mithelfen. „Steck die Waffe weg und beeil dich“, rief er ihm zu, sähe er denn nicht, dass der Regen wieder stärker werde?
Margerite
Ob unser Pfarrer auch ein Dechant ist? Mit dem Großvater in die Kirche gehen, in den Eferdinger Dom. Weil hoch und spitzbogig. Ein Langschiff, was für ein Wort. In der Bank unter der Kanzel ist unser Platz. Ein Messingschild mit geschwungener Schrift. Mit dem Finger die Linien nachfahren. Der fremde Name auf dem dunkel-goldenen Schild ist der des Vorbesitzers unseres Hauses: Jos. Heftberger, Gastwirth zum Krebsen.
Sitzen und atmen. Die weihrauch-kalte Luft hat ein Gewicht. Das Handtäschchen auf dem Schoß. „Tu’s her“, will der Großvater, legt es weg, es stört beim Händefalten, beim Knien und Aufsteh’n und wieder Hinsetzen, beim Bekreuzigen in richtiger Reihenfolge. Im Täschchen: ein Stofftaschentuch, ein Rosenkranz (rosige Glasperlen mit Kreuz an einem Silberkettchen), ein kleines, uraltes Gebetsbuch, von der Großmutter erbettelt, ein Schatz. Nicht zu gebrauchen für den Gottesdienst.
Aber was man hat.
Nimmt man mit.
Früh ist es am Tag, nach der Messe gibt es kein Aufhalten. Gleich heim, mithelfen beim Frühschoppen.





























