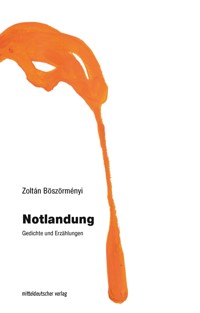Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mitteldeutscher Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Roman passend in unsere Zeit der Fluchtmigration und gesellschaftlichen Eliten // Ein Flug in die vermeintliche Freiheit, doch dann ist Tamás staatenlos. Seine Ankunft in der neuen Heimat Kanada ist geprägt von unüberwindbar erscheinenden Widrigkeiten. Gut, dass ihm Walter, Journalist und angehender Parlamentarier, zur Seite steht und hilft, Fuß zu fassen. Doch Walter zieht ihn auch immer tiefer in die dunklen Abgründe der neuen Heimat. Tamás ahnt nicht, dass er in einer Art Geheimklub gelandet ist, in dem sich die Spitzen der Gesellschaft zusammenfinden. Intrigen, Missgunst, sexuelle Ausschweifungen und Tragödien begleiten ihn von nun an. Das schwere Schicksal eines Einwanderers, geprägt von Hoffnung, Verzweiflung und schließlich der Aussicht auf einen baldigen Nachzug seiner Familie steht den kriminellen Machenschaften, den Geschichten um Walter und dessen Welt gegenüber. „Weicher Körper der Nacht“ ist eine durch und durch spannungsgeladene Lektüre, die Einsicht in ein Einwandererschicksal und in ein Außenseiterleben von gesellschaftlich anerkannten Persönlichkeiten des Aufnahmelands gewährt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 605
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ZOLTÁN BÖSZÖRMÉNYI
Weicher Körper der Nacht
Roman
Aus dem Ungarischen von Hans-Henning Paetzke
Mitteldeutscher Verlag
Die Originalausgabe erschien 2008 unter dem Titel „Az éj puha teste“ im Verlag Ulpius-Ház, Budapest.
Copyright © 2008 by Zoltán Böszörményi
1. Auflage
Copyright © 2022 der deutschen Ausgabe
by mdv Mitteldeutscher Verlag GmbH, Halle (Saale) www.mitteldeutscherverlag.de
Alle Rechte vorbehalten.
Gesamtherstellung: Mitteldeutscher Verlag, Halle (Saale) Umschlagabbildung: The Island, 2009, Switzerland – Buğrahan Şirin
ISBN 978-3-96311-862-3
Alle Rechte vorbehalten! © Mitteldeutscher Verlag
„Leben ist Sorgen, und zwar in der Neigung des Es-sich-leicht-Machens, der Flucht.“
Martin Heidegger
„Wer ohne Ziel lebt, findet sich damit ab, vom Zufall beherrscht zu werden.“
„Ich befürchte, Sie haben mich nicht richtig verstanden. Wusste denn Kolumbus, als er Amerika entdeckte, wohin er sein Schiff steuerte? Sein Ziel war voranzukommen, immer geradeaus. Das Ziel war er selbst, und das beflügelte ihn.“
André Gide
„… Ist es in einem ähnlichen Fall nicht ungerecht, um körperlicher Freuden willen diesen die Seele zu entfremden und zu sagen, aus knechtischer Pflicht und Notwendigkeit ihnen hinterhertrotten zu müssen? … Denn es ist sehr wahr, was man sagt, dass der Körper seinem Appetit nicht auf Kosten der Seele nachgeben sol. Aber warum sollte nicht auch wahr sein, dass die Seele nicht dem ihren auf Kosten des Körpers folgen soll?“
Michel de Montaigne
ERSTES KAPITEL
1.
„Vergessen heißt, sich nicht an das Unauslöschliche erinnern“, trat Zeno ans Fenster. Er war zerknirscht. Unruhig. Verzweifelt. Als hätten ihn die Welt, das Glück im Stich gelassen. Er fühlte sich ausgelaugt. Ohne Zukunft. Ohne Pläne. Auf den keine neue Kampfarena mehr wartete, kein neuer Kampf. Nichts wartete mehr auf ihn. Er sah zum Fenster hinaus. Herrlich die Nacht dort draußen. Leichte Windstöße klammerten sich an das Laub der Bäume. Aufgeschreckt fielen sich die Blätter in die Arme.
Scheinwerferfarben von vorüberhuschenden Autos auf der Straße. „Würde ich das Fenster weiter öffnen, könnte ich den weichen Körper der Nacht berühren, seinen dunklen Samt, mein knochig aus dem Fleisch hervorstehendes Leben. Noch ist es hier, mein Leben, noch höre ich meinen Atem. Noch gehört das ins Wasser der Stille eintauchende Gesicht mir. Noch sehe ich, was mich umgibt. Noch pulsieren hinter meinen Schläfen die sich an die Landschaft anschmiegenden Gedanken. Alles um mich her ist so sanft. Dennoch ist es mir, als stünde ich inmitten eines Sturms.“
Ein Regentropfen benetzte seine Hand. Er kam ihm wie Eis vor. Die nächsten Tropfen nahm er als glühende Funken wahr. In seinem Inneren loderte ein Scheiterhaufen. Und draußen schossen Flammen in die Höhe. Schwungvoll schloss er das Fenster.
2.
Gleich einem Schauspielanfänger, den das unerforschliche Schicksal ausersehen hat, eine große Szene aus seinem Leben zum Besten zu geben, bestieg Tamás den Bus. Obwohl seine Nerven zum Bersten angespannt waren, begab er sich gemächlich zu einem hinteren Sitzplatz. Eintauchend in die morgendliche Nebelwand hatte es den Anschein, als sei er bereits in der neuen Heimat angekommen. In seinem gelobten Land. In Sicherheit.
Er nahm eine Prise von dem, was er sich erhoffte, bekam eine Ahnung von der nicht vorhersehbaren Zukunft, auf die er sich vorbereitete. Und schon fand er sich im Strudel unerwarteter Ereignisse wieder. Das Gefühl zumindest hatte er. Die Gedanken schwirrten wild durcheinander. Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft verbanden sich zu etwas Unentwirrbarem. Auf seinem Sitz in der dritten Reihe machte er sich’s bequem, setzte sich, als würde er ein tägliches Ritual wiederholen. Hinter ihm tippelten die anderen durch den schmalen Gang, rempelten sich gegenseitig an, hielten Ausschau nach dem besten Sitzplatz, von wo aus sie die an ihnen vorbeihuschende Welt speichern, sich tief würden einprägen können, um dereinst von der Atmosphäre, dem Gesehenen, der Anspannung, dem Einmaligen berichten zu können.
Vom Platz vor dem Gebäude setzte sich der weiße Bus, kaum merklich durch das Schlagloch neben dem Gehweg schaukelnd, majestätisch in Bewegung. Zurückgebliebene Lagerinsassen winkten, hoben zum Abschied die Arme, als würden sie die in Worte nicht zu fassende Erfüllung der Freiheitssehnsucht der im Bus Sitzenden feiern, als wüssten sie ganz sicher, dass auf die Davonziehenden ein aufregender Neubeginn warten würde. Auch Tamás fühlte sich ergriffen vom Abschied der ihnen Zuwinkenden. „So“, dachte er, „mochten sie auch von Odysseus Abschied genommen haben, als der von Ithaka aus in See gestochen war.“
An jenem Morgen transportierte das monströse Fahrzeug auch noch eine weitere Gruppe von Auswanderern über die holprigen Straßen zum Flughafen. So viele Schicksale an so viele Ziele. Von einer erstarrten Gegenwart in eine andere, eine bildsame Gegenwart. Von einer in eine andere, für sicher gehaltene Unsicherheit. Was damals von den erwartungsvoll zum Fenster Hinausblickenden noch niemand wusste. Doch vielleicht hatten sie schon eine Ahnung. Nur zeichnete sie sich noch nicht so deutlich ab, auch wenn das Unbekannte leicht beklommen machte und Träume alles andere überlagerten. Später richtete sich ihre Aufmerksamkeit nicht auf die Planung der Zukunft, sondern vielmehr auf die in den Vordergrund drängenden aktuellen Geschehnisse. Später dann wurden sie von der kaum zurückgelassenen Vergangenheit verfolgt, von den weniger schönen Erinnerungen an die Lagerzeit. Dabei hätten sie all dies gern vergessen, das Gewesene ungeschehen gemacht.
Vor dem Eingang zum Flughafen stellten sich die Auswanderer zum Gänsemarsch auf. Zumeist junge Frauen und Männer.
Doch auch einige Kinder, die ständig zur Ordnung gerufen werden mussten, damit sie nicht aus der Reihe tanzten und am Ende gar verlorengingen. „Wenn sie in der Gegend umherschwirren, wird die Maschine ohne sie starten. Und wer weiß, wann sich dann die nächste Möglichkeit für den ersehnten Flug ergibt.
Wenn überhaupt!“, dachte Tamás bei sich, noch bevor eine junge Frau im Jeansrock diese Befürchtung laut aussprach.
Die Gruppe bildete eine kleine Insel. Tamás fiel ein unbekannter Mann um die Vierzig auf: weißes Hemd, rote Krawatte, in der Hand eine prall gefüllte Aktentasche. Seine Erscheinung hatte den Anstrich von etwas keinen Widerspruch duldenden Amtlichem. Dabei hatte er noch gar nichts von sich gegeben. Seine Bewegungen waren dezent, fast schon bühnenreif, während er mit stechendem Blick den Raum, die Gesichter in Augenschein nahm. Er wartete ab, bis Ruhe eintrat, auch die Kinder zu plappern aufhörten und gespannt darauf warteten, was nun geschehen würde. Erst jetzt gab er durch einen Wink zu verstehen, dass man ihm folgen sollte.
Sie kamen in einem für Versammlungen geeigneten Raum an. Hier ging das verordnete Schweigen schnell in Raunen über, nachdem sie auf den militärisch akkurat angeordneten Stühlen Platz genommen hatten. Der Mann mit der Aktentasche begrüßte die Anwesenden. Die Ansprache könnte farblos genannt werden, würde er die Stimme am Satzende nicht heben, wie um dem Mitzuteilenden größeres Gewicht zu verleihen. Punkt um Punkt erläuterte er das weitere Prozedere, holte aus seiner Aktentasche gelbe Kuverts hervor, stellte sie wie Karteikarten auf den Tisch, fischte ein passartiges Dokument hervor, schlug es auf und las einen Namen vor. Dann den nächsten.
Als Tamás aufgerufen wurde, erhob er sich ruckartig von seinem Stuhl und Schritt entschlossen auf den Tisch zu, blickte dem Beamten unerschrocken ins Gesicht. Für den Bruchteil einer Sekunde, bevor ihm der Reisepass, die Einwanderungsgenehmigung, die Erklärung zum Grenzübertritt, das Flugticket, das Verzeichnis mit den Namen der Einwanderungsbehörde und die Liste mit den Ämtern überreicht wurden, begegneten sich ihre Blicke.
Nach einem routinierten Händedruck des Beamten begab sich Tamás zurück auf seinen Platz und begutachtete den Inhalt des Kuverts, kontrollierte die Angaben in seinem braunen Reisepass. Auf seinem Namen fehlte das Dehnungszeichen.
Der Anblick seines zu Beginn des Lageraufenthalts entstandenes Passbild ließ ihn bitter lächeln. Die Erinnerung an die Hektik in Verbindung mit dem Ausfüllen der Auswanderungsanträge stieg wieder in ihm auf, als er kurz vor Ladenschluss zum Fotografen an der Ecke gehastet war, der dann ein abgehärmtes, trauriges Gesicht abgelichtet hatte.
Während er den Reisepass aufmerksam in Augenschein nahm, stieß er verdutzt auf den Gültigkeitsvermerk. Dreißig Tage gewährte man ihm bis zum Verlassen des Landes. Damit er sich nicht etwa eines Besseren besinnen und ins Lager zurückkehren sollte.
Der Vermerk, dass er nun staatenlos sei, missfiel ihm nicht minder. Er fühlte sich wie vor den Kopf geschlagen, musste schlucken, las das Wort „staatenlos“ immer und immer wieder, führte sich dessen Bedeutung vor Augen, versuchte, sich daran zu gewöhnen. In die Freude über das bevorstehende neue Leben mischte sich ein Anflug von Schmerz, die verblüffende Erkenntnis der schwerwiegenden Wirklichkeit. Doch schließlich musste er sich eingestehen, dass jemand, dem die Heimat irgendwie abhanden gekommen war, tatsächlich staatenlos war. In seinem Lebenslauf würde die Auswanderung dereinst lediglich ein bizarres, eigenartiges und vielleicht sogar uninteressantes Moment sein. „Ich habe also keine Heimat mehr, bin staatenlos“, dachte er.
Pass und Flugticket verstaute er in der Westentasche, trennte sie von den anderen Dokumenten. Jetzt hatte er für den Sprung über den Großen Teich, den Sprung in eine ungewisse Zukunft alles beisammen. Die Kuverts auf dem Tisch nahmen langsam ab. „Meine Damen und Herren“, ließ sich der Beamte in seiner gewohnt trockenen und keinen Widerspruch duldenden Art vernehmen, „merken Sie sich bitte genau die auf dem Ticket vermerkte Gate-Nummer! Vierzig Minuten vor dem Abflug müssen Sie sich dort einfinden! Vor den Duty-free-Shops sollten Sie keine Maulaffen feilhalten! Am Ende würden Sie gar den Abflug verpassen!“
Nun machte er eine Pause, als wären ihm die Worte ausgegangen, holte tief Luft, schloss die Aktentasche, ließ seinen Blick feierlich über die Menge schweifen und wünschte allen einen guten Flug: „Und viel Glück in der neuen Heimat!“ Den Blick zu Boden gesenkt, verließ er den Saal mit flinken Schritten. Den Tisch, auf dem soeben noch die gelben Kuverts auf ihre Adressaten gewartet hatten, überzog eine Lichtflut. Zusehends hob ein undefinierbares Stimmengewirr an.
Vor dem Sicherheitstor eine Warteschlange. Auch Tamás stellte sich an. In seiner kleinen Kunstledertasche befanden sich die wenigen persönlichen Sachen, die ihm geblieben waren.
Auch das einzige, im Lager zu seinem Geburtstag bekommene Buch: Goethes Faust.
Bei der Leibesvisitation wurde nichts beanstandet. Nur der Mann, der die Papiere und das Ticket kontrollierte, schien die Stirn zu runzeln, als wollte er sagen: „Du bist also staatenlos, du lockerer Vogel!“ Aber es könnte auch sein, dass sich nur Tamás dieser Eindruck aufdrängte. Bei der Passkontrolle merkte der Grenzbeamte laut vernehmlich an, sodass auch die anderen in der Warteschlange Stehenden es hören konnten: „Ich hoffe, Sie wissen, dass Ihr Pass nur für eine einmalige Ausreise gültig ist und nicht zu einer Rückkehr berechtigt!“
Tamás dagegen wusste, dass dem nicht so war. Es soll schon vorgekommen sein, dass einige Auswanderer dennoch zurückkehrten und trotz gegenteiliger Rechtsverordnung auch mit dem abgelaufenen Pass wieder einreisen durften.
Vollkommen zufällig war er einem solchen Fall im Herbst begegnet. Es mochte Samstag gewesen sein, als Polizisten einen blonden, kurzgeschorenen jungen Mann in Handschellen anbrachten, von denen sie ihn erst nach der Ankunft im Lager befreiten. Er trug eine braune Lederjacke. Auf der Nase eine große goldumrandete Sonnenbrille, die er gemächlich abnahm und vor sich auf dem Tisch ablegte. Es hieß, er sei von irgendwo aus Amerika eingetroffen. Der Bursche machte einen verstörten Eindruck, redete kein einziges Wort, saß nur mit gesenktem Kopf da.
Auch am späten Nachmittag fand ihn Tamás am Mittagstisch sitzend. Wer den Raum betrat, musste um ihn wegen der Enge einen Bogen machen. Schon seit Stunden saß er einfach nur so da, die Hände im Schoß liegend. Abends aber, wie auf ein geheimes Zeichen, kehrten die Lebensgeister plötzlich zurück. Er verlangte nach Brot und Bier und begann zu erzählen, redete wie ein Wasserfall, berichtete von seinen Erfahrungen in Übersee, davon, dass er einmal ohne Schlaf vierundzwanzig Stunden hintereinander habe arbeiten müssen, weil die Kaffeeverpackungsmaschine einen Stil stand nicht duldete. Niemand unter den Arbeitern habe den Mut gehabt, sich dem zu widersetzen, obwohl sie nach der zwanzigsten Stunde schon alles doppelt gesehen hätten. Aus lauter Verzweiflung hätten sie gelacht und so getan, als würden sie vor Erschöpfung zusammenbrechen. Schließlich hätten sie die Maschine sich selbst überlassen und sich nicht darum gekümmert, dass die Kaffeetüten zur Erde gepurzelt seien und sich dort aufgetürmt hätten, als der Eigentümer empört hereingestürmt sei. Wie sich die Geschichten doch ähnelten. So etwas hatte Tamás ja in seiner Lagerzeit als Schwarzarbeiter gleichfalls erlebt.
Nun ja, dieser Bursche hatte erzählt, dass er mit einem ungültigen Pass eingereist sei. Diese Episode fiel Tamás bei der Passkontrolle ein, weshalb er auf die Androhung, nicht zurückkehren zu dürfen, einfach nicht reagierte, höchstens kurz nickte, als würde er den allzeitigen Erklärungen der Mächtigen zustimmen.
Nun blieben nur noch die schillernden Geschäfte. Tamás tat so, als würde er auf seinen Anschlussflug warten und sich die Wartezeit durch Einkäufe vertreiben, könnte es sich leisten und hätte Abnehmer für kleine Mitbringsel, die ihn in den Auslagen verlockend anlachten. Vor einem Schreibwarenladen blieb er stehen. Er mochte die verschiedensten Füllfederhalter und Bleistifte. Da er längere Zeit vor dem Schaufenster verharrte, kam die junge Verkäuferin aus dem Geschäft und bot ihm ihre Hilfe an. „Kommen Sie doch herein!“, forderte sie ihn auf. „Drinnen kann ich Ihnen einige neue handgefertigte, außergewöhnliche Exponate zeigen.“
Die Verkäuferin maß ihn schnell von oben bis unten, fand ihn, den hochgewachsenen jungen Mann mit der hohen Stirn im grauen Anzug, wohl sympathisch. Erschrocken machte er abwehrend fahrige Bewegungen mit den Händen. „Ich gucke nur, will nichts kaufen. Und überhaupt“, sah er auf seine Uhr, „ich muss mich sputen, meine Maschine startet gleich.“ Es schien fast, als würde die junge Frau bedauern, dass sie den feschen Fremden nun ganz sicher nicht würde kennenlernen. Sie zuckte die Schultern und zog sich ins Geschäft zurück.
Der Wartesaal Nummer 10 im Westflügel des Flughafens war bis auf den letzten Platz gefüllt. Erwartungsvolles Stimmengewirr, ein kleines Kind plärrte in einem zusammenklappbaren Kinderwagen, lärmende Halbwüchsige hänselten sich gegenseitig. Einige von ihnen hockten auf dem Boden und lasen ein Buch oder blätterten in einer Illustrierten. Tamás bemerkte, dass keines der Kinder sich wirklich auf die Lektüre oder die imposanten Fotos konzentrierte. Viel neugieriger waren sie auf das, was um sie herum geschah, weshalb sie ihre Blicke ständig kreisen ließen, statt sich auf die Geschichten aus den Büchern und Zeitschriften zu beschränken. So verscheuchten sie vielleicht ihre Angst vor dem bevorstehenden Flug. Tamás wich den Kindern aus. Durch die Glaswand des Wartesaals beobachtete er den am Ende der Fluggastbrücke parkenden Riesenvogel. Mit einem so großen Flugzeug war er noch nie geflogen. Sein Blick tastete den Rumpf ab. Für einen Moment war es, als hätte er im Fenster der Pilotenkanzel den Kopf des hinter dem Steuerknüppel sitzenden Flugkapitäns entdeckt.
Die Wartenden wurden zum Einsteigen aufgefordert. Jede Geschichte, so kam es Tamás plötzlich in den Sinn, beginne mit irgendeinem Einstieg. Auch die Gedanken müssten sich mit Worten füllen. Zuvor seien sie lediglich ein Gerippe, hervorgetreten aus dem unbekannten Nichts, ein ans Licht der Sinnhaftigkeit drängender Seufzer. Langsam betrat er das Flugzeug. Die Stewardess nahm ihm die Bordkarte ab und wies ihn nach links zur vierundzwanzigsten Reihe neben dem Fenster. Geduldig wartete er ab, bis die Fluggäste vor ihm ihr Handgepäck verstauten, ihre Plätze einnahmen und die Sicherheitsgurte anlegten.
Erst dann ließ auch er seine Habseligkeiten in der Gepäckablage verschwinden. Plötzlich überwältigte ihn eine unbeschreibliche Angst. Er fühlte sich in der Falle. Obwohl er nichts wahrnahm, was auch nur den geringsten Anlass zur Sorge gegeben hätte, traten ihm Schweißperlen auf die Stirn. Die Stewardess schloss die Eingangsluke, die beim Einrasten hörbar klickte. Er versuchte, an etwas Schönes zu denken, um seine Aufmerksamkeit von den mit dem Start einhergehenden Gefahren abzulenken. Alles verlief glatt. Wie ein schlanker Riesenvogel rollte die Maschine auf die Startbahn. Das Hochfahren der Turbinen ließ den Flugkörper erbeben, bevor der sich in Bewegung setzte, immer schneller raste, bevor er vom Boden abhob, der Abstand zwischen Flügeln und Betonpiste kaum merklich anwuchs. Majestätisch, ohne Wald und Flur eines Blickes zu würdigen, ließ der Riesenvogel die Betonwüste des Flughafens, die sich ins Bewusstsein eingegrabene Landschaft unter sich verschwinden.
3.
Seit fast einer Stunde schon waren sie in der Luft, doch Tamás’ Unruhe wollte nicht schwinden. Ja, er schien sogar noch aufgeregter und nervöser zu werden. Die Schläfen pulsierten, schmerzten. Er bat die Flugbegleiterin um ein Glas Mineralwasser und ein Mittel gegen Kopfschmerzen. Über die Lautsprecher war der Flugkapitän zu vernehmen. Er informierte die Passagiere, dass es bis zur Landung noch acht Stunden dauern würde, erzählte noch dies und jenes, doch Tamás hörte nicht mehr zu, war nicht bei der Sache. In seiner Fantasie war er anderswo. Zu Hause. In den Straßen seiner Heimatstadt, auf dem Hof seines Wohnhauses.
Eine sich großer Wertschätzung erfreuende, betuchte Metzgerfamilie hatte das Gebäude, in dem er zehn Jahre lang wohnte, in den letzten Jahren des neunzehnten Jahrhunderts errichtet.
Ursprünglich umrahmte das L-förmige eingeschossige Wohnhaus einen großen Hof. Allerdings änderte sich die Bestimmung der Immobilie im Laufe der Jahre mehrmals, nachdem sich deren Eigentümer wegen unüberwindlicher familiärer Zwistigkeiten davon getrennt hatten. Die beiden Familien schafften es nicht, sich darüber zu einigen, wem wie viele Gebäudeanteile zustanden und welchen Beitrag sie für die Instandhaltung zu leisten hätten. Deshalb überließen sie das weitere Schicksal des Hauses lieber einem Makler. Vom neuen Besitzer wurde es als Mietshaus umgebaut. Im hinteren Teil des großen Hofes entstand eine ebenerdige Villa mit einem hübschen kleinen Park davor und einem Blumengarten. Auf den zehn Jahre alten Lindenbaum waren alle Bewohner ausgesprochen stolz. Sooft sich dazu die Gelegenheit bot, schwärmten sie von seinem geraden Stamm, den regelmäßigen Zweigen und der symmetrischen Baumkrone. Seinen Duft umrankten märchenhafte Geschichten. Vor allem zum Sommerbeginn, wenn die Umgebung vom süßlichen, betäubenden Duft der Lindenblüte eingehüllt wurde. Ein mythischer Baum. Wie es ein Freund aus Kindheitsjahren einmal formulierte: „Zwar sind alle Lindenbäume gleich, ähnlich wie Zwillinge, doch ihr Duft unterscheidet sich dennoch. Doch wirklich weiß das nur derjenige, der diese mythische Luft schon einmal tief eingeatmet hat.“
Im mehrgeschossigen Haus wohnten drei Familien. In der einen Wohnung waren Tamás und seine Familie zu Hause, in der zweiten ein berentetes Geschwisterpaar und in der dritten ein Ingenieursehepaar mit seiner fünfzehnjährigen Tochter. Außer Tamás’ beiden Söhnen gab es im Haus keine weiteren Kinder.
Im Haus herrschte ein gutnachbarschaftliches Klima. Streit und laute Worte waren dem verträumten Hof fremd. Sonnenstrahlen ließen die Stille zufrieden lächeln. Schattenwesen der Nacht sorgten immer und immer wieder für Geborgenheit.
Erst als eines Tages vollkommen unerwartet Fremde auftauchten, geriet alles durcheinander. Sie gingen von Wohnung zu Wohnung und erkundigten sich nach Tamás, wollten einfach alles über ihn in Erfahrung bringen. „Wann verlässt er das Haus? Wohin geht er? Wann kommt er abends nach Hause? Wer besucht ihn? Kennen sie jemanden von seinen Besuchern? Haben sie etwas von den Gesprächen aufgeschnappt? Was halten Sie von Tamás?
Welches Verhältnis hat er zu seiner Familie? Bekommt er Besuch von Frauen? Ist Ihnen an seinem Verhalten etwas Komisches aufgefallen? Trinkt und randaliert er? Wie ist er als Ehemann und Vater? Kümmert er sich um seine Familie? Gibt es manchmal Streit daheim? Wie benimmt er sich gegenüber seinen Mitbewohnern?
Unterhält er sich mit denen über Politik? Geht er zur Kirche?
Schimpft er auf Partei und Staat? Ist er unzufrieden mit denen?
Neigt er zum Jammern? Besuchen ihn seine Eltern?“
Als Menschen, die mit dem Gesetz noch nie in Konflikt geraten waren, gaben die Nachbarn den neugierigen Fremden bereitwillig und verängstigt Auskunft.
Die beiden alten Brüder verzogen sich, nachdem sie Tamás in der Haustür entdeckt hatten, demonstrativ in ihre Wohnung.
Das Ingenieursehepaar dagegen bedeutete dem Ankömmling, dass es etwas Wichtiges mitzuteilen habe, bat ihn an das andere Ende des Gartens. Flüsternd, sich gegenseitig ins Wort fallend, berichteten sie von den unheimlichen Besuchern. Ihrer Meinung nach sei Tamás in großen Schwierigkeiten. Freilich wüssten sie nicht, in was für scheußliche Dinge er hineingeraten sei. Die Fremden hätten sich ziemlich bedeckt gehalten, nicht einmal Andeutungen gemacht, was er sich zuschulden kommen lassen habe. Gerade deshalb seien die beiden Nachbarn zu der Schlussfolgerung gelangt, dass die Anschuldigungen sehr schwerwiegend sein müssten, wenn die zwei Männer in schwarzen Ledermänteln alle Mitbewohner verhört hätten, noch dazu einzeln, sogar mehrfach. „Wenn es den Verantwortlichen nicht so wichtig wäre, hätten sie bestimmt nicht zwei Geheime geschickt“, erklärte die Ingenieursfrau mit stockendem Atem.
Tamás verstand, worum es ging. Natürlich begriff er, was Sache war. Während die beiden Geheimen bei den Mitbewohnern Erkundigungen einzogen, war er in einem Keller der Polizei sechsundzwanzig Stunden lang festgehalten und erst nachmittags nach einem intensiven Verhör entlassen worden. Doch er tat so, als wüsste er mit der Angst des Ingenieursehepaars nichts anzufangen, setzte stattdessen all seine Überzeugungskraft ein, um sie zu beruhigen: „Aber nicht doch! Es kann sich nur um eine Routinekontrolle gehandelt haben. So was kann heutzutage jedem passieren. Das ist wie eine Krebsgeschwulst. Die kommt mehr oder weniger in jeder Gesellschaft vor. Die Mächtigen platzen fast vor Neugier, sind misstrauisch, haben kein Vertrauen zu ihren Untertanen.“ Dies sagte Tamás leise, kaum hörbar, fast so, als würde er ein Selbstgespräch führen. Sichtlich verstört und verängstigt, gefolgt von ihrem Mann, der richtiggehend zu zittern schien, kehrte die Ingenieurin Tamás den Rücken.
Tamás plagte das schlechte Gewissen, meinte, nicht wirklich überzeugend genug argumentiert zu haben. Er bedauerte seine Unfähigkeit, ihren Argwohn zu zerstreuen, ihnen zu vermitteln, dass kein Anlass zur Sorge, zur Panik bestünde, dass es lediglich ein kleines Durcheinander gegeben habe wie bei einer Stromsperre. Hernach, wenn der Strom wieder angestellt werde, die Lampen brennen und sich die alte Ordnung einstelle, sei es so, als sei nichts gewesen.
Als sich dann die Nachricht von seiner geglückten Flucht wie ein Lauffeuer verbreitete und auch die beiden Ingenieure davon erfuhren, fühlten sie sich darin bestätigt, dass die Geheimen keineswegs grundlos Erkundigungen eingezogen, dass sie, die Ingenieure, die aufziehende Gefahr sehr wohl richtig gespürt, zu Recht um ihren jungen Nachbarn, doch auch um sich selbst Angst gehabt hatten.
Von all dem berichtete Irene ihrem Mann in den sicherheitshalber von einem anderen Land aus aufgegebenen Briefen, die ihn im Flüchtlingslager erreichten. Die im Ton melancholischen Briefe kündeten angesichts der schrecklichen Trennung von Ausweglosigkeit und Hoffnungslosigkeit. Irene schilderte den Alltag der beiden gemeinsamen Kinder, deren Sehnsucht nach ihrem Vater.
Sie hielt es für wichtig, von allem ausführlich zu berichten. Deshalb schrieb sie endlos lange Briefe. Nach dem Lesen der mit großer Verzögerung und zerknittert eintreffenden Papierblätter fühlte Tamás sich hundsmiserabel. Angst vor einer ungewissen Zukunft überkam ihn. Immer und immer wieder, wenn ihn die plötzliche Einsamkeit in den Monaten des eintönigen Lageralltags quälte, las er die Briefe, begriff sie als Beleg dafür, dass die Sache mit seiner Familie trotz allem irgendwie in Ordnung war und dass er hoffen durfte, Kinder und Ehefrau eines nicht allzu fernen Tages wieder in die Arme schließen zu dürfen.
Als Irene und die Kinder von Tamás’ baldigem Verlassen des Lagers in Richtung Übersee erfuhren, fand sich im mehrseitigen Brief ein vierblättriges Kleeblatt: „Es soll Dir Glück bringen! Doch selbst wenn sich der Aberglaube nicht bewahrheiten sollte, haben wir es vielleicht dennoch nicht vergebens geschickt.
Denn sollte sich Dein Schicksal, man kann ja nie wissen, irgendwann zum Besseren wenden, kannst Du das mit dem vierblättrigen Kleeblatt erklären.“
Zwei Tage vor dem Abflug über den Großen Teich traf Irenes letzter Brief im Lager ein. Kürzer als sonst enthielt er viele gute Ratschläge und Weisheiten. Unter anderem hieß es: „Du begibst dich nun arglos auf eine große Reise in eine unbekannte Welt.“ Mehrmals las er diesen Satz, verstand nicht wirklich, was ihm Irene damit sagen wollte. Bemühen wir uns etwa nicht immer, unseren Argwohn nicht die Oberhand gewinnen zu lassen?
Unser Sein ist letztlich stets ein Bemühen darum, uns vom Argwohn gegenüber dem Fremden nicht unterkriegen zu lassen.
Die Kopfschmerzen waren wie verflogen. Auch die innere Unruhe schien sich gelegt zu haben. Trotzdem fühlte er sich matt und niedergeschlagen. Auf dem Weg zur Toilette begegnete er dem einen Steward. Der mochte so um die Fünfzig sein.
Sein kahler Kopf drehte sich auf dem gedrungenen Nacken wie eine Kugel. Auf seiner Sitzgelegenheit hockend glich er einem Gnomen. Vor ihm befand sich ein Rollstuhl voll mit Flaschen.
Er schenkte sich gerade Mineralwasser in einen Kunststoffbecher ein. Wie einen alten Bekannten, so grüßte Tamás durch ein flüchtiges Kopfnicken. Dabei hatte er ihn zuvor noch nie gesehen. Müde und gelangweilt erwiderte der Mann den Gruß, verspürte aber offensichtlich keine Lust, sich auf ein Gespräch einzulassen. Tamás wollte ein Gespräch keineswegs erzwingen, betrat stattdessen die Toilette und verschloss hinter sich die Tür, betrachtete sich lange im Spiegel, aus dem ihn ein eigenartiger Fremder anstarrte. Er forschte nach Erinnerungen an eine glückliche Zeit. Vielleicht würde sich darin ja etwas finden, was ihn heiter stimmen könnte. Doch vergebens zerbrach er sich den Kopf. Aus dem Hahn rann ein dünner Strahl lauwarmes Wasser.
Er hielt die hohle Hand darunter, um das Gesicht zu benetzen.
Nachdem er es abgetrocknet hatte, blickte er erneut in den Spiegel, zwang sich zu einem Lächeln. Doch das wirkte aufgesetzt. Er winkte ab, unternahm keinen weiteren Versuch. Zurück auf seinem Platz sah er zum Fenster hinaus. Unter den Tragflügeln der Maschine erstreckte sich erstarrt und behäbig eine dichte Wolkendecke. Es schien, als wäre die Landschaft zu Eis erstarrt, als flöge die Maschine gar nicht, sondern stünde reglos in der Luft.
Einzig das Surren der Triebwerke zeugte von Bewegung.
4.
Die Flugbegleiter schoben ihre kleinen Wagen mit Erfrischungs- und alkoholischen Getränken über die Gänge. Einer von ihnen fragte Tamás nach seinen Wünschen. Er bat um Mineralwasser mit Eiswürfeln und Zitrone. Zum Wasser bekam er ungefragt auch eine kleine Tüte mit Erdnüssen. Die kaute er eine Weile.
Sah zum Fenster hinaus, machte es sich im Sitz bequem.
Lange Zeit döste er vor sich hin, lauschte dem monotonen Triebwerkgesumm. Von irgendwo aus der Ferne tauchten vor seinen Augen tanzende Bilder auf. Er verstand nicht das Wieso und Warum. Warum gerade diese und nicht andere? Schon früher war es gelegentlich vorgekommen, dass sich seiner Erinnerung Ereignisse aufdrängten, an die er sonst nie gedacht, sie eigentlich auch nicht für wichtig gehalten hatte. In solchen Momenten wunderte er sich über jene eigentlich bedeutungslosen Episoden, winzigen Gesten, Gerüche und Stimmungen, die vollkommen unerwartet aus seiner Erinnerung an die Oberfläche gespült wurden. Die aus seiner Kindheit aufscheinenden Erinnerungsfetzen, so auch den Anblick von lila Fliedertrauben, wälzte er hin und her.
Über den Bildschirm des Fahrgastraums huschten stumme Gestalten. Die vor dem Abflug verteilten Kopfhörer warteten an der Lehne des Vordersitzes auf ihre Nutzung. Eine Weile ließ er sich nachdenklich von den Bildern berieseln, schließlich aber blätterte er wieder in den Zeitschriften und Zeitungen.
Plötzlich bebte der mächtige Flugkörper, wurde von Luftwirbeln nach rechts und links geschleudert. Erschrocken klammerte sich Tamás an den Sitz. Binnen weniger Augenblicke aber schwebten sie wieder durch den Raum, als wäre nichts Ungewöhnliches passiert. Verständnislos sah er sich um. Niemand schien von dem unangenehmen Vorfall etwas bemerkt zu haben, niemand rührte oder beschwerte sich oder stieß gar Angstschreie aus. Im Fahrgastraum bemerkte er nur eine Stewardess, die einige Sitzreihen vor ihm einem Fluggast Wasser brachte. Tamás war auf das Schlimmste gefasst, wartete angespannt ab, was geschehen würde. Minuten vergingen ohne weitere unangenehme Vorkommnisse. Die Zeit spulte sich ins Nichts hinüber, vermengte sich mit dem Brummen der Triebwerke, die eintönig die Luft aufwirbelten. Tamás hatte das Gefühl, vom monotonen Lärm, der sich in seinen Gedanken einnistete, total durchdrungen zu werden. Die meisten Fluggäste schlummerten. Auch er schloss die Augen.
Die Zeitschriften fielen ihm aus der Hand. Es dauerte Sekunden, bevor er zu sich kam. Müdigkeit quälte ihn. Die Geschehnisse in seinen Träumen waren wie ausgelöscht. Die Triebwerke dröhnten auch weiterhin eintönig. Sein linker Arm fühlte sich ganz taub an. Er hatte Herzstechen. Bisher unbekannte Ängste bemächtigten sich seiner. Anfangs nur ein wenig, dann aber überwältigten sie ihn heimtückisch. Was würde sein, sollte die Maschine auseinanderbrechen und in den Ozean stürzen? Wie scheußlich würde dann sein ohnehin fragiles Leben enden! Vor seinem inneren Auge erschien Irene mit den beiden Kindern. „Grüß dich, Papi! Warum hast du uns nicht mitgenommen? Du hast uns allein gelassen! Wir sind Waisen geworden, beweinen dich. Jeden Abend beten wir zusammen mit Mami für dein Seelenheil. Du fehlst uns schrecklich! Wir denken immer an dich. Doch du bist nirgendwo. Du hast uns einen Bananenbaum versprochen. In der einen Zimmerecke.
Mit kleinen Äffchen, die sich mit Bananen bewerfen. Erinnerst du dich? Vergebens suchen wir danach. Frühmorgens nach dem Aufwachen suchen wir dich. Aber du fehlst im Bett neben Mami.
Sie ist immer traurig. Nicht wahr, das nächste Mal nimmst du uns mit? Nicht wahr, du verlässt uns nie? Papi, du musst auch Mami sagen, dass du ohne deine Familie nicht leben kannst, dass du uns über alles liebst. Nur uns!“
Angespannt lauschte er. Es hatte den Anschein, als würde ein Triebwerk auf der rechten Seite stottern, als würde es nicht gleichmäßig die Luft durchschneiden wie das andere, es könnte seinen Geist aufgeben oder in Brand geraten. In Zeitungen hatte er schon von solchen Unfällen gelesen. Mit einem Mal war die Maschine vom Radar der Fluglotsen verschwunden. Dann fand man die Trümmer. Auch den Flugschreiber. Trotzdem konnten die Experten die Ursache für das Unglück nicht feststellen. Genau das würde, so befürchtete Tamás, auch mit ihrem Flugzeug passieren. Jeden Moment könnte das eintreten. Wozu dann all die vielen Qualen, die Entbehrungen, die Unannehmlichkeiten im Lager, die tausendfachen Hoffnungen? Alles vergebens, alles, worauf er sich gefreut hatte, würde sich in Rauch auflösen, ein schreckliches Ende nehmen. Er spürte die innere Anspannung, sah sich außerstande, ruhig zu bleiben, sprang plötzlich auf. Sein Nachbar sah ihn verblüfft an: „Was ist denn in den bisher so ruhigen Zeitgenossen gefahren. Ist dem jungen Mann etwa schlecht geworden?“, dachte er bei sich und erhob sich, um ihn vorbeizulassen.
Tamás fand den zur Glatze neigenden Steward an seinem gewohnten Platz. Er döste vor sich hin, öffnete die Augen, musste Tamás irgendwie wahrgenommen haben. „Kann ich Ihnen helfen?“, rieb er sich das Gesicht. „Möchten Sie etwas haben?“
„Ja, vielleicht ein Glas Mineralwasser. Mit Eiswürfeln und Zitrone.“
Während der Glatzkopf einen Kunststoffbecher hervorholte und nach Mineralwasser suchte, bestürmte Tamás ihn mit Fragen: „Mit was für einem Flugzeugtyp fliegen wir eigentlich?“
„Mit einer Boeing 767.“
„Ist die sicher?“
„Die sicherste überhaupt!“
„Eine alte Maschine?“
„Vier Jahre alt.“
„Hat keine einzige Maschine diesen Typs in den vergangenen Jahren einen Unfall gehabt? Ich meine, ob keine abgestürzt oder vom Radarschirm verschwunden ist.“
„Nein, von so einem Unfall ist mir nichts zu Ohren gekommen. Meines Wissens ist bisher noch keine einzige Maschine verschwunden.“ Der Mann gab Eis in den Becher und sah Tamás aus den Augenwinkeln an.
„Arbeitet die Fluggesellschaft bei der Wartung mit guten Mechanikern zusammen?“
„Wir haben eigenes Wartungspersonal.“
„Und verrichten die Mechaniker ihre Arbeit gewissenhaft?“
„Das will ich doch hoffen.“
„Und alles zur rechten Zeit?“
„Schauen Sie, ich bin kein Techniker“, reagierte der Steward zusehends gereizt. „Ich gehöre zum Bordpersonal. Fragen Sie mich zum Fahrgastraum der Maschine, was Sie wollen, zu den hier vorhandenen Einrichtungen und Instrumenten, aber mit anderen Sachen müssen Sie mir kein Loch in den Bauch fragen!“ Er sah Tamás an und drückte ihm den Becher in die Hand.
„Entschuldigen Sie bitte, wenn ich Sie mit meinem Gefrage belästigt habe!“ Mit diesen Worten nahm er den Becher in Empfang. „Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist, aber mich hat plötzlich eine panische Angst überkommen. Mir schwant nichts Gutes, ich habe Angst davor, dass unsere Maschine abstürzen könnte.
Eine böse Vorahnung hat mich fest im Würgegriff. Ich kann mich davon einfach nicht freimachen, habe Angst, sehr große Angst!“
Der Steward arbeitete seit fünfzehn Jahren bei der Fluggesellschaft, hatte schon Gelegenheit, so manch einem Narren zu begegnen, sodass er auch Tamás’ Verhalten nicht besonders ungewöhnlich fand; es machte ihn lediglich nervös. Doch so oft er von Panik gequälte Passagiere an Bord hatte, überkam auch ihn eine gewisse Unruhe. Die Angst der anderen war ansteckend, so stark er auch dagegen anzugehen suchte.
„Also, wovor konkret haben Sie Angst?“, trat er näher an Tamás heran.
„Na ja, davor, dass wir abstürzen.“
„Wissen Sie was“, nahm er Tamás am Arm, „gehen Sie zurück auf Ihren Platz! Sie werden sehen, nichts wird passieren. Unsere Maschine gehört zu den sichersten der Welt. Gehen Sie, das Mineralwasser wird Sie beruhigen. Glauben Sie mir!“ Und er führte Tamás, der die Hilfe dankbar annahm, nicht protestierte und keine weiteren Fragen stellte, zurück an seinen Platz. Seine Angst schien abgenommen zu haben. Sein Blick schweifte in die Ferne. Je mehr er an Irene dachte, desto weiter weg schien sie zu sein. Je näher er sie in Gedanken zu sich holte, desto mehr wuchs der Abstand.
Wenn sie hier bei ihm im Flugzeug säße, würde er bestimmt keine Todesangst haben. Denn in Wirklichkeit mochte er davor Angst haben, allein sterben zu müssen. Dabei wusste er sehr wohl, dass jeder Mensch für sich allein stirbt. Allein im Flugzeug, mit einem Pass für Staatenlose in der Tasche, mit Todesangst unterwegs in ein ihm unbekanntes Land, vermisste er Irene schmerzlich. Sie fehlte ihm. Daheim kroch sie oft zu ihm unter die Bettdecke, um ihm näher zu sein. „Ich weiß ja, wie sehr du als Kind die Liebe deiner Mutter entbehren musstest, ihr Streicheln. Deshalb krieche ich an deine Seite, damit du spürst, wie sehr ich dich liebe, wie wichtig du für mich bist und wie sehr ich dich brauche.“
Wann genau seine Eltern sich scheiden lassen hatten, daran konnte Tamás sich nicht erinnern; die Zeit hatte die Ereignisse miteinander verschwimmen lassen. Manches stand ihm noch deutlich vor Augen, doch anderes wiederum hatte sich verflüchtigt. Einige Begegnungen, mit viel Nervosität einhergehende Reisen waren ihm noch gegenwärtig, wenn auch nur bruchstückhaft, schemenhaft. Die Zusammenhänge waren im Nebel des Vergessens verloren gegangen. Dann plötzlich tauchte ein Bild aus dem Nichts auf: ein kleines Dorf, gerade Straßen, im Sommer in Staub gehüllt, im Frühling und Herbst lauter Schlamm. Asphaltiert war nur die durch das Dorf führende Straße, über die Lastwagen und Busse rauschten. Die kleinen Ausflüge damals waren stets ein Abenteuer.
Für gewöhnlich bestiegen sie einen Bus, um in die nahe gelegene Stadt zu gelangen. Für die zwanzig Kilometer brauchten sie anderthalb Stunden. Tamás reiste mit seinen Großeltern oder seinem Vater, umgeben von stinkenden Säcken und Gepäckstücken in verschiedenen Farben und Formen, lebendem Vieh: Hühnern, Lämmern und Ferkeln. Das Fahrzeug war derart vollgepackt, dass es an ein Wunder grenzte, wenn es keinen Achsbruch gab. Radau erfüllte den Bus, sodass eine Unterhaltung schier unmöglich war.
Das war auch nicht unbedingt nötig. Die Reisenden hockten wie Hühner auf ihren unbequemen Sitzgelegenheiten. Der Bus holperte über die mehr als schadhafte Landstraße, während die Menschen in ihrem bitteren Leben gefangen waren.
Ein weiteres Bild leuchtete vor ihm auf: in der Hofmitte ein majestätischer Walnussbaum, ein winziger Ausschnitt der Landschaft. Großvaters Gesicht, im Mundwinkel eine nie verglimmende, selbstgedrehte Zigarette, erscheint in gleißendem Licht.
Neben Tamás der Vater, der ihn ausfragt. Eine leichte Brise streift sein Gesicht. Wortfetzen entschweben als winzige Vögel zwischen die Blätter des Baumes. Erstarren plötzlich. Fallen zu Stein geworden in den Brunnen der Erinnerungen. „Deine Mutter ist ein sinkendes Schiff. Ich bin eine Fähre der Sicherheit. Zu wem willst du gehen, mein Junge?“ Das Kind sieht ihn traurig an: „Zu Mami!“ – „Du willst dich auf ein sinkendes Schiff begeben, mein Junge?“ – „Ja!“ – „Und warum? Warum willst du dorthin?“ –
„Weil es dort für mich besser ist! Ich will zu meiner Mami!“ – „In die Unsicherheit?“, schreit der Mann nun schon. „Mami ist doch nicht unsicher. Warum sollte sie unsicher sein?“ – „Deine Mutter kann nicht für dich aufkommen. Sie kann dich nicht zur Schule schicken“, hebt der Mann erneut seine Stimme. Tamás bricht in Weinen aus. „Wieso sollte sie das nicht können? Ich gehe auch von selbst“, schluchzt er.
Der Brunnen der Erinnerungen voller Steine.
Bevor er Irene kennenlernte, machte er Iris den Hof, einem jüdischen Mädchen, molett und sehr begehrenswert. Sie besaß ein unerklärlich prickelndes und verführerisches Wesen. Ihre strahlend blauen Augen und ein sommersprossiges Gesicht zogen ganze Heerscharen von jungen Männern an. Tamás suchte Iris des Öfteren auf. Zusammen mit ihrem älteren Bruder teilte sie sich eine komfortable Vier-Zimmer-Eigentumswohnung. Abel, ein besessener Glücksspieler und Lebenskünstler, bestritt seine Existenz vom väterlichen Erbe, überwarf sich ständig mit dem vom Vater eingesetzten Vormund, gab sich mit dem wöchentlich zugeteilten Taschengeld nicht zufrieden, forderte immer mehr. War er nicht in der Spielhalle, spielte er derart virtuos und erfolgreich Geige, dass er die Spielschulden meist dank der vor seinen Auftritten ausgehandelten Honorare bezahlen konnte. Tagsüber lungerte er in der Spielhalle oder in irgendwelchen Spelunken herum.
Sooft Tamás Iris besuchte, lernte er eine Reihe von Gedichten auswendig, um dem Mädchen, das dem Vortrag verzaubert lauschte, zu imponieren. Glühten die Verse vor Leidenschaft, zeigten sich auf der Stirn der Zuhörerin winzige Schweißperlen.
Schmachtend hing sie an Tamás’ Lippen, der jedes Mal davon überzeugt war, dass sie unsterblich in ihn verliebt sei.
Tamás trug die Gedichte immer wieder vor. Doch mehr geschah nicht. Zwar zog er das Mädchen mit dem Rezitieren in seinen Bann, mehr aber nicht.
Beider Lieblingsbeschäftigung bestand darin, durch die Wohnung zu streifen und sich an den mit Biedermeiermöbeln vollgestopften Räumen zu ergötzen. Tamás fühlte sich wie im Museum. „Mein Vater hat hier bis zu seinem plötzlichen Tod eine Arztpraxis betrieben“, erklärte Iris im größten Zimmer, dessen zwei Fenster es in hellem Licht erstrahlen ließen. Der saalartige Raum wirkte überdimensioniert und rätselhaft. An den Wänden in gotischen Buchstaben Arztdiplome, Ehrenurkunden von Vereinen, eine ganze Armada an Auszeichnungen und eine Reihe von Bücherregalen, in denen sich von einer Staubschicht überzogene Literatur langweilte. Zwischen den beiden Fenstern ein riesiger Mahagonischreibtisch, davor zwei schwere, rissige, ausgebleichte braune Ledersessel.
Als Erinnerung an diese Besuche sind nur ein Kuss und ein gelegentlich inniger Händedruck geblieben. Und Tränen. Als er Iris wieder einmal mit neuen Gedichten aufsuchte, wurde er mit ausgeweinten Augen empfangen. „Ich weiß selbst nicht, warum ich heule“, meinte sie schluchzend. „Eigentlich wollte ich dieses Land doch schon immer verlassen. Und jetzt, wo sich die Möglichkeit dazu bietet, fühle ich mich außerstande.“
„Ich verstehe nicht, wovon du redest“, trat Tamás an sie heran. Sie setzten sich auf das breite Sofa. „Abel hat beschlossen auszuwandern. Vor einigen Wochen hat er sich mit unserem Vormund überworfen. Heute um die Mittagszeit ist er unerwartet hereingestürmt gekommen und hat mit den Auswanderungspapieren wie mit einer Siegestrophäe geschwenkt. Binnen eines Monats müssen wir das Land verlassen.“
Tamás musste an seine Kindheit denken, als nach endlosen Ehezwistigkeiten der Entschluss gefasst wurde, zusammen mit Vater und Großmutter wegzuziehen. Nun saßen sie beide, Iris und Tamás, hier auf dem Sofa. Er hatte das Gefühl, als würde er ein Märchen hören. Während Iris wie ein Wasserfall redete, dachte er an ihre Ausreise. Bilder einer ungewissen Zukunft entstanden. Verlust. Schmerz. Der Augenblick wurde zu Vergangenheit. Dieser Vorgang würde bis zur Unwiederholbarkeit dauern, bis er aus der Erinnerung abgerufen werden müsste. Und dieser als Vergangenheit verewigte Augenblick würde dann kommen, wenn Iris und Abel das Flugzeug bestiegen.
Nun saß Tamás im Flugzeug. Hatte Angst. Krähen der Angst umringten ihn. Ließen ihn nicht aus ihren Fängen. Er verscheuchte sie, wollte sich von ihnen befreien. Von einem schlechten Gefühl. Oder lediglich vom Gedanken? Wie interessant, indem er den Gedanken dachte, wurde er zugleich eins mit ihm.
Am liebsten wäre er erneut aufgestanden, um seine eingeschlafenen Gliedmaßen zu bewegen. Doch er verzichtete darauf. Allmählich beruhigte er sich wieder. Er hatte das Gefühl, als würde von oben ein ätherisches Licht über sein Antlitz rinnen.
Die Flugzeugturbinen rumorten in gleichförmiger Rotation. Es gab nichts mehr, wovor er Angst haben musste. Das Gleichgewicht war wieder hergestellt.
Aus unerfindlichen Gründen schreckte Tamás auf. Schuld daran waren vielleicht die aus seiner Hand gleitenden Zeitschriften. Seine Augenlider waren schwer geworden. Er hob den Kopf.
Sah sich verstört um. Die vor ihm Sitzenden waren im Gespräch vertieft. Der im Flüsterton geführten Unterhaltung konnte er keinen Sinn entnehmen. Seine Beine waren eingeschlafen. „Ich müsste mir die Füße vertreten“, dachte er. Doch als er den friedlich neben ihm schlummernden Sitznachbarn bemerkte, hatte er kein Herz, den aus seinen Träumen aufzuschrecken. Also verzichtete er darauf, sich zwischen den Sitzen herauszuquetschen.
Stattdessen reckte und streckte er sich, so gut es eben ging, und beobachtete das Flattern der Tragflügel der durch den weißen Nebel schwimmenden Maschine. Gespenstisch die milchige Unendlichkeit da draußen. Der Nebel erinnerte ihn an Hauffs steuer- und besatzungslos schlingerndes Gespensterschiff. An den Masten die eingeholten Segel wie herabhängende Flügel ohnmächtiger Vögel. In unheimlicher Stille löste sich aus dem alles einhüllenden dichten Nebel der an einen Mast gefesselte Seeräuber. Die Stirn des Matrosen festgenagelt am Schiffsmast.
Der Gedanke daran ließ Tamás erschaudern. Er mochte diese Geschichten nicht sonderlich. Sooft ihm seine Mutter daraus vorlas, bekam er Albträume. Andersens Märchen machten ihm weniger Angst, auch wenn sich darunter gleichfalls einige zutiefst traurige fanden. Doch schreckenerregend waren sie nicht.
Wenn er Angst hatte, konnte er nicht einschlafen. Da half auch keine vollkommene Dunkelheit im Zimmer, keine pechschwarze Nacht, worin er nicht einmal seine Nasenspitze sehen konnte. Oft tanzten dann vor seinen Augen scheußliche gespensterhafte Schemen. An einem Abend, als ihn wieder quälende Angst überkommen hatte und er einfach keinen Schlaf finden wollte, drang die Stimme seines Vaters zu ihm ins Zimmer. Der war von der Nachmittagsschicht nach Hause gekommen und erzählte seiner Frau in der Küche verärgert, dass er Tamás’ Schlitten in der Werkstatt geschweißt habe. Aber als er ihn aus der Fabrik habe mitnehmen wollen, habe ihm der Pförtner nicht geglaubt, dass er den Rodel von daheim nur repariert habe. Der Pförtner beschlagnahmte ihn sofort und drohte damit, bei der Direktion Anzeige zu erstatten. Als Tamás’ Vater sah, dass die Sache ernst wurde, verlegte er sich auf die Mitleidstour, sagte, wie sehr sich der Junge über den Schlitten freuen würde. Schließlich ließ sich der alte Pförtner erweichen. „Sogar einige verstohlene Tränen rannen ihm über die Wangen. So ergriffen war er“, hörte der Junge seinen Vater erzählen. „Und zu guter Letzt erlaubte er mir sogar, den kleinen Schlitten nach Hause zu ziehen.“
Daraufhin sprang Tamás aus dem Bett und rannte in die Küche. Glücklich sah er seine Eltern an, die natürlich nicht damit gerechnet hatten, dass er noch wach sein könnte.
In jener Zeit war Tamás wie ein Seismograph, der auf die kleinsten Regungen reagierte. Sein Vater sagte nichts weiter, ließ den Jungen einen Mantel anziehen und einen Schal um den Hals wickeln, Stiefel anziehen und gab ihm eine Mütze auf den Kopf, nahm ihn an der Hand und wäre nun zusammen mit ihm auf den dunklen Hof hinausgegangen, um ihm den Schlitten zu zeigen. Als Tamás sah, dass er hinaus in die pechschwarze Nacht gehen sollte, fing er zu weinen an. Seine Mutter sagte: „Der Junge hat Angst vor der Dunkelheit. Geh nicht raus mit ihm!“ Woraufhin die Hölle losbrach. „Was? Du behauptest, mein Sohn hat Angst? Das darf doch nicht wahr sein! Was heißt Angst?! Ich werde ihm beibringen, was Angst heißt!“, schrie sein Vater und bekam Tamás’ Hand zu packen und zerrte das plärrende Kind hinaus auf den Hof.
Auf den Höllenlärm kam der Schuster aus der Nachbarschaft angerannt, bat den aufgebrachten Vater, das unglückliche Kind nicht noch weiter zu malträtieren. Vergebens. Am nächsten Tag erstattete der Schuster Anzeige. Zwei Polizisten untersuchten das Vorgefallene.
Tamás erinnerte sich. Über seinen Vater wurde ein Bußgeld verhängt. Das zog große Verärgerung nach sich. Eine Zeitlang würdigte der Vater den Sohn keines einzigen Blickes, schenkte ihm keine Beachtung.
Bei den Großeltern auf dem Dorf war alles anders. Dort durfte Tamás Angst haben. Großmutter ließ ihn nie allein im dunklen Zimmer. Dies selbst dann nicht, wenn es ihr schwerfiel, sich wegen ihres Übergewichts und der schmerzenden Beine vom Küchenstuhl hochzuhangeln. Sie begleitete ihn ins Zimmer und knipste stets die kleine Nachttischlampe an. Ein bisschen hatte Tamás trotzdem Angst, aber nicht so sehr wie sonst.
Höchstens vor dem Alleinsein. Er war nicht gern allein.
Die Passagiere wurden plötzlich gehörig durchgerüttelt.
Über Lautsprecher meldete sich der Flugkapitän: „In der nächsten halben Stunde durchqueren wir ein Schlechtwettergebiet. Ich bitte Sie, bis auf Weiteres Ihre Sicherheitsgurte anzulegen! Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis.“
Auf dem Gang zwischen den Sitzreihen kontrollierten die Stewardessen die angelegten Sicherheitsgurte. Mehrere Passagiere erkundigten sich erschrocken, ob es keine Probleme geben werde. Geduldig erklärten die Flugbegleiter, dass von Gefahr keine Rede sei, dass dies nur eine Vorsichtsmaßnahme sei. Man solle sich beruhigen, es werde nichts passieren, die Maschine werde nur ein bisschen durchgerüttelt.
Tamás sah zum Fenster hinaus. Die Maschine wurde noch immer von milchigem Nebel umgeben. Plötzlich aber wurden sie von heftigen Windstößen hin und her geschleudert. Im Fahrgastraum kam alles in Bewegung. Die Sitze zitterten wie Espenlaub, die Gepäckablagen klapperten. Die ganze Maschine schüttelte sich. Manchmal stürzte sie in die Tiefe. Es ging in den Wirbeln auf und ab wie in einer Berg- und Talbahn. Tamás klammerte sich am Sitz fest. Hatte Todesangst. Dachte an Irene und seine beiden Söhne. Was würde aus ihnen werden, wenn er jetzt abstürzen sollte?
Doch es passierte nichts. Das Rütteln an der Maschine verschwand genauso plötzlich, wie es gekommen war.
Tamás kehrte zurück zu seinen unterbrochenen Erinnerungsbildern. Entlang den Mauern des U-förmigen Hauses zwei mächtige Tannenbäume, leuchtende Blumenbeete mit weißen Lilien, regenbogenfarbenen Petunien, Nelken mit winzigen Blüten und Löwenmaul. Auf dem verwilderten Hinterhof dichtes Gestrüpp, von Unkraut und Brennnesseln überwucherter Rasen, Schnecken, die sich, mit ihrem Haus auf dem Rücken, gemächlich fortbewegten. Am Ende des Gebäudes ein riesiges Auffangbecken für Regenwasser, worin gelegentlich auch Frösche eine Behausung fanden. Hier erschreckte ihn nichts mehr.
Die Maschine, die, einem Vogel gleich, ihr Gleichgewicht zurückgewonnen hatte, glitt majestätisch durch die Lüfte.
Das im Flugzeug servierte Abendessen mundete Tamás.
Vielleicht sei es sogar ein wenig zu üppig, dachte er bei sich, dennoch ließ er den Himbeerpudding nicht stehen. Seit einer Ewigkeit saß er nun schon im Flugzeug. Das sei zu ertragen, machte er sich Mut. Die Beklemmungen ließen nach. Langsam nahm der Glaube an eine heile Ankunft zu. Dann sollte kommen, was da kommen musste. Entspannt lehnte er sich nach hinten, starrte ins Leere.
Der Flugkapitän meldete sich: „Verehrte Fluggäste, die noch bis zur Landung vor uns liegende Zeit beträgt anderthalb Stunden. Die Wolkendecke lichtet sich. Die Außentemperatur beträgt zweiundzwanzig Grad Celsius. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.“
Kinderweinen mischte sich in das eintönige Brummen der Triebwerke. „Bisher war der Winzling ja friedlich, vielleicht hat er die ganze Zeit über geschlafen“, dachte Tamás und versenkte die Zeitschriften in der Rückenlehne des Sitzes vor ihm. Seine Anspannung hatte sich gelöst. Die Angst war gewichen, die Kopfschmerzen hatten sich gelegt. Es war ihm, als würde sich auch sein Organismus auf die Ankunft in der Neuen Welt vorbereiten.
5.
„Noch fünfundzwanzig Minuten bis zur Landung“, halten die Worte des Kapitäns in Tamás wider. „In fünfundzwanzig Minuten beginnt ein neues Leben“, so Tamás im Innersten frohlockend und bang zugleich. Er versuchte, die Stimmung dieser fünfundzwanzig Minuten auszukosten. Er hätte jauchzen mögen, wie noch nie zuvor.
Beim Landeanflug empfand Tamás einen unangenehmen Druck in den Ohren. In grauen Wolkenknäueln wurde die Maschine gehörig durchgerüttelt. Langsam löste sich der Nebel auf.
In der Ferne bunte Hausdächer. Die untergehende Sonne färbte die Wolkenflügel rosa. Das Aufsetzen der Maschine nahm er kaum wahr, sah nur, dass die Welt um ihn her langsamer an ihm vorüberzog. Würdevoll rollte die Maschine über die Betonpiste.
Die Türen öffneten sich. Die Menschen drängten zum Ausgang.
Auch Tamás. Er entdeckte seinen Bekannten, den untersetzten Steward. Der bahnte sich mit müdem Gesicht seinen Weg. „Na, sehen Sie, wir sind heil angekommen. Ich sagte Ihnen ja, diese Maschine ist sicher!“, wandte er sich Tamás zu.
Vor der Passkontrolle bildeten sich zehn, vielleicht sogar noch mehr Warteschlangen. Er holte seine Einwanderungspapiere und den braunen Pass hervor. Als er an die Reihe kam, blätterte der Grenzbeamte gelangweilt in den Dokumenten. Die Einwanderungsgenehmigung befestigte er mit einer Büroklammer am Pass, sah den Neuankömmling an und wünschte ihm einen guten Abend. Tamás dachte, damit die Formalitäten hinter sich gebracht zu haben. Welch ein Irrtum! Das war erst der Anfang. Die eigentlichen Überraschungen kamen erst noch. Kaum hatte er die Passkontrolle passiert, als ein Uniformierter an einem Stehpult in der Flurmitte erneut die Papiere verlangte. Er warf nur einen flüchtigen Blick auf den Pass und winkte Tamás nach links. Der gehorchte und begab sich in einen riesigen Saal mit reicher Bestuhlung. Nachdem er Platz genommen hatte, bemerkte er, dass die nach ihm Kommenden von einem kleinen, walzenförmigen Apparat winzige Papierzettel abrissen. Er tat es ihnen gleich und setzte sich wieder hin.
Allmählich füllte sich der Saal mit Auswanderern, Schicksalsgenossen. Tamás hielt Ausschau nach bekannten Gesichtern.
Einige, die ihm in der Maschine aufgefallen waren, hatte er sich eingeprägt. Doch jetzt entdeckte er niemanden. Erst später bemerkte er in der Saalecke zwei herumkaspernde Kinder mit ihren Eltern. Nun fühlte er sich schon nicht mehr ganz allein.
Hinter sechs Pulten wurden die laufenden Nummern der Wartenden von den Beamten aufgerufen. Es ging langsam voran. Zwei Stunden mochten vergangen sein, bevor Tamás an die Reihe kam. Eine junge, molette Dame, unterstützt von einem älteren Dolmetscher, nahm seine Dokumente apathisch in Augenschein. Schließlich teilte sie ihm mit, dass er den Anschlussflug leider verpasst habe und erst morgen weiterreisen könne. Eine Nacht müsse er im Hotel schlafen. Das mache aber nichts, für die Kosten komme die Fluggesellschaft auf. Im Zeitlupentempo versenkte sie die Dokumente wieder in das gelbe Kuvert, forderte Tamás auf, sich später im Raum 17 des Wartesaals zu melden.
Er schlenderte schon durch die riesige Halle des Flughafens, das heißt würde schlendern, denn plötzlich überkam ihn ein Unwohlsein. Er hatte das Gefühl, gleich ohnmächtig zu werden.
„Das fehlt mir gerade noch, dass mit mir etwas passiert, gerade jetzt, wo ich fast schon am Ziel meiner Wünsche bin!“, schoss es ihm durch den Kopf, als er sich am Geländer festklammerte.
„Reiß dich zusammen, Junge, sei stark!“, redete er sich gut zu und suchte nach einer Sitzgelegenheit, schleppte sich zu einer Bank. Doch nach ein paar Minuten wurde er unruhig: „Wenn ich zu spät komme, kann ich statt im Hotel hier auf einer Bank übernachten. Ich muss unbedingt den Raum 17 suchen!“
Schwerfällig stand er auf. Nach einigen Schritten fühlte er sich besser. Nervös suchte er nach dem Raum 17. Alsbald erblickte er die Nummer. Davor hatten sich Wartende versammelt. Er gesellte sich zu ihnen. Die Welt um ihn her drehte sich. Er biss die Zähne zusammen. Eine Schlange hatte sich gebildet. Die Tür öffnete sich, und auf der Schwelle erschien eine Frau mit schwarzen Haaren und Brille, eine aus dünnem Stoff gefertigte Jacke leger über den Schultern. Sie schien angesichts der Massenansammlung überrascht zu sein. In der Hand hielt sie eine Namensliste, aus der sie zehn Namen aufrief und aufforderte, ihr zu folgen. Tamás sah ihnen traurig hinterher, musste an Irene und seine Söhne denken.
Warum konnten sie nicht bei ihm sein? Seit seiner Landung quälten ihn andere Beklemmungen als während des Flugs. „Jetzt muss ich nur geduldig sein. Geduldig“, sprach er sich Mut zu.
Inzwischen war die Beamtin zurückgekommen und hatte zehn weitere Einwanderer aufgerufen. Tamás befand sich wieder nicht darunter. Doch dann, als nur noch acht Wartende übrig geblieben waren, kam auch er an die Reihe. Die Beamtin überprüfte sicherheitshalber noch einmal die Namen, sagte, der Bus werde sie ins Hotel bringen, wo sie ein Abendessen bekämen. Morgens halb neun sollten sie sich am Hotelausgang einfinden, damit sie im Kleinbus zum Flughafen zurückgebracht werden könnten. Die Tickets seien für den Flug morgen Vormittag umgebucht worden.
Das angegebene Boardingtor bleibe unverändert gültig. Eventuelle Fragen sollten jetzt gestellt werden. Es meldete sich niemand.
Dann ging es endlich los. Sie begaben sich hinaus in die Nacht. Es schauderte ihn. Quietschende Autobremsen, rasantes Beschleunigen. Traumhafte Limousinen rasten an ihnen vorbei.
Von einer Fußgängerinsel her schrilles Lachen. Überall hasteten Reisende mit viel Gepäck voran. Taxis trafen ein, Autohupen mahnten zur Eile, Motorengeheul, Zuschlagen von Autotüren, tausendfacher, kribbelnder Lärm drang durch die Nacht. Fasziniert beobachtete Tamás das betriebsame Durcheinander. Es schien ihm, als würde alles von einer unsichtbaren Hand gelenkt und in einer unsichtbaren Ordnung vereint werden.
Im Bus schlief er ein, stand vor einem in Regenbogenfarben schillernden Karussell, wollte sich darauf im Kreis drehen lassen, presste das gelöste Ticket in der Hand. Ein alter Mann im Zylinder trat an ihn heran, verlangte die Eintrittskarte. Doch Tamás verweigerte sich der Aufforderung, hielt sie nur um so krampfhafter fest. Der Zylindermann wurde handgreiflich, wollte ihm den Arm umdrehen, so das Billett entwenden. Mit einer ruckartigen Bewegung entwand sich Tamás aus der Umklammerung des Alten und fand sich durch einen einzigen Sprung auf dem Karussell wieder, das gar nicht mehr anhalten wollte, sich immer schneller und schneller drehte, die schwarze Nacht durchschnitt.
Der Zylindermann kroch durch die Luft, um Tamás zu packen, lachte nur und schrie, er werde die Eintrittskarte schon noch bekommen. Doch das Karussell schleuderte Tamás atemberaubend im Kreis umher, immer schneller, immer schneller. Plötzlich leuchteten überall Lichter, Sternen gleich. Der Alte blieb zurück, nur sein Lachen wurde zunehmend lauter.
Tamás schreckte zitternd auf. Im Bus wohlige Wärme. Einige Fahrgäste schliefen, den Kopf zur Seite geneigt. Die anderen nahmen die an ihnen vorbeihuschende Landschaft in sich auf.
Die Autobahn schwamm in einer Lichtflut, trug sie hinein ins leuchtende Unbekannte.
Der Hotelportier verteilte die Zimmerschlüssel, zeigte den Neuankömmlingen den Weg zum Restaurant. Ganz benommen betrat Tamás sein Zimmer, stellte sein Handgepäck und den kleinen Koffer auf die Ablage.
Das Restaurant war trotz der späten Stunde gut besucht, sodass er kaum einen leeren Tisch fand. Als er seinen am Flughafen erhaltenen Gutschein dem heraneilenden Kellner in Frack und Fliege zeigte, verzog der seinen Mund, schenkte aus einer Plastikkanne mit Eiswürfeln aufgefülltes Wasser ein und stob von dannen.
Tamás sah sich schläfrig um. An den in gedämpftes Licht getauchten Tischen sich laut unterhaltende Gäste, ein sich verliebt streichelndes junges Pärchen. Das Gesicht war nicht zu erkennen, nur die im Lampenschein aufleuchtenden Finger. Ihn überkam Sehnsucht nach Zärtlichkeit.
Teller, Servietten, Essbesteck, dampfende Suppe und Gemüsebeilage, Brot, Lärm, Lachen, blutige Schnittstelle im Fleisch, Hände, Türenknallen, Salznapf, Raunen, blendender weißer Teller. Alles vermischte sich mit den Worten hinter ihm:
„Schmeckt es? Ist das Fleisch weich genug? Haben Sie noch einen Wunsch?“ – „Nicht doch, der hat schon gezahlt. Per Gutschein für ein Abendessen. Um den musst du dich nicht kümmern! Geh in die andere Ecke dort hinten. Da sitzt ein Ehepaar mit Moneten.“ – „Das mit dem Sekt? Da habe ich das Tablett fallen lassen.
Die Gläser sind futsch.“ – „Kehr die Scherben zusammen!“ –
„Soll ich den Diensthabenden rufen?“ – „Ist alles auf dem Tablett kaputt?“ – „Ja.“ – „Dann kannst du dir deinen Wochenlohn in den Wind schreiben! Sieh zu, dass du Trinkgeld an Land ziehst!“
Mit steif gewordenen Gliedern kroch Tamás ins Bett.
6.
Der Raum, ach, der Raum, der uneinsehbare Schauplatz der Wunder. Dort ist die Unendlichkeit zu Hause, mit Verstand und Fantasie nicht zu durchschreiten. Und dennoch begibt sich der Mensch immer wieder auf den Weg. Wie im Märchen der arme Wandergesell mit einem in Asche gebackenen Brotlaib in seinem Tornister. An den Tornister kann sich Tamás erinnern.
Doch nicht an das Ende des Märchens. Davor war er als Kind, wenn ihm seine Mutter eine Abendgeschichte vorlas, immer eingeschlafen. Wer einschläft, für den hat auch die Geschichte keine Fortsetzung. Das Wort, die Fantasie erstirbt, hört auf, die Materie, die Zeit, den Raum wahrzunehmen.
Tamás erinnerte sich nicht daran, was in der Nacht mit ihm geschehen war, war mitten im Geschehen eingeschlafen. Er betrachtete seine Füße, die unter der Bettdecke hervorlugten. Um ihn her eigenartige Geräusche, Kreischen, lautes Klirren, Musik. Ihm wurde die akustische Quelle bewusst. Er hatte vergessen, den Fernseher auszuschalten. Sein Blick streifte das im Zwielicht liegende Zimmer. Durch die Ritzen der Jalousie sickerte schwaches Licht ein. Alles um ihn her war so unfreundlich. Er sprang aus dem Bett, als würden Flammen an ihm züngeln, stand in der Zimmermitte, hielt eine Ortsbesichtigung ab. Inzwischen waren Geschosseinschlag, Explosionen, Helikoptermotoren zu hören. Er schaltete den Fernsehapparat aus, setzte sich aufs Bett. „Angekommen!“, dachte er. Doch die Bedeutung des Wortes begriff er erst unter der Dusche, als ihn der kalte Wasserstrahl vollkommen zu sich kommen ließ.
Er wohnte im Zimmer 601. Das las er von der am Schlüssel hängenden Kunststoffscheibe ab, bevor er nach draußen eilte.
Die Tür fiel hinter ihm krachend ins Schloss. Ohne zu wissen, in welche Richtung er gehen sollte, versenkte er den Schlüssel in der Hosentasche und lief den Flur entlang. Vorbei an den Zimmern Nummer 604, 605, 606. Gelangte zum Fahrstuhl, der auf Knopfdruck klingelnd stehen blieb. In der Hotelhalle fiel ihm ein, dass er sich halb neun am Ausgang einfinden sollte. Nervös suchte er nach seiner Armbanduhr. Konnte sie nicht finden. „Habe sie bestimmt im Zimmer gelassen“, durchfuhr es ihn. Über dem Kopf des Nachtportiers hingen nicht nur eine, sondern fünf Uhren. Die erste zeigte die Lokalzeit: 8 Uhr 28. Er rannte zurück in sein Zimmer.
Der Bus zum Flugzeug wartete vor dem Eingang auf seine Fahrgäste. Tamás stieg als letzter ein, betrachtete die vorbeihuschende Landschaft, dachte an seine Zukunft.
Das Flugzeug war schon an den Einstiegkorridor herangefahren. Zweieinhalb Flugstunden standen vor den Einwanderern. Er machte es sich bequem. Zum Tee verlangte er weder Milch noch Zitrone. Dann besann er sich eines Besseren. Die Stewardess sah ihn vorwurfsvoll an, reichte ihm zwei doppelte Portionen Kaffeesahne. Draußen der Himmel unwirklich blau.
So ein Blau hatte Tamás noch nie zuvor gesehen. Unter ihnen zeichnete sich die Erde in verschiedensten Figuren ab. In der Tiefe ordneten sich die bräunlichgrauen Konturen wie ein Geflecht aus lauter Blutadern an. Haarfeine Linien blickten aus dem Universum zurück. Vor der Ankunft glitten sie über einen Gebirgszug hinweg, beschrieben einen Halbkreis und setzten unbemerkt und weich auf der Landebahn auf. In der Wartehalle des Flughafens erblickte er eine Dame in malvenfarbenem Mantel mit einem in die Höhe gehaltenen Schild, worauf „Einwanderungsbüro“ zu lesen stand.
„Ich bin Tamás“, stellte er sich verwirrt vor. „Herzlich willkommen! Herzlich willkommen!“, wiederholte das weibliche Wesen. „Im Namen aller Mitarbeiter des Einwanderungsbüros heiße ich Sie in unserer Stadt willkommen!“, ließ sie sich, jedes einzelne Wort besonders deutlich artikulierend, vernehmen. „Linda mein Name“, stellte sie sich vor. Inzwischen schätzte sie Tamás’ Gepäck ab, als würde noch etwas fehlen. „Haben Sie alles?“, fragte sie besorgt. „Ja, mehr habe ich nicht“, reagierte Tamás, dessen Gesicht eine leichte Schamröte überzog. Mehr Worte vermochte er in der ihm fremden Sprache nicht zusammenzuklauben. „Nur ich“, dachte er bei sich, „bin so bettelarm. Andere treffen mit zig Koffern ein.“
Die Einwanderungsbeamtin redete ohne Punkt und Komma, erzählte, dass sie sich um ein Haar verspätet hätte, weil sie mit ihrem Sohn noch einen Arzttermin gehabt habe. Ihr Mann sei auf Dienstreise, und mit ihrer Schwiegermutter stehe sie auf Kriegsfuß, sodass sie alles allein erledigen müsse. Tamás verstand von all dem nur Wortfetzen, konnte sich nicht zusammenreimen, wovon eigentlich die Rede war. Höfliches Nicken überbrückte seine Stummheit. Linda hielt in ihrem Redefluss plötzlich inne, sah Tamás an und meinte, jede einzelne Silbe betonend: „Ich rede zu schnell , nicht wahr?“ Tamás lächelte. „Schnell“, das verstand er.
Dem stimmte er eifrig zu. Sie bestiegen Lindas Auto. Die, Tamás’
Sprachkenntnisse erneut vergessend, hielt mit flinker Zunge einen kleinen Vortrag über die Stadtteile, durch die sie gerade fuhren.
Berichtete, was warum eine Touristenattraktion war, wo Festivals veranstaltet wurden und wer alles dort schon aufgetreten war.
Sie hatten schon die Innenstadt erreicht, wo Tamás ergriffen die unglaublich hohen Gebäude bestaunte, die über die Gehwege wogenden Menschenmassen, schnurgerade Straßen, nirgendwo Kurven, einzig durch Ampeln wurde der Verkehr zur Langsamkeit angehalten. Vor einem mittelhohen Eckgebäude, einem Hotel, hielten sie an. Hier sollte Tamás für einige Tage wohnen, bis man ihm eine Wohnung zuweisen würde, erklärte Linda, während sie ihm ein Kuvert mit der Adresse des Einwanderungsbüros, wo er sich am nächsten Vormittag zu melden hätte, in die Hand drückte. Sie begleitete ihn ins Hotelinnere, wo er vom Portier argwöhnisch ins Visier genommen wurde. Der überreichte ihm mürrisch einen Zimmerschlüssel.
„Nochmals herzlich willkommen! Einen angenehmen Tag!
Auf Wiedersehen!“ Mit diesen Worten verabschiedete sich Linda und verschwand. Tamás nahm seine Sachen und begab sich zum Aufzug, als ihm der Portier noch hinterherrief: „Wenn Sie telefonieren oder etwas aus der Minibar nehmen, dafür kommt das Einwanderungsbüro nicht auf!“ Tamás drehte sich um und sah den Mann verständnislos an. Der winkte resigniert ab: „Oje, diese Einwanderer sind alle taubstumm.“
Das Zimmer 413 lag im vierten Stock. Aus den Worten des Portiers begriff Tamás nur, dass er Telefon und Minibar offensichtlich nicht benutzen durfte. Doch ausgerechnet telefonieren wollen hätte er gar zu gern, Irene anrufen, um ihr zu sagen, dass er angekommen, die Maschine mit ihm nicht abgestürzt war.
Darüber musste er lächeln, so kindisch kam ihm seine Angst jetzt vor. Wäre das Flugzeug abgestürzt, hätte Irene das aus den Fernsehnachrichten ohnehin erfahren. Auch Walter hätte er gern angerufen, einen ortsansässigen Journalisten, dessen Namen und Telefonnummer er im Flüchtlingslager bekommen hatte.