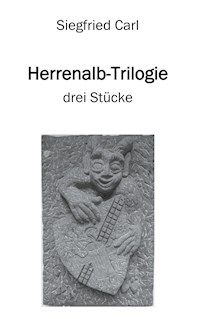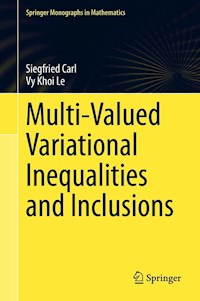Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: salamandra edition
- Sprache: Deutsch
Der Erzählband bringt sehr kurze Mikrogeschichten und längere Erzählungen, die sich mit Momenten der Literatur- und Kultgeschichte auseinandersetzen. Vom 18. Jahrhundert bis in unsere Tage, mit Schwerpunkt in der Vergangenheit, reichen die meisten Personen und Begebenheiten, im "Gastmahl" treffen sich Autoren und Autorinnen vom späten Mittelalter bis ins späte 19. Jahrhundert gemeinsam im Ludwigsburger Schloss. Ein kleiner Schwerpunkt liegt rund um Goethe, auf den ja auch der Titel des Bandes verweist. Hier zwei Zitate aus dem Vorwort des Verfassers: "Die "Weimarer Kehrwoche" ist ein doppeldeutiger Titel für diese Sammlung von Erzählungen. Zum einen ist es der Name einer der Mikrogeschichten rund um Goethe, der natürlich vom Titel her in mehreren Erzählungen mehr oder weniger im Mittelpunkt steht; zum anderen handelt es sich bei diesem Band um ein paar poetische Putzarbeiten im Wust kulturhistorischer Legendenbildungen, vor allem im Bereich der klassischen deutschen Literatur." "Es geht bei der Lektüre nicht darum, wissenschaftliche Hintergründe zu erfahren, sondern sich darauf einzulassen, eine kleine Episode aus dem reichhaltigen kulturellen Erbe in einem Akt des phantasievollen Eintauchens in die vergangene Zeit, in die historischen Begebenheiten, Interaktionen von bekannten und unbekannteren Persönlichkeiten der Kulturgeschichte, von Umständen der Entstehung oder Rezeption von Werken zu erleben. Vor dem bewussten oder unbewussten Wissen, Gehörten, Gelesenen als Hintergrund kann jede und jeder die kleinen Geschichten im Kopfkino einfach laufen lassen, und vielleicht an der einen oder anderen Stelle weiterspinnen; dies mag den je individuellen Reiz der Lektüre ausmachen."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 164
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Allen fleißigen Kehrwöchnerinnen und Kehrwöchnern
Ob alte oder neue Besen,
entscheidend ist, was hinten rauskommt;
drum prüfe, ob – ungleiche Wesen –
der Besen mit dem Eimer auskommt.
Der Besen muss stets sauber kehren,
ein Eimer nutzt uns nur, wenn er sich
mit Wasser wohlfühlt und ihn ehren
Wollmäuse, Dreck und Staub vom Kehrwisch.
Wer seinen Tag verbringt mit Putzen,
im Treppenhaus von früh bis spät schafft,
muss Besen, Eimer, Kehrwisch nutzen,
geb’ acht auf wertige Gerätschaft.
Der ist beim Putzen wahrhaft Meister,
der sein Gerät beherrscht; es wär doch
fatal, irre Putzteufelgeister
verdürben ihm die saub’re Kehrwoch’.
Inhalt
Vorwort
Literatur- und Kultur-Geschichten
Die Legende vom gebrochenen Herzen
Die Audienz
Dazwischen
Ein Singspiel
Eine unmögliche Begegnung
Weimarer Kehrwoche
Das Findelkind
Der Berliner Prolog von 1821 in Weimar
Ein ungeschriebener Brief
Mozart auf der Reise nach Bologna
Von der schönen Müllerin
Die Hand der Emmerick
Eine Nacht in Odessa
Longfellow und die Nachtigall von St. Goar
Der Titel
Port Said – Suez
Der blaue Schmetterling
Hoffnungsvolle Ankunft in Tanga
Der Abgrund – 1901
Zum Tee bei Missionar Hesse
Johannes – und das Lachen der Lau
Unterm Regenbogen
ins Blaue
Das Gastmahl – Ludwigsburger Symposion
Der Vorlass
Wahrheit und Herz der Kehrwoche Nachwort von Jakob Ossner
zum Autor Siegfried Carl | Rüdiger Krüger
Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser, die „Weimarer Kehrwoche“ ist ein doppeldeutiger Titel für diese Sammlung von Erzählungen. Zum einen ist es der Name einer der Mikrogeschichten rund um Goethe, der natürlich vom Titel her in mehreren Erzählungen mehr oder weniger im Mittelpunkt steht; zum anderen handelt es sich bei diesem Band um ein paar poetische Putzarbeiten im Wust kulturhistorischer Legendenbildungen, vor allem im Bereich der klassischen deutschen Literatur. Schon die griechischen Götter wussten, dass ein Stall dann und wann vom angesammelten Mist, ja zum Teil von der Kloake befreit werden muss, den die Rindviecher über die Jahre hinterlassen haben. Es bedarf nicht immer eines Herkules und großer Wasserströme, manchmal reicht die spitze Feder oder auch eine Computertastatur. Und es muss ja auch nicht immer gleich der große Augias-Stall sein, der ausgemistet wird. Die Schwaben unterscheiden zwischen der großen und einer kleinen Kehrwoche. Bei letzterer ist es im Mietswohnhaus nur das innere Treppenhaus, das gekehrt und nass gewischt wird. Das ist überschaubar. So ist dieser Band eine „kleine“ Weimarer Kehrwoche, im riesigen Mietskomplex der deutschen Kulturgeschichte werden nur einige Dreckspuren und Wollmäuse der letzten Woche im Treppenhaus der Wohnungen 18-20 beseitigt. Ich gehe mit dem Putzlappen auch nur in wenige Ecken und versteckte Winkel, die seltener in den Blick genommen werden. Eine große, gründliche Weimarer Kehrwoche wäre eine wahrhaft herkulische Herausforderung und wird wohl frühestens an Pflaumenpfingsten oder, da an Feiertagen nicht gearbeitet und auch keine Kehrwoche durchgeführt werden darf, am Sank Nimmerleins-Tag stattfinden.
Die hier versammelten Erzählungen sind zum Teil älter und schon an anderer Stelle publiziert. So das „Ludwigsburger Symposium“, das ich vor über 35 Jahren meinem Doktorvater Günther Schweikle in der Festschrift zu seinem 60. Geburtstag überreicht habe, „Mozart auf der Reise nach Bologna“, das nach dem Erstdruck vor 30 Jahren für das Rossini Opernfestival in Putbus auf Rügen mehrfach erschien, letztmalig vor 6 Jahren als Einstimmung im von meinem Freund Guido Johannes Joerg herausgegebenen dreibändigen Werk zum deutschsprachigen Rossini-Schrifttum, oder die Eingangs-Legende, die vor rund 20 Jahren erstmals gelesen wurde. 13 Mikrogeschichten rund um interessante, zum Teil von der Forschung vernachlässigte, schreibende Frauen sind als abrundende weibliche Farbtupfer aus „… immer Luise“ in diesen Band aufgenommen. Manches entstand in den vergangenen Jahren parallel und nach den Luisen-Geschichten bis heute, und vier Erzählungen nehmen indirekt auf das Jahr 2025 Bezug, indem sie durch runde Gedenktage – Tod (Eduard Mörike, Hannah Ahrendt, Josephine Baker), Geburt (Thomas Mann) oder ein biografisches Erinnerungsdatum (Hermann Hesse) – angeregt sind. „Unterm Regenbogen“ ist Luise F. Pusch gewidmet, die mich auf die beiden bis auf wenige Tage gleich alten, parallel unterschiedliche Kulturen repräsentierenden Frauengrößen aufmerksam gemacht hat.
Selbstredend sind bei einem Menschen, der sich zeitlebens mit Literatur lesend, forschend, vermittelnd und wissenschaftlich wie poetisch schreibend beschäftigt, alle poetischen Texte mit autobiografischen Versatzstücken durchsetzt, doch meist nicht im engeren Sinn autobiografisch. Alles Erdachte nährt sich vom bewusst und unbewusst Erlebten und Erfahrenen. Bei einem Text im vorliegenden Band ist dieser Bezug etwas enger. Die Legende zum Beginn ist entstanden, als ich im Nonnenflügel des ehemaligen Benediktinerinnen-Klosters Herzebrock über dem letzten erhaltenen Kreuzgangflügel wohnte und sich im Kaminzimmer der Äbtissin mein Arbeitszimmer nebst Bibliothek befand.
Diese Literatur- und Kultur-Geschichten sind keine wissenschaftlichen Abhandlungen. Da sie allerdings überwiegend an historische Ereignisse anknüpfen, meist auf Schriftstellerinnen und Schriftsteller sowie deren überlieferte Werke und verbürgte biografische Fakten Bezug nehmen, ist Redlichkeit der Fakten gefordert. Andererseits handelt es sich um Geschichten rund um die Fakten, Werke und historischen Ereignisse, um ein „so mag es wohl gewesen sein …“. Bei aller Faktentreue sprechen die handelnden Figuren sowohl ihre eigenen, überlieferten als auch erdachte, in den Mund gelegte Worte. Zitate sind bewusst nicht kenntlich gemacht. Das sonstige Vexierspiel der echten und erfundenen Rede ist bei der Karschin in „Die Audienz“ klar: alle wörtlichen Reden entsprechen dem von der Karschin für Gleim aufgezeichneten Audienz-Dialog bei Friedrich dem Großen, der sich in einer Abschrift von Gleim im Halberstadter Gleimhaus befindet. Im „Ludwigsburger Symposium“ mit seinen angeregten Unterhaltungen, meist in poetischer, gar Versform, vermischen sich Original und Fiktion. So auch bei den meisten wörtlichen Reden historischer Personen in den Kultur-Geschichten.
Als mir für die Widmung bei der Fertigstellung des Bandes die „Kehrwöchnerinnen und Kehrwöchner“ einfielen, ergab sich bei der Recherche neben oberschwäbischen Kabarettisten der Hinweis auf die wundervolle Mikrogeschichte von Peter Maiwald: „Ich war Schillers Apfel“ im „Nebelspalter“ 3/2005. Ich war entzückt, einen prominenten, leider verstorbenen Vorgänger in dieser knappen, wissenschaftlich fundierten Erzähltradition gefunden zu haben …
Es geht bei der Lektüre nicht darum, wissenschaftliche Hintergründe zu erfahren, sondern sich darauf einzulassen, eine kleine Episode aus dem reichhaltigen kulturellen Erbe in einem Akt des phantasievollen Eintauchens in die vergangene Zeit, in die historischen Begebenheiten, Interaktionen von bekannten und unbekannteren Persönlichkeiten der Kulturgeschichte, von Umständen der Entstehung oder Rezeption von Werken zu erleben. Da und dort sind kleine editorische Notizen und Bemerkungen eingestreut. Vor dem bewussten oder unbewussten Wissen, Gehörten, Gelesenen als Hintergrund kann jede und jeder die kleinen Geschichten im Kopfkino einfach laufen lassen, und vielleicht an der einen oder anderen Stelle weiterspinnen; dies mag den je individuellen Reiz der Lektüre ausmachen.
Ich wünsche meinen Leserinnen und Lesern Spaß bei der Lektüre und neue Entdeckungen in bisher verborgenen Winkeln der Kultur und vor allem der Literatur.
Halle in Westfalen
im September 2025 Rüdiger Carl Siegfried Krüger
Weimarer Kehrwoche
Literatur- und Kultur-Geschichten
Mikrogeschichten und Erzählungen zur Literatur, Musik, Kultur etc.
Die Legende vom gebrochenen Herzen
Die klugen Historiker mit ihren randlosen Brillen, staubig von der vielen Archivarbeit und dem wirklichen Leben manches Mal ein wenig fremd geworden, wollen uns weismachen, der Name des kleinen westfälischen Fleckens Herzebrock komme von einer in den dichten Wald gehauenen Pferdeweide. Sie führen hierfür als Beweis schwer verständliche altwestfälische Namensformen wie Horsabruoca oder Rossobroc ins Feld.
Das verstehe, wer mag, immer Fakten oder Beweise braucht und ein Faible für alte Sprachformen hat. Die wahre Geschichte ist eine ganz andere – viel einfacher, menschlicher.
Vor vielen Jahrhunderten, als die Sachsen schon einige Zeit durch die Bekehrungsversuche Bischof Bonifatius und die schlussendliche Unterwerfung unter die gewaltsame Hand Karls des Großen den rechten Weg zum rechten Leben gefunden hatten, gab es doch weiterhin viel Unfrieden und Händel zwischen den sächsischen Adeligen. Dem edlen Eckhardt, der reiche Besitztümer in der weiten Gegend zwischen Soest und Osnabrück sein Eigen nannte, erging es nicht anders. Aus nichtigem Anlass – er hatte seine Tochter Duda zunächst einem weitläufigen älteren Verwandten zur Ehefrau versprochen, und der noch nicht Sechzehnjährigen dann doch gestattet, den Schleier im Stift Liesborn zu nehmen – aus solch nichtigem Anlass wurde er heimtückisch meuchlings ermordet. Seiner Ehefrau Waldburg, die Eckhardt in innigster Liebe zugetan war, brach es das Herz bei der Nachricht vom Tod des geliebten Mannes.
Mit ihrer Tochter Duda im schwarzen Gewand der Lisborner Stiftsdamen machte sie sich auf den Weg in die Waldeinsamkeit auf der Gemarkung der späteren Gemeinde Herzebrock. Der dichte Wald, unterbrochen von einzelnen ihrer Familie zugehörigen Meierhöfen, lichtete sich auf einer unmerklichen Anhöhe. Ein Kranz von Linden gab eine anmutige Lichtung frei und ganz in der Nähe plätscherte eine lautere Quelle. Die Luft war erfüllt vom klagenden Gesang einer Nachtigall, als Waldburg mit ihrer Tochter in der frühabendlichen Stimmung auf die Lichtung trat und vom Schmerz überwältigt niedersank. Ein Windhauch löste sacht ein Lindenblatt aus den Zweigen des Baumes, unter dem Waldburg kniete. Das herzförmige Blatt flatterte zu Boden und blieb direkt vor ihr liegen. Sie nahm es auf und brach das Herz-Blatt zwischen ihren gefalteten Händen. Ein Blutstropfen fiel aus den gefalteten Händen auf dem Boden, mischte sich mit ihren Tränen; und an derselben Stelle entspross eine weiße Lilie, das Symbol der unbefleckten Jungfrau Maria.
Als Waldburg dies sah, erhob sie sich und sagte zu ihrer Tochter: „Dies ist uns ein Zeichen. Als Erinnerung an mein gebrochenes Herz soll hier ein Stift mit dem Namen Herzebrock errichtet und der Jungfrau Maria geweiht werden. Und du, geliebte Duda, sollst die erste Äbtissin sein und mir hier eine Heimstatt für meine alten Tage gewähren.“
Das zuvor noch traurig klagende Lied der Nachtigall wandelte sich in eine freudvolle, beinahe süße Melodie.
***
Nota bene:
Dies ist die Legende vom gebrochenen Herzen der Klostergründerin Waldburg, die Herzebrock den Namen gab. Noch heute erinnern die rund um das ehemalige Kloster und das Kruzifix am Kirchplatz stehenden Linden an die einstige Lichtung und laden Liebende zum glücklichen Verweilen. Die im Kloster über die Jahrhunderte entstandenen prachtvollen Psalterien und sonstigen geistlichen und liturgischen Handschriften sind durch kriegerische Auseinandersetzungen, durch die Enteignungen und den Grundbesitz-Raub der Säkularisation, während derer sich ein westfälisches Fürstenhaus das Kloster mit Ländereien und reichem Waldbesitz unrechtmäßig aneignete und die Nonnen vertrieb, und sonstige Wirren großenteils verloren gegangen. Das wenige Erhaltene interessiert nur noch die Wissenschaft und verstaubt ansonsten in den Münsteraner Archiven.
Die Audienz
Höflinge im hinteren Teil des großen Audienzsaals, zum Teil leise tuschelnd. König Friedrich II., nach dem dritten Schlesischen Krieg – den die Engländer und Franzosen den Siebenjährigen nennen –, der die Macht Preußens gefestigt und erweitert hat, nimmt in der ihm eigenen Bescheidenheit die erste große sommerliche Audienz nach dem Friedensschluss ab. Endlich geht alles wieder seinen gewohnten Gang und im Charlottenburger Schloss kann der König seine musikalischen und philosophischen Ablenkungen vom Regierungs- und Militäralltag genießen. Die Königin hält derweil die meiste Zeit in der Residenz Berlin Hof mit zahlreichen Gesellschaften, auch Anna Louisa Karsch war schon als Gast eingeladen. Nun finden in Berlin auch nach lang geübter Tradition wieder die monatlichen Audienzen statt.
Als nächste Antichambrierende ist mit der Karschin eine glühende Verehrerin Friedrichs II. an der Reihe, deren Gedichte über die siegreichen Feldzüge und Preußens Glorie auf Begeisterung gestoßen sind. Sie wird in den Audienz-Saal gebeten; der König winkt die gebeugt auf ihn Zutretende heran: „Ist Sie die Poetin?“ Schüchterne Antwort: „Ja! Ihro Majestät! Man nennt mich so!“ Er: „Sie ist doch aus Schlesien?“, mit scheuem Aufblicken: „Ja! Ihro Majestät!“ Fast wie ein – allerdings durchaus sympathisches – Verhör geht es weiter; wobei die knappen Fragen des nie viele Worte machenden Königs auch ebenso knappe Antworten erwarten: „Wer war ihr Vater?“ Sie: „Er war ein Brauer aus Schweidnitz, beim weinreichen Grünberg!“ Der König, ganz aufmerksamer Kenner seiner Lande im Schlesischen: „Aus Schweidnitz? Gehört das nicht den Geistlichen?“ Die Karschin denkt kurz nach: „Bey Lebzeiten meines Vaters war ein Herr von Köselitz der Eigentümer!“ Das scheint dem König zu wenig: „Aber, wo ist Sie geboren?“ Sie ganz schnell: „Auf einer Meierei, wie Horaz eine gehabt hat.“ Die Erwähnung des Horaz lässt ein schmales Lächeln über des Königs Gesicht huschen: „Sie hatte, sagt man, niemals Unterweisung?“ „Niemals, Ihro Majestät! Meine Erziehung war die schlechteste!“ Er schaut erstaunt interessiert: „Durch wen aber ward Sie eine Poetin?“ Daraufhin die Karschin selbstbewusst: „Durch die Natur, und durch die Siege von Ew. Majestät!“ Er überhört die Schmeichelei: „Wer aber lehrte sie die Regeln?“ Sie versucht sich im Folgenden als in und nach der Natur dichtende Autodidaktin darzustellen: „Ich weiß von keinen Regeln!“ Der König hinterfragt: „Von keinen Regeln? Das ist nicht möglich! Sie muss doch das Metrum wissen!“ Darauf sie, ganz Poetin: „Ja! Ihro Majestät! aber ich beobachte das Metrum nach dem Gehör, und weiß ihm keinen Namen zu geben!“
Das Gehörte scheint den König nicht zu befriedigen, seit dem Generaledikt von 1717, das sein Vater, der von allen so genannte „Soldatenkönig“ zum Unterrichten aller Kinder erlassen hatte, sollten alle Untertanen gutes Lesen und Schreiben erlernt haben. Dass dies in bäuerlichen Gegenden, wo alle auf dem Hof und bei der Ernte zupacken müssen, nicht immer eingehalten wird, ist ihm ein Dorn im Auge. Er wird diese Unsitte mit dem neuen Generallandschulreglement ausmerzen. Daher fragt er interessiert weiter: „Wie denn kommt Sie mit der Sprache zurecht, wenn sie sie nicht lernte?“ Als die Karschin antwortet: „Meine Muttersprache hab ich so ziemlich in meiner Gewalt!“, schaut er zufrieden, bohrt aber weiter: „Das glaub ich, was die Feinheit betrifft, wie aber steht’s mit der Grammatik?“ „Von der hab ich die Gnade Ew. Majestät zu versichern, dass ich nur kleine Fehler mache!“ Darauf der König verschmitzt-vorwurfsvoll: „Man muss aber gar keine machen!“ Lächelnd fragt er interessiert weiter: „Was liest Sie denn?“ Sie, durchaus stolz: „Plutarchs Lebensbeschreibungen!“, und der König: „Nicht auch Poeten?“ „Ja, Ihro Majestät, zuweilen auch Dichter“, die Karschin zählt auf: „den Gellert, den Haller, den Kleist, den Uz und alle unsre deutschen Dichter!“ Da die Karschin sich auch ins Deutsche gebrachter antiker Metren bedient, fragt der König: „Aber liest sie nicht auch die alten Dichter?“ Sie ziert sich: „Ich kenne ja nicht die Sprache der Alten!“ Der König insistiert: „Man hat doch Übersetzungen!“, und sie klärt auf: „Ein Paar Gesänge Homers von Bodmer übersetzt, und den Horaz von Lange las ich.“ Ein Lächeln huscht wieder über des Königs Gesicht, er erinnert ihre erste Erwähnung des Horaz zu Beginn des Gesprächs: „Also den Horaz!“
Genug der Poesie, wechselt der König das Thema zur persönlichen Situation seiner Untertanin: „Hat Sie auch einen Mann?“ Die Karschin ganz schnell, es scheint ihr etwas peinlich: „Ja! Ihro Majestät! aber er ist von Ihren Fahnen entlaufen, irrt in Polen umher, will wieder heiraten, und bittet mich um die Scheidung, die ich ihm einwillige, denn er versorgt mich nicht!“ Der König ungerührt: „Hat Sie Kinder von ihm?“ „Eine Tochter!“ Der König besorgt: „Wo ist die?“ „Zu Berlin! Hofrat Stahl bezahlt für sie.“ Beruhigt fragt Friedrich: „Ist sie schön?“ Selbstbewusst meint die Karschin: „Mittelmäßig, Ihro Majestät! Sie hat keine schöne Mutter gehabt!“ Stirnrunzelnd mustert sie der König: „Diese Mutter war doch wohl einmal schön!“ Daraufhin sie ein wenig bitter aber sehr offen: „Ich bitte untertänig um Vergebung! Sie war niemals schön! Die Natur vergaß den äußern Putz an ihr!“
Da wechselt Friedrich galant zu einem anderen, persönlichen Thema: „Wie wohnt Sie denn?“ Beinahe klagend antwortet die Karschin: „O, Ihro Majestät! Sehr schlecht! Ich kann kein Haus bekommen in Berlin, und, um Ew. Majestät eine Idee zu machen von meiner Wohnung, muss ich bitten, eine Kammer in der Bastille zu Paris sich zu denken!“ Das will der König genauer wissen: „Aber, wo wohnt sie denn?“ „Im alten Consistorium, drei Treppen hoch, unterm Dach!“ Friedrich schaut erstaunt: „Wovon lebt Sie?“, und muss hören, wie prekär ihre Lage ist: „Von Geschenken meiner Freunde! Hofrat Stahl gibt mir sehr oft zu essen!“ Aber ihre Lieder müssen doch etwas einbringen: „Wenn Sie Lieder in Druck gibt, was gibt man ihr für den Bogen?“ „Nicht viel, Ihro Majestät! ich ließ acht Lieder auf Ihre Triumphe drucken –“ Der König, ganz hellhörig, was die erfolgreichen Flugschriften auf seine Siege eingebracht haben: „Was gab man Ihr?“ Die Karschin mit einem tiefen Seufzer: „Nur zwanzig Taler.“ Friedrich scheint erstaunt, fast ein wenig empört: „Zwanzig Taler? In Wahrheit! Davon lebt man nicht lange! Ich will schon sehen, will sorgen für Sie!“ Mit diesen Worten und einem knappen Winken mit der Rechten entlässt sie der König.
Das Gespräch war äußerst aufschlussreich für den Monarchen, aus berufenem Mund authentisch zu erfahren, wie es selbst den augenscheinlich erfolgreich wirkenden Untertanen in seinem Preußen geht. Er lässt den nächsten im Antichambre Wartenden holen.
Louisa Karsch taumelte aus dem Audienz-Saal, völlig benommen von dem Erlebten, aber stolz, unendlich stolz. Ihr König kennt, ihr König interessiert sich für sie – für sie, die schlesische Wirtshausmagd, die Poetin, seine ihm immer untertänigst ergebene Dichterin. Der Alte Fritz will für sie sorgen, für sie – seine Karschin!
Dazwischen
Die Karschin schüttelt mit schiefem Lächeln den Kopf und gibt den gerade gelesenen Brief der an ihrem Rockzipfel hängenden kleinen Wilhelmine, dass sie ihn der Mutter nach hinten bringt. Caroline Louise von Klencke ärgert es, wie ihre Mutter das Brief-Siegel erbrochen und ihre Korrespondenz gelesen hat. Prinzessin Anna Amalie sendet ihrer lieben jungen Freundin Caroline Louise eine kleine Zuwendung, mit der brieflichen Ermunterung, doch zu ihr an den Hof zu kommen, um sorgenfrei ihren literarischen Ambitionen nachgehen zu können. Verbunden hat die Prinzessin ihr liebes Angebot mit einem Dank für die wunderbare Epistel über den Tod des Königs am 17. August, 1786, die Caroline dem Kampfgefährten ihres Bruders, Seiner Hochfürstlichen Durchlaucht, Herzog Ferdinand von Braunschweig, adressiert hatte. Die Prinzessin weiß gut, dass ihr Bruder der Karschin ein Haus in Berlin versprochen hat, was er nie einhielt; und darum wohnen nun Caroline mit der kleinen Wilhelmine bei ihrer Mutter in diesen bescheidenen Verhältnissen, die der Prinzessin im Herzen leid sind, und die sie gerne für die begabte junge Dichterin ändern möchte.
Die Karschin steht in der Türe und schaut ihre Tochter vorwurfsvoll herrisch an. „Kannst ruhig ein wenig für den Unterhalt beitragen“, fordert sie die Tochter auf, den monetären Inhalt des Briefes zu teilen. Caroline gehorcht sofort; und ihre Mutter macht ihr Vorhaltungen: wenn sie der Prinzessin folge und aus dem Haus ginge, habe sie, die Alte, die Enkelin am Hals; sie brauche nicht zu meinen, sie könne dann einfach so, wie sie es immer mache, wieder zurückkommen, nein, wenn sie jetzt geht, dann kann sie bleiben und schauen, wie sie in der Zukunft zurechtkommt. Im Schwall der Worte ihrer Mutter laufen der Tochter Tränen über die Wangen, die sie verschämt wegwischt. Sie duckt sich und fügt sich in ihr Schicksal.
Ein paar liebe Zeilen an die hochwohlgeborene Freundin und Prinzessin mit Dank und einigen erwählten Versen erklären die Unabkömmlichkeit der Caroline Louise von Klemcke im Haus der Mutter und die Sorge um die kleine, von der Oma verhätschelte Tochter.
***
Erwähnenswert:
Im Jahr darauf, 1787, stirbt unter großer Anteilnahme Prinzessin Anna Amalia von Preußen und Caroline hat eine Freundin verloren, die sich um sie sorgte. Friedrich Wilhelm II. erfüllt 1789 das Versprechen seines Onkels und überlässt der Karschin an der neuen Promenade ein stattliches Haus, in das sie mit Tochter und Enkelin einzieht.
Caroline ist wie immer dazwischen – sie wird ihrer Mutter den Nachruf schreiben und bekommt ihren von Wilhelmine. An ihre Mutter, die selbst vom jungen Goethe hofierte Karschin, und an ihre Tochter Wilhelmine, die unter dem Namen Helmina von Chézy nicht nur mit Ihrer „Rosamunde“, zu der Schubert die Bühnenmusik schrieb, in die Kulturgeschichte Eingang gefunden hat, erinnern sich alle; aber kaum jemand an die dazwischen…
Ein Singspiel