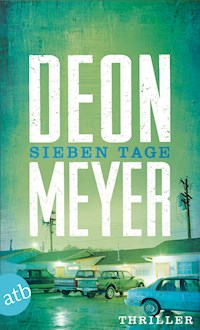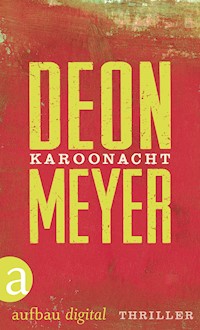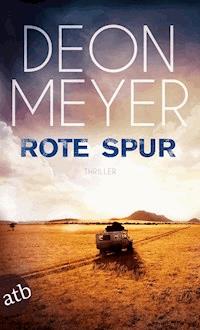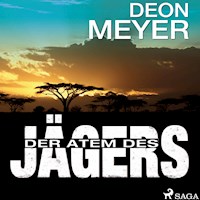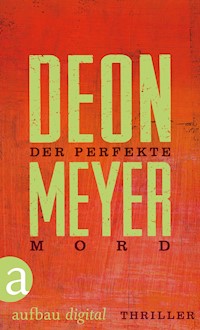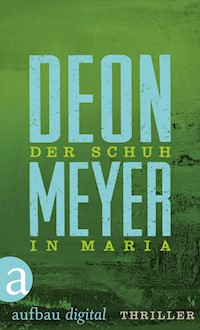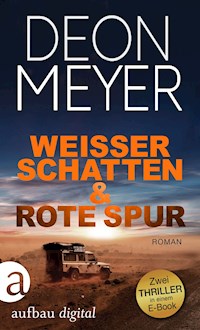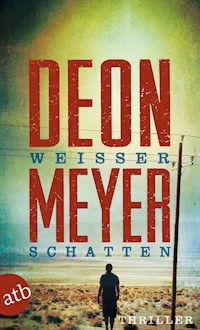
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Bodyguard-Lemmer-Serie
- Sprache: Deutsch
»Ein mitreißender Thriller.« Hamburger Abendblatt.
Er heißt Lemmer, sein Job ist es, Bodyguard zu sein. Als Emma, eine weiße Südafrikanerin, ihn anheuert, hofft Lemmer auf einen harmlosen Job. Sie meint, ihren Jahre verschwundenen Bruder in den Nachrichten gesehen zu haben. Angeblich hat er skrupellos vier Wilderer getötet. Kaum sind sie im Kruger-Park angekommen, muss Lemmer den ersten Anschlag auf Emma vereiteln. Er beginnt zu begreifen, dass er einer Sache auf der Spur ist, die etliche Nummern zu groß und zu gefährlich für ihn ist ...
»Eine abenteuerliche Geschichte durch Südafrikas Wildnis, Gesellschaft und Geschichte. Deon Meyer wird immer besser.«Die Welt.
Ausgezeichnet mit dem Deutschen Krimipreis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 551
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Deon Meyer
Weißer Schatten
Thriller
Aus dem Englischen von Ulrich Hoffmann
Impressum
ISBN E-Pub 978-3-8412-0015-0ISBN PDF 978-3-8412-2015-8ISBN Printausgabe 978-3-7466-2590-4
Aufbau Digital,veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, Februar 2010© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2010Copyright © 2007 by Deon MeyerErstmals erschienen 2008 bei Rütten & Loening Berlin; Rütten & Loening ist eine Marke der Aufbau Verlag GmbH & Co. KG
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.
Umschlaggestaltung morgen, Kai Dieterichunter Verwendung eines Motivs von plainpicture/Mark Owen und zwei Motive von iStockphoto: © pashabo, © Qweek
E-Book Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, www.le-tex.de
www.aufbau-verlag.de
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Informationen zum Autor
Impressum
Inhaltsübersicht
TEIL 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
TEIL 2
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
TEIL 3
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
TEIL 1
1
Ich schwang den Vorschlaghammer im langsamen Rhythmus. Es war Dienstag, der 25. Dezember, kurz nach Mittag. Die Mauer war dick und von einer ungeheueren, widerspenstigen Härte. Nach jedem dumpfen Schlag brachen Ziegel- und Zementsplitter heraus und schossen wie Schrapnells über den Dielenboden. Ich spürte den Schweiß durch den Staub auf meinem Gesicht auf meinen Oberkörper rinnen. Es war heiß wie in einem Ofen, obwohl die Fenster aufstanden.
Zwischen zwei Hammerschlägen hörte ich das Telefon klingeln. Ich hatte eigentlich keine Lust, meinen Rhythmus zu unterbrechen. In dieser Hitze wäre es schwierig, den inneren Motor wieder anzuwerfen. Doch langsam legte ich den langen Griff nieder und ging hinüber ins Wohnzimmer. Ich spürte die Zementsplitter unter meinen nackten Füßen. Auf dem Display des Telefons stand JEANETTE. Ich wischte mir die schmierige Hand an den Shorts ab und nahm das Gespräch an.
»Jis.«
»Schöne Weihnachten.« Jeanette Louws Grabesstimme war voll unerklärlicher Ironie – wie immer.
»Danke. Dir auch.«
»Muss ganz schön heiß draußen bei dir sein.«
»Achtunddreißig Grad im Freien.«
Im Winter sagte sie: »Muss ganz schön kalt draußen bei dir sein«, und man konnte hören, was sie von der Wahl meines Wohnortes hielt. »Loxton«, sagte sie jetzt, als wäre das ein Fauxpas. »Tja, dann musst du eben schwitzen. Was macht man bei dir draußen zu Weihnachten?«
»Die Mauer zwischen Küche und Bad rausbrechen.«
»Hast du gesagt, zwischen Küche und Bad?«
»So haben sie damals gebaut.«
»Und so feierst du also Weihnachten. Alte Dorftradition, was?« Dann brüllte sie einmal: »Ha!«
Ich wusste, sie hatte nicht angerufen, um mir schöne Weihnachten zu wünschen. »Du hast einen Job für mich.«
»Mhhm – mhhm.«
»Ein Tourist?«
»Nein. Eine Frau vom Kap. Sie sagt, gestern sei ein Überfall auf sie verübt worden. Sie will dich für ungefähr eine Woche und hat schon die Anzahlung geleistet.«
Ich dachte an das Geld, das ich gut brauchen konnte.
»Oh?«
»Sie ist in Hermanus. Ich schicke dir die Adresse und Handynummer per SMS. Ihr sage ich, du bist unterwegs. Ruf mich an, wenn du Probleme hast.«
Ich traf Emma le Roux das erste Mal in einem Strandhaus, von dem aus man über den alten Hafen von Hermanus blickte. Das Haus war beeindruckend, drei nagelneue Stockwerke mit einer handgeschnitzten Eingangstür und einem Türklopfer in Form eines Löwenkopfes. Ein Spielplatz für reiche Leute.
Um Viertel vor sieben am ersten Weihnachtsfeiertag öffnete mir ein junger Mann mit langem, lockigem Haar und einer Brille mit dünnem Stahlrand die Tür. Er sagte, er heiße Henk und ich werde erwartet. Ich konnte sehen, dass er neugierig war, obwohl er es gekonnt verbarg. Er bat mich herein und sagte, ich solle im Wohnzimmer warten, während er »Miss le Roux« rufe. Ein gut erzogener Bursche. Es waren Geräusche aus der Tiefe des Hauses zu vernehmen – klassische Musik, Gespräche. Es roch nach Essen.
Er verschwand. Ich setzte mich nicht. Nach sechs Stunden Fahrt durch die Karoo in meinen Isuzu stand ich lieber. Es gab einen Weihnachtsbaum, ein großes künstliches Ding mit Plastiknadeln und künstlichem Schnee. Vielfarbige Lichter blinkten. Oben auf dem Baum stand ein Engel mit langem, blondem Haar, die Flügel gespreizt wie ein Greifvogel. Dahinter waren die Vorhänge des großen Fensters offen. Die Bucht sah schön aus am späten Nachmittag, das Meer war ruhig und still. Ich starrte hinaus.
»Mr. Lemmer?«
Ich drehte mich um.
Sie war klein und schlank. Ihr schwarzes Haar war sehr kurz geschnitten, fast wie bei einem Mann. Ihre Augen waren groß und dunkel. Das obere Ende ihrer Ohren war ein wenig spitz. Sie sah aus wie eine Nymphe in einer Kindergeschichte. Sie stand einen Augenblick da und sah mich an; sie musterte mich unwillkürlich von oben bis unten, um mich an ihren Erwartungen zu messen. Sie verbarg ihre Enttäuschung gut. Normalerweise rechnen sie mit jemandem, der durch seine Statur beeindruckt – nicht mit einer Person von durchschnittlicher Größe und Erscheinung.
Sie kam auf mich zu und streckte die Hand aus. »Ich bin Emma le Roux.« Ihre Hand war warm.
»Hallo.«
»Bitte setzen Sie sich«, sagte sie und deutete auf das Sofa im Wohnzimmer. »Kann ich Ihnen etwas zu trinken anbieten?« In ihrer Stimme lag ein überraschendes Timbre, als gehörte sie zu einer größeren Frau.
»Nein, danke.«
Ich setzte mich. Ihr zarter Körper bewegte sich fließend, als fühlte sie sich vollkommen wohl darin. Sie setzte sich mir gegenüber, schlug die Beine unter, fühlte sich zu Hause. Ich fragte mich, ob dies ihr Heim war und wo das Geld herkam.
»Ich, äh…« Sie wedelte mit einer Hand. »Es ist das erste Mal, dass ich einen Bodyguard habe …«
Ich war nicht sicher, wie ich darauf reagieren sollte. Die Lichter des Weihnachtsbaums blinkten farbig und mit monotoner Regelmäßigkeit.
»Vielleicht können Sie erklären, wie es funktioniert?«, sagte Emma ohne Peinlichkeit. »In der Praxis, meine ich.«
Ich wollte sagen: Wenn Sie den Dienst bestellen, sollten Sie doch wissen, wie es funktioniert. Es gibt keine Bedienungsanleitung.
»Es ist recht einfach. Um Sie zu beschützen, muss ich wissen, was Sie am Tag vorhaben …«
»Natürlich.«
»Und worin die Bedrohung besteht.«
Sie nickte. »Nun … Ich bin nicht ganz sicher, worin sie besteht. Es sind ein paar eigenartige Dinge vorgefallen … Carel hat mich überzeugt … Sie werden ihn gleich treffen; er hat Ihre Dienste bereits in Anspruch genommen. Ich … da war ein Überfall, gestern Morgen …«
»Auf Sie?«
»Ja. Na ja, wohl schon … Sie haben die Tür meines Hauses aufgebrochen und sind eingedrungen.«
»Sie?«
»Drei Männer.«
»Waren sie bewaffnet?«
»Nein. Ja. Sie, äh … Es ging so schnell … Ich … ich habe sie kaum richtig gesehen.«
Ich unterdrückte den Drang, die Augenbrauen hochzuziehen.
»Ich weiß, das klingt … merkwürdig«, sagte sie.
Ich sagte nichts.
»Es war … merkwürdig, Mr. Lemmer. Irgendwie … surreal.«
Ich nickte, ermutigte sie.
Sie schaute mich einen Augenblick lang forschend an, dann beugte sie sich zur Seite und schaltete die Tischlampe neben sich ein.
»Ich habe ein Haus in Oranjezicht«, sagte sie.
»Sie wohnen also nicht hier?«
»Nein … das ist Carels Haus. Ich bin nur zu Besuch. Zu Weihnachten.«
»Ich verstehe.«
»Gestern Morgen … Ich wollte meine Arbeit zu Ende bringen, bevor ich für das Wochenende packe … Mein Büro … Ich arbeite von zu Hause, verstehen Sie. Gegen halb zehn habe ich geduscht …« Ihre Geschichte klang anfangs nicht flüssig. Sie schien es nicht noch einmal durchleben zu wollen. Ihre Sätze waren unvollständig, die Hände ruhig, die Stimme war von höflicher, indifferenter Monotonie. Sie berichtete mir mehr Details, als die Situation verlangte. Vielleicht hatte sie das Gefühl, das sei glaubwürdiger.
Nach dem Duschen, sagte sie, habe sie sich in ihrem Schlafzimmer angezogen, ein Bein schon in der Jeans, gerade so eben im Gleichgewicht. Sie hörte, wie das Gartentor sich öffnete und sah durch den Spitzenvorhang drei Männer schnell und zielgerichtet durch ihren Vorgarten laufen. Bevor sie auf dem Weg zur Haustür aus ihrem Blickfeld verschwanden, fiel ihr auf, dass sie Balaclavas trugen – Sturmhauben. Sie hatten stumpfe Gegenstände in den Händen.
Sie war eine moderne, vorsichtige Single-Frau. Sie hatte oft darüber nachgedacht, dass sie Opfer eines Verbrechens werden konnte und wie sie im Notfall reagieren sollte, wenn es zum Äußersten kam. Also steckte sie ihren Fuß in das andere Bein der Jeans und zog sie hastig hoch. Sie war halb angezogen und trug nur Unterwäsche und Jeans, aber jetzt ging es darum, zum Notruf zu gelangen und bereit zu sein, den Alarm auszulösen. Aber noch nicht zu drücken, schließlich waren da noch das Sicherheitsgitter vor der Haustür und die Fenstergitter. Sie wollte sich die Peinlichkeit ersparen, ohne Grund die Polizei zu rufen.
Ihre nackten Füße huschten eilig über den Teppich zum Notruf an ihrer Schlafzimmerwand. Sie hob einen Finger und wartete. Ihr Herz klopfte in ihrem Hals, aber noch konnte sie sich zusammenreißen. Sie hörte das Quietschen von Metall, das sich widerwillig bog und schließlich brach.
Die Sicherheitstür war nicht mehr länger sicher. Emma le Roux löste den Alarm aus. Er heulte von der Decke herunter, und mit diesem Ton ereilte sie eine Welle der Panik.
Ihr Bericht schien sie jetzt selbst gefangen zu nehmen, und ihre Hände begannen zu erzählen. Ihre Stimme nahm einen musikalischen Ton an, klang etwas höher.
Emma le Roux rannte durch den Flur in die Küche. Sie war sich für einen Augenblick der Tatsache bewusst, dass Diebe und Einbrecher nicht so vorgingen wie diese Leute. Durch diese Erkenntnis verstärkte sich ihre Angst noch. In ihrer Hast stieß sie mit einem dumpfen Krachen gegen die hölzerne Hintertür. Ihre Hände zitterten, als sie die Riegel öffnete und den Schlüssel im Schloss drehte. Kaum hatte sie die Tür aufgerissen, hörte sie ein Splittern im Flur, Glas zerbarst. Die Eingangstür war offen. Die Männer waren in ihr Haus eingedrungen.
Sie machte einen Schritt nach draußen und hielt inne. Dann kehrte sie zurück in die Küche, um sich ein Trockentuch von der Spüle zu greifen. Sie wollte sich damit bedecken. Später sollte sie sich über dieses irrationale Handeln ärgern, aber es war instinktiv. Und sie zögerte eine weitere Sekunde. Sollte sie sich eine Waffe nehmen, ein Küchenmesser? Sie unterdrückte den Impuls.
Dann rannte sie ins helle Sonnenlicht, das Trockentuch vor die Brust gedrückt. Ihre sorgfältig gepflasterte Terrasse war sehr schmal.
Emma le Roux schaute die hohe Betonmauer an, die sie schützen sollte und die Welt draußen hielt. Jetzt schloss die Mauer sie ein. Zum ersten Mal schrie sie: »Hilfe!« Eine Bitte an die Nachbarn, die sie nicht kannte, denn in diesem Teil Kapstadts hielt man sich von den anderen fern und zog jeden Abend die Zugbrücke hoch, um für sich zu bleiben. Sie konnte die Männer hinter sich im Haus hören. Einer rief etwas. Sie bemerkte die schwarze Mülltonne vor der Betonmauer – eine Treppe in die Sicherheit. »Hilfe!«, rief sie über die jaulenden Alarmwellen hinweg.
Emma konnte sich nicht erinnern, wie sie über die Mauer gelangt war, aber sie schaffte es in ein oder zwei adrenalingetriebenen Bewegungen. Das Trockentuch blieb dabei zurück, sodass sie mit leeren Händen im Garten ihres Nachbarn landete. Ihr linkes Knie schrammte an irgendetwas entlang. Sie spürte keinen Schmerz, erst später würde ihr der kleine Riss im Jeansstoff auffallen.
»Helfen Sie mir!« Ihre Stimme klang schrill und verzweifelt. Emma rannte auf die Hintertür ihres Nachbarn zu. »Helfen Sie mir!«
Sie hörte, wie die Mülltonne umfiel, und wusste, dass die Männer mit den Sturmhauben dicht hinter ihr waren. Die Tür vor ihr öffnete sich, und ein grauhaariger Mann in einem roten Morgenmantel mit weißen Punkten trat heraus. Er hatte ein Gewehr in der Hand. Über seinen Augen wucherten silberne Brauen, die auf seiner Stirn wie Schwingen aussahen.
»Helfen Sie mir«, sagte sie mit Erleichterung in der Stimme.
Der Nachbar sah sie einen Augenblick lang an, eine erwachsene Frau mit jungenhafter Figur. Dann zog er die Augenbrauen hoch und wandte seinen Blick der Mauer hinter ihr zu. Er hob das Gewehr auf Schulterhöhe und zielte damit auf die Mauer. Emma hatte ihn nun beinahe erreicht und sah sich um. Eine Balaclava erschien für einen Moment über dem Beton.
Der Nachbar drückte ab. Der Schuss hallte von den zahlreichen Mauern um sie herum wider, und die Kugel schlug mit einem eigenartigen Geräusch in die Wand ihres Hauses. Drei oder vier Minuten lang konnte sie nichts hören. Sie stand dicht neben ihrem Nachbarn und zitterte. Er sah sie nicht an. Er lud durch. Eine Patronenhülse klimperte auf den Zement, tonlos für ihre tauben Ohren. Der Nachbar behielt die Mauer im Visier.
»Dreckschweine«, sagte er, während er über den Lauf schaute. Er schwang das Gewehr langsam horizontal, um die ganze Breite abzudecken.
Emma wusste nicht, wie lange sie dort standen. Die Angreifer waren verschwunden. Mit einem Rauschen kehrte ihr Hörvermögen zurück, dann nahm sie erneut den Alarm wahr. Schließlich ließ der Nachbar langsam das Gewehr sinken und fragte sie mit einer osteuropäisch klingenden Stimme voller Sorge: »Ist alles in Ordnung, meine Liebe?«
Sie begann zu weinen.
2
Der Name ihres Nachbarn lautete Jerzy Pajak. Er führte sie in sein Haus. Er bat seine Frau Alexa, die Polizei zu verständigen, und dann sorgten sie sich gemeinsam, mit polnischem Akzent sprechend, um sie. Jerzy gab ihr eine leichte Decke, um sich darin einzuhüllen, und süßen Tee. Später gingen sie mit Emma und zwei Polizisten zurück zu ihrem Haus.
Das Sicherheitsschloss aus Stahl hing schief, und die hölzerne Eingangstür war nicht mehr zu reparieren. Der farbige Polizist war der höherrangige der beiden, mit Streifen auf der Schulter seiner schicken Uniform. Emma dachte, er sei ein Sergeant, aber weil sie nicht sicher war, sprach sie beide als »Mister« an. Er bat sie, zu überprüfen, ob etwas gestohlen worden sei. Sie sagte, sie werde sich bei dieser Gelegenheit anziehen. Sie hatte immer noch die bunte Decke um ihre Schultern, und die Temperatur in der Stadt stieg. Sie ging in ihr Zimmer und saß einen Augenblick auf der weißen Decke ihres Doppelbettes. Es war über eine Stunde her, dass sie es gemacht hatte. Sie glaubte nicht, dass die Männer Diebe gewesen waren. Emma hatte Zeit genug gehabt, zu diesem Schluss zu kommen und eine Theorie zu entwickeln.
Sie zog sich ein grünes T-Shirt und Turnschuhe an. Danach ging sie durch das Haus und konnte tatsächlich dem Sergeant bestätigen, dass nichts fehlte. Nachdem sie sich im Wohnzimmer niedergelassen hatten, die Pajaks auf der Couch, sie und die Polizisten in Sesseln, befragte er sie vorsichtig und mitfühlend in gutem, ordentlichem Afrikaans.
Ob ihr aufgefallen sei, dass jemand in letzter Zeit sie oder ihr Haus beobachtet habe?
»Nein.«
»Haben Sie einen Wagen oder irgendein anderes Fahrzeug bemerkt, das für diese Gegend ungewöhnlich ist?«
»Nein.«
»Hat sich irgendjemand auf der Straße herumgetrieben oder verdächtig benommen?«
»Nein.«
»Sie befanden sich in Ihrem Schlafzimmer, als die Personen einbrachen?«
Emma nickte. »Ich war dabei, mich anzuziehen, als ich das Tor hörte. Es macht so ein Geräusch. Dann sah ich sie Richtung Haustür rennen. Nein, nicht rennen – zügig gehen. Als ich die Balaclavas bemerkte, habe ich …«
»Ich nehme an, Sie konnten ihre Gesichter nicht sehen.«
»Nein.«
Die Pajaks verstanden kein Afrikaans, aber ihre Köpfe folgten dem Verhör von einer Seite zur anderen, wie Zuschauer bei einem Tennismatch.
»Hautfarbe?«
»Ich bin nicht sicher …«
Emma glaubte, die Männer seien schwarz gewesen, aber sie wollte den anderen Polizisten nicht beleidigen. »Ich kann es nicht sicher sagen. Es ging alles so schnell.«
»Ich verstehe, Miss le Roux. Sie hatten Angst. Aber jede Kleinigkeit könnte helfen.«
»Vielleicht … Einer war schwarz.«
»Und die anderen beiden?«
»Ich weiß nicht …«
»Haben Sie in letzter Zeit am Haus oder im Garten Arbeiten vornehmen lassen?«
»Nein.«
»Befinden sich irgendwelche wertvollen Gegenstände im Haus?«
»Nur das Übliche. Ein paar Schmuckstücke. Ein Laptop. Der Fernseher …«
»Ein Laptop?«
»Ja.«
»Und den haben die Eindringlinge nicht mitgenommen?«
»Nein.«
»Sie müssen entschuldigen, Miss le Roux, aber das ist ungewöhnlich. Wenn ich höre, was hier vorgefallen ist, ist das nicht das typische Vorgehen von Einbrechern. Die Tür aufbrechen und Sie in den Garten verfolgen …«
»Ja?«
»Das klingt so, als hätte man Sie persönlich angreifen wollen.«
Emma nickte.
»Da sucht man nach einem Motiv, Sie verstehen.«
»Ich verstehe.«
»Und das ist normalerweise etwas Persönliches. In den meisten Fällen.«
»Oh?«
»Entschuldigen Sie, aber haben Sie sich vielleicht im Schlechten von jemand getrennt?«
»Nein«, sagte Emma mit einem Lächeln, um ihm ihre Erleichterung zu verbergen. »Nein … nicht so schlecht, hoffe ich.«
»Man kann nie wissen, Miss. Es gab also einen Mann in der jüngeren Vergangenheit?«
»Ich kann Ihnen versichern, es ist über ein Jahr her, dass ich eine ernsthafte Beziehung hatte, und das war mit einem Briten, der zurück nach England gegangen ist.«
»Die Trennung war freundschaftlich?«
»Absolut.«
»Und seitdem gab es vielleicht jemand anders, der unglücklich über eine Trennung sein könnte?«
»Nein. Definitiv nicht.
»Was arbeiten Sie, Miss le Roux?«
»Ich bin Marken-Consultant.«
Sie bemerkte seine Verwirrung und erklärte es. »Ich helfe Firmen, ihre Produktmarken zu positionieren. Oder neu zu erfinden.«
»Für welche Firma arbeiten Sie?«
»Ich arbeite für mich. Meine Kunden sind Firmen.«
»Sie haben also keine Angestellten?«
»Nein.«
»Und Sie arbeiten mit großen Firmen?«
»Meistens. Manchmal sind es auch kleinere …«
»Ist bei der Arbeit irgendetwas passiert, das Leute verärgert haben könnte?«
»Nein. Es ist nicht … Ich arbeite mit Produkten oder der Wahrnehmung einer Marke. Das würde niemand verärgern.«
»Ein Zwischenfall? Ein Autounfall? Oder Probleme mit jemandem, der für Sie tätig war? Gärtner, Haushälterin?«
»Nein.«
»Fällt Ihnen irgendetwas anderes ein? Irgendetwas, was dazu geführt haben könnte?«
Genau das war die Frage, die zu beantworten Emma noch nicht bereit war.
»Also habe ich ›nein‹ gesagt, aber ich glaube nicht, dass das ganz richtig ist«, erklärte Emma mir. Die Stehlampe neben ihr warf einen weichen Schein auf sie.
Ich sagte nichts.
»Ich … Ich dachte mir … Ich war nicht sicher, ob es miteinander zu tun hatte. Nein, ich … Ich wollte nicht, dass es miteinander zu tun hatte. Außerdem ist es tausend Kilometer vom Kap entfernt geschehen, und vielleicht war es Jacobus, vielleicht aber auch nicht, und ich wollte die Polizei nicht mit etwas belästigen, was ich mir genauso gut eingebildet haben könnte.« Plötzlich hörte sie auf zu sprechen, sah mich an und lächelte langsam, als hätte sie ihr eigenes Gerede satt.
»Das ergibt keinen Sinn, oder?«
»Lassen Sie sich Zeit.«
»Es ist nur … es ergibt keinen Sinn. Sehen Sie, mein Bruder …« Emma unterbrach sich wieder, holte tief Luft. Sie sah auf ihre Hände, dann langsam zu mir auf. Gefühl zeigte sich in ihrem Blick, ihre Hände vollführten eine kleine Geste, aus der Hoffnungslosigkeit sprach. »Mr. Lemmer, er ist gestorben …«
Es waren ihre Körpersprache, ihre Wortwahl und der plötzliche Tempowechsel, die den Alarm in meinem Kopf auslösten. Als hätte sie diesen Satz geübt, den Glauben daran. Da war ein winziger Hauch Manipulation, als wollte sie meine Aufmerksamkeit von den vorliegenden Tatsachen ablenken. Ich fragte mich nur: Warum sollte das notwendig sein?
Emma le Roux wäre nicht die erste Mandantin, die mit höchst ernsthaftem Gesichtsausdruck offen log, was eine Bedrohung anbetraf. Nicht die erste, die ein paar Tränen verdrückte oder ein wenig übertrieb, um die Anwesenheit eines Bodyguards zu rechtfertigen. Menschen lügen – aus Millionen von Gründen. Manchmal einfach nur, weil sie können. Das war eine der Bestätigungen für Lemmers erstes Gebot: Nicht einmischen. Es war zugleich der Hauptgrund für Lemmers zweites Gebot: Trau niemandem.
3
Emma erholte sich schnell. Als sie keine Antwort erhielt, ließ sie die Gefühle mit einem Kopfschütteln hinter sich und sagte: »Mein Bruder hieß Jacobus Daniël le Roux …«
Sie sagte, er sei 1986 verschwunden. Ihre Sätze kamen jetzt weniger flüssig, ihre Erzählweise war oberflächlich, als wären die Details eine Quelle, aus der sie nicht zu trinken wagte. Sie war damals vierzehn; Jacobus zwanzig. Er war eine Art Wildhüter, einer von ein paar Soldaten, die sich bereit erklärt hatten, der Verwaltung beim Kampf gegen die Elfenbeindiebe im Kruger-Park zu helfen. Und dann war er einfach verschwunden. Später fand man Spuren einer Auseinandersetzung mit Wilderern, Patronenhülsen und Blut und die Überreste eines Zeltplatzes, der eilig verlassen worden war. Sie suchten zwei Wochen lang, bis sie zum einzigen möglichen Schluss kamen. Jacobus und sein schwarzer Helfer waren bei dem Aufeinandertreffen ums Leben gekommen, und die Elfenbeindiebe hatten ihre Leichen mit sich genommen, weil sie fürchteten, was sonst passieren würde.
»Das ist über zwanzig Jahre her, Mr. Lemmer … Eine lange Zeit … Das macht es alles so schwierig … Letzte Woche, am 22., ist etwas passiert, was ich der Polizei nicht gesagt habe …«
An diesem Samstagabend hatte sie kurz nach sieben im zweiten Schlafzimmer ihres Hauses gesessen. Es war als Büro eingerichtet, mit Schreibtisch, Aktenschränken und hohen Regalen. Es gab einen Fernseher, ein Fitness-Rad und eine Pinwand mit ein paar fröhlichen Fotos von Freunden plus Zeitungsausschnitten aus Business-Magazinen, die ihren Erfolg als Marken-Consultant bestätigten. Emma arbeitete auf ihrem Laptop, sie untersuchte Tabellen von Statistiken, die große Konzentration erforderten. Sie war sich nur vage der Fernseh-Nachrichten bewusst, die ihr das Gefühl eines Déjà-vu verschafften. Präsident Mbeki und die Mitglieder seiner Regierung lagen sich in den Haaren, ein Selbstmordattentat in Bagdad, afrikanische Politiker beklagten sich über die G8-Konditionen für den Schuldenerlass.
Später konnte sie sich nicht erinnern, was sie überhaupt dazu gebracht hatte, aufzuschauen. Vielleicht hatte sie gerade eine Grafik fertig gehabt und musste einen Augenblick an etwas anderes denken, vielleicht war es reiner Zufall. Als sie jedoch auf den Fernsehschirm schaute, dauerte es nur Sekunden, bevor ein Foto erschien. Sie hörte den Nachrichtensprecher sagen: »… verwickelt in einen Schusswechsel in Khokovela in der Nähe des Kruger-Nationalparks, bei dem ein traditioneller Heiler und drei Männer aus der Gegend starben. Die Überreste von vierzehn seltenen und geschützten Geiern wurden am Tatort aufgefunden.«
Ein Foto erschien in Schwarz-Weiß. Ein Weißer Anfang vierzig starrte geradewegs in die Kamera, wie für ein Ausweisfoto.
Er sieht aus wie Jacobus ausgesehen hätte. Das war ihr plötzlicher, instinktiver Gedanke, eine reine Beobachtung, und ein Hauch von … beinahe Nostalgie.
»Die Polizei von Limpopo sucht nach einem Mr. Jacobus de Villiers, auch bekannt als Cobus, ein Angestellter einer Tierklinik in Klaserie, der bei den Ermittlungen weiterhelfen könnte. Wer über seinen Verbleib Informationen hat, soll die Polizeiwache in Hoedspruit kontaktieren …«
Emma schüttelte den Kopf. Zufall.
Der Nachrichtensprecher wandte sich nun den aktuellen Preissteigerungen für Grundnahrungsmittel zu, und sie konzentrierte ihre Aufmerksamkeit wieder auf den Computerbildschirm und die Arbeit, die vor ihr lag. Sie zog den Mauszeiger über einen Datenblock, wählte ein Grafik-Icon.
Wie hätte Jacobus ausgesehen mit … vierzig – wäre er dieses Jahr vierzig geworden? Ihre Erinnerung an seine Züge basierte vor allem auf den Fotos bei ihren Eltern zu Hause; ihre eigene Erinnerung war wenig zuverlässig. Aber sie erinnerte sich an die unglaubliche Intensität ihres Bruders, seinen Geist, seine überwältigende Persönlichkeit.
Sie verwandelte die Grafik in bunte Datentürme, die gewisse Kauftrends aufzeigen sollten.
Zufall. Eigenartig, dass der Mann auf dem Foto im Fernsehen auch Jacobus heißen sollte.
Emma wählte noch mehr Datenblöcke.
Jacobus war kein häufiger Name.
Sie musste Tortendiagramme daraus machen, mit Marktanteilen, um zu demonstrieren, dass das Salatdressing ihres Mandanten der Nachzügler war, das letzte Pferd über der Linie. Und dann musste sie das Problem lösen.
Die Überreste von vierzehn seltenen, geschützten Geiern wurden am Tatort aufgefunden.
Das hätte Jacobus verärgert.
Sie machte einen Fehler bei der Erstellung der Grafik und schnalzte mit der Zunge. Zufall, reiner Zufall. Wenn man zwanzig Jahre lang jeden Tag Tausende von Informationen aufnahm, passierte das im Leben mindestens einmal, vielleicht zweimal. Die Wahrscheinlichkeit verschwor sich, um einen mit ihren Möglichkeiten zu necken.
Emma unterdrückte diesen Gedankengang fast zwei Stunden lang, bis sie mit den Daten fertig war. Sie sah nach, ob sie neue E-Mails erhalten hatte, und schaltete anschließend ihren Computer aus. Sie holte sich ein sauberes Handtuch aus dem Handtuchschrank und stieg auf das Fitness-Rad, das Handy in der Hand. Sie las SMS und hörte ihre Nachrichten ab. Sie trat immer schneller, schaute abgelenkt Fernsehen, wechselte mit der Fernbedienung die Sender.
Sie fragte sich, wie ähnlich das Foto Jacobus wirklich sah und ob sie überhaupt in der Lage wäre, ihn zu erkennen. Wenn er nicht gestorben wäre und jetzt hier hereinspazierte?
Was hätte ihr Vater über diese Nachricht zu sagen gehabt? Welcher Arbeit würde Jacobus nachgehen, wenn er noch am Leben wäre? Wie hätte er reagiert, wenn er vierzehn tote, vom Aussterben bedrohte Geier entdeckte?
Mehr als einmal zwang Emma ihre Gedanken in andere Bahnen, ihre Pläne für morgen, die Vorbereitungen für ein paar Tage in Hermanus zu Weihnachten, aber Jacobus kehrte immer und immer wieder zurück. Wenige Minuten nach zehn öffnete Emma einen ihrer Schränke und zog zwei Alben heraus. Zügig blätterte sie hindurch, sie hielt sich nicht mit den Bildern ihrer Eltern oder fröhlichen Familienfotos auf. Sie suchte nach einem bestimmten Foto von Jacobus, auf dem er seinen Buschhut trug.
Sie zog es heraus, legte es beiseite und betrachtete es.
Erinnerungen. Es bedurfte beachtlicher Willenskraft, sie beiseitezuschieben. Sah er aus wie der Mann im Fernsehen?
Plötzlich war sie sich sicher. Sie nahm das Foto mit in ihr Arbeitszimmer und rief die Auskunft an, um sich die Nummer der Polizeiwache in Hoedspruit geben zu lasen. Sie sah wieder das Foto an. Zweifel kehrten zurück. Sie wählte die Nummer in Lowveld. Sie wollte nur fragen, ob die ermittelnden Polizisten sicher waren, dass es sich um Jacobus de Villiers handelte und nicht um Jacobus le Roux. Das war alles. Nur damit sie diese Idee aus dem Kopf bekam und Weihnachten genießen konnte, ohne sich nach ihrer verstorbenen Familie zu sehnen – nach ihnen allen, ihrem Vater, ihrer Mutter und nach Jacobus.
Schließlich sprach sie mit einem Inspector. Sie entschuldigte sich. Sie habe keine Informationen für ihn und wolle auch nicht seine Zeit verschwenden. Aber der Mann im Fernsehen sehe aus wie jemand, den sie kannte und der auch Jacobus hieß. Jacobus le Roux. Dann unterbrach sie sich, damit er etwas sagen konnte.
»Nein«, sagte der Inspector mit der übermäßigen Geduld eines Mannes, der eine Menge absurder Anrufe bekommt. »Er heißt de Villiers.«
»Ich weiß, dass er jetzt de Villiers heißt, aber vielleicht hieß er ja mal le Roux.«
Die Geduld des Polizisten schwand. »Wie kann das sein? Er war sein ganzes Leben hier. Alle kennen ihn.«
Emma entschuldigte sich, dankte ihm und verabschiedete sich. Wenigstens wusste sie es jetzt. Sie ging zu Bett mit ungestilltem Verlangen, als hätte sie diesen Verlust nach all den Jahren noch einmal erlitten.
»Und dann, gestern Abend, stand ich draußen mit den Männern, die meine Haustür ersetzten. Der Sergeant, der Polizist, hatte jemand in Hanover Park aufgetrieben, einen Holzarbeiter … Tischler. Ich hörte das Telefon im Arbeitszimmer klingeln. Als ich abnahm, war da ein Rauschen, die Verbindung war nicht besonders gut, aber ich dachte, jemand hätte gesagt: ›Miss Emma?‹ Es klang wie ein Schwarzer. Als ich ›Ja‹ sagte, sagte er etwas, das klang wie ›Jacobus‹. Ich sagte, ich könne ihn nicht verstehen. Dann sagte er: ›Jacobus sagt, Sie dürfen …‹, und ich sagte erneut, ich könne ihn nicht verstehen, aber er wiederholte es nicht noch einmal. Ich fragte: ›Wer ist da?‹, doch die Leitung war tot …«
Einen Augenblick lang hing Emma ihren Gedanken nach, konzentrierte sich auf etwas in der Ferne, dann kehrte sie zu mir zurück, sie schaute mich an und sagte: »Ich bin nicht einmal sicher, dass er das gesagt hat. Es war … Der Anruf war so kurz.« Plötzlich sprach sie schneller, als wollte sie es hinter sich bringen. »Ich bin letzte Nacht hierhergefahren. Als Carel die Geschichte gehört hat …«
Dabei beließ sie es. Sie wollte eine Reaktion von mir, ein Anzeichen, dass ich sie verstand, und die Versicherung, dass ich sie vor all dem beschützen würde. Das war der Augenblick ihrer Reue, wie bei jemandem, der sich ein neues Auto gekauft hat und noch einmal die Anzeige liest. Ich kenne das, den Augenblick, in dem man sich dem ungeschriebenen Teil des Vertrages beugt, der lautet: Ich akzeptiere vorbehaltlos.
Ich nickte mit ernster Miene und sagte: »Ich verstehe. Es tut mir leid …« Ich beschrieb einen Halbkreis mit den Händen, um zu zeigen, dass das alles einschloss, ihren Verlust, ihren Schmerz, ihr Dilemma.
Es folgte ein kurzes Schweigen, das die Vereinbarung besiegelte. Nun würde sie Handeln erwarten, irgendeinen Vorschlag.
»Als Erstes muss ich mich im Haus umsehen.«
»Ah, natürlich«, sagte sie, und wir erhoben uns.
»Aber wir bleiben nur eine Nacht hier, Mr. Lemmer.«
»Oh.«
»Ich muss wissen, was los ist, Mr. Lemmer. Es … Ich finde das alles verstörend. Ich kann nicht bloß herumsitzen und mich fragen, was passiert ist. Ist es in Ordnung, wenn wir reisen? Können Sie mit mir reisen? Denn ich fahre morgen nach Lowveld.«
4
Draußen war es dunkel, aber die Straßenlaternen schienen hell. Ich ging um das Haus herum. Es war keine Festung. Es gab nur im Erdgeschoss Einbruchsicherungen, geschickt genug angebracht, um die Ästhetik nicht zu stören. Der schwächste Punkt waren die Schiebetüren aus Glas, die sich zu einer großen Terrasse öffneten, von der aus man aufs Meer sehen konnte. Toskanische Säulen, Ecken und Erker boten vier oder fünf Möglichkeiten, die Fenster im ersten und zweiten Stock zu erreichen.
Drinnen gab es die übliche Alarmanlage mit Bewegungsmeldern und einer Verbindung zu einer privaten Wachfirma in der Gegend. Ihr blau-weißes Schild prangte neben der Garage. Es waren Feiertags-Sicherheitsmaßnahmen, hoffnungsfrohe Abwehrmittel – so blieben die Versicherungsprämien niedriger.
Das Haus war etwa drei Jahre alt. Ich fragte mich, was hier vorher gestanden hatte und was das Grundstück und der Bau gekostet hatten.
Lemmers Gebot reicher Afrikaaner: Wenn ein reicher Afrikaaner angeben kann, tut er es.
Das Erste, was ein reicher Afrikaaner kauft, sind größere Titten für seine Frau. Das Zweite ist eine teure, dunkle Sonnenbrille (der Markenname muss deutlich zu sehen sein), die er nur abnimmt, wenn es vollkommen dunkel ist. Ihre Aufgabe besteht darin, eine erste Barriere zwischen ihm und den Armen zu errichten. »Ich kann dich sehen, aber du kannst mich nicht mehr sehen.« Das Dritte, was ein reicher Afrikaaner kauft, ist ein zweistöckiges Haus im toskanischen Stil. (Und das Vierte ist eine Nummer für sein Auto mit seinem Namen oder der Nummer seines Rugby-Trikots). Wie viel länger wird es noch dauern, bevor wir das uns innewohnende Gefühl der Unterlegenheit hinter uns lassen? Warum können wir nicht bescheidener auftreten, wenn der Gott des Geldes uns zulächelt? Wie unsere wohlsituierten, Englisch sprechenden Landsleute, deren Hochnäsigkeit mich schwer beleidigt, die aber wenigstens ihren Reichtum mit Stil ertragen.
Ich stand im Dunkeln und spekulierte über den Hausbesitzer Carel. Offenbar war er bereits ein Kunde Jeanettes. Der reiche Afrikaaner braucht aber keine Bodyguards, sondern bloß eine Alarmanlage, einen Notruf und eine Wachmannschaft in der Nachbarschaft. Welchen Bedarf also hatte Carel für Personenschutz?
Die Antwort erhielt ich später beim Abendessen.
Als ich den Raum betrat, saßen die meisten bereits am großen Tisch. Emma stellte uns vor. Sie war offenbar die Einzige, die nicht zur Familie gehörte.
»Carel van Zyl«, sagte der Patriarch am Kopf des Tisches. Sein Händedruck war unnötig fest, als müsse er etwas beweisen. Er war ein großgewachsener Mann in den Fünfzigern, mit fleischigen Lippen und breiten Schultern, aber das gute Leben hatte bereits Spuren auf seinen Wangen und unterhalb der Rippen hinterlassen. Außerdem gab es drei jüngere Paare – Carels Kinder und ihre Ehepartner. Einer von ihnen war Henk, der mich an der Tür in Empfang genommen hatte. Er saß neben seiner Frau, einer hübschen Blondine mit einem Säugling auf dem Schoß. Es gab vier weitere Enkel, der älteste war ein Junge von acht oder neun. Ich saß neben ihm.
Carels Frau war groß und unglaublich attraktiv. »Sie können gern ihr Jackett ausziehen, Mr. Lemmer«, sagte sie mit übertriebener Wärme, als sie eine Platte mit dampfendem Truthahn auf den Tisch stellte.
»Mamma …«, sagte Carel mahnend.
»Was?«, fragte sie.
Er formte eine Pistole mit der Hand und schob den Finger, der den Lauf darstellte, in sein Hemd hinein. Er wollte ihr andeuten, dass ich eine Waffe trüge und sie nicht würde zeigen wollen.
»Oh! Entschuldigung«, sagte sie, als wäre ihr ein gesellschaftliches Missgeschick unterlaufen.
»Kommt, sagen wir Dank«, erklärte Carel voller Ernsthaftigkeit. Alle hielten Händchen und neigten die Köpfe. Die Hand des Jungen fühlte sich in meiner klein und schweißig an, die seines Vaters auf der anderen Seite war kühl und weich. Carel betete so voller Eloquenz, als wäre Gott auch nur einer seiner Kollegen in der Geschäftsführung.
»Amen«, hallte es dann um den Tisch. Beilagen wurden angeboten, und die Kinder ermuntert, Gemüse zu nehmen. Es folgten kurze Pausen: das heimliche Bewusstsein des Fremden in ihrer Mitte und die unmerkliche Unsicherheit über die korrekte Form der Interaktion. Ich war ein Gast, aber auch ein Angestellter, ein Eindringling mit einem interessanten Job.
Der Junge betrachtete mich mit offener Neugier. »Haben Sie echt eine Kanone?«, fragte er.
Seine Mutter wollte ihn zum Schweigen bringen und sagte: »Kümmern Sie sich nicht um ihn.«
Ich legte mir Truthahn auf den Teller. Die Gastgeberin sagte: »Es sind nur Reste.« Carel sagte: »Es schmeckt ausgezeichnet, Ma.«
Irgendwer kam aufs Wetter zu sprechen, und die Konversation begann zu fließen – Pläne für den nächsten Tag, wie man die Kinder beschäftigen könne, wer damit dran sei, sich um das Braai zu kümmern. Emma nahm nicht an dem Gespräch teil. Sie konzentrierte sich auf ihren Teller, aß aber wenig.
Mir fiel die unnatürliche Herzlichkeit zwischen ihnen auf, obwohl ich da war. Hier gab es keine Konflikte, keine brüderliche Rivalität und auch nicht das übliche Hin und Her unter Paaren. Sie waren eher wie eine dieser idealen Familien, die man aus dem amerikanischen Fernsehprogramm kennt. Es lag daran, wie Carel das letzte Wort hatte, die entscheidende Stimme. Ihre Unterwerfung war kaum zu bemerken, sie war verwoben mit einem fröhlichen, geübten Muster der Interaktion, aber sie war da, sie neigten alle das Haupt vor dem gütigen Despoten – dem mit der Geldbörse und dem Vermögen.
Wie passte Emma in all das hinein?
Als die Teller leer waren und ein Gespräch über das Golfspiel am nächsten Tag ausgeklungen war, entschied Carel, dass es Zeit war, sich an mich zu wenden. Er wartete auf einen ruhigen Augenblick und bedachte mich dann mit einem vertraulichen Lächeln.
»Jetzt wissen wir also, wie die Geister aussehen, Mr. Lemmer.«
Für einen Moment hatte ich keine Ahnung, wovon er sprach. Dann begriff ich. Er hatte schon vorher mit Body Armour zu tun gehabt, aber etwas falsch verstanden.
Jeanette Louw ist eine Lesbe in den Fünfzigern, mit wallendem, blondiertem Haar, eine Kettenraucherin – Gauloise war ihre Marke – mit einer Leidenschaft dafür, kürzlich geschiedene, zutiefst verletzte heterosexuelle Frauen zu verführen. Aber dahinter verbargen sich ein scharfer Intellekt und ein ausgezeichneter Geschäftssinn.
Sie war die legendäre Regimental Sergeant-Major des Women’s Army College in George gewesen, bevor sie sich vor sieben Jahren hatte abfinden lassen. Nach mehreren Monaten Marktrecherche hatte sie ihre eigene Firma im sechzehnten Stock eines luxuriösen Bürogebäudes an der Cape Beachfront eröffnet. Auf der gläsernen Doppeltür, durch die man Jolene Freylinck sehen konnte, die manikürte Empfangsdame, stand in fetten Buchstaben BODY ARMOUR und darunter in schlanken Lettern Personenschutz.
Anfangs waren ihre Mandanten ausländische Geschäftsleute, die höherrangigen Mitarbeiter internationaler Firmen, die herkamen, um herauszufinden, wie man in Afrika auf die Schnelle ein wenig Geld verdienen konnte. Ihre diplomatischen Vertretungen hatten ihnen in vertraulichen Berichten zugeflüstert, das Land sei stabil genug für Investitionen, aber die Sicherheit auf der Straße entspreche nicht ganz dem westlichen Standard. Jeanette richtete ihr Marketing auf die Diplomaten aus, die Attachés und Konsuln, die Botschaftsangestellten und -mitarbeiter. Wollten deren wichtige Besucher lieber die lange Liste persönlicher Gefahren vermeiden – Raubüberfälle, Autoentführungen, Angriffe, Vergewaltigungen, Entführungen, Einbrüche? Body Armour war die Antwort. Ihre ersten paar Klienten kamen sicher zurück nach Hause, und der Kundenkreis wuchs. Mit der Zeit engagierte das gesamte Spektrum von Osten bis Westen ihre Leute: Japaner, Koreaner, Chinesen, Deutsche, Franzosen, Briten und Amerikaner.
Dann begannen die Ausländer, am Kap Filme zu drehen, und die Popstars dieser Welt kamen her, um den Buren Konzerttickets zu verkaufen. Die Kundenliste bekam eine neue Dimension. Schnappschüsse von Jeanette mit Colin Farrell, Oprah, Robbie Williams, Nicole Kidman und Samuel L. Jackson hingen an ihren Wänden. Sie saß hinter ihrem Schreibtisch und erzählte von den großen Fischen, die sie nicht ins Netz gekriegt hatte. Will Smith mit seiner riesigen Entourage inklusive seiner eigenen US-Bodyguards, die ihn umschwirrten wie afrikanische Lobsänger. Sean Connery hatte sich ihre ewige Bewunderung verdient, indem er ihren Dienst ablehnte mit den Worten: »Sehe ich etwa aus wie ein verdammter Schlappschwanz?«
Jeanettes Portfolio ausgewählter freiberuflicher Bodyguards gliederte sich wie bei allen derartigen Firmen in der ganzen Welt in zwei Kategorien. Zunächst waren da die abschreckenden Riesen – höchst sichtbar, muskelbepackt, Kolosse mit dicken Hälsen und randvoll mit Steroiden –, die Berühmtheiten begleiten und den Pöbel in Schach halten, indem sie bedrohlich aussehen. Ihre einzige Qualifikation waren Bizeps und Brustumfang sowie die Fähigkeit, finster vor sich hin zu starren.
Der andere Teil von Jeanettes Diensten bestand aus Jobs, die schwieriger und unauffälliger zu erledigen waren und die vor allem aus eingebildeten Bedrohungen bestanden. Die Mitarbeiter, die das erledigten, mussten dem Ego des Kunden mit einem Curriculum Vitae schmeicheln, das sowohl eine anerkannte Ausbildung als auch große Erfahrung verriet. Sie bewahrten die Illusion einer Gefahr, indem sie sich am Rande hielten, beobachteten und evaluierten. Manchmal arbeiteten sie in Teams von zwei, vier oder sechs, mit kleinen verborgenen Ohr-Mikrofonen. Manchmal arbeiteten sie allein, je nachdem, wie groß die zu beschützende Gruppe war, um wie viel Geld es ging und worin die Bedrohung bestand. Sie mussten sich in die Umgebung einfügen können, durch die der Klient sich bewegte, sie tauchten nur im richtigen Augenblick auf, um höfliche Vorschläge zu flüstern. Der Kunde erwartete das, weil es im Film und Fernsehen immer so aussah. (Ich hatte sogar einmal eine skandinavische Geschäftsfrau gehabt, die darauf bestand, dass ich ein Ohr-Mikrofon mitsamt Kabel trug, das in meinem Kragen verschwand, obwohl ich allein arbeitete und niemand hatte, mit dem ich kommunizieren konnte).
Konsequenterweise fragte Jeanette Louw mögliche Klienten oder deren Agenten: »Brauchen Sie einen Gorilla oder einen Unsichtbaren?« In der Welt der Reichen und Berühmten war das die gängige Terminologie.
Aber Carel Alleswisser hatte es nicht wirklich verstanden. Sein Fehler verriet mir etwas – sein Wissen war nur fragmentarisch.
»Wenn man einen Bodyguard engagiert, fragt Jeanette einen, ob man einen Geist oder einen Gorilla will«, erklärte er den anderen am Tisch. »Wir haben bisher nur Gorillas für die Stars benutzt, die mit uns Werbespots drehen.«
Ich wusste nicht, was ich dazu sagen sollte. Die Situation war mir fremd. Der Angestellte sitzt normalerweise nicht am selben Tisch wie der Auftraggeber – das war gesellschaftlich inakzeptabel. Dazu kam mein mangelnder Enthusiasmus für Smalltalk. Aber Carel erwartete auch gar keine Antwort.
»Die Gorillas sind die Riesenkerle«, sagte er. »Sie sehen aus wie Nachtclub-Türsteher. Aber die Geister sind die echten Profis. Sie bewachen Präsidenten und Minister.«
Sie starrten mich an – der ganze Tisch.
»Ist das auch Ihr Hintergrund, Mr. Lemmer?«, fragte Carel. Es war eine Einladung, aber ich lehnte sie mit einem einfachen Nicken ab, schlicht und ohne Enthusiasmus.
»Siehst du, Emma. Du bist in guten Händen«, sagte Carel.
In guten Händen. Ich vermutete, dass Carel keine eigene Erfahrung mit dem Engagement von Body Armour hatte. So etwas überließ er Untergebenen. Wenn er sich selbst darum gekümmert hätte, wäre ihm klar gewesen, dass Jeanette eine Preisliste hatte, auf der ich nicht besonders weit oben stand. Mein Platz war im Schnäppchenkeller, denn ich mochte kein Teamwork, ich hatte eine schwierige Vergangenheit, daher konnte man mit mir nicht gut PR machen.
Wusste Emma das? Sicher nicht. Jeanette war zu professionell. Sie hatte gefragt: »Was möchten Sie ausgeben?«, und Emma hatte gesagt, sie habe keine Ahnung, wie viel sie ausgeben müsse. »Alles zwischen zehntausend Rand pro Tag für vier Leute und siebenhundertfünfzig Rand für einen einzelnen Mitarbeiter.« Jeanette hatte ihr die Möglichkeiten erklärt, ohne zu erwähnen, dass sie zwanzig Prozent kassierte, plus eine Bearbeitungsgebühr, Arbeitslosenversicherung, Einkommensteuer und Bankgebühren.
Was verdiente eine Marken-Beraterin? Wie viel davon waren siebenhundertfünfzig Rand am Tag, fünftausendzweihundertfünfzig Rand pro Woche, einundzwanzigtausend Rand im Monat? Kein Kleingeld, besonders nicht für bloß eingebildete Gefahren. Also waren sie vielleicht doch nicht ganz unwirklich.
»Ich bin sicher, das bin ich«, sagte Emma mit einem abwesenden Lächeln, als seien ihre Gedanken anderswo.
»Wir haben noch Eiscreme«, rief Carels Frau hoffnungsvoll.
Er bat mich in sein Spielzimmer. Er nannte es sein Herrenzimmer.
Er »bat mich« im weitesten Sinne. »Sollen wir mal reden?«, waren die Worte, die Carel wählte, ein grauer Bereich zwischen Einladung und Anweisung. Er ging vor. Ein ausgestopfter Kudu-Kopf starrte durch das Zimmer. Es gab einen Billardtisch und eine Bar, Flaschen auf einem Regal und einen kleinen Zigarren-Humidor. Die Bilder an der Wand zeigten Carel-und-Gewehr mit toten Tieren.
»Etwas zu trinken?«, fragte er und ging hinter die Bar.
»Nein, danke«, sagte ich und lehnte mich gegen den Billardtisch.
Er goss sich selbst etwas ein, zwei Finger hoch einer braunen, unverdünnten Flüssigkeit. Er trank aus dem Glas und öffnete den Humidor. »Havanna?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Sind Sie sicher? Die sind erstklassig«, sagte er selbstzufrieden. »Die lassen sie vierundzwanzig Monate reifen, wie Wein.«
»Ich rauche nicht, danke.«
Er suchte eine Zigarre für sich heraus und streichelte mit den Fingern über den dicken Zylinder. Er kniff das Ende mit einem großen Instrument ab und steckte sich die Zigarre in den Mund. »Die Amateure kappen sie mit diesen billigen Drecksdingern, die sie hier am Ende platt quetschen.« Er hielt sein Gerät hoch, damit ich es inspizieren konnte. »Das hier nennt man eine .44 Magnum. Macht ein absolut perfektes Loch.«
Er griff nach einer Streichholzschachtel. »Und dann gibt es die Blödmänner, die Zigarren anlecken, bevor sie sie anzünden. Das kommt noch aus der Zeit, in der man Zigarren aus der Gegend im Eckcafé kaufte. Wenn die Feuchtigkeit ordnungsgemäß gesteuert wurde, muss man sie nicht anlecken.«
Er riss ein Streichholz an und erlaubte es der Flamme aufzulodern. Dann hielt er sie an die Zigarre. Er inhalierte in kurzen, schnellen Zügen, während er die Zigarre zwischen den Fingern drehte. Weiße Rauchwölkchen stiegen um ihn herum auf, und ein reichhaltiges Aroma erfüllte den Raum. Er schüttelte das Streichholz aus. »Man sagt, die beste Möglichkeit, eine Zigarre anzuzünden, sei ein spanischer Zedernspan. Man nimmt ein langes dünnes Stückchen Zeder, setzt es in Brand, und damit entzündet man die Zigarre. Das sei eine reine, saubere Flamme, die den Geschmack der Zigarre nicht beeinflusst. Aber woher sollen wir spanische Zeder bekommen, frage ich Sie?« Er lächelte mich an, als hätten wir beide dasselbe Problem.
Er nahm einen langen Zug. »Eine Havanna, nichts ist besser. Die amerikanischen sind auch nicht schlecht, angenehm und leicht, die dominikanischen irgendwo dazwischen, Honduras ist zu wild, aber nichts kommt an die Ernten des alten Fidel heran.«
Ich fragte mich einen Moment, wie lange er diesen Monolog vor gelangweiltem Publikum aufrechterhalten konnte, aber dann fiel mir wieder ein, dass er ein reicher Afrikaaner war. Die Antwort lautete: ewig.
Er zog einen Aschenbecher heran. »Manche Blödmänner glauben, man sollte die Asche einer Zigarre nicht abklopfen. Ein reiner Mythos. Unfug«, keckerte er. »Diese Leute rauchen billige Zigarren und behaupten dann, der bittere Geschmack entstehe, weil sie die Asche abklopfen.«
Carel setzte sich auf einen Barhocker, die Zigarre in einer Hand, den Drink in der anderen.
»Es wird viel Blödsinn in der Welt geredet, mein Freund, unglaublich viel Blödsinn.«
Was wollte er?
Wieder ein Zug von der Zigarre. »Aber ich sage Ihnen etwas, die kleine Emma macht keinen Blödsinn – sie nicht. Wenn sie sagt, dass Leute ihr schaden wollen, dann glaube ich ihr. Haben Sie verstanden?«
Ich war nicht in der Stimmung für dieses Gespräch. Ich antwortete nicht. Ich wusste, dass ihm das nicht gefiel.
»Wollen Sie sich nicht setzen?«
»Ich habe heute schon zu viel gesessen.«
»Sie ist wie eine Tochter in diesem Haus, mein Freund, wie eines meiner Kinder. Deswegen ist sie in dieser Sache zu mir gekommen. Deswegen sind Sie jetzt hier. Sie müssen verstehen, Emma hat im Leben viel durchgemacht. Stille Wasser …«
Ich versuchte meine Gereiztheit zu zügeln, indem ich darüber nachdachte, wie faszinierend ein Mann wie Carel van Zyl war.
Selfmademen haben alle dieselbe Persönlichkeit – getrieben, klug, arbeitsam und dominant. Wenn ihr Reichtum wächst und die Leute beginnen, sich ihrer Macht und ihrem Einfluss zu beugen, macht jeder Reiche denselben Fehler. Sie glauben, der Respekt gelte ihnen persönlich. Das freut ihr Selbstbewusstsein und lässt ihre Persönlichkeit angenehmer werden. Aber es bleibt ein dünnes Furnier; der ursprüngliche Dynamo ist hinter der Selbsttäuschung immer noch an der Arbeit.
Er war daran gewöhnt, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Es gefiel ihm gar nicht, einen Platz am Rande der Ereignisse einnehmen zu müssen. Er wollte mich wissen lassen, dass er verantwortlich war für mein Engagement; er war die Vaterfigur, die Emmas Interessen unterstützte und daher letztlich alles unter Kontrolle hatte. Er war derjenige, der mich ins Spiel gebracht hatte. Er hatte das Recht, sich einzumischen und teilzuhaben. Vor allem aber wusste er Bescheid. Und das würde er mir jetzt zeigen.
»Sie hat bei mir angefangen, als sie mit der Uni fertig war. Die meisten Männer hätten nur ein hübsches, kleines Ding gesehen, aber ich wusste, sie hatte etwas, mein Freund.« Er betonte diesen Satz mit der Zigarre.
»Viele von ihnen haben für mich gearbeitet – als Kundenbetreuerinnen, und sie sehen bloß den Glamour, die langen Mittagessen und die üppigen Gehaltsschecks. Aber Emma nicht. Sie wollte lernen, sie wollte etwas leisten. Man würde nie darauf kommen, dass sie Geld hat; sie hatte den Antrieb von jemand aus einem armen Haushalt. Glauben Sie mir, mein Freund, ich erkenne das. Auf alle Fälle war sie schon drei Jahre bei mir, als die Sache mit ihren Eltern geschah. Autounfall, sofort tot, beide. Sie saß in meinem Büro, mein Freund, das arme kleine Ding, am Boden zerstört – zerstört, weil ihr niemand mehr blieb. Da hat sie mir von ihrem Bruder erzählt. Können Sie sich das vorstellen? So ein Verlust. Schreckliche Zeiten. Was soll man machen?«
Er griff nach der Flasche und schraubte sie auf.
»Aber sie ist stark, sehr stark.«
Er zog das Glas näher.
»Ich habe erst später erfahren, was sie geerbt hat. Und ich sage Ihnen jetzt eines …« Er schenkte sich zwei Finger breit ein. »Es geht nur um das Geld.«
Ein dramatisches Schweigen, Verschluss wieder auf die Flasche, ein Schlückchen aus dem Glas, ein kurzer Zug von der Zigarre. »Dort draußen sind eine Menge Geier, mein Freund. Je größer das Vermögen, desto schneller können sie einen riechen. Ich sage Ihnen, ich weiß das.«
Er vollführte eine Geste mit dem Glas: »Da draußen ist irgendwer, der etwas vorhat. Jemand, der seine Hausaufgaben gemacht hat, der ihre Geschichte kennt und sie benutzen will, um an ihr Geld heranzukommen. Ich weiß nicht wie, aber es geht um das Geld.«
Er hob das Glas wieder an die Lippen und stellte es dann mit einer gewissen Endgültigkeit auf den Tresen. »Sie müssen nur den Plan entschlüsseln. Dann haben Sie Ihren Mann.«
In diesem Augenblick hätte ich ihm Lemmers erstes Gebot entgegenhalten können. Ich tat es aber nicht.
»Nein«, sagte ich.
An dieses Wort war er nicht gewöhnt, wie seine Reaktion bewies.
»Ich bin ein Bodyguard – kein Detektiv«, sagte ich, bevor ich ging.
Mein Zimmer lag neben Emmas. Ihre Tür war geschlossen.
Ich duschte und legte mir Sachen für den nächsten Tag heraus. Ich setzte mich auf den Rand des Bettes und schickte Jeanette Louw eine SMS: GIBT ES AKTE BEI SAPS GARDENS WG ANGRIFF/EINBRUCH BEI EINER E. LE ROUX GESTERN?
Dann öffnete ich die Schlafzimmertür, damit ich hören konnte, was draußen vor sich ging, und schaltete das Licht aus.
5
Zum Flughafen folgte uns niemand.
Wir fuhren in Emmas Renault Mégane, einem grünen Cabriolet. Mein Isuzu Pick-up blieb in Carels Garage. »Wir haben mehr als genug Platz dafür, Emma«, hatte er am Morgen gesagt und mich völlig ignoriert.
»Fahren Sie, Mr. Lemmer?« fragte sie.
»Wenn Sie das in Ordnung finden, Miss le Roux.« Es war unser letzter förmlicher Wortwechsel. Während ich mich zwischen Fisherhaven und der N2 an die Automatik und die überraschende Kraft des Zwei-Liter-Motors gewöhnte, sagte sie: »Bitte nennen Sie mich Emma.«
Das ist immer ein unangenehmer Augenblick, denn die Leute erwarten, dass ich gleichziehe, aber ich sage nie freiwillig meinen Vornamen. »Ich bin Lemmer.«
Anfangs schaute ich mit größter Sorgfalt in den Rückspiegel, denn dort würde man die Amateure finden – sichtbar und wild. Aber da war nichts. Ich variierte das Tempo zwischen neunzig und hundertzwanzig Stundenkilometern. Beim Anstieg zum Houhoek-Pass hatte ich einen weißen japanischen PKW vor uns im Verdacht. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, die ich gewählt hatte, behielt er dasselbe Tempo bei wie wir, und mein Misstrauen wuchs, als wir auf der anderen Seite hinabfuhren und ich den Renault bis hundertvierzig trieb.
Ein paar Kilometer vor Grabouw entschied ich mich, ganz sicherzugehen. Kurz vor der T-Kreuzung schaltete ich den Blinker an und verlangsamte, als wollte ich abbiegen, wobei ich den weißen Wagen beobachtete. Keine Reaktion. Er fuhr einfach weiter. Ich schaltete den Blinker aus und beschleunigte.
»Wissen Sie den Weg?«, erkundigte Emma sich höflich.
»Ja, ich weiß den Weg«, entgegnete ich.
Sie nickte zufrieden, dann kramte sie in ihrer Handtasche herum, bis sie ihre Sonnenbrille gefunden hatte.
Auf dem internationalen Flughafen Kapstadt herrschte Chaos – nicht genug Parkplätze wegen der Umbauten, zu viele Leute; ein Bienenstock aus besorgten Weihnachtsreisenden unterwegs irgendwohin, die ihre Reise so schnell wie möglich hinter sich bringen wollten. Es war unmöglich, Beschatter auszumachen.
Wir gaben Emmas großen Koffer und meine schwarze Sporttasche auf.
»Was ist mit Ihrer Waffe?«, fragte sie auf dem Weg zum Abflug.
»Ich habe keine.«
Sie runzelte die Stirn.
»Carel ging bloß davon aus«, sagte ich.
»Oh.« Unzufrieden. Sie wollte sicher sein, dass ihr Beschützer angemessen ausgestattet war. Ich schwieg, bis wir die Gepäckkontrolle hinter uns hatten, dann warteten wir am Nescafé-Coffeeshop darauf, dass ein Tisch frei wurde.
»Ich dachte, Sie seien bewaffnet«, sagte sie mit leichter Besorgnis.
»Waffen machen alles komplizierter. Vor allem Reisen.« Es würde nicht helfen, ihr zu erklären, dass ich wegen meiner Bewährungsauflagen keine Waffe tragen durfte.
Ein Tisch wurde frei, und wir setzten uns. »Kaffee?«, fragte ich.
»Bitte. Cappuccino, wenn möglich. Kein Zucker.«
Ich stellte mich an, aber so, dass ich sie sehen konnte. Sie hielt ihre Bordkarte in der Hand und starrte sie an. Was dachte sie? Überlegte sie, welche Art von Schutz sie erwartete und ob Waffen dafür nötig waren? Oder was vor uns lag?
Da sah ich ihn. Er konzentrierte sich sofort auf Emma. Schlängelte sich zwischen den Tischen hindurch. Groß, weiß, sorgfältig gestutzter Bart, senffarbenes T-Shirt, gebügelte Jeans, Sportsakko. Anfang vierzig. Ich setzte mich in Bewegung, aber er war schon zu nah, um ihn zu bremsen. Er streckte eine Hand nach ihrer Schulter aus, und ich trat dazwischen. Ich packte sein Handgelenk und drehte seinen Arm nach hinten, drückte mein Gewicht gegen seinen Rücken, presste seines gegen die Säule neben Emma, aber ohne Gewalt. Ich wollte niemanden auf uns aufmerksam machen.
Der Mann gab ein überraschtes Geräusch von sich. Er sah mich an. »Hey«, sagte er.
Emma schaute auf. Sie war verwirrt, ihr Körper angespannt vor Angst. Aber sie erkannte den Bartträger. »Stoffel?«, sagt sie.
Stoffel sah sie an, dann mich. Er versuchte, seinen Arm zu befreien. Er war stark, aber unkoordiniert. Ein Amateur. Ich blieb geschmeidig, gab ihm ein wenig Raum.
»Kennen Sie ihn?«, fragte ich Emma.
»Ja, das ist Stoffel.«
Ich löste meinen Griff, und er entriss mir seinen Arm.
»Wer sind Sie?«, fragte er.
Ich blieb dicht an ihm dran, drohte ihm mit meinem Blick. Das gefiel ihm nicht. Emma stand auf und hob entschuldigend die Hand in die Luft. »Das ist nur ein Missverständnis, Stoffel. Schön, dich wiederzusehen. Bitte setz dich.«
Stoffel war empört. »Wer ist dieser Typ?«
Emma nahm seine Hand. »Komm und sag mir hallo. Kein Problem.« Sie zog ihn weg von mir. Er ließ es zu. Sie bot ihm ihre Wange dar. Er küsste sie schnell, als erwartete er, dass ich etwas Unberechenbares täte.
»Kaffee?«, fragte ich in einem freundlichen Ton.
Er antwortete nicht gleich. Er setzte sich, langsam und ernsthaft, sodass er seine Würde wiederherstellen konnte. »Ja, bitte«, sagte er. »Milch und Zucker.«
Auf Emmas Gesicht lag ein winziges Lächeln, die Angst war vergessen. Sie warf mir einen flüchtigen Blick zu, als teilten wir ein Geheimnis.
Wir flogen mit einem Jet der SA Express Canadair mit fünfzig Plätzen nach Nelspruit. Ich saß neben Emma am Gang, sie hatte am Fenster Platz genommen. Das Flugzeug war fast voll. Es gab mindestens zehn Passagiere, die sich aufgrund ihres Alters und ihres offensichtlichen Interesses zu Emmas eingebildeten Gegnern zählen ließen. Aber ich hatte meine Zweifel. Jemand zur Beschattung in ein Flugzeug zu stecken ist overkill, denn man weiß ja, wo es abfliegt und wo es landet.
Bevor wir starteten, sagte sie: »Stoffel ist Anwalt.« Ich hatte mich nicht zum Kaffee zu ihnen gesetzt. Es gab nur zwei Stühle am Tisch, und ich stand auch lieber, um besser sehen zu können und noch ein letztes Mal meine Beine zu strecken. Ich ging davon aus, dass Stoffel wissen wollte, wer ich war, und sie der Frage ausgewichen war.
»Er ist ein guter Kerl«, sagte sie und setzte hinzu: »Wir sind mal ausgegangen, vor ein paar Jahren …« Mit Wehmut, die auf eine gemeinsame Geschichte hinwies. Dann zog sie das Flugmagazin aus der Tasche und klappte es auf.
Stoffel, der Ex.
Ich hatte etwas anderes vermutet – ich dachte, er sei ein Geschäftsfreund oder der Ehemann einer Freundin. Er war mir nicht erschienen wie die Art Mann, mit der sie sich abgab. Und ihr Umgang miteinander war so … freundlich; aber ich konnte es vor mir sehen: Sie trafen sich an einem der gesellschaftlichen oder kulturellen Wasserlöcher, wo sich die Reichen nach Sonnenuntergang zusammenfinden. Er war wortgewandt und intelligent, mit erkennbarer Selbstironie und einem Bündel Gerichts-Insidergeschichten, die er humorvoll vortragen konnte. Die Aufmerksamkeit, die er Emma zuwandte, wäre unaufdringlich gewesen, er hatte eine Art mit Frauen umzugehen, ein Rezept, das er in zwanzig Junggesellenjahren perfektioniert hatte. Sie würde das angenehm finden. Wenn er vier oder fünf Tage später ihre Nummer von einem gemeinsamen Bekannten bekommen hatte, würde sie sich erinnern, wer er gewesen war. Sie würde seine Einladung in ein Top-Ten-Restaurant annehmen – oder zur Kunstausstellung, zum Symphoniekonzert. Sie würde von Anfang an wissen, dass er nicht wirklich ihr Typ war, aber sie würde der Sache trotzdem eine Chance geben. Bis Mitte dreißig hätte sie genug gelernt über Menschen im Prinzip und Männer im Besonderen, um zu wissen, dass ihr Lieblingstyp Nachteile mit sich brachte. Eine Frau wie Emma würde angezogen werden von Männern, die auf Men’s Health-Covern zu sehen waren – die fein ziselierten griechischen Götter, einen halben Meter größer als sie. Damit sie ein schönes Paar abgaben.
Ihr Typ waren die Heterosexuellen mit dunklem, lockigem Haar, hellen Augen und einem perfekten Lächeln, die sportlichen, fitten Outdoor-Typen, die mit ihrem Staffordshire Terrier am Strand joggten und ihren alten Land Rover Defender aus zweiter Hand vor den Hotspots in Camps Bay parkten, den Spaten deutlich sichtbar in der Halterung neben dem Reservekanister. Aber nach vier oder fünf Beziehungen mit Clowns dieser Art würde sie auch wissen, dass das seelenvolle Schweigen und die lakonischen Auf-Teufel-komm-raus-Plaudereien vor allem Tarnung waren für Selbstverliebtheit und durchschnittlichen Intellekt. Und daher gab sie den Stoffels dieser Welt eine Chance, und nach einem Monat durchaus amüsanter, aber wenig aufregender Dates würde sie ihm freundlich sagen, dass es besser wäre, wenn sie bloß Freunde blieben (»Du bist ein guter Kerl«), während sie sich insgeheim fragte, warum diese Art Mann ihr Herz nicht in Flammen setzen konnte.
Wir hoben ab in den Südostwind. Emma steckte das Magazin weg und starrte zum Fenster hinaus auf False Bay, wo weiße Wellen gen Küste rauschten. Dann wandte sie sich mir zu.
»Wo kommen Sie her, Lemmer?« Mit ehrlichem Interesse.
Ein Bodyguard sitzt im Flugzeug nicht bei seinem Klienten. Der Bodyguard ist, selbst wenn er allein arbeitet, Teil einer größeren Entourage. Normalerweise reist er in einem anderen Fahrzeug, immer aber in einer anderen Reihe, um seinen Pflichten anonym und unpersönlich nachzugehen. Kein enger Kontakt, keine Gespräche, keine Fragen über die Vergangenheit. Es ist ein notwendiger Abstand, ein professioneller Puffer, erzwungen durch Lemmers erstes Gebot.
»Vom Kap.«
Das reichte nicht, um sie zufriedenzustellen. »Welche Gegend?«
»Ich bin in Seapoint aufgewachsen.«
»Das muss wundervoll gewesen sein.« Was für eine interessante Annahme.
»Sie haben gar keinen Akzent mehr.«
»Das passiert nach zwanzig Jahren im Dienste der Öffentlichkeit.«
»Brüder oder Schwestern?«
»Nein.«
Irgendein Teil von mir genoss die Aufmerksamkeit, das Interesse. Ich kam mir ebenbürtig vor.
»Und Ihre Eltern?«
Ich schüttelte bloß den Kopf und hoffte, das würde reichen. Es war Zeit, das Thema zu wechseln.
»Was ist mit Ihnen? Wo sind Sie aufgewachsen?«
»Johannesburg. Linden, genaugenommen. Dann ging ich zur Stellenbosch University. Das war so eine … romantische Angelegenheit, im Vergleich zu Pretoria und Johannesburg.« Sie hielt einen Moment inne, ihre Gedanken wanderten. »Danach blieb ich am Kap. Das ist so anders als im Highveld. So viel … netter. Ich weiß nicht, ich habe mich einfach zu Hause gefühlt – als gehörte ich hierher. Mein Dad hat mich immer verspottet … Er hat gesagt, ich lebe in Kanaan, während sie im Exil in Ägypten seien.«
Ich wusste nicht, was ich danach noch fragen sollte. Also kam sie wieder dran. »Jeanette Louw hat gesagt, Sie leben auf dem Land?«
Meine Arbeitgeberin hatte wohl erklären müssen, warum ich sechs Stunden brauchte, um aufzutauchen. Ich nickte. »Loxton.«
Sie reagierte vorhersehbar. »Loxton …« Als sollte sie wissen, wo das war.
»In Nordkap. Obere Karoo, zwischen Beaufort West und Carnarvon.«
Sie hatte so eine Art, einen anzuschauen, eine ernsthafte, offene Neugier. Ich wusste, welche Frage ihr auf der Zunge lag. »Warum will jemand dort leben?« Aber sie fragte nicht. Sie war zu politisch korrekt, sie war sich der Konventionen zu sehr bewusst.
»Ich hätte nichts gegen ein Haus auf dem Land, irgendwann«, sagte sie, als beneidete sie mich. Sie wartete auf meine Reaktion, dass ich ihr meine Gründe erzählte, die Vor- und Nachteile. Es war ein dezenter Umweg zur Frage »Warum wohnen Sie dort?«
Der Steward rettete mich, als er blaue Kartons mit Essen austeilte – ein Sandwich, ein Päckchen Salzgebäck, Fruchtsaft. Ich mied das Brot. Emma trank nur den Saft. Während sie den Strohhalm mit ihren schlanken Kinderfingern durch das kleine folienversiegelte Loch bohrte, sagte sie: »Sie haben einen sehr interessanten Job.«
»Nur wenn ich die Stoffels dieser Welt gegen eine Säule drücken kann.«
Sie lachte. Da war auch noch ein Hauch von etwas anderem, ein wenig Überraschung, als hätte sie etwas gesehen, was dem Bild, das sie von mir gehabt hatte, zuwiderlief. Dieser Durchschnittsmann, der bisher eine Enttäuschung im Gespräch gewesen war, hatte Sinn für Humor.
»Haben Sie irgendwelche Berühmtheiten bewacht?«
Das wollen alle wissen. Einigen meiner Kollegen hat die Zusammenarbeit mit Stars tatsächlich wertvolle Aufmerksamkeit verschafft. Sie antworteten: »Ja« – und legten dann die Namen von Filmstars und Musikern wie Trumpfkarten auf den Tisch. Dann stürzte sich der Fragesteller auf einen Namen und fragte: »Ist er/sie nett?« Nicht: »Ist sie ein guter Mensch?« oder »Ist er ein ehrlicher Kerl?«, sondern nett – dieses allumfassende, bedeutungslose, faule Wort, das Südafrikaner so sehr lieben. Was sie wirklich wissen wollen, ist jedoch, ob Ruhm und Geld das Thema des Gespräches in ein selbstzentriertes Monster verwandelt haben, was sie dann als Teil der Informationen weitererzählen konnten, die letztlich auch ihren sozialen Status bestimmten.
Oder irgendetwas in der Art. Die Standardantwort von B. J. Fitker, dem einzigen anderen Body-Armour-Angestellten, mit dem ich einigermaßen zusammenarbeiten kann, lautet: »Das könnte ich Ihnen sagen, aber danach müsste ich Sie erschießen.« Es war eine Bestätigung, die immer noch für einen gewissen Status sorgte, und der abgenutzte Scherz half, keine Details preisgeben zu müssen.
»Wir unterschreiben eine Vertraulichkeitserklärung«, sagte ich zu Emma.
»Oh.«
Es dauerte eine Weile, bis sie zu dem Schluss kam, dass sie alle denkbaren Themen erfolglos durchprobiert hatte. Gnädige Stille breitete sich aus. Nach einer Weile griff sie wieder nach dem Flugmagazin.