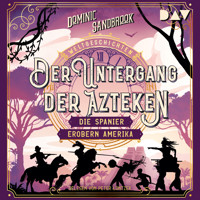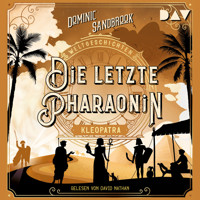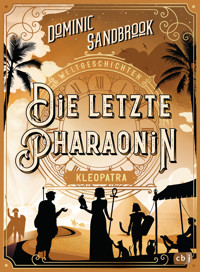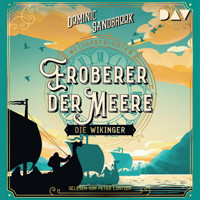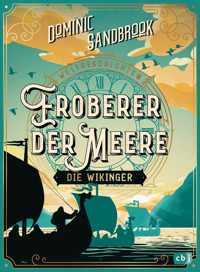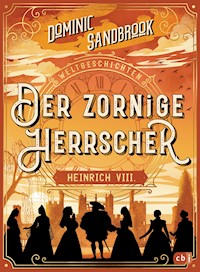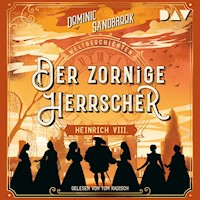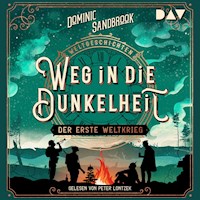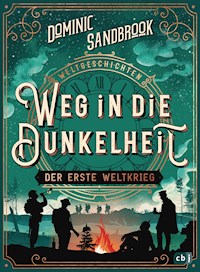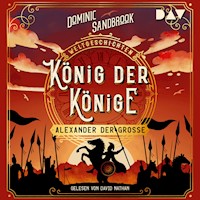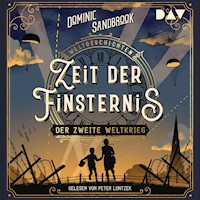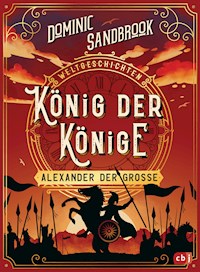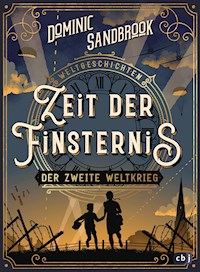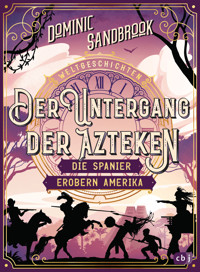
Weltgeschichte(n) - Der Untergang der Azteken: Die Spanier erobern Amerika E-Book
Dominic Sandbrook
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Weltgeschichten-Reihe
- Sprache: Deutsch
Weltgeschichte hautnah: Das Ende der alten amerikanischen Hochkulturen
Riesige Städte, gewaltige Pyramiden und die berühmten Goldschätze: Das Reich der Azteken gehörte zu den größten Zivilisationen der Weltgeschichte - voller Wunder und voller Grauen. Montezuma, der Gottkönig, herrschte über Millionen und opferte den Göttern das Blut seiner Gefangenen. Doch Montezuma wurde von düsteren Vorahnungen gepeinigt. Und als die fremden Heere aus dem fernen Spanien an der Küste des heutigen Mexico landeten, auf der Jagd nach Gold und Macht, war es nicht nur für Montezumas Reich der Anfang vom Ende.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 366
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Dominic Sandbrook
Aus dem Englischen
von Roman Stadler
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
© für die deutschsprachige Ausgabe 2024
cbj Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Text © 2023, Dominic Sandbrook
Die englische Originalausgabe erschien 2023
unter dem Titel »Adventures in Time: The Fall of the Aztecs«
bei Particular Books, einem Imprint von Penguin Press, London
Übersetzung: Roman Stadler
Lektorat: Eva Spessa
Umschlaggestaltung und -illustration: Nele Schütz Design/Sonja Gebhardt
CK • Herstellung: AW
Satz und Reproduktion: KCFG – Medienagentur, Neuss
ISBN 978-3-641-30992-3V001
www.cbj-verlag.de
Für Nicholas Bailey
INHALT
Prolog: Die Fremden
TEIL 1
DAS LAND DER FÜNFTEN SONNE
1Die Gefiederte Schlange
2Die Ankunft der Azteken
3Die Kinder des Adlers
4Der Tempel des Todes
5Montezuma
Teil 2
DIE SEEFAHRER
6Der Junge aus dem Nirgendwo
7Insel der Geheimnisse
8Tod im Paradies
9Die Goldjäger
10Aufbruch
TEIL 3
REISE IN DIE ANGST
11Das Mädchen vom Meer
12Sturm der Schwerter
13Die Stadt auf dem See
14Trommeln in der Nacht
15Das Fest des Blutes
16Die traurige Nacht
TEIL 4
DAS ENDE DER WELT
17Krieg um alles oder nichts
18Tenochtitlan wird belagert
19Die Adler fallen
20Stadt der Geister
Epilog: Die Erben
Nachwort
PROLOG
Die Fremden
Es war ein warmer, klarer Herbsttag und in der Stadt Tenochtitlan schlugen die Trommeln.
Den ganzen Morgen schon war die Stadt in heller Aufregung. Alt und Jung, Reich und Arm, Männer, Frauen und Kinder – alle hatten sie die Neuigkeit gehört.
Nach Wochen der Anspannung, nach all den geflüsterten Gerüchten, waren die Fremden im Tal von Mexiko angekommen und befanden sich jetzt auf der gegenüberliegenden Seite des Sees. In wenigen Stunden würden sie auf dem Dammweg sein. Dann würden die Bewohner der Stadt diese wunderlichen Neuankömmlinge von jenseits des Meeres endlich zu Gesicht bekommen.
Schon seit Sonnenaufgang waren die Bediensteten des Königs damit beschäftigt gewesen, die Zugbrücken herunterzulassen und die Straßen sauber zu fegen. In der kühlen Ruhe des Palasts des Axayacatl im Zentrum der Stadt waren die Dienstmädchen gerade dabei, die Quartiere für die Gäste vorzubereiten, die Betten herzurichten und Essen und Getränke bereitzustellen.
Auf den Flachdächern der Stadt drängte man sich dicht an dicht, um womöglich von dort einen Blick auf die Fremden zu erhaschen. Männer in Umhängen und Lendenschurzen, Frauen in weiten Blusen und Röcken und Kinder, die angezogen waren wie Miniaturausgaben ihrer Eltern, traten sich gegenseitig auf die Füße und kniffen die Augen zusammen, um jenseits des Sees irgendetwas zu erkennen.
Eine Hornfanfare ertönte und das Begrüßungskomitee machte sich, in Reih und Glied, auf aus dem Palast und begab sich in würdevoller Prozession hinunter zum Damm. Allen voran die Jaguarkrieger in prächtiger Kämpfermontur. Ihnen folgten die Edelmänner in ihren farbenfrohen Umhängen und die Priester mit ihrem aufwendigen Kopfschmuck.
Dann kam ihr Herrscher, der Große Sprecher, der Hohe König. Er ruhte unter einem Baldachin aus grünen Federn auf einer blumenbedeckten Sänfte, die von seinen engsten Verwandten getragen wurde. Er trug den farbenprächtigsten Umhang von allen und einen aufwendigen federgeschmückten Kopfputz. Um seine Stirn wand sich ein türkisfarbenes Band.
Er war der mächtigste Mann der Welt. Jeder, an dem er vorbeikam, neigte den Kopf. Niemand wagte es, ihm in die Augen zu sehen.
Alles war jetzt ganz still – eine letzte Ruhe vor dem Sturm. Die Sonne brannte herab. In der Luft lag eine Spannung, die stärker und stärker zu werden schien …
Plötzlich durchlief die Schaulustigen auf den Dächern ein kaum merkliches Zittern, ein halb ersticktes Einatmen aus tausend Mündern hing in der Luft. Am Rande der Stadt setzte der Rhythmus der Trommeln ein.
Jetzt kamen sie.
Reihe um Reihe kamen die Fremden auf dem Damm heran. Ihr Anführer – bleichgesichtig und mit rotem Bart – ritt auf einem seltsamen Tier, das einem riesigen Hirsch ohne Geweih glich.
Neben ihm lief barfuß ein zierliches Mädchen mit dunklerer Haut. Sie sah anders aus als der Rest der Fremden und viele der Schaulustigen runzelten verwundert die Stirn.
Hinter ihnen weitere Männer auf diesen fremdartigen riesigen Tieren. Einer hielt eine Flagge, auf der ein rotes Kreuz zu sehen war. Dann Hunderte Fremde zu Fuß, mit metallenen Schwertern an ihren Gürteln oder auf dem Rücken.
Ihnen folgten weitere Riesentier-Reiter. Dann Männer mit seltsamen Bögen, die sie in ihren Armen hielten. Und hinter ihnen konnte man jetzt diese seltsamen Vorrichtungen, über die man so viele Gerüchte gehört hatte, über den Damm heranrollen sehen – große Röhren auf Rädern, die Kugeln aus Eisen spuckten.
Die Begleiter des Herrschers halfen ihm von seiner Sänfte herab. Er setzte seine goldenen Sandalen auf den Boden, dann trat er auf die Fremden zu.
Deren Anführer war ebenfalls von seinem Reittier abgesessen. Langsam machte er seinerseits einige Schritte auf den König zu – und warf plötzlich beide Arme nach vorne.
Die Menge erstarrte.
Der Fremde versuchte, ihren Herrscher zu berühren!
Die Zeit selbst schien stillzustehen – der König regungslos auf dem Damm, der Fremde mit ausgestreckten Armen, die Höflinge mit schreckgeweiteten Augen, die Umstehenden mit der Hand vor dem Mund.
Es war der 8. November 1519 und das Schicksal der Welt lag in der Schwebe.
Der Name des Herrschers war Montezuma. Seit siebzehn Jahren regierte er von Tenochtitlan aus das Reich der Azteken, das sich auf der einen Seite bis an die Ufer des Pazifiks erstreckte und auf der anderen bis zum Golf von Mexiko.
Seinem Volk war er ein Mann von überwältigender Erhabenheit. Man nannte ihn nicht umsonst den Großen Sprecher – er sprach mit der Stimme der Götter, er war der Mittelsmann, mit dessen Hilfe gewöhnliche Sterbliche versuchten, den Himmel zu besänftigen.
Und der andere, der Anführer der Fremden? Er war ein Niemand. Selbst da, wo er herkam, hatten die wenigsten je von ihm gehört.
Sein Name war Hernán Cortés und er kam von der anderen Seite des Meeres, aus einem staubigen kleinen Städtchen im äußersten Westen Spaniens, Tausende von Kilometern entfernt.
Das Aufeinandertreffen dieser beiden Männer – des Herrschers der Azteken und des spanischen Abenteurers – würde den Lauf der Geschichte verändern. Es war der Höhepunkt einer Tragödie epischen Ausmaßes, in deren Verlauf das Mittelalter endgültig sein Ende fand und die Neuzeit eingeläutet wurde.
Cortés’ Sekretär wird mit dem Ausspruch zitiert, die spanische Eroberung Amerikas sei »das wichtigste Ereignis seit der Erschaffung der Welt«. Und der schottische Philosoph Adam Smith schrieb noch mehr als zweihundert Jahre später, die spanischen Expeditionen seien »die größten und wichtigsten schriftlich bezeugten Ereignisse der Menschheitsgeschichte«.
Beide Einschätzungen haben viel Zutreffendes an sich. Die Abenteuer von Cortés bilden eines der spannendsten Kapitel der Weltgeschichte, dem nur die Reisen Alexanders des Großen, das Leben Kleopatras oder die beiden Weltkriege gleichkommen.
Es ist ein Schlüsselmoment der Geschichte, ein Wendepunkt vom Alten zum Neuen. Denn es war die spanische Eroberung, die erstmals eine Verbindung herstellte zwischen der »alten« Welt Europas, Asiens und Afrikas und der »neuen« Welt Nord- und Südamerikas.
Vor allem aber ist dies die Geschichte einer atemberaubenden untergegangenen Hochkultur, hochkomplex und grausam, wunderschön und schrecklich zugleich – die verschwundene Welt der Azteken.
Die riesigen Städte, die in den Himmel ragenden Pyramiden, der Federkopfschmuck, die Menschenopfer, all das hat Fremde immer fasziniert. Sie schienen so stolz, so mächtig – und dann, mit einem Mal, brach alles in sich zusammen …
Ein kleines, interessantes Detail am Rande: Sie selbst nannten sich nie »Azteken«.
Ihre Sprache hieß Nahuatl und sie selbst Nahua. Diejenigen von ihnen, die in der Stadt Tenochtitlan lebten, nannten sich selbst Mexica*. »Mexiko« bedeutet wahrscheinlich einfach »der Ort der Mexica«.
Das Wort »Azteken« stammt aus dem neunzehnten Jahrhundert und wurde erfunden, um die früheren Mexica von den später dort lebenden Mexikanern zu unterscheiden. Die Bezeichnung »Azteken« ist aber so geläufig, dass es sich komisch anfühlen würde, sie nicht zu verwenden.
Viele der Namen der Hauptdarsteller dieses Dramas sind ebenfalls umstritten, weil die Azteken nicht unser Alphabet benutzten.
So ist der Herrscher, den wir auf dem Damm zurückgelassen haben, nicht nur als Montezuma bekannt, sondern auch als Moctezuma, Motecuhzoma, Motewksomah oder Motecuhzomatzin. Montezuma ist aber eine sehr bekannte und häufige Schreibweise – belassen wir es also dabei.
Montezuma war gnadenlos und kriegerischen Gemüts. Wie Cortés. Und der Untergang der Azteken – wir wollen das nicht verheimlichen – ist eine sehr blutige Geschichte.
Lange Zeit hat man diese Geschichte als ein Aufeinandertreffen zwischen bösartigen Azteken und edlen Spaniern erzählt. Heutzutage wird das oft umgekehrt: Die Azteken werden zu noblen »Underdogs« und die spanischen Eroberer, oder Konquistadoren, zu gierigen Monstern.
Ich sehe das nicht so. Es gab viel Grausamkeit auf beiden Seiten – und auch viel Mut.
War Montezuma ein Held? War Cortés ein Schurke? Oder war es andersherum? Wer war blutrünstiger – die Azteken oder die Spanier? Oder ist das alles viel zu einfach gedacht?
Ich habe versucht, mich nicht auf eine Seite zu schlagen. Entscheidet selbst. Eine »richtige« Antwort gibt es nicht – zu Geschichte darf jede und jeder eine eigene Meinung haben, das macht sie so faszinierend.
Nun aber genug der Vorrede. Das Drama ist viel zu spannend, um seinen Beginn noch länger hinauszuzögern. Schlagen wir also die allererste Seite der Geschichte der Azteken auf.
Wir beginnen, wo wir auch aufhören werden: mit einer Welt in Dunkelheit.
*Ungefähr ausgesprochen wie »Me-SCHI-ka«.
TEIL EINS – DAS LAND DER FÜNFTEN SONNE
1
Die Gefiederte Schlange
Am Anfang war Dunkelheit. Dann hauchten die Götter der Welt Leben ein und warfen sich selbst ins Feuer, um die Zeit und das Licht zu erschaffen.
Der erste Gott, der sich opferte, war Tezcatlipoca, Herr des Nordens und des Nachthimmels. Er sprang in die Flammen und wurde zur ersten Sonne. Während seiner Herrschaft wandelten Riesen im strahlenden Sonnenlicht. Doch eines Tages wurden sie alle von Jaguaren aufgefressen und die Dunkelheit kehrte zurück.
Die zweite Sonne war sein Bruder Quetzalcoatl, die Gefiederte Schlange und der Herr der Winde. Zu dieser Zeit wandelten die ersten Männer und Frauen auf der Erde. Doch Stürme und Fluten kamen über das Land, und die Menschen, die überlebten, wurden zu Affen.
Dann war Tlaloc, der Regengott, an der Reihe. Er warf sich in die Flammen und wurde zur dritten Sonne. Doch seine Frau verriet ihn, und während er trauerte, verwüstete eine schreckliche Dürre die Welt.
Die Menschen schrien um Hilfe, doch Tlaloc war wütend. Feuer fiel vom Himmel und die ganze Welt erstickte in Asche.
Die vierte Sonne war Chalchiuhtlicue, Herrin der Meere und Flüsse. Eine Zeit lang lebten die Menschen gut, es gab genug Mais zu essen für alle. Doch die Götter stritten sich und Chalchiuhtlicue weinte blutige Tränen. Die Wasser strömten über die Erde und alle Männer und Frauen wurden in Fische verwandelt.
Der letzte schwache Lichtschein erlosch und einmal mehr kam endlose Nacht über das Land. Das Zeitalter der vierten Sonne war vorüber, und die Götter wussten, dass ein fünftes Opfer vonnöten war.
In der dunklen, furchtbaren Finsternis versammelten sie sich in Teotihuacán, der riesigen, steinernen Stadt der Götter im Tal von Mexiko. Um sie herum drückten sich die wenigen Menschen und Tiere, die die Flut überlebt hatten, verängstigt in dunkle Winkel.
»Wer wird diese Last tragen?«, fragten die Götter. »Wer wird es auf sich nehmen, die Sonne zu sein und die Morgendämmerung zu verkünden?«
Ihr Blick fiel auf Tecuciztecatl, den reichen und stolzen Sohn von Tlaloc. Sie überreichten ihm einen prächtigen Federkopfschmuck, und er begann, sich auf das Ritual vorzubereiten.
»Wer noch?«, fragten die Götter. Schweigen. Es schien, als wollte niemand sonst den Sprung wagen.
Doch dann bemerkten sie Nanahuatzin, den ärmsten und schwächsten von allen Göttern, der sich bescheiden im Hintergrund hielt. »Ja«, sagte er ruhig. Ja, er würde es machen.
Die Götter entzündeten ein riesiges Feuer und die beiden Freiwilligen bereiteten sich vor. Schließlich war alles so weit.
Die Flammen züngelten und prasselten. Hoch darüber, auf einer großen hölzernen Plattform, bereiteten sich Tecuciztecatl und Nanahuatzin auf den Schicksalsmoment vor.
Tecuciztecatl trat nach vorne. Die Flammen knisterten. Die Götter, die um das Feuer saßen, warteten und warteten …
Viermal trat Tecuciztecatl nach vorne. Doch jedes Mal, wenn die Flammen in den Himmel züngelten und er die Hitze auf seinem Gesicht spürte, verließ ihn der Mut.
Nun sah Nanahuatzin seine Chance gekommen. Er schloss die Augen, rannte los und warf sich mitten ins Herz des Feuers. Und im Moment seiner größten Pein erhob sich der kleinste und schwächste der Götter glorreich gen Himmel und wurde die fünfte Sonne.
Jetzt fand auch Tecuciztecatl seinen Mut wieder. Er sprang seinem Kameraden hinterher und stieg als Mond in den Himmel. Zwei weitere Mutige folgten ihnen – ein Jaguar und ein Adler, die tapfersten aller Tiere.
Aber das Ritual war noch nicht zu Ende. Die Sonne ging zwar im Osten auf, bewegte sich aber nicht. Sie blieb feurig leuchtend hoch am Himmel stehen und verbrannte die Erde unter ihr.
Da wussten die anderen Götter, was sie zu tun hatten. Auch sie würden sich opfern müssen. Sie entblößten ihre Brust und boten sie dem heiligen Messer dar – sie gaben ihr Blut, auf dass die Sonne ihre Reise fortsetzen konnte.
Das Universum hatte eben seine Regeln. Es gab keine Belohnung ohne Pein und Leid, kein neues Leben ohne Blutvergießen. Nur mit dem Tod konnte man für das Leben bezahlen.
So wurde das Opfer gebracht und für die Menschheit begann das Zeitalter der fünften Sonne.
Jahr um Jahr zog ins Land, doch die Menschen wussten, dass das nicht ewig so bleiben würde. Eines Tages würde das Licht schwinden und Erdbeben würden die Welt entzweireißen.
Es gab nur eine Möglichkeit, diesen Moment hinauszuzögern: Um den Lauf der fünften Sonne nicht zu unterbrechen, um für das Leben auf der Erde zu bezahlen, musste die Schuld beglichen werden.
Das Opfermesser musste sich heben und senken, Blut musste die Tempelstufen hinabrinnen …
Und so begann der Zeitenlauf von Neuem. Jeden Morgen erhob sich die Sonne aus den Schatten und Licht ließ das Gesicht der Erde erstrahlen. Auf den Zweigen glitzerte der Frost und in den Seen spiegelte sich der Schein der Dämmerung.
Die Welt der Mythen wurde zur Welt der Geschichte(n). Und eines Tages, vor etwa fünfzehntausend Jahren, machte sich eine Gruppe von Jägern auf eine Reise, die den Lauf des Lebens auf der Erde für immer verändern würde.
Sie waren der Mühseligkeit, die asiatische Tundra nach Essbarem zu durchkämmen, müde und hatten beschlossen, die Eisbrücke, die nach Osten führte, zu überqueren. In der leeren Wildnis jenseits davon wollten sie ein neues Leben beginnen. In dieser neuen Welt, so hatten einige ihrer Ältesten gesagt, würden sie Mammuts, Mastodons, Bieber und Bisons jagen können, ohne dass ihnen andere Jäger dabei in die Quere kommen würden.
Im Laufe der Jahrhunderte folgten ihnen viele andere nach.Nachdem sie die Eisbrücke von Russland nach Alaska überquert hatten, führte sie ihr Weg jagend und fischend weiter Richtung Süden, in ihren Kanus die Küste entlang.
Dann, vor etwa elftausend Jahren, begannen die Temperaturen zu steigen. Die Eiszeit war vorbei und die Gletscher schmolzen. Der Meeresspiegel stieg an, Wasser überspülte die Eisbrücke und die Verbindung zwischen den beiden Kontinenten war für immer verschwunden.
Einige Zeit später begannen die Menschen in der Alten Welt, als Bauern sesshaft zu werden. Sie bauten Weizen und Gerste an und sie begannen, Hunde als Haustiere zu halten und Schafe und Kühe für deren Milch und Fleisch.
Sie gründeten Dörfer und Märkte, erfanden das Rad und stellten Metallwerkzeuge her. In den Tälern Mesopotamiens und Ägyptens bauten sie schließlich die ersten Städte und Paläste und begannen, Gesetze und Geschichten aufzuschreiben.
In der Neuen Welt, jenseits des Meeres, gab es das alles lange nicht. Die Nachkommen der Jäger lebten noch viele Tausend Jahre als Nomaden und durchstreiften die Ebenen und Wälder auf der Suche nach Nahrung.
Um etwa 4000 vor Christus begannen die Menschen im heutigen Mexiko, Nutzpflanzen wie Mais, Bohnen und Pfefferschoten anzubauen. Sie hatten jedoch weder Pferde noch das Rad, also auch keine Fuhrwerke.
Die erste Hochkultur Nord- und Mittelamerikas entstand erst um 1500 vor Christus, der Zeit ägyptischer Pharaonen wie Hatschepsut, Echnaton und Tutanchamun. Es war das Reich der Olmeken, die an der Küste des Golfs von Mexiko lebten.
Aus heutiger Sicht erscheinen die Olmeken unergründlich und rätselhaft, da sie nur wenige Aufzeichnungen hinterlassen haben. Die bekanntesten Zeugnisse ihrer Existenz sind riesige Köpfe aus Stein – jeder so groß wie ein erwachsener Mann – mit wütenden Gesichtern.
Sie müssen jedoch außerordentlich klug und geschickt gewesen sein. Wir wissen, dass sie Felder mit Mais und Bohnen bepflanzten und Tempel und Städte bauten. Sie schnitzten Schmuck aus Holz und Jade, bemalten Tonteller und -schüsseln und tanzten zur Musik ihrer Flöten und Trommeln.
Zeit und Zahlen faszinierten die Olmeken. Sie verfolgten die Bahnen der Planeten, entwickelten einen Kalender mit 365 Tagen und erfanden mehrere verschiedene Schriftsysteme, alle mit einer Art Hieroglyphen.
Viele Geschichtswissenschaftler glauben, dass die Olmeken sogar die Zahl Null erfunden haben. Für uns ist es schwer vorstellbar, aber weder die Griechen noch die Römer hatten ein Symbol für die Darstellung der Zahl Null – wohl, weil sie nichts mit ihr anzufangen wussten.
Etwas, das die Olmeken auch heute noch sehr lebendig und sympathisch erscheinen lässt, ist die Tatsache, dass sie das Spiel mit einem Ball auf einem abgegrenzten, ummauerten Feld erfunden haben – dabei benutzten die Spieler ihre Hüften, nicht ihre Hände, um einen Gummiball unter Kontrolle zu halten. Die Spielregeln sind leider nicht überliefert, aber wir wissen, dass es auf manchen der Spielfelder steinerne Ringe gab, die wahrscheinlich als Tore dienten.
Fast alle Olmekenstädte hatten ein solches Ballspielfeld auf dem zentralen Platz in der Stadtmitte, wo sich die Menschen versammelten, um die besten Spieler zu bewundern. Frauen und Kinder spielten ebenfalls, und manche Spiele endeten mit dem Tod – weil die Verlierer den Göttern geopfert wurden.
Niemand weiß, warum es mit der Kultur der Olmeken schließlich zu Ende ging. Doch um etwa 300 vor Christus – nicht lange nach dem Tod Alexanders des Großen – waren alle ihre Städte im Verfall begriffen. Ihr Kalender, die Zahl Null und das Ballspiel hatten sich jedoch unter ihren Nachbarn verbreitet und würden ihre Erfinder um Jahrhunderte überleben.
Die zweite frühe Hochkultur in der Neuen Welt war die der Maya, die in den Wäldern des heutigen Guatemala, Belize und südöstlichen Mexiko lebten. Das Goldene Zeitalter der Maya begann um etwa 300 nach Christus und dauerte etwa sechshundert Jahre – erstreckte sich also etwa von der Endphase des Weströmischen Reiches bis in die Hochzeit der Angelsachsen und Wikinger.
Die Welt der Maya war ein Mosaik aus Königreichen und Stadtstaaten, die durch unzählige Straßen und Flüsse miteinander verbunden waren. In Städten wie Tikal und Palenque erhoben sich ihre gigantischen Steinpyramiden, die man noch heute besichtigen kann, weit über die höchsten Baumwipfel.
Auf dem Höhepunkt der Mayakultur herrschten ihre Kriegsfürsten über etwa eine Million Menschen, die mehr als einhundert verschiedene Götter verehrten. Auch die Maya nutzten das Rad nicht und hatten deshalb weder Karren oder Fuhrwerke noch Wassermühlen.** In anderen Bereichen ihrer Kultur hatten sie die Leistungen ihre Vorgänger noch weiterentwickelt – sie hatten zum Beispiel wunderschön ausgeschmückte Bücher und einen Sonnenkalender, der an Genauigkeit alles in den Schatten stellte, was es im mittelalterlichen Europa gab.
Dann, Anfang des zehnten Jahrhunderts, geschah etwas sehr Merkwürdiges. Aus einem Grund, den man bis heute nicht kennt, begannen die Maya, ihre größten Siedlungen zu verlassen.
Städte, Dörfer und Marktplätze leerten sich, als seien ihre Bewohner einfach in den Wald verschwunden. Sogar ihre Steininschriften wurden mehr und mehr zu einem unverständlichen Kauderwelsch, so als würden die Maya ihre eigenen Schriftsysteme nicht mehr verstehen.
Zeit und Geschichte schienen rückwärts zu laufen.
Was war passiert? Wurden die Maya von Invasoren vernichtend geschlagen? Sind sie einer schrecklichen Epidemie zum Opfer gefallen? Oder haben sie ihren eigenen Lebensraum durch Rodung der Wälder und Übernutzung der Böden zerstört, was schließlich zu Unterversorgung und Hungersnöten führte?
Dieses Rätsel ist nie gelöst worden – und es wird wohl auch nicht mehr gelöst werden.
Das plötzliche Verschwinden der Maya ist bis heute auch eine Warnung: Es sollte uns bewusst machen, dass auch wir womöglich am Rande der Katastrophe herumtänzeln, so reich und fortschrittlich wir auch scheinen mögen …
Trotz des Schicksals der Mayastädte ist ihre Welt nicht komplett verschwunden. Ihre Vorstellungen und Bräuche hatten sich in alle Richtungen ausgebreitet und lebten noch lange fort, als die meisten ihrer Pyramiden bereits vom Dschungel verschluckt worden waren.
Als viele Jahrhunderte später die ersten Europäer die Regenwälder Mexikos und Guatemalas erkundeten, fanden sie dort Menschen vor, die Ballspiele spielten, Göttern huldigten und Kalender und Schriftsysteme verwendeten, die allesamt sehr an die Blütezeit der Mayakultur erinnerten.
Nun waren die Maya natürlich nicht die einzigen Nachfolger der Olmeken, die kulturelle Leistungen vollbrachten, die allem, was es in der Alten Welt gab, in nichts nachstanden. Hunderte Kilometer weiter nördlich – an dem Ort, wo sich Nanahuatzin geopfert hatte, um zur fünften Sonne zu werden – lag eine riesige Stadt von außerordentlicher Pracht und Schönheit: Teotihuacán.
Teotihuacán war die größte Ansiedlung im Tal von Mexiko, einer ausgedehnten Hochebene, die sich von Norden nach Süden über etwa einhundertfünfzig Kilometer erstreckt. Umgeben von hoch aufragenden schneebedeckten Gipfeln wirkte das Tal wie ein umschlossener, geschützter Garten im Zentrum der Welt. Inmitten des Tals glitzerte das Wasser des Texcoco-Sees – so sauber und so klar, dass viele sagten, er gäbe nichts Vergleichbares auf der ganzen Welt.
Von all den Siedlungen und Städten im Tal war Teotihuacán mit großem Abstand die spektakulärste. Wie so oft liegt viel ihrer Vergangenheit im Dunkeln – aber man versteht sofort, warum die Stadt der Legende nach ein Wohnsitz der Götter gewesen sein soll.
Wir wissen nicht, wer sie erbaut hat, wie sich die Erbauer nannten, welche Sprache sie sprachen – ja, wir wissen nicht einmal, wie sie ihre Stadt nannten. Der Name Teotihuacán – grob übersetzt »Stadt der Götter« – geht auf die Azteken zurück, die erst Jahrhunderte später im Tal von Mexiko ankamen.
Zur Blütezeit der Stadt, etwa um das Jahr 500, war Teotihuacán die Hauptstadt eines Reiches, das sich über viele Hundert Kilometer erstreckte. Sie war so groß, so gewaltig, dass ihre Wahrzeichen selbst heute noch die Landschaft dominieren – von der weitläufigen Straße derToten bis zu den gewaltigen Stufenpyramiden, die als Sonnenpyramide und Mondpyramide bekannt sind und die sich vor ihren Gegenstücken in Ägypten nicht zu verstecken brauchen.
In dieser Stadt mit ihren Schulen, Tempeln, Markt- und Ballspielplätzen lebten etwa zweihunderttausend Menschen. Hier brachten sie ihrem meistgeliebten und meistgefürchteten Gott Quetzalcoatl, der Gefiederten Schlange, dem Herrn des Windes und des Regens, des Wissens und der Morgendämmerung, Pumas und Jaguare als Opfer dar.
Doch trotz all der Macht und Pracht Teotihuacáns gab es kein Entrinnen aus dem Kreislauf von Leben und Tod. Selbst die hellste Sonne musste irgendwann vergehen, das hatten die Priester schon immer gewusst.
Irgendwann um die Mitte des sechsten Jahrhunderts muss die Stadt der Götter von einer furchtbaren Krise erschüttert worden sein. Den Auslöser kennen wir nicht. Klimawandel? Eine schreckliche Dürre? Niemand weiß es.
Was wir wissen, ist, dass viele der prächtigsten Gebäude Teotihuacáns niedergebrannt wurden, während andere völlig unversehrt blieben. Womöglich hatten sich die einfachen Leute der Stadt gegen ihre Herren aufgelehnt und in einem Wutausbruch gegen die Reichen und Mächtigen deren Paläste in Brand gesteckt.
Wie dem auch sei – diese Krise besiegelte den Niedergang Teotihuacáns. Als viele Jahrhunderte später Neuankömmlinge das Tal von Mexiko betraten, fanden sie die Stadt völlig verlassen vor.
Die Pyramiden erhoben sich noch majestätisch über die Ebene. Die Straße der Toten erstreckte sich noch bis zum Horizont. Gemalte Schlangen schlängelten sich noch die Häuserwände hinab.
Doch Menschen gab es dort keine mehr – sie waren wie vom Erdboden verschluckt.
Aus der Stadt der Götter war eine Stadt der Geister geworden. Und vom einst geschäftigen Treiben auf den Straßen und Plätzen war nur noch eine endlose, gespenstische Stille geblieben.
Mit dem Niedergang Teotihuacáns brach im Tal von Mexiko eine neue Zeit an. Und es sollte sehr, sehr lange dauern, bis sich wieder eine Stadt so hervortun konnte.
Aus dem Norden strömte Welle um Welle von Kriegern ins Tal, die von Gerüchten über dessen fruchtbare Ackerböden angezogen wurden. Sie jagten dort Rotwild, Kaninchen, Wachteln und Pumas. Aber sobald sich eine Gruppe niedergelassen hatte, kam auch schon die nächste – es war ein endloser, chaotischer Konkurrenzkampf.
Um das Jahr 1000 gewann eine der Gruppen aus dem Norden – die Tolteken – die Oberhand. Dieses furchterregende, kämpferische Volk errichtete seine Hauptstadt, Tula, etwa achtzig Kilometer nördlich der verlassenen Stadt der Götter.
Später berichteten die Geschichtenerzähler vom toltekischen Priesterkönig Topiltzin Quetzalcoatl – »Unser edler Herr, die Gefiederte Schlange« –, der schließlich von seiner eigenen Familie gestürzt wurde.
Mit einem Häufchen Getreuer ins Exil gezwungen, soll er sich zu Wasser Richtung Südosten aufgemacht haben, ins alte Kernland der Maya. Dort besiegte er die ansässigen Stammesführer und begründete ein mächtiges neues Reich, wo er in aller Pracht regierte.
War Topiltzin Quetzalcoatl Mensch oder Gott? War er nur ein Sterblicher, ein König, eine Figur der Geschichte? Oder war er vielleicht doch die Gefiederte Schlange selbst?
Es gab sicher eine Zeit, in der die Menschen das noch wussten. Aber im Verlauf der Jahrzehnte und Jahrhunderte wurde er mehr und mehr zur Legende – und schließlich wusste es keiner mehr genau zu sagen.
Schließlich, nach etwa zwei Jahrhunderten, war es dann auch für die Tolteken und ihre Hauptstadt Tula vorbei. Der Strom von Neuankömmlingen ins Tal hatte nicht nachgelassen, jeder wollte ein Stück vom Kuchen, und bald herrschte dort wieder das alte Chaos rivalisierender Städte.
Doch auf den Marktplätzen entlang der Ufer des Texcoco-Sees waren die Menschen sich sicher, dass sie nur lange genug warten mussten. Bald, so flüsterten sie, bald würde Topiltzin Quetzalcoatl bedeckt mit Blumen und Juwelen aus dem Osten zurückkehren.
Die Gefiederte Schlange würde sich ihr Reich wieder nehmen, eine ruhmvolle Herrschaft errichten und den Menschen des Tals bis ans Ende aller Tage ein Leben in Frieden und Wohlstand ermöglichen.
Die Sonne ging auf und wieder unter, aus Wochen wurden Monate, dann Jahre … doch Quetzalcoatl kehrte nicht zurück.
In den Ruinen von Teotihuacán, der uralten Stadt der Götter, huschten die Eidechsen über den bröckelnden Stein. Manchmal machten sich Leute vom Seeufer in der Hoffnung auf eine Eingebung auf in die alte Stadt – ein Omen, ein Zeichen, eine Nachricht von der Gefiederten Schlange.
Doch sie mussten alle enttäuscht wieder gehen.
Die fünfte Sonne brannte herab. Die Adler kreisten am Himmel. Doch Quetzalcoatl, so schien es, war für immer verschwunden.
Auf der Straße der Toten und in den Schatten der großen Pyramiden herrschte nichts als Stille.
Und dann, eines Tages, kamen die Azteken.
**Das stimmt … nicht ganz. Es gab tatsächlich Räder an Kinderspielzeugen – doch die Maya kamen offensichtlich nicht auf die Idee, das Rad auch für andere Zwecke einzusetzen. Vielleicht weil sie keine Pferde hatten?
2
Die Ankunft der Azteken
Sie kamen von weit her aus dem Nordwesten, aus einem Land, das bald auch für sie nur noch Legende war.
Ihre Priester erzählten, dass ihre Vorfahren einst im Innern des Hügels der Sieben Höhlen gelebt hatten, umgeben von wilden, gefährlichen Tieren. Doch eines Tages, die fünfte Sonne war noch jung, kamen sie aus ihren Höhlen hervor ans Licht und fanden sich in einem Land, das Aztlán genannt wurde – der Ort der Weißen Reiher.
Dort lebten sie auf einer Insel, umgeben vom glitzernden Wasser eines riesigen Sees. (Wo diese Insel oder das Land Aztlán zu finden waren, wusste jedoch später keiner mehr genau zu sagen – bereits als sie im Tal von Mexiko ankamen, hatten sie es vergessen. Nahe der nördlichen Grenze des heutigen Mexiko vielleicht, oder noch weiter weg, in den sonnenverbrannten Wüsten von Utah oder Colorado. Vielleicht hatte es das Land und die Insel aber auch nie gegeben.)
Der Legende nach hatten sie dort viele Jahre glücklich und in Frieden gelebt. Eines Tages jedoch richtete ihr Lieblingsgott, Huitzilopochtli – der »Kolibri des Südens« und Gott der Sonne –, das Wort an seine Priester.
Es sei Zeit, sagte Huitzilopochtli, dass sie den See überquerten und ein neues Land fänden. Um ihnen dabei zu helfen, schenkte er ihnen ein Netz, mit dem sie fischen konnten, und Pfeil und Bogen für die Jagd.
Huitzilopochtli unterteilte sie nach Familienzugehörigkeit in Clans – die Calpolli – und gab ihnen einen neuen Namen. Von jetzt an, sagte er, seien sie die Mexica.
Sie hatten keine Pferde, niemand hier hatte jemals auch nur ein Pferd gesehen. Nachdem sie den See überquert hatten, machten sie sich also zu Fuß auf den Weg Richtung Süden. Sie liefen und liefen, in der Gluthitze des Tages und in der dunklen Stille der Nacht, erklommen Berge und durchquerten Wüsten und Flüsse.
Eines Tages kamen sie an einen großen Hügel, den sie Cerro Coatepec – Schlangenberg – nannten. Dies, so erklärten ihnen ihre Priester feierlich, sei der Berg, wo Huitzilopochtli geboren worden war.
Hier ließen sie sich nieder und blieben dreißig Jahre. Sie bauten einen Damm in einem nahe gelegenen See, jagten Wild und pflanzten Gemüse und Blumen an.
Doch dann sprach Huitzilopochtli wieder durch seine Priester zu ihnen. Sie müssten weiterziehen, sagte er, weil er Größeres mit ihnen vorhabe.
Nun stritten sie sich. Eine Seite, die von der Kriegerin Coyolxauhqui – »Goldene Glocken« – angeführt wurde, wollte bleiben. Die anderen, Huitzilopochtli treu ergeben, wollten weiterziehen.
Die Huitzilopochtli-Getreuen trugen den Sieg davon. Um Mitternacht schlugen sie zu, töteten Coyolxauhquis Gefolgsleute und brachten sie selbst dem Gott als Opfer dar.
Dann zogen sie weiter, geduldig, immer einen Fuß vor den anderen, durch Hitze und Staub, die Worte ihres Gottes ständig im Ohr:
Wir werden weiterziehen, bis wir an dem Ort sind, wo wir uns niederlassen und sesshaft werden, und wir werden alle Völker der Welt unterwerfen.
Und ich gebe euch mein Wort, dass ich euch zu den Herren der Welt machen werde. Und wenn ihr Könige seid, werdet ihr unzählige Untertanen haben, die euch Tribut zollen werden …
So sprach Huitzilopochtli, Gott der Sonne, Herr des Krieges, Beschützer der Mexica.
Zwei Jahrhunderte vergingen – zweihundert lange Jahre der Entbehrungen und des Hungers. Dann, eines schönen Frühlingsmorgens, die Sonne tauchte die Hügel um sie herum in ein goldenes Licht, überquerten die Wanderer einen letzten Bergkamm …
… und da sahen sie es, weit unter sich: das Tal von Mexiko, ihr Paradies. Ein verwunschener Garten, ein grüner Flickenteppich aus kleinen Gehöften und Dörfern, Städten und Marktplätzen, mit einem glitzernden blauen See in seiner Mitte.
Doch die Mexica – oder Azteken, um sie bei ihrem geläufigeren Namen zu nennen – waren beileibe nicht die Ersten, die sich den Bergpfad hinab zu diesem üppigen Ackerland aufgemacht hatten. Zum Zeitpunkt ihrer Ankunft, um das Jahr 1250, wurden die fruchtbarsten Felder bereits von anderen bestellt.
Die Tepaneken, die zu dieser Zeit im Tal das Sagen hatten, entstammten ebenfalls einer Gruppe Wanderer aus dem Norden. Doch die Azteken sprachen dieselbe Sprache, Nahuatl, und überredeten die Tepaneken, sie als Vasallen anzunehmen, die für sie kämpfen und ihnen einen jährlichen Tribut zahlen würden.
Als Gegenleistung erlaubten die Tepaneken den Neuankömmlingen, sich an einem Ort anzusiedeln, der Chapultepec, Heuschreckenhügel, genannt wurde. Heute liegt dort der größte Park von Mexiko-Stadt, damals jedoch erhob sich der Hügel direkt neben dem – mittlerweile nahezu trockengelegten – Texcoco-See.
Mit den Jahren begannen die Azteken, die Sitten und Gebräuche ihrer Herren zu kopieren. Es waren die Tepaneken, die ihnen von Quetzalcoatl, der Gefiederten Schlange, erzählten. Es waren die Tepaneken, die ihnen beibrachten, Federn zu kaufen und zu verkaufen, die Jahre mithilfe von Kalendern zu zählen, Figuren und Schmuck aus Jade zu schnitzen und große Pyramiden zu errichten, um dort ihren Göttern zu opfern.
Schließlich wurden die Azteken des Daseins als Diener ihrer Nachbarn überdrüssig. In den letzten Jahren des dreizehnten Jahrhunderts erklärte einer ihrer mutigsten Kämpfer, Huitzilíhuitl – »Kolibrifeder« –, die Unabhängigkeit seines Volkes; er selbst nannte sich tlatoani***, oder König.
Die Vergeltung der Tepaneken erfolgte umgehend und war fürchterlich. Sie fielen über die Azteken her, brachten die Männer um, versklavten die Frauen und schleppten Huitzilíhuitl und seine Tochter davon, um sie zu opfern.
Huitzilíhuitls Tochter war noch ein Kind und hieß Chimalxochitl – »Sonnenblume«. Später, als sich die Leute ihre Geschichte erzählten, staunten sie immer und immer wieder über ihren Mut.
Tagelang wurde sie von den Tepaneken als Gefangene öffentlich zur Schau gestellt, als Warnung für alle, die mit dem Gedanken spielten, gegen ihre Herren aufzubegehren. Verzweifelt flehte ihr Vater die Tepaneken an, seine Tochter zu verschonen, aber diese lachten ihm nur ins Gesicht.
Chimalxochitl ertrug die Schmach der Gefangenschaft nicht. Sie wollte ehrenhaft sterben.
Von einem Mitgefangenen lieh sie sich Kreide und Kohle und versah ihren Körper mit den Zeichnungen eines Opfers für die Götter. Dann trat sie vor und rief so laut, dass alle es hören konnten: »Warum opfert ihr mich nicht?«
Beschämt von dieser Geste Chimalxochitls entzündeten die Tepaneken den Scheiterhaufen. Ohne zu zögern und mit hocherhobenem Haupt trat das Mädchen in die Flammen – eine wahre Königin.
»Ich gehe zu meinem Gott«, schrie sie. »Aber eines Tages … Ihr werdet sehen! Eines Tages werden die Kindeskinder meines Volkes große Kämpfer sein und ich werde gerächt werden! Ihr werdet sehen!«
Das Feuer prasselte und die Flammen züngelten in den Himmel, und Chimalxochitls Seele wich aus ihrem Körper. Ihre Prophezeiung jedoch würde niemals vergessen werden.
Zwei weitere Generationen folgten. Dann wendete sich das Blatt – genau wie Chimalxochitl vorhergesagt hatte.
Nachdem sie vom Hügel der Heuschrecken vertrieben worden waren, waren die Azteken jahrelang auf der Suche nach einem neuen Zuhause in der Küstengegend des Texcoco-Sees umhergewandert. Schließlich hatten sie an dem einen Ort Zuflucht gesucht, den sonst niemand wollte: auf der Insel in der Mitte des Sees, die so sumpfig und morastig war, dass bisher alle Bewohner des Tals dankend abgelehnt hatten.
Tagelang durchstreiften sie die Insel auf der Suche nach Nahrung und einem Ort, der zumindest etwas Schutz bot. Doch sie fanden weder das eine noch das andere.
Dann, eines Nachts, sprach ihr Gott Huitzilopochtli im Traum zu einem ihrer Priester. »Sucht im Sumpf nach einem Kaktus. Dort werdet ihr einen Adler finden, der sich in der Sonne wärmt.«
Am nächsten Morgen führte der Priester die Azteken ins Schilf am Rande des Wassers. Dort fanden sie – wie es der Gott versprochen hatte – einen einzeln stehenden Kaktus, auf dessen Spitze sich ein Adler niedergelassen hatte. Seine ausgestreckten Schwingen glichen den Strahlen der Sonne, sein Nest war gepolstert mit Federn, die in allen nur vorstellbaren Farben schimmerten; am Boden verstreut lagen die Knochen unzähliger Vögel.
Als der Adler sie sah, neigte er seinen Kopf. Dann war eine seltsame Stimme zu hören: »Volk von Mexiko – dies ist der Ort!«
Es war das Jahr 1325 und sie hatten ihr Zuhause gefunden. Ihre Reise war beendet.
Die Azteken nannten ihr neues Zuhause Tenochtitlan – »die Kaktusfeige, die zwischen Felsen wächst«. Auch heute noch zeigt das mexikanische Staatswappen einen Adler auf einem Feigenkaktus, der eine Schlange im Schnabel hält.
Zunächst war das Leben sehr anstrengend. Der feuchte, sumpfige Boden machte es ihnen nicht leicht, dort ihre rechteckigen Häuser aus Lehmziegeln, die Adobe genannt werden, zu bauen. Nutzpflanzen anzubauen, war noch schwieriger. So lebten sie zunächst von Vogeleiern und vom Fischen.
Doch sie arbeiteten hart. Sie schütteten am Rande des Wassers Erde auf, rammten Holzpfähle in den Boden und verflochten sie mit dem Schilf. So schufen sie kleine künstliche Inseln, die sogenannten Chinampas, auf denen sie Mais, Bohnen, Kürbis und Pfefferschoten anbauten.
Sie legten Kanäle an, die sie mit ihren Kanus befahren konnten. Sie bauten Erddämme und Steinstraßen. Und dort, wo sie den Adler gesehen hatten, bauten sie aus Lehm und Kies eine weitläufige, erhabene Plattform – das Fundament einer Pyramide zu Ehren Huitzilopochtlis.
Aber ihr Leben bestand nicht nur aus Arbeit: Nachts tanzten sie zur Musik ihrer Trommeln und Schneckenhörner. Sie sangen Lieder von den alten Kriegern und erzählten die Geschichte von Chimalxochitl, dem Mädchen, das so furchtlos ins Feuer getreten war.
Irgendwann um das Jahr 1350 krönten sie ihren ersten König. Sein Name war Acamapichtli, und er war der erste aztekische Herrscher, der seine eigene Schilfmatte hatte, die ihm als Thron diente.
Zu dieser Zeit waren die Azteken jedoch noch immer sehr schwach. Die Ufer des Texcoco-Sees gehörten noch immer den Tepaneken, die regelmäßigen Nachschub an jungen Männern forderten, die in ihren Kriegen kämpfen mussten.
Als Acamapichtli um das Jahr 1400 starb, ging die Schilfmatte auf seinen Sohn Huitzilíhuitl über, der nach Chimalxochitls Vater benannt worden war. In den nächsten beiden Jahrzehnten arbeitete Huitzilíhuitl unermüdlich daran, aus der Insel einen echten Stadtstaat zu machen.
Da die Azteken so wenig Ackerland hatten, war die Ernte für sie deutlich weniger aufwendig als für ihre Nachbarn. Das ließ ihnen mehr Zeit zum Kämpfen. Und so war es für ihre Nachbarn sehr bald ein gewohnter Anblick, die Krieger von Tenochtitlan mit ihrem prächtigen Kopfputz und ihren federgeschmückten Schilden den See überqueren zu sehen.
Tenochtitlan war bereits die aufstrebende Macht im Tal, als Huitzilíhuitl 1417 starb. Ihm folgte zunächst sein Sohn Chimalpopoca auf die Schilfmatte, dann sein Halbbruder Itzcóatl, dessen Name »Obsidianschlange«**** bedeutet.
Itzcóatl war schon über vierzig – alt für die damaligen Verhältnisse. Doch er war erfahren, weil er lange mit Huitzilíhuitl zusammengearbeitet hatte, und seine Pläne für seine Stadt und sein Volk waren ehrgeizig.
Unmittelbar nachdem er König geworden war, sandte er Boten in den Stadtstaat Texcoco auf der östlichen Seite des Sees und in die kleinere Stadt Tlacopan. Schon viel zu lange, so seine Nachricht, sei man nur Vasall gewesen und habe rücksichts- und erbarmungslosen Machthabern Tribut gezollt.
Itzcóatl schlug vor, eine Dreier-Allianz zu bilden, und so gemeinsam die tepanekische Elite zu stürzen. Er wisse, sagte er, dass der Feldzug ein langer und blutiger werden würde – doch wenn sie zusammenhielten, könnten sie die Macht im Tal von Mexiko übernehmen.
Er behielt recht. Der Krieg wütete fast ein Jahr. Die Obsidianschwerter hoben und senkten sich unablässig, das Blut floss, die Priester hoben ihre Opfergaben in den Himmel. Am Ende behielt die Dreier-Allianz die Oberhand und die Azteken und ihre Verbündeten waren die neuen Herrscher im Tal.
Am Abend des Sieges saß Itzcóatl noch lange mit seinem Neffen Tlacaélel zusammen, um Zukunftspläne zu schmieden.
Tlacaélel war ein junger Mann mit Ideen, ein Denker. Er hatte die Armee seines Onkels gegen die Tepaneken geführt und sich mit seiner Weitsicht und seinem Mut einen Namen gemacht.
Doch nun war die ganze Kämpferei für ihn bereits eine Sache der Vergangenheit. Seine Priorität waren jetzt Bücher – Geschichtsbücher insbesondere.
Soweit die Erinnerungen zurückreichten, hatten die Azteken ihre Geschichte in reich bebilderten Büchern aufgezeichnet, den sogenannten Kodizes. Diese bestanden aus großen Pergament- oder Papierbögen, die aus Hirschhaut oder Feigenrinde, einem besonders weichen und weißen Holz, hergestellt waren.
Aztekische Kodizes enthalten keine Schrift***** im heutigen Sinn, sondern Bilderfolgen, die Szenen aus Geschichten oder Legenden darstellen. Einer der erhaltenen Kodizes erzählt beispielsweise davon, wie die Vorfahren der Azteken Aztlán verließen: Die erste Seite zeigt nichts als das Bild eines Mannes, der über einen See rudert.
Allen Völkern im Tal von Mexiko war Geschichte sehr, sehr wichtig. So verbrannte man beispielsweise, wenn wieder einmal ein Nachbar besiegt worden war, oft dessen Bücher, in der Hoffnung, die Vergangenheit der Besiegten – und damit deren Identität – auszulöschen.
Der Vorschlag, den Tlacaélel jetzt machte, klingt deshalb zunächst vollkommen unglaublich: Die Azteken sollten nicht nur die Bücher ihrer Feinde verbrennen – sondern ebenso ihre eigenen.
»Es ist nicht recht«, sagte er, »dass unser Volk diese Bilder kennt. Denn diese Bilder sind voller Lügen.«
Welche Lügen? Die Antwort liegt auf der Hand.
Die alten Geschichtsaufzeichnungen stellten die Azteken als arm, schwach und unterdrückt dar. Sie schilderten ihre Niederlagen und zeigten ihre Heimat als unbedeutenden Ort am See, als einen von vielen.
Tlacaélel hingegen träumte von einer neuen Geschichte – einer, in der die Azteken von Anfang an besonders waren. Die gemalten Bücher sollten sie als Gründer eines Reichs darstellen, die von einem Gott beschützt und für Großes bestimmt waren.
Itzcóatl willigte ein. Ein ruhmreiches Volk, so meinte er, verdiene eine ruhmreiche Geschichte.
In den darauffolgenden Tagen durchkämmten Tlacaélels Männer die Stadt auf der Suche nach »falschen« Büchern und warfen diese auf einen großen Haufen zusammen. Schließlich legte Tlacaélel eine Fackel an den Haufen und schwarzer Rauch stieg über den Pyramiden von Tenochtitlan in den Himmel.
Dann machten sich die Priester an die Arbeit und fertigten neue Bücher, die den Vorstellungen Tlacaélels entsprachen.
In diesen neuen Büchern wurde aus der Geschichte der Azteken eine des stetigen Fortschritts. Ihre Vorfahren waren jetzt nicht mehr nur eine Gruppe erschöpfter, staubiger Nomaden wie viele andere auch, sondern die Nachkommen der Tolteken, dieser geheimnisvollen Könige der Vorzeit.
Und Huitzilopochtli, ihr göttlicher Beschützer, war nicht mehr nur irgendein Gott. Er war jetzt der größte und wichtigste Gott von allen – der Lebensspender.
In Tlacaélels Version der Geschichte hatten die Azteken eine heilige Mission, von der nicht weniger als das Überleben der gesamten Menschheit abhing. Ihnen oblag es, für Ordnung zu sorgen und zu diesem Zweck die ganze Welt unter ihrer Vorherrschaft zu vereinen.
Am wichtigsten war es allerdings, sicherzustellen, dass die Sonne jeden Morgen wieder aufging. Und hierfür gab es nur eine Möglichkeit: ein stetiger Zufluss an Lebensenergie – man musste Huitzilopochtli das geben, wonach es ihn am meisten verlangte.
Und das war, so wie die Dinge lagen, das Blut von Menschen …
Weit, weit entfernt – im Osten, jenseits des Meeres – ging es nicht minder turbulent zu. In England war der Heldenkönig Heinrich V. jung gestorben und auf den Thron folgte ihm sein einziger Sohn, ein neun Monate altes Baby. In Frankreich wurde eine junge Frau namens Johanna von Orleans als Ketzerin verbrannt.
In Deutschland arbeitete ein Erfinder, ein gewisser Johannes Gutenberg, an einer Maschine, die Bücher drucken konnte. Und in Portugal bereiteten sich Seeleute darauf vor, die Inseln des Atlantiks zu erforschen und die Küste Afrikas kartografisch zu erfassen.
Von diesen Ländern wussten die Azteken natürlich nichts. Sie waren unter Itzcóatl und seinen Nachfolgern damit beschäftigt, ihr Reich zu erweitern und ihre Macht und ihren Einfluss immer weiter nach Süden auszudehnen.
Im späten fünfzehnten Jahrhundert waren ihre Kaufleute bereits viele Hundert Kilometer bis in die Gebiete der heutigen mexikanischen Staaten Oaxaca und Chiapas vorgedrungen, und es ging immer weiter nach Süden, ins heutige Guatemala und in den Dschungel Zentralamerikas.
Mit ihren etwa sechs Millionen Untertanen regierten die aztekischen Herrscher etwa doppelt so viele Menschen wie die englischen Könige, aber nicht ganz so viele wie die Könige von Frankreich oder Spanien. In der Neuen Welt war nur das Reich der Inka – im heutigen Peru und Ecuador – noch größer.
Die Macht der Azteken war jedoch nicht unbegrenzt. Sie hatten nur wenige militärische Stützpunkte und mischten sich auch sonst nicht viel in die Angelegenheiten der unterworfenen Völker und Stämme ein. Die Stadtstaaten unter Tenochtitlans Herrschaft hatten ihre eigenen Könige, ihre eigenen Götter und ihre eigenen Gesetze.
Trotzdem war das Leben für die unterworfenen Städte nicht leicht. Sie hatten zweimal im Jahr Abgaben zu leisten – was bedeutete, ihren Herren alles zu überlassen, was diese benötigten. Nicht nur Nahrung wie Mais, Bohnen, Truthähne oder Tomaten, sondern auch Stoff für deren Kleidung, Gummi für deren Ballspiele, Kakao für deren Schokolade und Federn für deren Kopfputz.
Wer sich weigerte, forderte zwangsläufig einen Rachefeldzug aztekischer Kämpfer heraus. Und sobald man besiegt war, erhöhten sich natürlich die Tributzahlungen.
Trotzdem unterwarfen sich einige wenige Königreiche nie. Wie beispielsweise der größte Rivale des Aztekenreichs, Tlaxcala, das sich in einem tiefen Tal gleich hinter den Bergen Richtung Osten befand.
Tlaxcala war eine Republik, umfasste vier Städte und wurde von einem Gremium erfahrener Politiker regiert. Man sprach dort ebenfalls Nahuatl und teilte sich mit den Azteken viele Bräuche, Götter und Legenden.
Die Tlaxcalteken waren fest entschlossen, sich ihre Unabhängigkeit zu bewahren. Und weil sie furchtlose Kämpfer waren, hatten die Azteken immer gezögert, einen Kampf auf Leben und Tod zu riskieren.