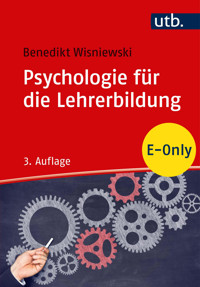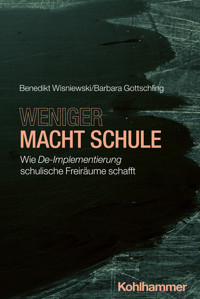
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Wie kann Schule aufhören, das zu tun, was nicht funktioniert? Wie können sinnlose schulische Praktiken reduziert oder eliminiert werden? Wie bekommen Lehrerinnen und Lehrer Zeit zurück, die sie für das aufwenden können, was wirklich wichtig ist? Dieses Buch gibt Antworten auf diese Fragen und zeigt fundiert und praxisnah, wie Schule besser werden kann, indem sie auf ein Weniger statt auf ein Mehr setzt. Es beschreibt, wie Qualitätssteigerung und berufliche Entlastung vereinbart werden können und leistet damit einen Beitrag zu wirkungsvoller Schulentwicklung und gleichzeitig zur Gesunderhaltung von Lehrerinnen und Lehrern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 209
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
Vorwort von Andreas Hillert
1 Einführung: Warum De-Implementierung?
2 Ausgangslage: Wie immer mehr dazukommt und Schule trotzdem nicht besser wird
2.1 Die »Mehr ist besser«-Logik
2.2 Schule wird nicht besser ...
2.3 ... obwohl immer mehr dazukommt
3 Was De-Implementierung bedeutet
3.1 Missverständnisse
3.2 Begriffliche Eingrenzung
3.3 Lernen und Verlernen
3.4 Arten der De-Implementierung
4 Hürden und Hemmnisse: Woran De-Implementierung scheitern kann
4.1 Warum Schule so ist, wie sie ist – und sich kaum ändert
4.1.1 Grammar of schooling
4.1.2 Einzelkämpfer-Denkmuster
4.1.3 Verantwortungsdiffusion
4.2 Warum Menschen an sinnlosen Dingen festhalten
4.2.1 Kognitive Faktoren
4.2.2 Emotionale Faktoren
4.2.3 Soziale Faktoren
4.2.4 Ideologische Faktoren
4.3 Warum Quantität im Schulsystem als Qualitätsindikator dient und wozu dies führt
4.3.1 Loose Coupling und Gratifikationskrisen
4.3.2 Multa non multum
4.3.3 Das 3-E-Modell
5 Wie De-Implementierung funktioniert
5.1 Wie man sinnlose Dinge erkennt
5.1.1 Die Frage nach dem Kriterium
5.1.2 Chestertons Zaun
5.1.3 Technologiedefizit
5.1.4 Evidenz durch Forschung
5.1.5 Evidenz durch eigene Evaluation
5.2 Wie man aufhört, an sinnlosen Dingen festzuhalten
5.2.1 Das Motel-One-Prinzip
5.2.2 Was die Schule von Motel One lernen kann
5.3 Wie man sinnlose Dinge dauerhaft los wird
5.3.1 Intentionen stärken
5.3.2 Gewohnheiten ändern
5.3.3 Denkmuster und Selbstverständnis anpassen
6 Leitfaden zur praktischen Umsetzung
6.1 Allgemeiner Ablauf der De-Implementierung
6.1.1 Ziele oder das »Warum«
6.1.2 Analyse der Situation
6.1.3 Der Prozessplan
6.1.4 Umsetzung der De-Implementierung
6.1.5 (Zwischen-)Evaluation
6.1.6 Zurück auf Los!
6.2 Ablauf der De-Implementierung auf institutioneller (Schul-)Ebene
6.2.1 Legitimation, Team und Ziele
6.2.2 Analyse der Situation
6.2.3 Der Prozessplan
6.2.4 Umsetzung der De-Implementierung
6.2.5 (Zwischen-)Evaluation
6.2.6 Zurück auf Los!
6.3 Ablauf der De-Implementierung auf individueller Ebene
6.3.1 Ziele oder das »Warum«
6.3.2 Analyse der Situation
6.3.3 Der Prozessplan
6.3.4 Umsetzung der De-Implementierung
6.3.5 (Zwischen-)Evaluation
6.3.6 Zurück auf Los!
7 Zu guter Letzt
Literatur
Anhang
1 Beispiele zur De-Implementierung auf einen Blick
Korrekturen ()
Lesen durch Schreiben ()
Dekoration im Klassenzimmer ()
Lerntypen ()
Tage der offenen Tür ()
Rechenschaftsablagen ()
Edu-Kinestetik ()
Team Teaching ()
Methodentraining ()
One-Shot-Fortbildungen ()
Tür-und-Angel-Gespräche ()
Analoge Absenzenverwaltung ()
2 Materialien zur De-Implementierung auf Schulebene
Reflexion von schulischen Standards
Der Umgang mit dem »Ja, aber...«
3 Materialien zur De-Implementierung auf individueller Ebene
Die Autorin, der Autor
Dipl.-Psych. Dr. Barbara Gottschling arbeitet als Schulpsychologin, Supervisorin und Coach für schulische Führungskräfte. Ihr Schwerpunkt liegt im Bereich der Lehrkräftegesundheit.
Dr. habil. Benedikt Wisniewski ist Schulpsychologe, Supervisor und Coach. Er war lange als Lehrer und in der Lehrerbildung tätig. Als Fachbuchautor und Podcaster beschäftigt er sich mit psychologischen Themen im Kontext Schule.
Benedikt Wisniewski, Barbara Gottschling
Weniger macht Schule
Wie De-Implementierung schulische Freiräume schafft
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565 [email protected]
Print:ISBN 978-3-17-045484-2
E-Book-Formate:pdf:ISBN 978-3-17-045485-9epub:ISBN 978-3-17-045486-6
Vorwort von Andreas Hillert
Einerseits ist De-Implementierung ein Ansatz, den Schule und Lehrkräfte heute so nötig haben wie die Luft zum Atmen. Andererseits ist De-Implementierung schlicht eine Zumutung! Wenn man es so ernst nimmt, wie es ausgehend von den im Buch vorgestellten Konzepten ernst genommen werden sollte, dann läuft es schlicht auf eine Revolution hinaus.
Weniger ist mehr! Wer würde dieser Aussage, zumal was die aktuelle Situation in der Schule und nicht zuletzt das Schule tragende System anbelangt, grundsätzlich widersprechen wollen? Selbstverständlich! Reduzieren Sie Ihre Tätigkeit, Ihr Engagement und die Schule überhaupt auf das Wesentliche. Damit Schule effektiver, für alle Beteiligten anregender, flexibler und nicht zuletzt für Lehrkräfte weniger belastend und damit gesünder wird! Die entscheidende Frage und das Problem sind dabei zum einen, was man jeweils für unwesentlich bzw. überflüssig hält, und zum anderen, im Sinne von Schule als hierarchisch-staatlichem System: darf man überhaupt, ausgehend von guten Argumenten und besserer Einsicht, de-implementieren? Also etwas von oben Verordnetes einstellen, damit aufhören, es quasi zufälligerweise übersehen? Schließlich geht es vielfach um hochoffizielle, verbindliche Anweisungen und Vorgaben. Nochmal: Auch wenn diese noch so unsinnig zu sein erscheinen (und viele es offenkundig sind), dürfen diese von im System verankerten Lehrkräften, zumal verbeamteten, wirklich miss- und nicht mehr beachtet werden? Von außen betrachtet: schön wäre es, wenn Lehrkräfte, die Schülerinnen und Schüler zu selbstständig denkenden, Verantwortung tragenden Menschen entwickeln sollen, systemintern nicht in entsprechenden Zweifelsfällen ihrerseits (mehr oder weniger spürbar) als Vorgaben ausführende Befehlsempfänger fungieren müssten. Andererseits, neben den beamtenrechtlichen Aspekten, hat die aktuelle Situation allerdings unübersehbar auch Verantwortung- und damit potentiell Stress-reduzierende Aspekte.
Was alles in der Schule und im Verhalten von Lehrpersonen unsinnig ist, das lässt sich absehbar unendlich diskutieren. Es gibt einige ganz offensichtliche Punkte, die aber teils wiederum so offensichtlich politisch sind, dass es im System Tätige kaum wagen würden, diese offen zu hinterfragen. Hier Beispiele zu nennen könnte selbst einen nur ein Vorwort Schreibenden potentiell in Verruf bringen. Und andererseits gibt natürlich pädagogische und psychologische Forschung. Wenn Untersuchungen zeigen, dass diese oder jene Maßnahme sinnlos bzw. eine andere besser wäre, ist das damit hinreichend und ein für alle Mal tatsächlich bewiesen? Forschungsergebnisse im pädagogischen Bereich führen leider keineswegs immer zu eindeutigen Handlungsanweisungen, wie dies mitunter dargestellt und von Politikerinnen und Politikern missverstanden wird. Und nicht zuletzt ist Schule eben nicht gleich Schule. Was in einem Kontext sinnlos ist, ist in einem anderen absolut genial.
Im Sinne von Stressverstärkern hat jede und jeder von uns Gewohnheiten, die vor allem den Charme des Gewohnten haben und ansonsten Hemmschuhe und Ballast sind. Angefangen von existenziellem Perfektionismus bzw. überzogen hohen Standards zu Aspekten wie »Mache keine Fehler!« oder auch »Sei beliebt und anerkannt!«. Wobei nicht vergessen werden darf, dass im Sinne von »Jeder hat gute Gründe sich zu überlasten, sonst würde er es nicht tun« (vgl. Hillert et al., 2016), alle entsprechenden Implementierungen zunächst einmal positive Qualitäten hatten. Dies wiederum bedingt eine Dynamik, die es schwer bis sehr schwer macht, sie selbst dann, wenn klar ist, dass sie mehr Kraft kosten als Sinn machen, nicht weiter zu perpetuieren. Verhaltensänderungen und somit jede Form von De-Implementierung bedeutet dann zunächst einmal mehr Stress zu haben als zuvor. Auch auf Aspekte, die quasi nur noch ritualisierte Qualitäten haben, zu verzichten macht Stress! Schließlich ist es Sinn und Zweck von Ritualen dort, wo ansonsten kaum Sicherheiten zu finden sind, zumindest das Gefühl von Sicherheit zu generieren. Der De-Implementierungs-Stress dauert dann so lange, bis sich neue Normalitäten eingestellt haben. Diese wiederum sind dadurch charakterisiert, dass nicht nur rational, sondern auch emotional deutlich wurde, dass die betreffenden Rituale verzichtbar waren. Was eine ganze Weile, Wochen und Monate, dauern kann. Wenn letzteres nicht berücksichtigt wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass alle noch so engagierten De-Implementierungs-Projekte eher theoretisch bleiben.
Angesichts des hier skizzierten, breiten und absehbar in vielen Aspekten unwegsamen, mitunter regelrecht verminten Geländes kann man der Autorin und dem Autor nur dankbar dafür sein, sich diesbezüglich ein gutes Stück und das mit substanziellen Argumenten vorgewagt zu haben. Es bleibt zu hoffen, dass ihnen viele auf allen hierarchischen Ebenen folgen. Damit Schule durch De-Implementierung nicht nur schlanker, sondern auch so dynamisch wird, dass sie den heute noch unkalkulierbaren Anforderungen, die unsere nahe und fernere Zukunft für uns parat haben wird, entsprechen kann. Wer heute vorgibt zu wissen, was das perspektivisch konkret heißt, ist naiv und/oder gefährlich. Mit existenziellen Unsicherheiten dieser Art umzugehen ist eine schwierige Lektion, die wir alle noch zu bewältigen haben. Dazu abschließend ein persönlicher (archäologisch fundierter) Hinweis: Alle Inhalte, die man als überflüssigen alten Ballast empfindet, abzuwerfen, führt absehbar – ins Nichts. Kleine Kinder brauchen bekanntermaßen Wurzeln, die ihnen nicht zuletzt die Schule vermitteln muss. Ihre Flügel müssen wachsen aus dem Material, was da ist, für gut befunden wurde und damit Identität verleiht. Das ergibt die Basis, von der aus große Kinder, die wir alle sind, jeweils neu starten können, um zu de-implementieren und/oder um neue Inhalte zu entwickeln. Wie (vermutlich vom Theologen Karl Paul Reinhold Niebuhr, 1892 – 1971, gesagt): »Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.« Darüber hinaus braucht man dann als Lehrkraft »nur« noch den Mut und die Frustrationstoleranz, um das mit Augenmaß, bestem Wissen und Gewissen für gut Befundene, idealerweise gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen und allen übrigen Beteiligten angemessen umzusetzen.
Prien am Chiemsee, 11. 06. 2024Prof. Dr. phil. Dr. med. Andreas Hillert (Chefarzt an der Schön Klinik Roseneck in Prien am Chiemsee)
1 Einführung: Warum De-Implementierung?
In diesem Buch geht es darum, wie Schule aufhören kann, das zu tun, was nicht funktioniert. Es zielt darauf, dass Lehrerinnen und Lehrer Zeit zurückbekommen, die sie entweder für effektivere Maßnahmen der beruflichen Tätigkeit oder aber als Freizeit – und damit zur Gesunderhaltung – nutzen können. In der Vergangenheit wurde kontinuierlich versucht, Schule besser zu machen, indem immer neue Aufgaben, Prozesse, Maßnahmen, Programme, Initiativen, Methoden und andere Dinge hinzukamen. De-Implementierung bedeutet die Umkehr dieser Logik. Schule kann besser werden, indem sie auf ein »Weniger« statt auf ein »Mehr« setzt. Kurz: Besser weniger – dafür weniger besser. Aber warum sollte es überhaupt sinnvoll sein, auf »weniger« zu setzen?
Die Idee, Verbesserungen durch ein Weglassen zu erzeugen, ist nicht neu. Anfang des 20. Jahrhunderts entstand in der Architektur eine neue Vorstellung des Bauens, die schmückende Verzierungen ablehnte und schlichte, einfache Formen bevorzugte. Ein Vertreter dieser Strömung, die als Minimalismus bezeichnet wird, war Ludwig Mies van der Rohe, ein deutsch-amerikanischer Architekt. Er prägte in seinem Fachgebiet den Satz »less is more« als Grundsatz für die Reduktion auf das Wesentliche.
Das Motto »less is more« wurde schnell in andere Bereiche übertragen. Firmen wie Apple, Google oder auch IKEA setzten alle auf einfache Anwendungen und Formen, klare Linien und eine reduzierte Ästhetik. Apple beispielsweise revolutionierte die Technologiebranche mit Produkten wie dem iPhone und dem MacBook, die durch ihr minimalistisches Design und ihre intuitive Benutzeroberfläche gekennzeichnet sind. Google übertrug das Prinzip auf seine Suchmaschine, indem es einfache und benutzerfreundliche Schnittstellen entwickelte. Und IKEA, weltweit bekannt für seine erschwinglichen Möbel, kombiniert skandinavisches Design mit dem Grundsatz von »less is more«, um funktionale und ästhetisch ansprechende Wohnlösungen anzubieten.
Im Jahr 1997 kreierte die Werbeagentur Weber, Hodel, Schmid für die Marke SMART der Mercedes-Benz AG, ein Kleinstwagen für die urbane Umgebung, den Slogan »reduce to the max«. Johann Tomforde, ehemaliger Geschäftsführer Entwicklung/Produktion bei Mercedes-Benz AG, betonte, dass sich die Werte ändern und man sich von überkommenen Statussymbolen verabschieden müsse. In einer Zeit, in der Prestigewerte an Bedeutung verlieren und die Anforderungen an Sicherheit, Umweltverträglichkeit und Handlichkeit steigen, werde die Reduktion auf das Wesentliche immer wichtiger. Die Marke Smart setzte daher auf Reduktion und Effizienz. Der Slogan »reduce to the max« verdeutlicht die Philosophie der Marke, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und unnötigen Ballast abzuwerfen (Bußmann, 1999).
In der Medizin ist De-Implementierung seit über zehn Jahren eine gängige Vorgehensweise. Die sogenannte »Choosing Wisely«-Initiative wurde im April 2012 von der ABIM Foundation in den USA ins Leben gerufen. Diese Initiative zielt seitdem darauf ab, die Qualität der medizinischen Versorgung zu verbessern, Kosten zu senken und die Patientensicherheit zu fördern, indem sie Überbeanspruchung und unnötige medizinische Maßnahmen reduziert. Es geht beispielsweise darum, die überflüssigen Verschreibungen von Medikamenten zu reduzieren. Überverschreibungen sind nicht wirksam, nicht kosteneffektiv oder sogar für die Patientinnen und Patienten schädlich.
Schule bekommt viele unsinnige Dinge verschrieben – unnötige Bürokratie, wirkungslose Schulentwicklungsprogramme, wenig substantiierte Konzepte usw. – und Schule verschreibt selbst viele unsinnige Dinge – in erster Linie pädagogische und didaktische Maßnahmen, die nachweisbar ineffektiv sind, sowie Druck und Stress. Ein zunehmender Lehrkräftemangel, überdurchschnittlich hohe Raten an psychischen Erkrankungen bei Lehrkräften und durch PISA offenbarte Schwächen in der Schulqualität erfordern Maßnahmen, die zum einen die Qualität von Schule steigern, zum anderen aber mit weniger Ressourcen als bisher auskommen. De-Implementierung bedeutet auch für Schule, auf Maßnahmen, Tätigkeiten, Programme und Gewohnheiten zu verzichten, die keinen nachweisbaren Nutzen für die Institution bzw. ihre Mitglieder haben. Und sie bedeutet, mit den freiwerdenden Ressourcen in Bereiche zu investieren, auf die es tatsächlich und nachweisbar ankommt.
Fast alle bisher gängigen Konzepte der Schulentwicklung basieren auf Strategien, die eine Steigerung des Ressourcenbedarfs erzeugen. Dieses »Mehr« führt meist zu einer erhöhten Belastung für Lehrerinnen und Lehrer, dabei aber nicht zwangsläufig zu einer Verbesserung der Schulqualität – zum Teil sogar zu einer Verschlechterung. Lehrkräften wird suggeriert, die einzige Lösung, einer Überlastung zu begegnen, läge in der Arbeit an persönlicher Resilienz und individueller Stressprävention. Die Möglichkeit, unproduktive Arbeitsabläufe und wirkungslose Interventionen und Projekte in den Blick zu nehmen, wird dabei sehr häufig ignoriert.
Die Antwort auf die Frage »Warum De-Implementierung?« lautet also im Kern: Weil durch das Weglassen von unnötigen oder unsinnigen Dingen die Möglichkeit entsteht, die essenziellen Dinge besser machen zu können. Und zu den essenziellen Dingen gehört auch die Regeneration der Beschäftigten.
Die zentralen Ziele der De-Implementierung im System Schule sind (in Anlehnung an Schoeffel & Rosenbrock, 2022):
♦
Lehrerinnen und Lehrern Zeit zurückzugeben, die sie nutzen können, um sich auf effektives Unterrichten und die Unterstützung ihrer Schülerinnen und Schüler zu konzentrieren,
♦
Programme und Initiativen zu entfernen, die geringe, keine oder unerwünschte Effekte haben,
♦
die Verringerung benötigter materieller, zeitlicher und personeller Ressourcen und
♦
die Reallokation von Ressourcen hin zu nützlichen Tätigkeiten.
»Less is more«, »Reduce to the max« und »Choosing wisely« sind Slogans, die komprimiert ausdrücken, dass ein »Weniger« nicht automatisch einen Verlust bedeutet, sondern dass gerade durch die Reduzierung und intelligente Auswahl von Dingen, in die Ressourcen investiert werden, Freiräume entstehen und Qualität steigen kann – und das bei besseren und der Gesundheit zuträglicheren Bedingungen für alle Beteiligten. Dieses Buch richtet sich folglich an Menschen, die nicht lernen wollen, besser mit Stress umzugehen, sondern an Menschen, die weniger Stress erleben wollen.
Wir möchten zunächst erläutern, wie sich aus den allgemeinen Entwicklungen von Schulqualität und der Beanspruchung von Lehrerinnen und Lehrern eine dringende Notwendigkeit von De-Implementierungsprozessen ergibt. Nach einer Klärung und Einordnung des Begriffs »De-Implementierung« wird auf Hürden und Hemmnisse eingegangen, die sich im Rahmen dieser Art der Veränderung insbesondere im schulischen Kontext ergeben können, da das Erkennen und Reflektieren dieser Hürden und Hemmnisse die wichtigste Voraussetzung für ein erfolgreiches Vorgehen sind. Im Kapitel 5 (▸ Kap. 5) funktioniert« gehen wir auf drei wesentliche Prozessschritte der De-Implementierung ein, nämlich die Erkennung von dysfunktionalen Praktiken, deren Entfernung und die dauerhafte Aufrechterhaltung dieser Entfernung. Im letzten Teil, dem Leitfaden zur praktischen Umsetzung, stellen wir Ihnen verschiedene konkrete Vorgehensweisen vor, einmal für schulübergreifende und einmal für individuelle De-Implementierungsprozesse.
2 Ausgangslage: Wie immer mehr dazukommt und Schule trotzdem nicht besser wird
Inhalte und Ziele
Bevor es im nächsten Kapitel um den Begriff der De-Implementierung geht, soll in diesem Kapitel zunächst gezeigt werden, warum Schulentwicklung in Deutschland zwar von einer unüberschaubar hohen Zahl an Implementationen geprägt ist, diese Implementationen aber in vielen Fällen nicht die gewünschten Effekte erzielen. Während die Leistungsfähigkeit des Schulsystems abgenommen hat, nahm die berufliche Beanspruchung von Lehrerinnen und Lehrern in den letzten zehn Jahren kontinuierlich zu.
Ziel dieses Kapitels ist es zu erläutern, warum die Ressourcen, die für Schulentwicklung in der jetzigen Form aufgewendet werden, in vielen Fällen fehlgeleitet sind und warum sich daraus die Notwendigkeit für De-Implementierungsprozesse ergibt.
2.1 Die »Mehr ist besser«-Logik
In der wegweisenden Studie People systematically overlook subtractive changes (Adams et al., 2021) wurde untersucht, warum Menschen dazu neigen, Formen der Veränderung zu bevorzugen, bei denen Komponenten hinzugefügt werden, und solche Veränderungen zu übersehen, bei denen Komponenten entfernt werden. In der Laborstudie wurden verschiedene Experimente durchgeführt, bei denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Veränderungen vornehmen mussten, um jeweils eine Verbesserung in Bezug auf einen Ausgangszustand herbeizuführen. Dabei wurde beobachtet, welche Ansätze die Versuchspersonen wählen.
Bei jeder Aufgabe hatten die Versuchspersonen grundsätzlich die Möglichkeit, entweder durch Addition oder Subtraktion von einzelnen Komponenten zum Ziel zu gelangen. In einem der Experimente mussten die Probanden beispielsweise eine Klemmbaustein-Konstruktion so stabilisieren, dass diese einen Ziegelstein tragen kann (Abb. 1). Die vorgegebene ursprüngliche Struktur konnte den Ziegelstein nicht tragen, da sie nur in einer Ecke gestützt wurde, ähnlich wie bei einem einbeinigen Tisch. Den Versuchspersonen wurde mitgeteilt, dass sie die Struktur nach Belieben verändern konnten. Sie konnten Stützen für die anderen drei Ecken hinzufügen, um die Stabilität herzustellen. Sie konnten aber auch einfach die Stütze in der einen Ecke entfernen, wodurch die Konstruktion eben aufsaß und den Ziegelstein tragen konnte. Das Experiment wurde unter zwei Bedingungen durchgeführt: Unter Bedingung 1 erwähnten die Anweisungen die Addition (»jedes hinzugefügte Teil kostet zehn Cent«), aber die Subtraktion wurde nicht erwähnt. Unter Bedingung 2 erwähnten die Anweisungen sowohl die Addition als auch die Subtraktion (»jedes hinzugefügte Teil kostet zehn Cent, aber das Entfernen von Teilen ist kostenlos).
Abb. 1:Versuchsaufbau von Adams et al. (2021), nachgebaut anhand der Studienbeschreibung
Die Studie zeigt, dass Menschen systematisch dazu neigen, additive Veränderungen zu bevorzugen, indem sie neue Komponenten hinzufügen, anstatt bestehende zu entfernen. Im Klemmbaustein-Experiment fügten die meisten Versuchspersonen Steine hinzu und bauten eine oder mehrere zusätzliche Stützen. Menschen vernachlässigen subtraktive Veränderungen auch dann, wenn diese additiven Veränderungen überlegen sind oder zu geringeren Kosten oder geringerem Aufwand führen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass Personen subtraktive Veränderungen verwenden, kann jedoch durch cues, also Hinweise, beeinflusst werden. Explizite Hinweise darauf, dass subtraktive Optionen möglich sind, führen dazu, dass solche Veränderungen mit höherer Wahrscheinlichkeit in Betracht gezogen werden. Dies deutet darauf hin, dass die Aufmerksamkeit von außen auf subtraktive Optionen gelenkt werden kann. Außerdem zeigte sich, dass sich die Identifizierung zielführender subtraktiver Strategien durch Übung verbessern lässt.
Bei hoher kognitiver Beanspruchung sinkt dagegen die Wahrscheinlichkeit, dass subtraktive Veränderungen herangezogen werden. Dies legt nahe, dass kognitive Ressourcen eine Rolle dabei spielen, ob Menschen dazu neigen, additive oder subtraktive Ansätze zu verfolgen. Wenn Menschen mehr Gelegenheiten geboten wurden, die Unzulänglichkeiten ihrer additiven Ansätze zu erkennen (durch wiederholtes Suchen), waren sie eher bereit, subtraktive Veränderungen vorzunehmen.
Zusammenfassend zeigt die Studie:
♦
Wenn Menschen einen Zustand verbessern sollen, operieren sie in der Regel nach dem Prinzip »mehr ist besser« und übersehen subtraktive Lösungen, die zu gleichguten oder besseren Ergebnissen führen würden.
♦
Die Generierung subtraktiver Lösungen kann durch Hinweise, dass diese existieren, gefördert werden.
♦
Das Generieren subtraktiver Lösungen kann durch Übung gefördert werden.
♦
Im Zustand hoher kognitiver Auslastung sinkt die Wahrscheinlichkeit, subtraktive Lösungen zu generieren.
2.2 Schule wird nicht besser ...
Die »Mehr ist besser«-Logik findet sich in der Entwicklung des Systems Schule in den letzten 50 Jahren deutlich erkennbar wieder.
Im Jahr 1979 veröffentlichte der britische Soziologe Michael Rutter unter dem Titel Fifteen thousand hours: Secondary schools and their effects on children eine wegweisende Studie zum Einfluss der Schule auf die Entwicklung junger Menschen (Rutter, 1979). Rutter und sein Team fanden heraus, dass die Schule einen erheblichen Einfluss auf die kognitiven Fähigkeiten und sozialen Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern hat. Zusammengefasst mit dem Slogan »Schools matter« wurde Rutters Studie zum Ausgangspunkt dessen, was heute als Schulentwicklung bezeichnet wird.
In den 1980er Jahren vollzog sich ausgehend von Rutters Studie auch in Deutschland ein Paradigmenwechsel: Schulentwicklung wurde nicht länger als zentralistische Steuerung durch übergeordnete Instanzen aufgefasst, sondern mehr als Aufgabe der einzelnen Schulen mit ihren jeweiligen Besonderheiten (Fend, 1986). Um die Jahrtausendwende wurde dann durch die ersten Schulleistungsstudien TIMSS und PISA der bis dahin vorherrschende Glaube an die hohe Leistungsfähigkeit und Überlegenheit des deutschen Schulsystems zutiefst erschüttert. Es wurde klar, dass das deutsche Schulsystem im internationalen Vergleich keine überdurchschnittlichen oder gar herausragenden Leistungen von Schülerinnen und Schülern produziert und zudem Bildungsungerechtigkeit in Form der Abhängigkeit schulischer Erfolge vom sozioökonomischen Status des Elternhauses nicht ausgleicht, sondern sogar verstärkt. Im Jahr 2004 erklärte die Kultusministerkonferenz Schulentwicklung zur eigenständigen Aufgabe von Lehrerinnen und Lehrern (KMK, 2004). Damit wurde Schulentwicklung für alle zu einem Bestandteil ihrer Arbeit mit verpflichtendem Charakter.
Schulentwicklung wird heute als ein Oberbegriff für Verfahren verstanden, die es ermöglichen, die Qualität und die Qualitätssicherung von Schulen systematisch zu verbessern und zu gewährleisten (Burow et al., 2008). Daher ist die zentrale Frage die, inwieweit Schulentwicklung tatsächlich zu systematischen Verbesserungen führt.
Leider ist eine Antwort auf diese Frage kaum möglich, denn das, was in Deutschland als Schulentwicklungsforschung bezeichnet wird, liefert dazu kaum Daten. Über Kausalzusammenhänge zwischen Maßnahmen der Schulentwicklung und der systematischen Verbesserung von Schule können schlicht keine Aussagen getroffen werden, da dazu keine empirischen Forschungsergebnisse vorliegen, die geeignet sind, solche Zusammenhänge zu belegen.
Um zumindest einen groben Eindruck darüber zu erhalten, wie gut Schulentwicklung in Deutschland in den letzten zehn Jahren funktioniert hat, bleibt daher nur die Möglichkeit, sich verschiedene Längsschnittdaten aus Untersuchungen anzusehen, die Leistungsmerkmale von Schulen im zeitlichen Verlauf untersucht haben. Aus diesen lassen sich zwar keine Kausal- oder Wirkungszusammenhänge ableiten, aber sie können einen Eindruck vermitteln, ob die gewünschten systematischen Verbesserungen zu beobachten waren und sind.
Das erste relevante Merkmal, zu dem Längsschnittdaten vorliegen, sind die Ergebnisse der PISA-Untersuchungen (Abb. 2). Hier werden die Kompetenzen von 15-jährigen Schülerinnen und Schülern in den Bereichen Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften erhoben (Der Mittelwert der PISA-Skala liegt bei 500, die Standardabweichung bei 100).
Abb. 2:Leistungsergebnisse von 15-jährigen Schülerinnen und Schülern in den PISA-Untersuchungen. Quelle: OECD
Die Schulentwicklung der letzten zehn Jahre hat im Durchschnitt nicht zu Leistungssteigerungen von Schülerinnen und Schülern in wesentlichen Kompetenzbereichen geführt. Diese sind sogar signifikant gesunken.
Weitere Längsschnittdaten liegen für Basiskompetenzen von Grundschülerinnen und Grundschülern im Rahmen des IQB-Bildungstrends vor (Abb. 3). Mindeststandards beziehen sich auf ein definiertes Minimum an Kompetenzen, das alle Schülerinnen und Schüler bis zu einem bestimmten Bildungsabschnitt erreicht haben sollten. Sie beschreiben ein Bildungsminimum am Ende der Primarstufe (Bremerich-Vos et al., 2010). Der Anteil von Grundschülerinnen und Grundschülern, die dieses Bildungsminimum nicht erreichen, ist seit 2011 für Lesen, Zuhören, Orthografie und Mathematik signifikant angestiegen.
Abb. 3:Anteil der Schülerinnen und Schüler im Primarbereich, die den jeweiligen Mindeststandard nicht erreichen. Quelle: IQB
Die Schulentwicklung der letzten zehn Jahre hat folglich im Durchschnitt nicht zu einer besseren Förderung benachteiligter Schülerinnen und Schüler in wesentlichen Kompetenzbereichen geführt.
Die »Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft« des Instituts der Deutschen Wirtschaft erhebt in ihrem Bildungsmonitor längsschnittlich verschiedene Merkmale von Schulen. Ein Merkmal ist das der Schulqualität, das sich aus mehreren Indikatoren zusammensetzt. Diese Indikatoren sind Schülerinnen- und Schülerleistungen in verschiedenen Vergleichsstudien. Die Längsschnittdaten für das Merkmal »Schulqualität« sind in Abb. 4 grafisch dargestellt.
Abb. 4:Schulqualität im ISNM-Bildungsmonitor. Quelle: ISNM
Die Schulentwicklung der letzten zehn Jahre hat im Durchschnitt nicht zu einer Steigerung der Schulqualität im Sinne der Steigerung von messbaren Lernerfolgen geführt. Die durchschnittliche Leistungsfähigkeit der Schulen in Deutschland hat signifikant abgenommen.
2.3 ... obwohl immer mehr dazukommt
Neben der Frage nach der Leistungsfähigkeit des Schulsystems stellt sich als zweite zentrale Frage, wie es den Menschen im Schulsystem geht. In Bezug auf Lehrerinnen und Lehrer können zu dieser Frage Längsschnittdaten herangezogen werden.
Viele Menschen in diesem Beruf haben permanent das Gefühl, dass immer noch mehr möglich wäre. Neben der vagen Definition dessen, was zu den beruflichen Aufgaben gehört, geben Bildungspläne und Verordnungen einen in vielerlei Hinsicht offenen Rahmen dafür vor, wie Lehrerinnen und Lehrer ihren Arbeitsauftrag definieren können (Hillert et al., 2013).
Zur Gesundheit von Personen in Lehrberufen stellt der BKK-Dachverband in seinem jährlichen Gesundheitsreport Daten zur Verfügung. Pro 100 Beschäftigter stieg die Anzahl der Tage, die Mitglieder dieser Berufsgruppe auf Grund von psychischen Störungen (darunter Erschöpfungsdepressionen und Burnout) arbeitsunfähig gemeldet waren, von 2016 bis 2022 im Durchschnitt um 83,3 Tage an (Abb. 5).
Abb. 5:Arbeitsunfähigkeitstage von Personen in Lehrberufen auf Grund von psychischen Erkrankungen (pro 100 Beschäftigte). Quelle: BKK-Dachverband
Die Anzahl der Tage, die Lehrende auf Grund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen arbeitsunfähig gemeldet waren, stieg zwischen 2016 und 2022 im Durchschnitt um 7,3 Tage an, allerdings mit einer Abnahme zwischen 2018 und 2021 (Abb. 6).
Abb. 6:Arbeitsunfähigkeitstage von Personen in Lehrberufen auf Grund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen (pro 100 Beschäftigte). Quelle: BKK-Dachverband
Seit 2016 hat sich die Gesundheit von Lehrerinnen und Lehrern im Durchschnitt verschlechtert. Erkrankungen, die typischerweise als Folgen von beruflicher Belastung aufgefasst werden (Schaarschmidt & Kieschke, 2013), haben seit 2016 zugenommen.
Das Schulbarometer von 20241 zeigt, dass sich 36 Prozent der Lehrenden mehrmals pro Woche erschöpft fühlen. Unter den häufigsten Nennungen von Belastungsfaktoren im Lehrerinnen- und Lehrerberuf finden sich Arbeitsbelastung und Zeitmangel (28 %), Personalmangel (26 %) sowie Bildungspolitik und Bürokratie (21 %).