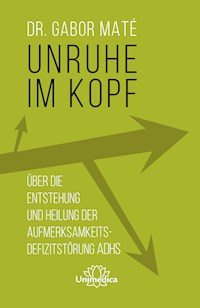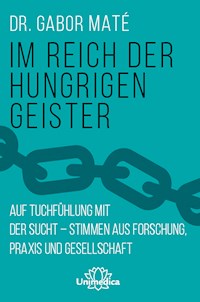Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Unimedica ein Imprint der Narayana Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein Must-read für Patienten und Ärzte: Es kann Leben retten. – Peter Levine, Bestseller-Autor Kann ein Mensch buchstäblich an Einsamkeit sterben? Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Fähigkeit, Gefühle auszudrücken, und Alzheimer? Gibt es so etwas wie eine „Krebspersönlichkeit“? Das Buch WENN DER KÖRPER NEIN SAGT von DR. GABOR MATÉ stützt sich auf wissenschaftliche Forschungsergebnisse und die jahrzehntelange Erfahrung des Autors als praktizierender Arzt. Das Buch gibt Antworten auf diese und andere wichtige Fragen zur Bedeutung der Leib-Seele-Einheit in Bezug auf Krankheit und Gesundheit sowie auf die Rolle, die Stress, Stressbewältigung und die individuelle emotionale Verfassung bei vielen häufig vorkommenden Krankheiten spielen. Klug und einfach nachvollziehbar liefert der Autor: Antworten auf die Rolle der Körper-Geist-Verbindung bei Krankheiten wie Arthritis, Krebs, Diabetes, Herzerkrankungen, Alzheimer, Reizdarmsyndrom und Multipler Sklerose zahlreiche aufschlussreiche Fallstudien und Geschichten von bekannten Persönlichkeiten wie Betty Ford (Brustkrebs), Ronald Reagan (Alzheimer) und Lance Armstrong (Hodenkrebs) 7 Prinzipien zu Prävention und Heilung von Krankheitsbildern WENN DER KÖRPER NEIN SAGT vermittelt neue Kenntnisse und verbessert die Heilchancen von Betroffenen. Es lehrt unter einer Krankheit zu verstehen, dass der Körper ab einem gewissen Punkt nein zu dem sagt, was der Geist nicht einmal wahrnimmt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 582
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DR. GABOR MATÉ
WENN DER KÖRPER NEIN SAGT
WIE VERBORGENER STRESS KRANK MACHT – UND WAS SIE DAGEGEN TUN KÖNNEN
Dr. Gabor Maté
Wenn der Körper Nein sagt
Wie verborgener Stress krank macht – und was Sie dagegen tun können
1. deutsche Auflage 2020
2. deutsche Auflage 2020
3. deutsche Auflage 2020
ISBN 978-3-96257-175-7
© Narayana Verlag 2020
Titel der englischen Originalausgabe:
When the Body Says No: The Cost of Hidden Stress
Copyright©2003 by Gabor Maté, this translation published by arrangement with Alfred A. Knopf Canada, a division of Penguin Random House Canada Limited and Liepman AG.
Translated from the English language: WHEN THE BODY SAYS NO
First published in Canada by Alfred A. Knopf Canada in 2003
Übersetzt aus dem Englischen von Annegret Hunke-Wormser
Cover Design: Andrew Roberts
Coverlayout: Narayana Verlag GmbH
Herausgeber: Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2,
79400 Kandern, Tel.: +49 7626 974970-0
E-Mail: [email protected], www.narayana-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Genehmigung des Verlags darf kein Teil dieses Buches in irgendeiner Form – mechanisch, elektronisch, fotografisch – reproduziert, vervielfältigt, übersetzt oder gespeichert werden, mit Ausnahme kurzer Passagen für Buchbesprechungen.
Sofern eingetragene Warenzeichen, Handelsnamen und Gebrauchsnamen verwendet werden, gelten die entsprechenden Schutzbestimmungen (auch wenn diese nicht als solche gekennzeichnet sind).
Die Empfehlungen in diesem Buch wurden von Autor und Verlag nach bestem Wissen erarbeitet und überprüft. Dennoch kann eine Garantie nicht übernommen werden. Weder der Autor noch der Verlag können für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den im Buch gegebenen Hinweisen resultieren, eine Haftung übernehmen.
Ich widme dieses Buch dem Gedenken an meine Mutter, Judith Lövi, 1919–2001. Und dem Gedenken an Dr. Hans Selye, einen Mann der Renaissance im 20. Jahrhundert, dessen wissenschaftliche Erkenntnisse und menschliche Weisheit weiterhin für Erleuchtung sorgen.
INHALT
An den Leser
KAPITEL 1 Das Bermudadreieck
KAPITEL 2 Das kleine Mädchen – zu gut, um wahr zu sein
KAPITEL 3 Stress und emotionale Kompetenz
KAPITEL 4 Lebendig begraben
KAPITEL 5 Nie gut genug
KAPITEL 6 Du gehörst auch dazu, Mom
KAPITEL 7 Stress, Hormone, Verdrängung und Krebs
KAPITEL 8 Am Ende wird etwas Gutes dabei herauskommen
KAPITEL 9 Gibt es eine „Krebspersönlichkeit“?
KAPITEL 10 Die 55-Prozent-Lösung
KAPITEL 11 Alles nur im Kopf
KAPITEL 12 Mein Kopf wird zuerst sterben
KAPITEL 13 Selbst oder Nicht-Selbst: Verwirrung im Immunsystem
KAPITEL 14 Eine subtile Balance: Die Biologie der Beziehungen
KAPITEL 15 Die Biologie des Verlusts
KAPITEL 16 Der Tanz der Generationen
KAPITEL 17 Die Biologie des Glaubens
KAPITEL 18 Die Macht des negativen Denkens
KAPITEL 19 Die sieben Prinzipien der Heilung
Anmerkungen
Bezugsquellen
Danksagung
Index
Es geht nicht darum, etwas zuerst zu sehen, sondern die Errichtung dauerhafter Verbindungen zwischen dem bereits Bekannten und dem bisher Unbekannten macht das Wesen wissenschaftlicher Entdeckungen aus. Es ist dieser Prozess des Verknüpfens, der am besten wahres Verständnis und echten Fortschritt fördern kann. Dr. Hans Selye, The Stress of Life
An den Leser
Die Menschen haben immer schon intuitiv verstanden, dass Körper und Geist eine untrennbare Einheit bilden. Die Moderne hat eine bedauernswerte Trennung mit sich gebracht – eine Spaltung von dem, was wir mit unserem ganzen Wesen wissen, und dem, was unser denkender Verstand als Wahrheit akzeptiert. Von diesen beiden Arten des Wissens setzt sich zu unserem Nachteil meistens die letztere, begrenztere Art durch.
Es ist daher eine Freude und ein Privileg, dem Leser die Erkenntnisse der modernen Wissenschaft nahezubringen, die das intuitive Wissen uralter Weisheit bestätigen. Das war mein wichtigstes Ziel, als ich dieses Buch geschrieben habe. Ein weiteres Ziel war es, unserer von Stress getriebenen Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten, damit wir erkennen können, wie wir in vielfältiger Weise unbewusst zur Entstehung von Krankheiten beitragen.
Dies ist kein Anleitungsbuch, aber ich hoffe, dass es dem Leser als Impuls zu einer persönlichen Verwandlung dienen wird. Anleitungen kommen von außen, Verwandlung vollzieht sich im Inneren. Jahr für Jahr erscheinen viele Bücher mit einfachen Anleitungen der einen oder anderen Art – körperlich, emotional, spirituell. Es war nicht meine Absicht, diesen noch ein weiteres hinzuzufügen. Anleitungen gehen davon aus, dass etwas repariert werden muss. Verwandlung fördert die Heilung – das Erlangen der Unversehrtheit, der Ganzheit – dessen, was bereits vorhanden ist. Ratschläge und Anleitungen mögen zwar hilfreich sein, aber noch wertvoller für uns ist das Erkennen, wie wir selbst in unserem Inneren und wie unser Geist und unser Körper funktionieren. Erkennen kann, wenn es von der Suche nach Wahrheit inspiriert ist, die Verwandlung fördern. Für alle, die hier eine heilende Botschaft suchen, beginnt diese Botschaft auf Seite eins mit der allerersten Fallstudie. Der großartige Physiologe Walter Cannon hat darauf hingewiesen, dass unserem Körper eine Weisheit innewohnt. Ich hoffe, dass Wenn der Körper Nein sagt den Menschen helfen wird, sich mit der inneren Weisheit, die wir alle besitzen, in Einklang zu bringen.
Einige der Fallbeispiele in diesem Buch stammen aus veröffentlichten Biografien und Autobiografien namhafter Personen. Die meisten kommen aus meiner klinischen Praxis oder aus aufgezeichneten Gesprächen mit Menschen, die in Bezug auf ihre medizinische und persönliche Vorgeschichte zugestimmt haben, befragt und zitiert zu werden. Zum Schutz der Privatsphäre wurden Namen (und in einigen Fällen auch andere Umstände) geändert.
Damit diese Arbeit für Laien nicht übermäßig theoretisch wurde, habe ich Anmerkungen nur sparsam verwendet. Die Quellenverweise sind für jedes Kapitel am Ende des Buches zu finden.
Die Kursivschrift stammt, sofern nicht anders angegeben, von mir.
Ich freue mich über Kommentare an meine E-Mail-Adresse: [email protected].
KAPITEL 1
Das Bermudadreieck
Mary war eine indigene Frau Anfang vierzig, von kleiner Statur, sanft und respektvoll im Umgang mit anderen. Sie und ihr Mann waren zusammen mit ihren drei Kindern seit acht Jahren meine Patienten. Ihr Lächeln war schüchtern, mit einem Hauch von Selbstironie. Sie lachte schnell. Wenn ihr unverändert jugendliches Gesicht sich aufhellte, war es unmöglich, nicht ebenso freundlich darauf zu reagieren. Wenn ich an Mary denke, wird mir immer noch warm ums Herz — und es zieht sich vor Kummer zusammen.
Mary und ich hatten nie viel geredet, bis sich die ersten Anzeichen der Krankheit, an der sie auch sterben sollte, bemerkbar machten. Anfangs war alles noch ganz harmlos: Eine kleine, durch eine Nähnadel verursachte Wunde an einer ihrer Fingerkuppen wollte monatelang nicht heilen. Zurückgeführt wurde das Problem auf das Raynaud-Phänomen, bei dem sich die kleinen, die Finger versorgenden Arterien verkrampfen und das Gewebe nicht mehr mit ausreichend Sauerstoff versorgt wird. Es kann dann, wie es bei Mary der Fall war, zu Wundbrand kommen. Trotz mehrerer Krankenhausaufenthalte und chirurgischer Eingriffe bettelte sie nach nicht einmal einem Jahr um eine Amputation, um den pochenden Schmerz in ihrem Finger loszuwerden. Als ihr Wunsch dann erfüllt wurde, hatte die Krankheit sich bereits stark ausgebreitet und selbst starke Betäubungsmittel konnten ihre ständigen Schmerzen nicht mehr lindern.
Das Raynaud-Phänomen kann unabhängig oder im Rahmen anderer Erkrankungen auftreten. Raucher sind einem größeren Risiko ausgesetzt und Mary war seit ihrer Teenagerzeit eine starke Raucherin. Ich hoffte, dass sich die Durchblutung ihrer Finger normalisieren würde, wenn sie damit aufhörte. Nach vielen Rückfällen hatte sie es endlich geschafft. Leider war das Raynaud-Syndrom der Vorbote einer weitaus schlimmeren Erkrankung: Bei Mary wurde Sklerodermie diagnostiziert, eine der Autoimmunerkrankungen, zu denen auch rheumatoide Arthritis, Colitis ulcerosa und systemischer Lupus erythematodes (SLE) gehören. Die Entstehung vieler anderer Krankheitsbilder, beispielsweise Diabetes, Multiple Sklerose und möglicherweise sogar die Alzheimer-Krankheit, wird nicht immer als Autoimmunstörung erkannt. Ihnen allen gemeinsam ist ein Angriff des Immunsystems auf den eigenen Körper, der zu Schäden an den Gelenken, dem Bindegewebe oder fast jedem Organ führen kann, ob es nun die Augen, die Nerven, die Haut, der Darm, die Leber oder das Gehirn sind. Bei der Sklerodermie (das griechische Wort für „verhärtete Haut“) führt der selbstmörderische Angriff des Immunsystems zu einer Versteifung der Haut, der Speiseröhre, des Herzens und des Gewebes in der Lunge sowie in anderen Organen.
Was löst diesen Bürgerkrieg im Körper aus?
In medizinischen Fachbüchern wird ausschließlich auf die biologischen Aspekte eingegangen. In einigen wenigen Fällen werden Toxine als ursächliche Faktoren angeführt, aber meistens geht man davon aus, dass die Krankheit überwiegend durch eine genetische Veranlagung hervorgerufen wird. Die medizinische Praxis spiegelt diese rein auf das Physische beschränkte Sichtweise wider. Weder die Spezialisten noch ich als ihr behandelnder Arzt hatten je darüber nachgedacht, was in Marys Vorgeschichte ebenfalls zu ihrer Krankheit beigetragen haben könnte. Keiner von uns hatte sich für ihren psychischen Zustand vor dem Ausbruch der Krankheit oder dessen Einfluss auf deren Verlauf und endgültigen Ausgang interessiert. Wir hatten einfach jedes einzelne ihrer körperlichen Symptome so behandelt, wie wir es vorfanden: Medikamente gegen Entzündungen und Schmerzen, Operationen zur Entfernung brandigen Gewebes und zur Verbesserung der Blutversorgung, Physiotherapie zur Wiederherstellung der Mobilität.
Eines Tages dann, fast aus einer Laune heraus und als Reaktion auf eine Art Eingebung, dass jemand ihr zuhören müsste, bat ich Mary, sich einen einstündigen Termin geben zu lassen, um mir etwas über sich selbst und ihr Leben erzählen zu können. Als sie anfing zu sprechen, kamen ihre Worte einer Offenbarung gleich. Hinter ihrer bescheidenen, zurückhaltenden Art verbargen sich viele unterdrückte Emotionen. Mary war als Kind missbraucht, im Stich gelassen und von einer Pflegefamilie zur nächsten geschoben worden. Sie erinnerte sich daran, dass sie im Alter von sieben Jahren mit ihren Schwestern im Arm auf dem Dachboden gekauert hatte, während ihre Pflegeeltern sich unten im Haus stritten und gegenseitig anschrien. „Ich war die ganze Zeit über von großer Angst erfüllt“, sagte sie, „musste aber als Siebenjährige meine Schwestern beschützen. Und niemand beschützte mich.“ Sie hatte diese traumatischen Erfahrungen noch nie irgendjemandem offenbart, nicht einmal ihrem Mann, mit dem sie seit 20 Jahren verheiratet war. Sie hatte gelernt, ihre Gefühle mit niemandem zu teilen und tief in ihrem Inneren zu verbergen. Als Kind über sich selbst zu sprechen, verletzlich zu sein und irgendetwas zu hinterfragen, hätte sie in Gefahr gebracht. Für sie bedeutete es Sicherheit, Rücksicht auf die Gefühle anderer Menschen zu nehmen, niemals aber auf ihre eigenen. Sie war in der Rolle gefangen, die man ihr als Kind aufgezwungen hatte. Ihr war nicht klar, dass sie selbst auch das Recht hatte, dass man sich um sie kümmerte, ihr zuhörte und dass sie es wert war, beachtet zu werden.
Mary beschrieb sich selbst als jemanden, der unfähig war, Nein zu sagen, und zwanghaft die Verantwortung für die Bedürfnisse anderer übernahm. Ihre größte Sorge galt weiterhin ihrem Ehemann und ihren fast erwachsenen Kindern, sogar dann noch, als ihre Krankheit sich verschlimmerte. War die Sklerodermie die Art und Weise ihres Körpers, sich schließlich gegen diese allumfassende Pflichtergebenheit zu wehren?
Vielleicht tat ihr Körper, was ihr Geist nicht konnte: sich gegen die unablässigen Erwartungen aufzulehnen, die zuerst dem Kind auferlegt worden waren und die sie sich im Erwachsenenalter selbst auferlegt hatte – andere waren immer wichtiger als sie selbst. Das hatte ich 1993 angedeutet, als ich in meinem allerersten Artikel als medizinischer Kolumnist für The Globe and Mail über Mary schrieb. „Wenn man uns daran gehindert hat zu lernen, Nein zu sagen“, schrieb ich, „sagt es vielleicht irgendwann unser Körper für uns.“ Ich zitierte einige medizinische Fachliteratur, in der über die negativen Auswirkungen von Stress auf das Immunsystem diskutiert wird.
Die Vorstellung, dass die Art und Weise, wie Menschen Emotionen bewältigen, zu Sklerodermie oder anderen chronischen Krankheiten beitragen kann, ist für einige Ärzte ein Gräuel. Eine Spezialistin für rheumatische Erkrankungen in einem größeren kanadischen Krankenhaus schrieb dem Herausgeber einen bissigen Brief, in dem sie nicht nur meinen Artikel anprangerte, sondern auch die Zeitschrift, weil diese ihn abgedruckt hatte. Ich hätte keine Erfahrung, schrieb sie, und hätte keine Forschungsarbeit geleistet.
Dass eine Spezialistin die Verbindung zwischen Körper und Geist abtat, war wenig erstaunlich. Dualismus, der in zwei Hälften spaltet, was eigentlich ein Ganzes ist, durchzieht die Gesamtheit unserer Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit. Wir versuchen, den Körper losgelöst vom Geist zu verstehen. Wir wollen den Menschen – ob nun gesund oder nicht – so sehen, als würde er abgetrennt von der Umgebung, in der er sich entfaltet, lebt, arbeitet, spielt, liebt und stirbt, funktionieren. Diese verborgene Voreingenommenheit ist typisch für die Strenggläubigkeit in der Medizin, die sich die meisten Ärzte während ihrer Ausbildung zu eigen machen und in ihre medizinische Praxis mitnehmen.
Im Gegensatz zu vielen anderen Wissenschaftszweigen muss die Medizin eine wichtige Lehre aus Einsteins Relativitätstheorie noch verinnerlichen: dass die Haltung eines Beobachters das beobachtete Phänomen beeinflusst und sich auf die Ergebnisse der Beobachtung auswirkt. Dem bahnbrechenden ungarisch-kanadischen Stressforscher Hans Selye zufolge bestimmen die ungeprüften Vermutungen des Wissenschaftlers, was er oder sie entdecken wird, und begrenzen diese zugleich. „Den meisten Menschen ist nicht in vollem Umfang klar, inwieweit die Wesensart der wissenschaftlichen Forschung und die daraus gewonnenen Erkenntnisse von den persönlichen Standpunkten der Entdecker abhängen“, schrieb er in Stress beherrscht unser Leben. „In einer Zeit, die in hohem Maße von Wissenschaft und Forschung abhängt, verdient dieser wesentliche Punkt besondere Aufmerksamkeit.“1 Mit dieser ehrlichen und selbstenthüllenden Einschätzung brachte Selye, der selbst Arzt war, eine Wahrheit zum Ausdruck, die auch heute noch, viele Jahrzehnte später, nur wenige Menschen begreifen.
Je spezialisierter Ärzte werden, desto mehr wissen sie über ein Körperteil oder Organ und desto weniger verstehen sie häufig den Menschen, in dem sich dieser Körperteil oder dieses Organ befinden. Die Personen, die ich für dieses Buch befragt habe, berichteten fast alle, dass weder ihre Spezialisten noch ihre Hausärzte sie jemals dazu aufgefordert hatten, den persönlichen, subjektiven Inhalt ihres Lebens zu erforschen. Im Gegenteil, sie hatten eher das Gefühl, dass die meisten Ärzte von einem solchen Dialog abrieten. Wenn ich mit meinen spezialisierten Kollegen über genau diese Patienten sprach, habe ich festgestellt, dass ein Arzt, selbst nach vielen Jahren der Behandlung eines Patienten, über dessen Leben und Erfahrungen außerhalb der engen Grenzen der Krankheit ziemlich wenig wissen kann.
In diesem Buch werde ich über die Auswirkungen von Stress auf die Gesundheit schreiben. Dabei geht es insbesondere um den verborgenen Stress, den wir alle durch unsere frühe Programmierung erzeugen, ein Muster, das so subtil ist und sich so stark eingeprägt hat, dass wir es als Teil unseres wahren Selbst empfinden. Obwohl ich hier ein so breites Spektrum der verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse vorstelle, wie mir in einem Werk für ein Laienpublikum sinnvoll erschien, machen – zumindest für mich – die individuellen Geschichten, die ich mit dem Leser teilen darf, den Kern dieses Buches aus. Daher werden diese Geschichten auch diejenigen am wenigsten überzeugen, die solche Aussagen als „Einzelberichte“ betrachten.
Nur ein intellektueller Luddit würde die enormen Vorzüge leugnen, die der Menschheit durch die gewissenhafte Anwendung wissenschaftlicher Methoden zugutegekommen sind. Aber nicht alle wesentlichen Informationen können im Labor oder durch statistische Analysen bestätigt werden. Nicht alle Aspekte einer Krankheit können auf Fakten reduziert werden, die durch Doppelblindstudien und strikte wissenschaftliche Techniken verifiziert wurden. „Die Medizin sagt uns genauso viel über die bedeutungsvolle Leistung des Heilens, Leidens und Sterbens wie eine chemische Analyse uns etwas über den ästhetischen Wert von Töpferware sagt“, schrieb Ivan Illich in Die Nemesis der Medizin. Wir beschränken uns auf einen sehr engen Raum, wenn wir menschliche Erfahrung und Erkenntnis von anerkanntem Wissen ausschließen.
Uns ist etwas verloren gegangen. Der Kanadier William Osler, einer der großartigsten Ärzte aller Zeiten, hegte bereits im Jahr 1892 den Verdacht, dass es sich bei der rheumatoiden Arthritis, einer mit der Sklerodermie verwandten Krankheit, um eine stressbedingte Störung handelt. Heute lässt die Rheumatologie diese Weisheit praktisch gänzlich außer Acht, obwohl untermauernde wissenschaftliche Belege in den 110 Jahren seit Oslers Erstveröffentlichung seines Textes gesammelt wurden. Genau dahin hat der enge Rahmen des wissenschaftlichen Ansatzes die Ausübung der medizinischen Heilkunde gebracht. Dadurch, dass wir die moderne Wissenschaft zur letzten Instanz unserer Leiden erhoben haben, waren wir zu sehr darauf bedacht, die Erkenntnisse aus vergangenen Zeitaltern auszusondern.
Wie der US-amerikanische Psychologe Ross Buck festgestellt hat, waren Ärzte bis zum Aufkommen der modernen Medizintechnik und der wissenschaftlichen Pharmakologie auf „Placeboeffekte“ angewiesen. Sie mussten in jedem Patienten das Vertrauen auf seine eigenen Heilungskräfte wecken. Um ihn wirksam behandeln zu können, musste ein Arzt dem Patienten zuhören, eine Beziehung zu ihm aufbauen und auch seiner eigenen Intuition vertrauen. Dies sind Qualitäten, über die Ärzte heute nicht mehr zu verfügen scheinen, da wir uns fast ausschließlich auf „objektive“ Maßnahmen, technikbasierte diagnostische Verfahren und „wissenschaftliche“ Heilmittel verlassen.
Deshalb kam die Kritik der Rheumatologin nicht überraschend. Aufrüttelnder war einige Tage später ein anderer – diesmal unterstützender – Leserbrief von Noel B. Hershfield, Professor für klinische Medizin an der Universität von Calgary: „Die neue Fachrichtung der Psychoneuroimmunologie ist inzwischen so weit fortgeschritten, dass von Wissenschaftlern aus vielen Fachbereichen überzeugende Belege dafür vorliegen, dass zwischen dem Gehirn und dem Immunsystem eine enge Verbindung besteht. Das emotionale Befinden eines Individuums und die Reaktion auf anhaltenden Stress können tatsächlich eine Ursache der vielen Krankheiten sein, die medizinisch behandelt werden, deren [Ursprung] jedoch noch nicht bekannt ist. Dazu zählen Krankheiten wie Sklerodermie und die große Mehrheit rheumatischer Erkrankungen, entzündliche Darmerkrankungen, Diabetes, Multiple Sklerose und ganze Heerscharen anderer Krankheitsbilder, die in jedem medizinischen Spezialgebiet vorzufinden sind …“
Die überraschende Entdeckung in diesem Brief war die Existenz eines neuen medizinischen Fachgebietes. Was ist Psychoneuroimmunologie? Wie ich gelernt habe, ist es nicht weniger als die Wissenschaft von den Interaktionen zwischen Körper und Geist, der unauflöslichen Einheit von Emotionen und Physiologie in der menschlichen Entwicklung und in Gesundheit und Krankheit während des gesamten Lebens. Dieses beängstigend komplizierte Wort bedeutet schlicht, dass in diesem Fachgebiet die Art und Weise untersucht wird, wie die Psyche – der Geist und die in ihm enthaltenen Emotionen – mit dem Nervensystem des Körpers interagiert und wie beide wiederum eng mit unserer Immunabwehr verbunden sind. Einige haben dieses neue Fachgebiet als Psychoneuroimmunoendokrinologie bezeichnet, um darauf hinzuweisen, dass das endokrine oder hormonelle System ebenfalls ein Teil unseres Systems der Ganzkörperreaktion ist. Bahnbrechende Forschungsarbeiten decken auf, wie diese Verbindungen bis hinunter zur Zellebene funktionieren. Wir entdecken die wissenschaftliche Grundlage dessen, was wir zuvor bereits wussten und sehr zu unserem Leidwesen vergessen haben.
Viele Ärzte haben im Laufe der Jahrhunderte verstanden, dass Emotionen eine wichtige Rolle spielen, wenn es um die Ursachen von Krankheit oder die Wiederherstellung von Gesundheit geht. Sie haben geforscht, Bücher geschrieben und die herrschende medizinische Ideologie infrage gestellt, aber ihre Ideen, Untersuchungen und Erkenntnisse sind immer wieder in einer Art medizinischem Bermudadreieck untergegangen. Das Verstehen der Körper-Geist-Verbindung früherer Generationen von Ärzten und Wissenschaftlern verschwand, ohne eine Spur zu hinterlassen, als wäre es nie vorhanden gewesen.
In einem 1985 in der Augustausgabe des New England Journal of Medicine erschienenen Leitartikel war es möglich, mit überheblicher Selbstsicherheit zu erklären, dass „es an der Zeit ist zu erkennen, dass unsere Überzeugung, Krankheit spiegele unmittelbar den mentalen Zustand wider, im Wesentlichen volkstümliches Brauchtum ist.“2
Solche negativen Äußerungen sind nicht länger haltbar. Die Psychoneuroimmunologie, die neue Wissenschaft, die Dr. Hershfield in seinem Brief an The Globe and Mail erwähnte, ist zu einem eigenen Forschungsgebiet geworden, selbst wenn ihre Erkenntnisse noch bis in die Welt der medizinischen Praxis vordringen müssen.
Ein kurzer Besuch medizinischer Bibliotheken oder Websites reicht aus, um sich der zunehmenden Flut von Forschungsartikeln, Zeitschriftenartikeln und Lehrbüchern bewusst zu werden, die sich mit den neuen Erkenntnissen auseinandersetzen. Informationen darüber haben viele Menschen auf dem Wege populärwissenschaftlicher Bücher und Zeitschriften erreicht. Das breite Publikum ist den Fachleuten in vielerlei Hinsicht voraus und hält weniger an alten Lehrmeinungen fest. Die Akzeptanz, dass wir nicht so leicht in Teile zerlegt werden können und dass der gesamte, wie ein Wunder erscheinende menschliche Organismus mehr ist als nur die Summe seiner Teile, erscheint ihm weniger bedrohlich.
Das Immunsystem existiert nicht losgelöst von unserer täglichen Erfahrung. So hat sich beispielsweise gezeigt, dass die Immunabwehr, die bei gesunden jungen Menschen normalerweise gut funktioniert, bei Medizinstudenten unter dem Stress der Abschlussprüfungen unterdrückt ist. Noch wichtiger für ihre zukünftige Gesundheit und ihr Wohlbefinden war die Tatsache, dass die negativen Auswirkungen auf das Immunsystem bei den einsamsten Studenten am stärksten waren. In ähnlicher Weise wurde bei einer Gruppe stationärer Psychiatriepatienten Einsamkeit mit einer verminderten Immunaktivität in Verbindung gebracht. Selbst wenn es keine weiteren Forschungsergebnisse gäbe – obwohl uns zahlreiche vorliegen – müssten die langfristigen Auswirkungen von chronischem Stress berücksichtigt werden. Der Prüfungsdruck ist offensichtlich und befristet, aber viele Menschen verbringen unwissentlich ihr gesamtes Leben, als würden sie von einem mächtigen und wertenden Prüfer beobachtet, den sie um jeden Preis zufriedenstellen müssen. Viele von uns leben, wenn nicht allein, dann in emotional unzureichenden Beziehungen, in denen unsere tiefsten Bedürfnisse nicht erkannt oder respektiert werden. Isolation und Stress betreffen viele Menschen, die ihr Leben vermutlich für ziemlich zufriedenstellend halten.
Wie kann sich Stress in Krankheit umwandeln? Stress ist eine komplizierte Kaskade physikalischer und biochemischer Reaktionen auf starke emotionale Stimuli. In physiologischer Hinsicht sind Emotionen elektrische, chemische und hormonelle Entladungen des menschlichen Nervensystems. Emotionen beeinflussen – und werden beeinflusst durch – die Funktion unserer wichtigsten Organe, die Unversehrtheit unserer Immunabwehr und die Arbeitsweise vieler zirkulierender biologischer Substanzen, die zur Steuerung des physischen Zustands unseres Körpers beitragen. Wenn Emotionen unterdrückt werden, wie es bei Marys Suche nach Sicherheit in ihrer Kindheit der Fall war, schwächt dieses Unterbinden die Abwehrkräfte des Körpers gegen Krankheiten. Die Verdrängung, das heißt, Emotionen vom Bewusstsein abzuspalten und sie in den Bereich des Unbewussten zu verbannen, stürzt unsere physiologische Abwehr in Verwirrung, sodass diese Abwehr bei einigen Menschen in die falsche Richtung geht und die Gesundheit eher zerstört als sie zu schützen.
In den sieben Jahren, in denen ich als medizinischer Koordinator der Palliativmedizin am Vancouver Hospital tätig war, habe ich viele Patienten mit chronischen Krankheiten gesehen, deren emotionale Geschichten der von Mary ähnelten. Ähnliche Dynamiken und Arten der Bewältigung lagen bei den Patienten vor, die für eine palliative Therapie zu uns kamen. Sie litten an Krebs oder degenerativen neurologischen Erkrankungen wie Amyotropher Lateralsklerose (ALS, in Nordamerika auch nach dem großartigen Baseballspieler, der ihr erlag, als Lou-Gehrig-Syndrom und in Großbritannien als Motoneuron-Krankheit bekannt). In meiner eigenen Praxis habe ich die gleichen Muster bei Patienten beobachtet, die bei mir in Behandlung waren wegen Multipler Sklerose, entzündlicher Darmerkrankungen wie Colitis ulcerosa und Morbus Crohn, Chronischem Erschöpfungssyndrom, Autoimmunkrankheiten, Fibromyalgie, Migräne, Hautproblemen, Endometriose und vielen anderen Krankheitsbildern. Fast keiner meiner Patienten mit einer schweren Erkrankung hatte in wichtigen Bereichen seines Lebens jemals gelernt, Nein zu sagen. Wenn die Persönlichkeiten einiger Patienten und die Umstände sich auf den ersten Blick auch deutlich von denen Marys zu unterscheiden schienen, war die zugrunde liegende emotionale Verdrängung ein allgegenwärtiger Faktor.
Einer meiner unheilbar kranken Patienten war ein Mann mittleren Alters, der als Geschäftsführer einer Firma tätig war, die Haifischknorpel als Mittel zur Behandlung von Krebs vertrieb. Als er zu uns auf die Station kam, hatte sich sein eigener, erst kürzlich diagnostizierter Krebs bereits in seinem ganzen Körper ausgebreitet. Fast bis zu dem Tag, an dem er starb, aß er weiterhin Haifischknorpel, aber nicht, weil er noch an ihre Wirksamkeit glaubte. Sie rochen faulig – den ekelhaften Geruch konnte man selbst aus einiger Entfernung wahrnehmen – und ich konnte mir unschwer vorstellen, wie sie schmeckten. „Ich hasse es“, sagte er zu mir, „aber mein Geschäftspartner wäre so enttäuscht, wenn ich damit aufhören würde.“ Ich überzeugte ihn davon, dass er alles Recht der Welt hatte, seine letzten Tage zu verbringen, ohne sich für die Enttäuschung eines anderen verantwortlich zu fühlen.
Es ist immer heikel, die Möglichkeit anzusprechen, dass die Art und Weise, wie Menschen in ihrer Lebensführung konditioniert wurden, zu ihrer Krankheit beigetragen haben könnte. Die Verbindung zwischen Verhalten und Folgeerkrankungen liegen in Fällen wie Rauchen und Lungenkrebs auf der Hand, außer vielleicht für die Chefs der Tabakindustrie. Aber solche Verbindungen sind schwerer nachzuweisen, wenn es um Emotionen und das Auftreten von Multipler Sklerose, Brustkrebs oder Arthritis geht. Der Patient ist nicht nur krank, sondern fühlt sich auch noch schuldig, weil er der Mensch ist, der er ist. „Warum schreiben Sie dieses Buch?“, sagte eine 52-jährige Universitätsprofessorin, die wegen Brustkrebs behandelt wurde. Voller Wut sagte sie zu mir: „Meine Gene sind für meinen Krebs verantwortlich, nicht irgendetwas, was ich getan habe.“ „Krankheit und Tod als persönliches Versagen zu betrachten, ist eine besonders unglückliche Form, dem Opfer die Schuld zuzuweisen“, hieß es 1985 im Leitartikel des New England Journal of Medicine. „In einer Zeit, in der Patienten bereits die Last ihrer Krankheit zu tragen haben, sollten sie nicht noch stärker belastet werden, indem sie die Verantwortung für den Ausgang akzeptieren müssen.“
Wir werden zu dieser leidigen Frage der zugewiesenen Schuld noch zurückkehren. Hier möchte ich lediglich anmerken, dass Schuld und Versagen nicht das Thema sind. Solche Begriffe verschleiern nur das Bild. Wie wir sehen werden, ist die Zuweisung von Schuld an den Betroffenen – abgesehen davon, dass sie moralisch unsensibel ist – aus wissenschaftlicher Sicht völlig unbegründet.
In dem Leitartikel im New England Journal of Medicine hat man Schuld und Verantwortung verwechselt. Wir fürchten uns zwar alle vor einer Schuldzuweisung, würden uns aber wünschen, fähig zu sein, achtsamer mit den Umständen in unserem Leben umzugehen, als nur auf sie zu reagieren. In unserem eigenen Leben wollen wir das Sagen haben: Verantwortlich und in der Lage, authentische Entscheidungen zu treffen, wenn es um unser Leben geht. Ohne Achtsamkeit gibt es keine echte Verantwortung. Eine der Schwächen des medizinischen Ansatzes in der westlichen Welt liegt darin, dass wir den Arzt zur einzigen Autorität erhoben haben und der Patient allzu oft nur der Empfänger einer Behandlung oder eines Heilmittels ist. Die Menschen werden der Möglichkeit beraubt, echte Verantwortung zu übernehmen. Niemand von uns trägt Schuld, wenn er krank wird oder stirbt. Jeder von uns kann jederzeit krank werden, aber je mehr wir über uns selbst lernen können, desto weniger neigen wir dazu, zu passiven Opfern zu werden.
Die Verbindungen zwischen Körper und Geist müssen nicht nur für unser Verständnis von Krankheit, sondern auch für unser Verständnis von Gesundheit wahrgenommen werden. Dr. Robert Maunder von der Psychiatrischen Fakultät der University of Toronto hat über die Körper-Geist-Schnittstelle bei Krankheiten geschrieben. „Der Versuch, die Frage nach Stress zu erkennen und zu beantworten“, sagte er zu mir in einem Interview, „führt mit größerer Wahrscheinlichkeit zu einem gesunden Leben, als das Ignorieren dieser Frage.“ Wenn es um Heilung geht, kann jede noch so unwichtig erscheinende Information, jedes kleinste bisschen Wahrheit entscheidend sein. Wenn es eine Verbindung zwischen Emotionen und Physiologie gibt, beraubt man die Menschen eines wichtigen Werkzeugs, wenn man sie nicht darüber informiert.
Und an dieser Stelle sind wir mit der Unzulänglichkeit von Sprache konfrontiert. Selbst wenn man über Verbindungen zwischen Körper und Geist spricht, bedeutet das, dass zwei getrennte Einheiten in gewisser Weise miteinander verbunden werden. Im Leben gibt es eine solche Trennung jedoch nicht. Es gibt keinen Körper, der nicht Geist ist, keinen Geist, der nicht Körper ist. Der Begriff „Körpergeist“ wurde vorgeschlagen, um den realen Zustand zu vermitteln.
Selbst im Westen ist die Körper-Geist-Idee nicht völlig neu. In einem der Dialoge Platons zitiert Sokrates die Kritik eines thrakischen Arztes an seinen griechischen Kollegen: „Aus diesem Grund vermögen die Ärzte von Hellas viele Krankheiten nicht zu heilen, weil sie von dem Zusammenhang nichts wissen. Denn das ist der große Irrtum unserer Zeit, dass die Ärzte bei der Behandlung des menschlichen Körpers die Seele vom Körper trennen.“3 Man kann den Geist und die Seele nicht losgelöst vom Körper sehen, sagte bereits Sokrates fast zweieinhalbtausend Jahre vor dem Aufkommen der Psychoneuroimmunoendokrinologie!
Das Schreiben von Wenn der Körper Nein sagt hat mehr bewirkt, als nur einige der Erkenntnisse zu untermauern, die ich zuerst in meinem Artikel über Marys Sklerodermie geäußert habe. Ich habe sehr viel dazugelernt und habe die Arbeit von Hunderten von Ärzten, Wissenschaftlern, Psychologen und Forschern zutiefst zu schätzen gelernt, die das zuvor unerforschte Terrain von Körper und Geist zugänglich gemacht haben. Die Arbeit an diesem Buch war darüber hinaus eine innere Erforschung der Art und Weise, mit der ich meine eigenen Emotionen verdrängt habe. Anlass zu dieser persönlichen Reise war die Antwort auf die Frage eines Mitglieds der British Columbia Cancer Agency, wo ich die Rolle der emotionalen Verdrängung bei Krebs untersuchen wollte. Bei vielen Menschen mit bösartigen Tumoren schien eine automatische Verleugnung psychischer oder physischer Schmerzen sowie unangenehmer Emotionen wie Wut, Traurigkeit oder Ablehnung vorzuliegen. „Welchen persönlichen Bezug haben Sie zu diesem Thema?“, fragte mich das Mitglied. „Warum interessieren Sie sich für dieses spezielle Thema?“
Die Frage erinnerte mich an einen Vorfall, der sieben Jahre zurücklag. Eines Abends besuchte ich meine 76 Jahre alte Mutter in dem Pflegeheim, in dem sie wohnte. Sie litt an progressiver Muskeldystrophie, einer Erbkrankheit, die zum Abbau der Muskeln führt. Da sie nicht einmal mehr in der Lage war, sich ohne Hilfe aufzusetzen, konnte sie nicht mehr zu Hause wohnen. Ihre drei Söhne und deren Familien besuchten sie regelmäßig bis zu ihrem Tod, der genau zu dem Zeitpunkt kam, als ich anfing, dieses Buch zu schreiben.
Ich humpelte leicht, als ich den Gang im Pflegeheim entlangging. An dem Morgen war ich wegen eines Knorpelrisses in meinem Knie operiert worden, weil ich ignoriert hatte, was mein Körper mir jedes Mal, wenn ich auf Zementboden joggte, in der Sprache des Schmerzes gesagt hatte. Als ich die Tür zum Zimmer meiner Mutter öffnete, ging ich automatisch mit lässigem, normalem Gang zu ihrem Bett, um sie zu begrüßen. Ich verbarg mein Humpeln spontan, bevor ich mir dessen bewusst wurde. Erst später fragte ich mich, was genau mich zu einer so unnötigen Maßnahme bewegt hatte – unnötig, weil meine Mutter gefasst akzeptiert hätte, dass ihr 51-jähriger Sohn 12 Stunden nach einer Operation etwas fußlahm war.
Was war geschehen? Mein automatischer Impuls, meine Mutter sogar in einer so harmlosen Situation vor meinem Schmerz zu schützen, war ein programmierter Reflex, der wenig mit den aktuellen Bedürfnissen von uns beiden zu tun hatte. Diese Verdrängung war eine Erinnerung – eine Reaktivierung einer Dynamik, die sich als Kind in mein Gehirn eingeätzt hatte, bevor ich mir dessen hätte bewusst werden können.
Ich bin sowohl ein Überlebender als auch ein Kind des Völkermords der Nationalsozialisten, da ich die meiste Zeit meines ersten Lebensjahres unter Nazi-Besatzung in Budapest gelebt habe. Meine Großeltern mütterlicherseits wurden in Auschwitz ermordet, als ich fünf Monate alt war. Meine Tante wurde ebenfalls deportiert und wir haben nie wieder etwas von ihr gehört. Und mein Vater war in einem Zwangsarbeiterlager im Dienst der deutschen und der ungarischen Armee. Meine Mutter und ich haben die Monate im Budapester Ghetto nur knapp überlebt. Sie musste sich für einige Monate von mir trennen, da dies die einzige Möglichkeit war, mich vor dem sicheren Tod durch Hunger oder Krankheit zu bewahren. Man benötigt nicht viel Fantasie, um zu verstehen, dass meine Mutter in ihrer Gemütsverfassung und unter dem unmenschlichen Stress, dem sie Tag für Tag ausgesetzt war, nur selten ein zärtliches Lächeln auf den Lippen hatte oder mir die ungeteilte Aufmerksamkeit schenkte, die ein heranwachsendes Kleinkind braucht, um ein Gefühl der Sicherheit und der bedingungslosen Liebe zu entwickeln. Meine Mutter hat mir sogar erzählt, dass sie an vielen Tagen so verzweifelt war, dass nur die Notwenigkeit, sich um mich zu kümmern, sie dazu bewegte, das Bett zu verlassen. Ich habe früh gelernt, dass ich mich um Aufmerksamkeit bemühen musste, meine Mutter so wenig wie möglich belasten durfte und meine Angst und meine Schmerzen am besten unterdrückte.
In einer gesunden Mutter-Kind-Beziehung ist die Mutter in der Lage, ihr Kind zu hegen und zu pflegen, ohne dass dieses sich in irgendeiner Weise darum bemühen muss. Meine Mutter war nicht in der Lage, mir diese bedingungslose Fürsorglichkeit zukommen zu lassen – und da sie weder heilig noch perfekt war, wäre ihr das vermutlich auch ohne die Schrecken, von denen unsere Familie heimgesucht wurde, nicht vollständig gelungen.
Diese Umstände ließen mich zum Beschützer meiner Mutter werden, der sie in erster Linie gegen die Wahrnehmung meines eigenen Schmerzes schützen wollte. Was als automatische defensive Bewältigung des Kleinkindes begann, verhärtete sich schnell zu einem starren Persönlichkeitsmuster, das mich auch noch 51 Jahre später dazu veranlasste, selbst die geringsten körperlichen Beschwerden vor meiner Mutter zu verbergen.
Über mein Projekt Wenn der Körper Nein sagt hatte ich in dieser Form nicht nachgedacht. Dies sollte eine intellektuelle Untersuchung werden, um eine interessante Theorie zu erforschen, die dazu beitragen würde, menschliche Gesundheit und Krankheit zu erklären. Diesen Weg hatten andere schon vor mir beschritten, aber es gab immer noch viel zu entdecken. Die Frage des Ausschussmitglieds brachte mich dazu, mich mit dem Thema der emotionalen Verdrängung in meinem eigenen Leben auseinanderzusetzen. Mir wurde klar, dass mein verstecktes Humpeln nur ein kleines Beispiel war.
Daher beschreibe ich in diesem Buch nicht nur, was ich von anderen oder aus Fachzeitschriften gelernt habe, sondern auch, was ich bei mir selbst beobachtet habe. Die Dynamik der Verdrängung ist in jedem von uns vorhanden. Wir alle verleugnen oder verraten uns mehr oder weniger selbst. Meistens geschieht dies auf eine Art und Weise, die uns nicht mehr bewusst ist als mir, als ich „beschlossen“ habe, mein Humpeln zu verbergen. Wenn es um Gesundheit oder Krankheit geht, ist es nur eine Frage des Grades und auch des Vorhandenseins oder Fehlens anderer Faktoren – wie zum Beispiel Vererbung oder gefährliche Umwelteinflüsse –, die ebenfalls für Krankheiten anfällig machen. Wenn ich also darlege, dass Verdrängung eine Hauptursache von Stress ist und maßgeblich zu Krankheiten beiträgt, zeige ich nicht mit dem Finger auf andere, weil sie „sich selber krank machen“. Ich möchte mit diesem Buch das Lernen und die Heilung fördern, nicht den Quotienten aus Schuld und Scham erhöhen, die in unserer Kultur bereits im Übermaß vorhanden sind. Vielleicht bin ich übermäßig empfindlich, wenn es um Schuld geht, aber das sind die meisten Menschen. Scham ist die tiefste der „negativen Emotionen“, ein Gefühl, das wir fast um jeden Preis vermeiden wollen. Leider beeinträchtigt unsere beständige Angst vor Scham unsere Fähigkeit, die Realität zu sehen.
Obwohl viele Ärzte sich nach besten Kräften bemühten, erlag Mary im Vancouver Hospital acht Jahre nach ihrer Diagnose den Komplikationen ihrer Sklerodermie. Trotz ihres schwachen Herzens und erschwerter Atmung behielt sie bis zum Schluss ihr sanftes Lächeln bei. Ab und zu bat sie mich, lange private Besuche einzuplanen, sogar noch in ihren letzten Tagen im Krankenhaus. Sie wollte einfach nur reden, über ernste und über belanglose Themen. „Sie sind der Einzige, der mir je zugehört hat“, sagte sie einmal.
Ich habe mich manchmal gefragt, wie Marys Leben verlaufen wäre, wenn jemand da gewesen wäre, der ihr zugehört, sie gesehen und verstanden hätte, als sie ein kleines Kind war – missbraucht, verängstigt und die Last der Verantwortung für ihre kleinen Schwestern auf den Schultern tragend. Vielleicht hätte sie, wenn fortwährend und verlässlich jemand da gewesen wäre, lernen können, sich selbst wertzuschätzen, ihre Gefühle zum Ausdruck zu bringen und ihren Ärger laut werden zu lassen, wenn jemand ihre physischen oder emotionalen Grenzen überschritt. Wäre sie noch am Leben, wenn das ihr Schicksal gewesen wäre?
KAPITEL 2
Das kleine Mädchen – zu gut, um wahr zu sein
Es wäre untertrieben zu sagen, dass Natalie im Frühling und Sommer des Jahres 1996 unter Stress litt. Im März wurde ihr 16 Jahre alter Sohn nach einem sechsmonatigen Aufenthalt aus einem Rehabilitationszentrum für Drogenabhängige entlassen. Er hatte in den zwei Jahren zuvor Drogen und Alkohol konsumiert und war wiederholt vom Schulunterricht ausgeschlossen worden. „Wir waren froh, dass er einen Platz in dem Programm für stationäre Behandlung bekommen hat“, sagt die 53-jährige ehemalige Krankenschwester. „Er war erst kurze Zeit zu Hause, als zuerst bei meinem Mann und dann bei mir medizinische Probleme diagnostiziert wurden.“ Im Juli wurde ihr Mann Bill wegen eines bösartigen Darmtumors operiert. Nach der Operation teilte man ihnen mit, dass sich der Krebs bis in die Leber ausgebreitet hatte.
Natalie hatte von Zeit zu Zeit an Erschöpfung, Benommenheit und Ohrengeräuschen gelitten, aber die Symptome hatten immer nur kurze Zeit angehalten und waren ohne Behandlung wieder verschwunden. In dem Jahr vor ihrer Diagnose war sie müder gewesen als gewöhnlich. Nach einem Schwindelanfall im Juni wurde ein CT-Scan durchgeführt, mit negativem Ergebnis. Zwei Monate später zeigte eine MRT-Untersuchung von Natalies Gehirn die typischen Anomalien, die bei Multipler Sklerose auftreten: Schwerpunktmäßige Entzündungsherde, in denen das Myelin – die unsere Nervenfasern umhüllende Fettschicht – geschädigt und vernarbt war.
Multiple Sklerose (aus dem Griechischen für „verhärten“) ist die häufigste der sogenannten demyelinisierenden Erkrankungen, die die Funktionsweise der Zellen im zentralen Nervensystem beeinträchtigen. Die Symptome hängen davon ab, wo die Entzündungen und Verhärtungen auftreten. Die wichtigsten betroffenen Bereiche sind in der Regel das Rückenmark, der Hirnstamm und der Sehnerv – das Nervenfaserbündel, das visuelle Informationen zum Gehirn transportiert. Liegt der geschädigte Bereich irgendwo im Rückenmark, sind die Symptome Taubheit, Schmerzen oder andere unangenehme Empfindungen in den Gliedmaßen oder im Rumpf. Auch unwillkürliche Bewegungen oder eine Schwäche der Muskeln kann die Folge sein. Im unteren Bereich des Gehirns kann der Verlust der Myelinschicht zu Doppelsehen oder Sprach- oder Gleichgewichtsproblemen führen. Patienten mit Optikusneuritis – Entzündung des Sehnervs – erleiden einen vorübergehenden Verlust der Sehkraft. Erschöpfung – das Gefühl überwältigender Abgeschlagenheit, die weit über die gewöhnliche Müdigkeit hinausgeht – ist ein häufiges Symptom.
Natalies Benommenheit hielt auch im Herbst und frühen Winter weiter an, während sie ihren Mann pflegte, der sich von seiner Darmoperation und einer zwölfwöchigen Chemotherapie erholten musste. Danach konnte Bill eine Zeit lang seinen Beruf als Immobilienmakler wieder ausüben, bis im Mai 1997 eine zweite Operation durchgeführt wurde, um die Tumore in seiner Leber zu entfernen.
„Nach der Resektion, bei der sie 75 Prozent seiner Leber entfernten, bekam Bill ein Blutgerinnsel in der Pfortader, an dem er hätte sterben können“, sagt Natalie. „Er war danach sehr verwirrt und kampflustig.“ Bill starb im Jahr 1999, aber zuvor setzte er seine Frau einem noch größeren emotionalen Leid aus, als sie hätte vorhersehen können.
Forscher in Colorado untersuchten hundert Personen mit der Art von MS, die als schubförmig remittierend bezeichnet wird und bei der sich Krankheitsschübe mit symptomfreien Perioden abwechseln. An genau dieser Art von MS litt auch Natalie. Bei Patienten, die extremsten Belastungen ausgesetzt waren, zum Beispiel einer größeren Beziehungskrise oder finanzieller Unsicherheit, war die Wahrscheinlichkeit einer Verschlimmerung der Krankheit viermal so hoch.1
„Weihnachten 1996 war mir immer noch sehr schwindelig, aber danach war zu fast 100 Prozent alles wieder gut“, berichtet Natalie. „Nur mein Gang war ein wenig unsicher. Und trotz all der Probleme mit Bills Leberresektion – zwischen Juli und August musste ich ihn viermal in die Notaufnahme bringen – ging es mir gut. Es sah so aus, als ob Bill es schaffen würde, und wir hofften, dass keine weiteren Komplikationen auftreten würden. Dann hatte ich einen neuen Krankheitsschub.“ Dieser Schub kam, als Natalie annahm, sie könne sich ein wenig entspannen, wenn ihre Dienste nicht länger dringend gebraucht würden.
„Mein Mann gehörte zu den Menschen, die das Gefühl haben, sie müssen nichts tun, was sie nicht tun wollen. Er war schon immer so gewesen. Wenn er krank war, schien es ihm nur logisch, einfach überhaupt nichts zu tun. Er setzte sich aufs Sofa und schnippte mit den Fingern – und wenn er schnippte, musste man springen. Sogar die Kinder wurden langsam ungeduldig. Im Herbst dann, als es ihm besser ging, schickte ich ihn mit einigen Freunden für einige Tage aus der Stadt. Ich sagte: ‚Er muss einfach mal rauskommen.‘“
„Und was mussten Sie einfach mal?“, frage ich.
„Ich hatte die Nase voll. Ich sagte: ‚Nehmt ihn mit und spielt ein paar Tage Golf‘, und einer seiner Freunde kam und holte ihn ab. Zwei Stunden später wusste ich, dass ich einen neuen Schub hatte.“
Was hatte sie aus dieser Erfahrung gelernt? „Nun“, sagt Natalie zögerlich, „dass ich wissen muss, wann ich mich aus meinem Hilfemodus zurückziehen muss. Aber ich kann es einfach nicht. Wenn jemand Hilfe braucht, muss ich helfen.“
„Egal, wie es Ihnen damit geht?“
„Ja. Fünf Jahre später habe ich immer noch nicht gelernt, dass ich mit meinen Kräften haushalten muss. Mein Körper sagt häufig Nein und ich mache einfach weiter. Ich lerne es nicht.“
Natalies Körper hatte während ihrer gesamten Ehe viele Gründe, Nein zu sagen. Bill war ein starker Trinker und brachte sie oft in Verlegenheit. „Wenn er ein wenig zu viel getrunken hatte, wurde er gemein“, sagt sie. „Er fing an zu streiten, wurde aggressiv und verlor die Beherrschung. Wenn er sich auf einer Party über irgendetwas aufregte, machte er die Leute grundlos in aller Öffentlichkeit zur Schnecke. Ich drehte mich dann einfach um und ging weg, und dann war er wütend auf mich, weil ich ihn nicht unterstützt hatte. Ich wusste innerhalb von 48 Stunden, nachdem ich die Diagnose MS bekommen hatte, dass Bill nicht für mich da sein würde.“
Aus seinem Golfurlaub zurückgekehrt, ging es Bill einige Monate lang körperlich sehr gut. Er hatte eine Beziehung mit einer anderen Frau, einer Freundin der Familie. „Ich dachte damals, schau mal, was ich für dich getan habe“, sagt Natalie. „Ich habe meine eigene Gesundheit aufs Spiel gesetzt. Ich war den ganzen Sommer über für dich da. Du warst dem Tod sehr nahe und ich habe 72 Stunden in diesem Krankenhaus gesessen und darauf gewartet zu erfahren, ob du stirbst oder dich erholst. Ich habe mich um dich gekümmert, als du wieder zu Hause warst, und das ist nun der Dank dafür. Ich bekomme einen Tritt.“ Die Idee, dass psychischer Stress das Risiko für Multiple Sklerose erhöht, ist nicht neu. Die erste umfassende klinische Beschreibung Multipler Sklerose stammt von dem französischen Neurologen Jean-Martin Charcot. Patienten, so berichtete er in einem im Jahr 1868 gehaltenen Vortrag, sehen häufig einen Zusammenhang zwischen „lang anhaltendem Kummer oder Ärger“ und dem Auftreten von Symptomen. Fünf Jahre später beschrieb ein britischer Arzt einen Fall, der ebenfalls mit Stress in Verbindung stand: „Ätiologisch ist es wichtig zu erwähnen, dass das arme Geschöpf in einem vertraulicheren Gespräch der Krankenschwester gegenüber äußerte, der Grund für ihre Krankheit liege darin, ihren Ehemann mit einer anderen Frau im Bett erwischt zu haben.“2
Ich habe für dieses Buch neun Personen mit MS interviewt, acht davon sind Frauen. (Etwa 60 Prozent der Betroffenen sind Frauen.) Die emotionalen Muster in Natalies Geschichte sind bei jedem Einzelnen von ihnen erkennbar, wenn auch nicht immer in so dramatischer Form.
Die aus meinen Interviews gesammelten Erkenntnisse stammen mit den veröffentlichten Forschungsergebnissen überein. „Viele, die diese Krankheit erforscht haben, haben den klinischen Eindruck geäußert, emotionaler Stress könne in irgendeiner Form mit der Entstehung von MS zu tun haben“, wurde in einem wissenschaftlichen Artikel aus dem Jahr 1970 erwähnt.3 Übermäßige emotionale Verstrickung mit einem Elternteil, ein Mangel an psychologischer Unabhängigkeit, ein überwältigendes Bedürfnis nach Liebe und Zuneigung sowie die Unfähigkeit, Wut zu empfinden oder zum Ausdruck zu bringen, werden von medizinischen Beobachtern seit Langem als mögliche Faktoren für die natürliche Entwicklung der Krankheit angesehen. Im Rahmen einer Studie aus dem Jahr 1958 stellte man fest, dass in nahezu 90 Prozent der Fälle „vor dem Ausbruch von Symptomen … Patienten traumatische Lebenserfahrungen hatten, die deren ‚Sicherheitssystem‘ bedrohten.“4
Eine im Jahr 1969 durchgeführte Studie untersuchte die Rolle psychologischer Prozesse bei 32 Patienten aus Israel und den Vereinigten Staaten. Bei 85 Prozent dieser MS-Patienten traten kurz nach stark belastenden Ereignissen erste Symptome auf, die später als MS diagnostiziert wurden. Die Art des stressauslösenden Faktors variierte beträchtlich und reichte vom Tod oder der Krankheit eines geliebten Menschen bis hin zur plötzlichen Gefahr, die Grundlage für den Lebensunterhalt zu verlieren. Darüber hinaus wurde ein familiäres Ereignis angeführt, das zu einer dauerhaften Lebensveränderung führte und eine Flexibilität und Anpassung erforderlich machte, die weit über die eigenen Fähigkeit hinausging. Sich lang hinziehende Ehekonflikte waren beispielsweise eine solche Quelle für Stress, mehr Verantwortung am Arbeitsplatz eine weitere. „Das gemeinsame Merkmal …“, schrieben die Autoren der Studie, „ist die allmählich wachsende Erkenntnis der Unfähigkeit, mit einer schwierigen Situation fertig zu werden …, die Gefühle der Unzulänglichkeit oder des Versagens hervorruft.“5 Diese Stressfaktoren traten gleichermaßen in unterschiedlichen Kulturen auf.
Eine weitere Studie verglich MS-Patienten mit einer Gruppe gesunder „Kontrollpersonen“. Stark bedrohliche Ereignisse waren in der MS-Gruppe zehnmal häufiger vertreten und Ehekonflikte kamen fünfmal häufiger vor.6
Von den acht Frauen mit Multipler Sklerose, mit denen ich gesprochen habe, lebte nur noch eine in einer langjährigen Partnerschaft. Die anderen lebten getrennt oder waren geschieden. Vier der Frauen waren irgendwann vor dem Ausbruch der Krankheit physisch oder psychisch von ihrem Partner missbraucht worden. In den restlichen Fällen waren die Partner emotional distanziert und unerreichbar gewesen.
Lois, eine Journalistin, war 24 Jahre alt, als im Jahr 1974 bei ihr MS diagnostiziert wurde. Auf eine kurze Episode des Doppelsehens folgte einige Monate später ein Kribbeln und Prickeln in den Beinen. In den vorangegangenen zwei Jahren hatte sie in einer indigenen Siedlung in der Arktis mit einem neun Jahre älteren Mann zusammengelebt, einem Künstler, den sie heute als psychisch instabil beschreibt. Später wurde er wegen einer manisch-depressiven Erkrankung stationär behandelt. „Er war mein Idol“, erinnert sie sich. „Er hatte sehr viel Talent und ich hatte das Gefühl, nichts zu wissen. Vielleicht hatte ich ein wenig Angst vor ihm.“
Lois empfand das Leben in der Arktis als extrem schwierig. „Für mich, ein wohlbehütetes Mädchen von der Westküste, war es, als wäre ich nach Timbuktu gezogen. Ich war Jahre später bei einem Psychologen in Behandlung und er sagte zu mir, ich hätte Glück gehabt, dort lebend herausgekommen zu sein. Trinkgelage, Tod, Mord und Isolierung waren an der Tagesordnung. Dort gab es keine einzige Straße. Ich hatte körperlich Angst vor meinem Partner, vor seinem Urteil und seiner Wut. Es war eine Sommerliebe, die einige Monate hätte dauern sollen, sich letztlich aber über einige Jahre hinzog. Ich habe getan, was ich konnte, um durchzuhalten, aber irgendwann hat er mich rausgeworfen.“
Die Lebensbedingungen waren schlecht. „Wir hatten ein Plumpsklo, was bei minus 40 oder 50 Grad grauenhaft ist. Schließlich gab er nach und ich bekam einen Nachttopf, in den ich nachts pinkeln konnte, weil Frauen häufiger pinkeln müssen als Männer, stimmt‘s?“
„Das war ein Zugeständnis?“, frage ich nach.
„Ja, genau. Wir mussten ihn wegbringen, um ihn auszugießen, und das wollte er nicht tun. Eines Nachts warf er ihn nach draußen in den Schnee und sagte zu mir, ich solle das Plumpsklo benutzen. Ich musste auch das Wasser tragen – wir hatten kein fließendes Wasser. Ich hatte keine Wahl. Wenn ich mit ihm zusammenbleiben wollte, musste ich das aushalten.
Ich erinnere mich, dass ich zu ihm gesagt habe, dass ich vor allem von ihm respektiert werden wolle. Ich weiß nicht, warum, aber für mich war das das Wichtigste. Ich wollte das so sehr, dass ich bereit war, mich mit vielen Sachen abzufinden.“
Lois sagt, dass ein verzweifeltes Bedürfnis nach Anerkennung auch ihr früheres Leben geprägt habe, vor allem die Beziehung zu ihrer Mutter. „Ich habe meine Mutter auf ihn übertragen, die immer die Kontrolle über mein Leben hatte … die mir von Anfang an gesagt hat, was ich anziehen soll, wie ich mein Zimmer dekorieren soll und was ich tun soll. Ich war das kleine Mädchen, das zu gut war, um wahr zu sein. Das bedeutet, dass man seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse unterdrückt, um Anerkennung zu bekommen. Ich habe immer versucht, so zu sein, wie meine Eltern mich wollten.“
Barbara, eine Psychotherapeutin, die den Ruf hat, sehr gute Arbeit zu leisten, behandelt viele Menschen mit chronischen Krankheiten. Sie selbst leidet an Multipler Sklerose. Sie will absolut nichts davon hören, dass die Unterdrückung, die sie in ihrer Kindheit erfahren hat, irgendetwas mit den Entzündungsherden und Narben an der Wurzel ihrer MS-Symptome zu tun haben könnte.
Barbaras Multiple Sklerose begann vor 18 Jahren. Die ersten Symptome traten auf, kurz nachdem sie einen Mann mit soziopathischen Zügen, mit dem sie in einer Justizvollzugseinrichtung gearbeitet hatte, für zwei Wochen in ihr Haus eingeladen hatte. „Er hatte eine lange Therapie hinter sich“, sagt sie, „und die Idee war, ihm eine neue Chance zu geben.“ Stattdessen sorgte er für Chaos und Probleme in ihrem Haus und ihrer Ehe. Ich frage Barbara, ob sie nicht gesehen habe, dass diese Einladung eines schwer problembeladenen Menschen ein Abgrenzungsproblem ihrerseits darstellte.
„Ja und nein. Ich dachte, es wäre in Ordnung, weil zwei Wochen vereinbart waren. Aber ich würde es natürlich nie wieder tun. Ich bin heute so gut darin, Grenzen zu ziehen, dass eine meiner Patientinnen mich die Königin der Grenzen nennt – und da sie ebenfalls Therapeutin ist, können wir darüber Witze machen. Leider musste ich es auf die harte Tour lernen. Manchmal denke ich, dass meine MS eine Strafe für meine Dummheit war.“
Dieser Hinweis auf Krankheit als Bestrafung wirft eine zentrale Frage auf, da Menschen mit chronischen Krankheiten häufig beschuldigt werden oder sich vielleicht auch selbst beschuldigen, ihr Unglück in irgendeiner Form verdient zu haben. Wenn die Unterdrückung/Stress-Sichtweise implizieren würde, dass Krankheit eine Bestrafung ist, wäre ich damit einverstanden, dass Barbara diese ablehnt. Aber eine Suche nach wissenschaftlichen Erkenntnissen ist unvereinbar mit einer moralisierenden Haltung und dem Fällen von Urteilen. Zu sagen, dass die unvernünftige Entscheidung, einen potenziell gefährlichen Menschen in sein Haus einzuladen, eine Quelle für Stress war und bei der Entstehung von Krankheit eine Rolle spielte, ist einfach nur ein Hinweis auf einen Zusammenhang zwischen Krankheit und Stress. Es geht dabei darum, eine mögliche Konsequenz zu diskutieren – nicht als Strafe, sondern als physiologische Realität.
Barbara besteht darauf, dass die Beziehung zu ihren Eltern auf beiden Seiten liebevoll und gesund war. „Es war immer toll, wenn meine Mutter und ich zusammen waren. Wir haben uns immer sehr nahegestanden.“
„Das Setzen von Grenzen lernt man in den Jahren seiner Entwicklung“, sage ich. „Weshalb mussten Sie es dann später auf die harte Tour lernen?“
„Ich kannte die Grenzen, aber meine Mutter nicht. Genau darum ging es in den meisten unserer Auseinandersetzungen – um ihre Unfähigkeit zu erkennen, wo sie aufhörte und ich anfing.“
Barbaras Aufnahme eines instabilen und gefährlichen Mannes in ihr eigenes Heim würde in Studien als ein Hauptstressfaktor definiert werden, aber der diesem Ereignis vorausgehende chronische Stress der schlecht gesetzten Grenzen wird nicht so leicht erkannt. Die Verwischung psychischer Grenzen während der Kindheit wird zu einer Hauptquelle für physiologischen Stress im Erwachsenenalter. Die Tatsache, dass Menschen mit unklar definierten Grenzen unter Stress leben, wirkt sich nicht nur negativ auf das Hormon-, sondern auch auf das Immunsystem aus. Es gehört zu ihrem Alltag dazu, permanent Übergriffe von anderen zu erfahren. Sie haben jedoch gelernt, diese Realität nicht bewusst wahrzunehmen.
„Die Ursache(n) der Multiplen Sklerose sind nach wie vor unbekannt“, heißt es in einem angesehenen Lehrbuch für Innere Medizin.7 Die Mehrheit der Forschungsarbeiten widerlegt, dass die Ursache eine Ansteckung ist, obwohl ein Virus möglicherweise angezeigt ist. Es gibt vermutlich genetische Einflüsse, da einige Ethnien nicht davon betroffen sind – zum Beispiel die Inuit in Nordamerika und die Bantu im südlichen Afrika. Aber Gene erklären nicht, wer daran erkrankt und warum. „Es ist zwar möglich, eine genetische Anfälligkeit für MS zu erben, aber die Krankheit selbst kann man nicht erben“, schreibt der Neurologe Louis J. Rosner, der ehemalige Direktor der UCLA-Klinik für Multiple Sklerose. „Und selbst Menschen, die alle hierfür erforderlichen Gene besitzen, erkranken nicht zwangsläufig an MS. Experten gehen davon aus, dass die Krankheit durch Umweltfaktoren ausgelöst werden muss.“8
Komplizierter wird das Ganze noch durch MRT-Untersuchungen und Autopsien, die die charakteristischen Anzeichen einer Demyelinisation im zentralen Nervensystem von Personen aufzeigten, die nie irgendwelche offen zutage tretenden Anzeichen oder Symptome der Krankheit aufwiesen. Wie kommt es, dass einige Menschen mit diesen neuropathologischen Befunden der ungehemmten Entwicklung der Krankheit entgehen, während andere dies nicht tun?
Welche „Umweltfaktoren“ könnte Dr. Rosner gemeint haben? Dr. Rosners ansonsten ausgezeichnete Einführung in die Multiple Sklerose blendet die Erforschung von emotionalem Stress als mitverantwortlichem Faktor für den Ausbruch der Krankheit ohne viel Federlesens aus. Stattdessen kommt er zu dem Schluss, dass die Krankheit vermutlich am besten als Autoimmunreaktion erklärt werden kann. „Eine Person reagiert allergisch auf ihr eigenes Gewebe“, erklärt er, „und produziert Antikörper, die gesunde Zellen angreifen.“ Er lässt die umfangreiche medizinische Fachliteratur außer Acht, in der Autoimmunprozesse mit Stress und Persönlichkeit in Verbindung gebracht werden, ein sehr wichtiger Zusammenhang, auf den in späteren Kapiteln noch umfassend eingegangen werden wird.
Im Rahmen einer im Jahr 1994 in der neurologischen Abteilung des Krankenhauses der University of Chicago durchgeführten Studie wurden die Interaktionen von Nerven- und Immunsystem und deren mögliche Rolle bei Multipler Sklerose untersucht.9 Anhand von Ratten wurde gezeigt, dass eine künstlich herbeigeführte Autoimmunerkrankung sich verschlimmerte, wenn die Kampf-oder-Flucht-Reaktion blockiert war. Wäre diese Reaktion nicht beeinträchtigt gewesen, wären die Tiere durch ihre Fähigkeit, normal auf Stress zu reagieren, geschützt gewesen.
Die in der Literatur über Stress beschriebenen MS-Patienten sowie all jene, die ich befragt habe, waren in eine Lage versetzt worden, die der der Versuchstiere in der Studie in Chicago ähnelte: Sie waren aufgrund ihrer Konditionierung in der Kindheit akutem und chronischem Stress ausgesetzt gewesen und ihre Fähigkeit, das erforderliche Kampf-oder-Flucht-Verhalten zu entwickeln, war beeinträchtigt. Das Grundproblem ist nicht der Stress von außen, wie zum Beispiel die in der Studie angeführten Lebensereignisse, sondern eine umweltbedingte Hilflosigkeit, die keine der normalen Reaktionen von Kampf oder Flucht zulässt. Der daraus resultierende Stress wird unterdrückt und damit unsichtbar. Irgendwann dann wird es nicht mehr als belastend empfunden, unerfüllte Bedürfnisse zu haben oder die Bedürfnisse von anderen erfüllen zu müssen. Es fühlt sich normal an. Man ist entwaffnet.
Véronique ist 33 Jahre alt und bekam vor drei Jahren die Diagnose MS. „Ich hatte einen größeren Schub“, berichtet sie, „von dem ich nicht wusste, dass es ein Schub war … drei Tage lang Schmerzen in den Füßen, Taubheit und Kribbeln, die bis in den oberen Brustraum gingen und dann wieder zurück. Ich fand es cool – ich habe mich gestoßen und nichts gespürt! Ich habe mit niemandem darüber geredet.“ Ein Freund überzeugte sie schließlich, einen Arzt aufzusuchen.
„Sie hatten ein Taubheitsgefühl von den Füßen bis in den oberen Brustraum und haben niemandem etwas gesagt? Warum?“
„Ich habe gedacht, es wäre nicht wichtig genug, es jemandem zu erzählen, und wenn ich es meinen Eltern erzählt hätte, hätten sie sich aufgeregt.“
„Aber wenn jemand anders ein Taubheitsgefühl und Schmerzen von den Füßen bis in die Brust hätte, würden Sie das auch ignorieren?“
„Nein, ich würde ihn drängen, zum Arzt zu gehen.“
„Warum haben Sie sich schlechter behandelt als einen anderen Menschen? Haben Sie eine Idee?“
„Nein.“
Am aufschlussreichsten ist Véroniques Antwort auf meine Frage nach irgendwelchen belastenden Erfahrungen vor dem Ausbruch ihrer Multiplen Sklerose. „Nichts wirklich Schlimmes“, sagt sie.
„Ich wurde adoptiert. Irgendwann, nachdem meine Adoptivmutter mich 15 Jahre lang dazu gedrängt hatte, suchte ich nach meinen biologischen Eltern, was ich eigentlich nicht wollte. Aber es ist immer der einfachere Weg, den Forderungen meiner Mutter nachzugeben, als mit ihr darüber zu streiten – immer!
Ich habe sie gefunden und mich mit ihnen getroffen. Mein erster Eindruck war, oh Gott, wir können unmöglich verwandt sein. Es war belastend für mich, meine Familiengeschichte kennenzulernen, da ich nicht unbedingt wissen wollte, dass ich möglicherweise durch eine inzestuöse Vergewaltigung entstanden war. So scheint es gewesen zu sein, aber niemand erzählt die ganze Geschichte und meine leibliche Mutter sagt kein Wort dazu.
Zu der Zeit war ich außerdem arbeitslos, wartete auf mein Arbeitslosengeld und lebte von Sozialhilfe. Und einige Monate zuvor hatte ich meinen Freund rausgeworfen, weil er Alkoholiker war und ich das nicht mehr aushalten konnte. Ich wollte nicht den Verstand verlieren, das war es nicht wert.“
Dies sind die Stressfaktoren, die von der jungen Frau als nicht unbedingt schlecht beschrieben werden: anhaltender Druck von ihrer Stiefmutter, die Véroniques eigenen Wunsch, ihre eigene zerrüttete biologische Familie nicht aufsuchen zu wollen, ignorierte; die Entdeckung, dass ihre Empfängnis vermutlich die Folge einer inzestuösen Vergewaltigung war (durch einen Cousin, Véroniques leibliche Mutter war damals 16 Jahre alt); finanzielle Not und die Trennung von ihrem alkoholabhängigen Freund.
Véronique identifiziert sich mit ihrem Adoptivvater. „Er ist mein Held“, sagt sie. „Er war immer für mich da.“
„Warum haben Sie ihn dann nicht um Hilfe gebeten, wenn Sie sich von Ihrer Mutter unter Druck gesetzt fühlten?“
„Ich konnte nie allein mit ihm sprechen. Ich musste immer zuerst mit ihr reden, bevor ich mit ihm sprechen konnte.“
„Und wie hat Ihr Vater auf all das reagiert?“
„Er hat einfach nur danebengestanden. Aber ich konnte spüren, dass es ihm nicht gefiel.“
„Ich bin froh, dass Sie sich Ihrem Vater nahe fühlen. Aber vielleicht möchten Sie sich einen neuen Helden suchen – jemanden, der Ihnen vorleben kann, wie man sich selbst behauptet. Um zu heilen, möchten Sie vielleicht Ihr eigener Held werden.“
———
Die begabte britische Pianistin Jacqueline du Pré verstarb im Jahr 1987 im Alter von 42 Jahren an den Komplikationen von Multipler Sklerose. Als ihre Schwester Hilary sich später fragte, ob Stress Jackies Krankheit verursacht haben könnte, versicherten ihr die Neurologen mit Nachdruck, dass Stress nichts damit zu tun hatte.
Die landläufige medizinische Meinung hat sich seitdem kaum verändert. „Stress ist nicht die Ursache von Multipler Sklerose“, war in einer Patientenbroschüre zu lesen, die von der MS-Klinik der University of Toronto herausgegeben wurde, „obwohl Menschen mit MS gut beraten sind, Stress zu vermeiden.“ Diese Behauptung ist irreführend. Natürlich verursacht Stress keine Multiple Sklerose – kein einzelner Faktor verursacht sie. Die Entstehung von MS hängt zweifellos von einer Reihe von zusammenwirkenden Einflüssen ab. Aber trifft es zu, dass Stress nicht maßgeblich am Ausbruch dieser Krankheit beteiligt ist? Forschungsstudien und das Leben der Personen, mit denen wir uns befasst haben, deuten stark darauf hin, dass dies der Fall ist. Ein Beweis dafür ist auch das Leben von Jacqueline du Pré, deren Krankheit und Tod praktisch wie ein Lehrbuch die verheerenden Auswirkungen von Stress durch emotionale Unterdrückung veranschaulichen.
Die Menschen haben bei du Prés Konzerten häufig geweint. Die Art, wie sie mit ihrem Publikum kommunizierte, bemerkte jemand einmal, „sei ziemlich atemberaubend gewesen und habe alle in ihren Bann gezogen“. Ihr Spiel war leidenschaftlich, manchmal unerträglich intensiv. Sie drang direkt zu den Emotionen durch. Anders als im Privatleben war sie auf der Bühne völlig ungehemmt: Ihre Haare flogen, ihr Körper wiegte sich hin und her. Sie zeigte dann mehr von der Extravaganz eines Rock-‘n‘-Roll-Stars als die in der klassischen Musik übliche Zurückhaltung. „Sie erweckte den Anschein einer süßen, sittsamen Milchmagd“, erinnerte sich ein Beobachter, „aber mit dem Cello in den Händen glich sie einer Besessenen.“10 Bis heute sind einige der aufgezeichneten Darbietungen du Prés, vor allem das Cellokonzert von Elgar, unübertroffen – und werden es vermutlich auch bleiben. Dieses Konzert war das letzte große Werk des herausragenden Komponisten, das in einer Stimmung der Verzweiflung nach dem Ersten Weltkrieg entstand. „Alles Gute und Schöne und Reine und Frische und Süße ist in weiter Ferne und wird nie wiederkehren“, schrieb Edward Elgar im Jahr 1917. Er war in seinen Siebzigern und an seinem Lebensabend angekommen. „Jackies Fähigkeit, die Emotionen eines Mannes im Herbst seines Lebens widerzugeben, gehörte zu ihren außergewöhnlichen und unerklärlichen Gaben“, schreibt ihre Schwester Hilary du Pré in ihrem Buch Ein Genie in der Familie.11
Außergewöhnlich, ja. Unerklärlich? Vermutlich nicht. Obwohl sie sich dessen nicht bewusst war, war Jacqueline du Pré mit 20 Jahren ebenfalls im Herbst ihres Lebens angekommen. Die Krankheit, die bald ihre musikalische Karriere beenden sollte, war nur noch wenige Jahre entfernt. Bedauern, Verlust und Resignation waren ein übermäßig großer Teil ihrer unausgesprochenen emotionalen Erfahrungen gewesen. Sie verstand Elgar, weil sie das gleiche Leid empfunden hatte. Sein Porträt brachte sie immer durcheinander. „Er hatte ein erbärmliches Leben, Hil“, sagte sie zu ihrer Schwester, „und er war krank, aber seine Seele strahlte trotzdem, und genau das fühle ich in seiner Musik.“
Von ihren frühesten Anfängen beschrieb sie sich selbst. Der Vater von Jackies Mutter Iris starb, während sie selbst noch mit Jackie auf der Entbindungsstation im Krankenhaus war. Von da an entwickelte sich Jackies Beziehung zu ihrer Mutter zu einer symbiotischen Abhängigkeit, aus der sich keine der beiden befreien konnte. Dem Kind war es weder erlaubt, ein Kind zu sein, noch zu einer erwachsenen Frau heranzuwachsen.
Jackie war ein empfindsames Kind, ruhig und schüchtern, manchmal spitzbübisch. Es heißt, sie sei still gewesen, außer beim Cellospiel. Ein Musiklehrer erinnert sich daran, dass sie im Alter von sechs Jahren „schrecklich höflich und gut erzogen gewesen sei“. Sie zeigte der Welt ein freundliches und fügsames Gesicht. Die Sekretärin der Mädchenschule, die sie besuchte, erinnert sich an sie als ein unbeschwertes und fröhliches Kind. Eine Mitschülerin in der Highschool sagt über sie, sie sei ein „freundliches, vergnügtes Mädchen gewesen, das sich überall gut einfügte“.