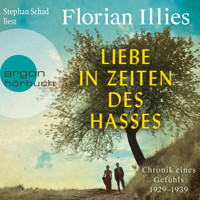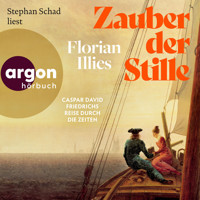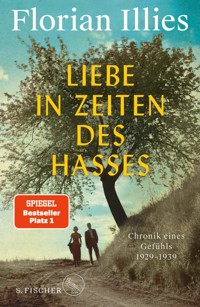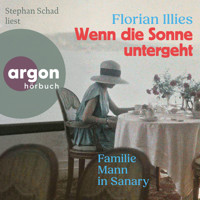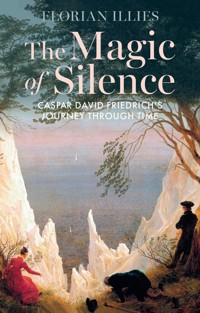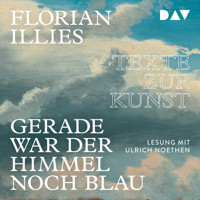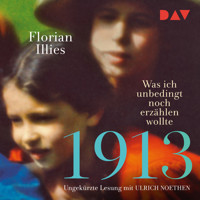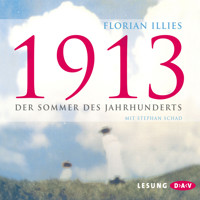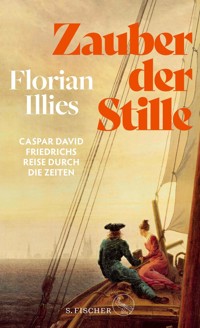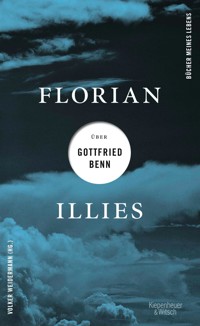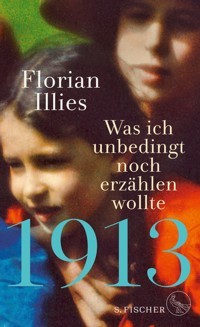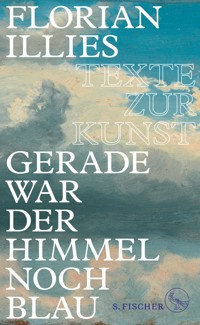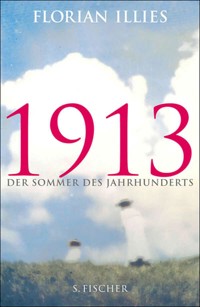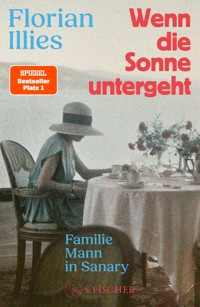
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Im glühend heißen Sommer 1933 spitzt sich die politische Lage in Europa zu - und die der Familie Mann: Thomas und Katia Mann und ihre sechs Kinder sind nach abenteuerlichen Fluchten im Juni in dem verträumten Hafenort Sanary am französischen Mittelmeer gestrandet. Und jetzt wissen sie alle weder vor noch zurück. Ein Ort, eine Familie, drei Monate bei dreißig Grad – »Wenn die Sonne untergeht« ist eine große Familienaufstellung: Kaum im unsicheren südfranzösischen Exil angekommen, will Thomas Mann eigentlich sofort wieder zurück in seine edle Münchner Villa. Sein Bruder Heinrich hingegen genießt die Freiheit des Südens. Dazwischen die sechs Kinder von Thomas und Katia: Der eine, Michael, spielt Tag und Nacht Geige, der zweite, Klaus, gründet eine Exil-Zeitschrift, die dritte, Elisabeth, badet und genießt die Zeit ohne Schule. Erika, die älteste, führt Regie und schmuggelt den Besitz der Manns aus München über die Grenze, Golo holt das Geld von den Konten und versorgt den vergessenen Hund. Und Monika? Sie bleibt einfach am Strand von Sanary liegen. Florian Illies erzählt von der Trauer um den Verlust der Heimat und des Besitzes, der Angst vor den Plünderungen der Nazis, von Trotz und Leidenschaft. Von Wehmut und vom Überlebenswillen, obwohl die alte Welt einzustürzen droht. Und er erzählt von der großen Zerreißprobe zwischen Klaus und Erika und ihrem Vater Thomas. »Ich glaube«, sagte Marcel Reich-Ranicki, »dass es in Deutschland im 20. Jahrhundert keine bedeutendere, originellere und interessantere Familie gegeben hat als die Manns.« In Sanary ist diese außergewöhnliche Familie in einem absoluten Ausnahmezustand – alle werden das erste Mal gezwungen, sich zu bekennen. Zueinander. Zu Deutschland. Oder auch, so traurig es ist: Dagegen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 411
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Florian Illies
Wenn die Sonne untergeht
Familie Mann in Sanary
Über dieses Buch
Vertreibung ins Paradies – Familie Mann in Sanary
Im glühend heißen Sommer des Jahres 1933 spitzt sich die politische Lage in Deutschland immer weiter zu – und genauso die der Familie Mann. Thomas, Katia und ihre sechs Kinder landen nach ihren abenteuerlichen Fluchten aus der Heimat durch puren Zufall am südfranzösischen Mittelmeer, in Sanary-sur-Mer.
Und jetzt wissen sie alle weder vor noch zurück.
Ein Ort, eine Familie, drei Monate bei dreißig Grad – Florian Illies erzählt von der Trauer um den Verlust der Heimat. Er erzählt aber auch von sechs Geschwistern, die erst miteinander schwimmen gehen und danach – jeder für sich und fast alle vergeblich – auf die Liebe des Vaters hoffen. Es ist ein Buch über Wehmut, über Trotz und über Leidenschaft. Über die Stiche der Trauer, der Angst und der Sehnsucht. Und über die große Zerreißprobe zwischen Klaus und Erika Mann und ihrem Vater.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Florian Illies, »der große Geschichtenerzähler« (»Süddeutsche Zeitung«) begründete mit seinem Welterfolg »1913« ein neues Genre. Ihm folgten bei S. Fischer das inzwischen in über zwanzig Sprachen übersetzte Buch über die 1920er und 1930er Jahre »Liebe in Zeiten des Hasses« (2021) sowie der große Nr. 1-Bestseller über die Sehnsuchtsbilder Caspar David Friedrichs, »Zauber der Stille« (2023).
Geboren 1971, studierte Florian Illies Kunstgeschichte und Neuere Geschichte in Bonn und Oxford. Er wurde 1996 Redakteur der »FAZ«, war Feuilletonchef der »Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung« und leitete ein Kunst-Auktionshaus. Heute ist Illies einer der Herausgeber der »ZEIT« und lebt als Autor in Berlin.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2025 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Coverabbildung: J.H. Lartigue, Madeleine Messager, genannt Bibi, im Restaurant des Eden Roc, Cap d’Antibes, Mai 1920 © Ministère de la Culture (France), MPP-AAJHL
ISBN 978-3-10-491696-5
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Danach
Dank
[Stammbaum]
Februar
Das ist nicht die richtige Zeit, um Deutschland zu verlassen. Der Zug nach Amsterdam geht schon um sechzehn Uhr, und Katia hat den Chauffeur für Viertel nach drei bestellt. Warum hat denn weder die Deutsche Reichsbahn noch seine eigene Frau daran gedacht, dass er, der Nobelpreisträger, genau dann für gewöhnlich eine Stunde ruht?
Es ist unerhört.
Thomas Mann unterdrückt seine Wut und zieht das nach Veilchen duftende Taschentuch aus der Jacke. Er entfaltet den feinen Seidenstoff dabei nicht, sondern tupft sich nur kurz und ernst über die Stirn, dann steckt er das Tuch genauso feinsäuberlich gefaltet wieder ein.
Alles muss in seiner Form bleiben.
Es beängstigt ihn, wenn sein Leben aus der Ordnung gerät. Wenn er also, zum Beispiel, nicht ruhen kann zwischen vier und fünf. Wenn die Schallplatte auf dem Grammophon zu kratzen beginnt. Wenn sich eine umherbrummende Fliege in sein Arbeitszimmer verirrt. Wenn er beim Schlucken die ersten Anzeichen eines drohenden Halsschmerzes spürt. Alles eine persönliche Kränkung.
Wir schreiben den 11. Februar des Jahres 1933. Am Mittagstisch im Haus der Familie Mann in der Poschingerstraße 1 in München sitzen die Eltern Thomas und Katia mit ihren beiden ältesten Kindern, Klaus und Erika. Daneben die kleine Elisabeth und die Hausdame Marie Kurz, bayerisch Kurz Marie genannt.
Es ist ein stilles Mittagessen, nur das Klappern der Löffel ist zu hören. Kein Essen ohne Suppe, so hat es der Hausherr verfügt, er hält das für ein Zeichen seines sozialen Aufstiegs.
Drei Kinder fehlen heute – und zwar die mit zerknautschtem Selbstbewusstsein: Der 23-jährige Golo bereitet sich in Göttingen auf sein Staatsexamen vor, Michael, der dreizehnjährige Sohn, ist auf dem Internat in Neubeuern, und Monika, die 22-Jährige, lässt sich gerade durch Berlin treiben. Und ihr Vater? Der ist froh, dass genau diese drei gerade weit weg sind.
Katia bespricht mit der Kurz Marie, was für die anstehende Reise nach Amsterdam in den Koffer muss. Nur leichtes Gepäck, sagt sie. Und dann bitte die ganzen Wintersachen direkt nach Arosa expedieren.
Ja, nach den Vorträgen in Amsterdam, Brüssel und Paris will das Ehepaar für drei Wochen in den Erholungsurlaub nach Arosa, in ihr geliebtes Waldhotel, in dem Katia so oft gekurt hat und dessen Speisesaal von Thomas im Zauberberg verewigt worden ist. Drei Wochen – sie wollen genauso lange im »Zauberberg« bleiben, wie es auch dessen Held Hans Castorp am Anfang geplant hat.
Nach dem Mittagsmahl geht er in sein Arbeitszimmer, um seinen Handkoffer zu packen; draußen dämmert der Wintertag schon vor sich hin. Thomas nimmt das Manuskript des Vortrages über »Leiden und Größe Richard Wagners« und steckt es – ein wenig ergriffen von sich selbst – in seine lederne Mappe. Er packt seine Zigarren aus dem in die Wand eingebauten Kühlfach ein. Die leichtgleitende Waterman-Feder, die Tinte. Er nimmt das letzte Ingwercake aus der Schale.
So.
Er blickt sich kurz um.
Überlegt.
Und dann deponiert er zu guter Letzt sein aktuelles Tagebuch im Wandschrank, legt es zu all den anderen alten Tagebüchern aus den letzten drei Jahrzehnten, schließt zweifach ab und dann – er weiß selbst nicht, warum – steckt er den Schrankschlüssel in die innere Tasche seines Handkoffers, um ihn mitzunehmen auf die Fahrt.
Den hohen Stapel mit dem Manuskript vom dritten Band von Joseph und seine Brüder, an dem er gerade schreibt, den aber lässt er liegen. Er will sich erst nach der Reise wieder daransetzen.
Schließlich geht er gemessenen Schrittes zur großen schwarzgoldenen Pendeluhr in der Ecke, die seit zwei Jahrzehnten auf dem Palisanderschränkchen tickt. Alter Lübecker Familienbesitz. Er überlegt kurz, ob es wirklich ratsam ist, sie kurz vor der Abreise noch einmal aufzuziehen. Dann beschließt er, sein ordnendes Werk dennoch zu verrichten. Mit heiligem Ernst zieht er an der Schnur, bis es sich im Uhrwerk regt. Das geliebte metallene Ticken erfüllt die Weite des Raums.
Die Zeit läuft.
Als er dann an seinem Tischkalender noch den 11. Februar aufblättert, und Katia ihren »Tommy« aus der Diele schon zum Aufbruch mahnt, erinnert er sich mit Schrecken daran, dass heute sein Hochzeitstag ist, ja, tatsächlich, der 11. Februar 1905, heute vor 28 Jahren ist es gewesen, wie hat er das nur vergessen können. Mit Rührung denkt er an Katia, die das natürlich auf keinen Fall vergessen hat, aber so dezent gewesen ist, ihn bislang nicht an sein Versäumnis zu erinnern. Er geht in die Diele und schaut sie sanft an, sanfter als sonst, und sie versteht, was er sagen will.
Elisabeth, sein Lieblingskind, kommt aus ihrem Zimmer herunter und kuschelt sich kurz an ihn, er gibt seiner »Medi« zum Abschied einen Kuss auf die Stirn. Sie soll rasch nachreisen, wenn die Eltern in zehn Tagen in Arosa eingetroffen sind. Und dann endlich zieht sich Thomas nacheinander Mantel, Schal und Hut an. Muschi, das kleine weiße Malteserhündchen mit dem albernen Mittelscheitel, reibt sich unruhig an seinem Bein, will nicht, dass sein Herrchen geht, und kläfft ein wenig herum. »Gib Ru-he!«, ruft Thomas Mann entnervt und bittet die Kurz Marie das Hündchen an sich zu nehmen, damit es ihnen nicht hinterherläuft.
»Ru-he« – er teilt das Wort immer feinsäuberlich in zwei Silben, wenn ihn eine unnötige Störung des Betriebsablaufs erzürnt. Alle im Haus wissen dann, dass jetzt nicht mehr mit ihm zu spaßen ist, selbst der Hund.
Sodann zieht Thomas Mann die Münchner Haustür mit lübeckischer Entschiedenheit hinter sich zu, und dann gehen er und Katia die paar Stufen hinab zum Vorplatz, wo Hans Holzner, der Chauffeur, schon mit laufendem Motor im Horch auf sie wartet.
Und Klaus und Erika? Sie sind froh, dass ihre Eltern endlich abfahren.
Am Tag zuvor ist Annemarie Schwarzenbach da gewesen, die ernste, reiche Schweizer Freundin mit dem Engelsgesicht. Sie hat Thomas und Katia frische Blumen und Klaus und Erika frische Drogen mitgebracht. Jetzt, da »Mielein« und »Pielein« endlich zum Bahnhof aufgebrochen sind, nehmen sie sie. Klaus ist vorher extra bei der Apotheke gewesen und hat destilliertes Wasser geholt, aber es gibt dennoch wieder Schwierigkeiten mit dem Aufziehen der Ampullen, dem Abbinden des Armes, den Spritzen. Alles kompliziert, aber, so notiert Klaus nachts erleichtert in seinem Tagebuch: »immerhin Wirkung«.
Abends sitzen Erika und Klaus allein in der heimischen Diele verstört vor dem Radio und hören den Reden der nationalsozialistischen Versammlung im Berliner Sportpalast zu. Auch hier: immerhin Wirkung. Um die auszuhalten, blättert Klaus beim Zuhören hingebungsvoll in dem Bildband Der Schöne Mensch mit griechischen Skulpturen. Was für herrliche Männerkörper. Doch auch das hilft nichts: Nachts im Traum wird Klaus von lauter unschönen deutschen SS-Soldaten verfolgt.
In genau diesen Stunden rollen seine Eltern in ihrem Schlafwagen über die deutsche Grenze.
In Michaels Internat in Neubeuern machen sie ständig Witze über »Bibis« Bruder Klaus und dessen schriftstellerische Versuche. »Besonders begabt scheinst du nicht zu sein«, fasst Bibi das Gerede vom Schulhof seinem großen Bruder gegenüber zusammen, als sie einmal im Winter zu dritt mit Monika zusammensitzen. Er genießt es, seine fünf älteren Geschwister bei jeder sich bietenden Gelegenheit zu piesacken. Doch Moni widerspricht, Klaus sei sehr wohl begabt (er ist schließlich der Einzige, der immer zu ihr hält). Bibi aber lässt sich nicht beirren und stellt mit der Logik eines Dreizehnjährigen nüchtern fest: »Du bist nicht begabt, denn du hast schließlich nicht so Erfolg wie unser Herr Papale.«
In diesem vermaledeiten Februar des Jahres 1933 muss Klaus Mann oft an Bibis Worte denken.
Am 13. Februar, dem fünfzigsten Todestag Richard Wagners, hält der Herr Papale, also Thomas Mann, abends um 20.30 Uhr im Saal des Amsterdamer Concertgebouw seinen Vortrag über »Leiden und Größe Richard Wagners«, an dem er seit Anfang Januar gearbeitet hat. Seine feierlichen Worte werden vom örtlichen Orchester eingerahmt, das sein geliebtes »Vorspiel« aus dem Lohengrin spielt, die Trauermusik aus der Götterdämmerung und das »Siegfried-Idyll«.
Thomas Mann weiß nicht, dass am selben Abend, 634 Kilometer östlich von ihm im Leipziger Gewandhaus, die Feier zu Wagners fünfzigstem Todestag vom neuen Reichskanzler Adolf Hitler eröffnet wird.
Thomas Manns gleichzeitige Amsterdamer Rede, obwohl aus seiner eigenen tiefen Leidensquelle und der nicht minder tiefen des verehrten Komponisten gespeist, misslingt. Der Saal ist zu groß, er spricht zu leise, viele der 2400 Plätze bleiben leer, und die Gäste, die da sind, sind erkältet. Katia, geboren im Todesjahr Richard Wagners, schreibt noch nachts zornig aus dem Grand Hotel an Erika und Klaus nach München: »Also in Amsterdam – und gerade darauf hatte sich der Zauberer doch so gefreut! – wäre ich fast gestorben. Stellt Euch vor: ein Saal von 2400 Personen, ein Riesenpublikum von geistig trägen Ausländern: Die überwiegende Mehrzahl hat gar nichts verstanden und gehustet.«
Was im Husten der trägen Ausländer unterging, das waren überraschende Sätze des großen Wagner-Liebhabers Mann: »Nicht nur oberflächlich, sondern mit Leidenschaft und Bewunderung hingeblickt«, erklärt er in seiner ernsten, leicht näselnden Stimme, »kann man sagen, auf die Gefahr hin, missverstanden zu werden, dass Wagners Kunst ein mit höchster Willenskraft und Intelligenz monumentalisierter und ins Geniehafte getriebener Dilettantismus ist.« Ein Satz, der sich noch rächen wird. Es wird nämlich so laut gehustet, dass auch der Berliner Korrespondent der Vossischen Zeitung nicht alles richtig versteht. Er schreibt, Mann habe in Amsterdam Wagners Gleichklang »von Deutschheit und Modernität« gerühmt. Stattdessen ist es aber die »Mondänität«, die Mann gepriesen hat. Als der Münchner Generalmusikdirektor Hans Knappertsbusch, der so gerne die Leitung der Bayreuther Wagner-Festspiele übernehmen möchte, diesen Artikel liest, brennen ihm die Sicherungen durch. Wagner ein »Moderner« und ein »Dilettant«? Seine Frau wird Hedwig Pringsheim, Katias Mutter, abends in der Opernpause in München erzählen, wie erzürnt ihr Gatte über Thomas Manns Äußerungen ist. Sie sei »sehr bös auf TM, denn der habe Richard Wagner einen Dilettanten genannt«. Das schreibt Hedwig Pringsheim in einem Brief an ihre Tochter. Als Thomas davon hört, schüttelt er nur den Kopf, aber er denkt sich noch nichts weiter dabei.
Er will aus seinen schwerwiegenden Gedanken zu Wagner, mit denen er selbst höchst zufrieden ist, in Kürze ein kleines Buch bei seinem Verlag S. Fischer machen; »es kommt bald«, kündigt er einem Freund aus den Bergen an. Doch es wird nie dazu kommen.
Nur zehn Tage nach der Abreise des Ehepaars Mann aus Deutschland, am 21. Februar, steigt in Berlin am Anhalter Bahnhof auch Heinrich Mann, Thomas’ älterer Bruder, in den Zug Richtung Westen. Doch er fährt zu keiner Vortragsreise. Der 61-Jährige fährt in die Emigration. Auch wenn er zunächst nur ein Ticket bis Frankfurt am Main gebucht hat, um keine schlafenden Hunde zu wecken. Er tarnt sich als Handlungsreisender – zum Glück sieht er ohnehin immer genau so aus, mit seinen zu korrekten Anzügen, der steifen Krawatte, den gezirkelten Bügelfalten. Niemand soll an diesem Tag merken, wohin es ihn, den Schriftsteller und ewigen Mahner, in Wahrheit zieht, nur einen Regenschirm hat er deshalb unterm Arm. Heinrich hat große Angst, noch am Bahnsteig oder an der Grenze festgenommen zu werden. Zu oft hat er mit den Sozialisten sympathisiert, zuletzt öffentlich einen »Appell des Sozialistischen Kampfbundes« für die Wahlen im März unterzeichnet. Die nationalsozialistische Presse tobt. Gerade hat man ihn aus seinem Amt als Präsident der Sparte Dichtkunst der Preußischen Akademie der Künste gedrängt. Zwei Jahre hat er dieses ehrenvolle Amt inne, aber nun passen er und seine Ansichten nicht mehr in den gleichgeschalteten neuen Geist der Zeit. Wenn er die Akademie betreten hat, ist hinter seinem Rücken nur noch geflüstert worden. Und dann warnt ihn auf einem Empfang der französische Botschafter André François-Poncet. Dringend. Da weiß Heinrich, dass seine Zeit in Deutschland abgelaufen ist.
Gleich am nächsten Morgen hat Nelly Kröger, seine lebensfrohe 35-jährige Partnerin, die er vor drei Jahren als Animierdame in der anrüchigen »Bajadere«, einer Bar am Wittenbergplatz, kennengelernt hat, in der gerade bezogenen gemeinsamen Wohnung in der Fasanenstraße 61 in Berlin zwei Anzüge und etwas Wäsche in einen Koffer gepackt und diesen jetzt, vor der Abfahrt des Zuges, unauffällig oben ins Gepäckfach von Heinrichs Abteil geschoben.
»Adieu, mein Heini«, haucht sie ihm zum Abschied am Gleis ins Ohr – sie nennt ihn tatsächlich immer »Heini«, als beackere er einen Rübenacker und nicht das edle Feld der deutschen Literatur. Aber ihm behagt das, »das Sozialgefälle muss mit Lust genossen werden«, hat er gerade in einer kleinen Liebeserklärung an die halbseidenen Damen geschrieben, denen er sein ganzes Leben lang verfallen bleibt. Nelly weint am Bahnsteig und fragt ihn, wann sie sich wiedersehen. »Morgen?«
Da lächelt er sie sanft an und sagt: »Übermorgen.«
Heinrich schlendert nach dem Abschied von Nelly alleine weiter zu seinem Waggon, nichts als den Regenschirm in der Hand. Der gerade entlassene Präsident der Sparte Dichtkunst der Preußischen Akademie der Künste, Verfasser des Untertan und von Professor Unrat, steigt in den Zug nach Frankfurt, schläft dort eine Nacht in einem einfachen Hotel, geht dann gleich in der Frühe wieder zum Bahnhof und fährt mit dem ersten Zug bis Karlsruhe und weiter in die Grenzstadt Kehl. Hier steigt er aus und nimmt seinen Koffer betont beiläufig aus dem Gepäckfach.
Heinrich Mann fürchtet, dass er im Zug an der französischen Grenze streng kontrolliert würde, und wähnt sich sicherer, wenn er Deutschland zu Fuß verlässt. Und tatsächlich, der in der ersten Sonne des Jahres vor sich hinträumende Beamte auf der deutschen Seite der Rheinbrücke drückt ihm den Ausreisestempel kommentarlos in seinen Pass.
Dann versucht Heinrich, die 234 Meter hinüberzuschlendern, als mache er bloß einen kleinen Spaziergang. Doch seine Anspannung steigt.
Unter ihm der breite, ruhige, gelassene Strom.
In perfektem Französisch begrüßt er den Grenzbeamten auf der anderen Seite, in Straßburg. Nein, er habe nichts zu verzollen, sagt er, er wolle nur kurz ein paar Tage entspannen. Und so bekommt er genauso kommentarlos auch einen französischen Stempel in seinen deutschen Pass. Dann geht er noch ein paar Schritte weiter, als sei es das Selbstverständlichste der Welt.
Er blickt, den Regenschirm weiter fest unter den Arm geklemmt, ungläubig hinauf in die Sonne, die nun also plötzlich eine französische geworden ist.
Heinrich Mann hat es geschafft.
Als er im Postamt warten muss, trägt er in seinen Taschenkalender für den 21. Februar nur ein Wort ein: »Abgereist«. Dann sendet er ein Telegramm der Erleichterung an seinen Freund Wilhelm Herzog im südfranzösischen Sanary, der eine Woche vor ihm ins Exil gegangen ist. Anschließend steigt Heinrich wieder in den Zug, der ihn bis nach Paris bringt. In den deutschen Zeitungen wird an diesem Tag sein Ende als Präsident der Dichtkunst an der Preußischen Akademie verkündet. »Das war ein Heinrich, vor dem uns graute«, grölt ihm der Völkische Beobachter hinterher.
Verstörende Gleichzeitigkeit: An ebenjenem 21. Februar, an dem ihr Onkel Heinrich Berlin fluchtartig verlässt, laden Klaus und Erika in München in die Poschingerstraße 1 zum »Pfeffermühlen-Ball«. Die Druckwellen des Machtwechsels in Berlin kommen in München etwas später an, das katholische Bayern hat noch eine gewisse Widerstandskraft, sogar über eine Rückkehr zur Monarchie raunt man dieser Tage.
Wie gut, dass die Eltern gerade unterwegs sind. Seit Tagen haben Klaus und Erika zu Hause alles mit Girlanden geschmückt, die Diele vor allem, neue Platten für das Grammophon gekauft – mit Pomp soll der Abschluss der ersten, ruhmreichen Spielzeit von Erikas »Pfeffermühlen«-Kabarett gefeiert werden. Fast jeden Abend hat sie in der Kleinkunstbühne »Bonbonniere«, direkt hinterm Hofbräuhaus, mit scharfer Zunge Scherze getrieben, auf Kosten der Spießer im Allgemeinen und der Nazis im Besonderen. Deren Presse sind diese Abende ein großer Dorn im Auge. Aber Erika gibt sich unerschrocken, treibt das neue Regime weiter zur Weißglut, gemeinsam mit ihrer Geliebten, der berühmten Theaterschauspielerin Therese Giehse, auf der Bühne fühlt sie sich auf merkwürdige Weise unverwundbar. Beim Ball in der Poschingerstraße sind die beiden das gefeierte Paar des Abends, eng umschlungen sitzen sie in ihren Karnevalskostümen auf der Couch in der Diele. Erika stolziert als Harlekin durch die Räume, auch wenn sie etwas torkelt, weil sie »früh besoffen« ist und im Kinderbadezimmer einschläft, wie Klaus später in sein Tagebuch schreibt. Er selbst geht ganz in Rot als Kardinal, sein Lippenstift ist farblich genau auf das kirchliche Gewand abgestimmt. Aber die Feier endet dennoch zu einer nicht christlichen Zeit, ja sie beginnt eigentlich gegen Mitternacht erst so richtig. Gegen sieben Uhr wankt Klaus schließlich die Treppe hoch, im Arm seinen Geliebten Herbert Franz, genannt »Babs«, dem nicht so berühmten Theaterschauspieler, der einen Tirolerhut zur Lederhose trägt. Auf der ersten Etage stoßen Hochwürden und Seppl auf die kleine Elisabeth, die dort gerade mit dem Hausmädchen frühstückt und große Augen macht. Sie muss gleich zur Schule.
Ein paar Stunden später schleppen sich Klaus und Erika derangiert in die Arcisstraße, zum Tee im Palais der Großeltern, sie haben dummerweise mal wieder versprochen, an diesem Nachmittag vorbeizukommen. Ja, eigentlich ist fast jeden zweiten Tag einer der Enkel bei den Großeltern, und sobald sie auf Reisen sind, fließt ein steter Briefstrom ins Pringsheim’sche Palais.
Aber an diesem Tag merkt die Großmutter, dass mit ihren beiden ältesten Enkeln nicht viel anzufangen ist: »Beim Tee Eri und Aißi, völlig verkatert von ihrem gestrigen häuslichen Pfeffermühlenfest.«
Überhaupt, diese Großmutter! Hedwig Pringsheim, steinreich, lebenstüchtig, hochfahrend, hartgesotten – und voll wunderbarem Witz. Die Tochter der Frauenrechtlerin Hedwig Dohm und des Chefredakteurs des Kladderadatsch ist einige Jahre Schauspielerin gewesen, bevor sie mit 23 Jahren die Bühne der Ehe betreten hat. Sie ist vor kurzem 78 Jahre alt geworden, aber der Zahnarzt mit dem schönen Namen Doktor Knoche hat ihr gerade bescheinigt, dass sie das Gebiss einer Vierzigjährigen habe, wie sie stolz in ihrem Tagebuch vermerkt. Ihr Mann ist der vergnügte 83-jährige Alfred, Mathematikprofessor und, dank des Erbes der väterlichen Eisenbahnfabrik, ein großer Mäzen, einst – er erzählt es jedem, der es nicht hören will – war er ein enger Brieffreund von Richard Wagner. Alfred spielt im von den wichtigsten Malern seiner Zeit ausgestatteten Musiksalon noch immer sehr schön Klavier, gerne auch vierhändig, zum Beispiel mit seiner Enkelin Monika, die schreibt ihm deshalb manchmal seltsame Liebesbriefe, die er aber immer schnell verschwinden lässt, bevor seine Frau die Nase darüber rümpfen kann. Ansonsten ist er nicht so diskret, ein Leben lang muss Hedwig Pringsheim seine wechselnden Liebschaften sogar zu Hause zum Tee empfangen – und dabei Haltung bewahren und lächeln, furchtbar. Milka Ternina ist die Erste gewesen, eine berühmte Wagner-Sängerin. Sie wird dann abgelöst von einer adligen Malerin, die besucht Alfred nachmittags zum Tee, ja, der Hausherr hat es nicht nur zu Hause, sondern auch aushäusig gerne ein bisschen kultiviert.
Katia wird früh zur Vertrauten ihrer Mutter, die ihr vom untreuen Vater erzählt und dessen Nachmittagen eines Fauns – und ist also bestens auf eine Ehe in Lüge vorbereitet.
Offi und Ofei heißen die Großeltern bei den Kindern der Manns. Nur manchmal, wenn er ein wenig genervt ist, nennt Klaus sie »die Urgreise«. Die Familien besuchen sich permanent, meist geht es zu den Großeltern in das schöne Palais, nur sehr selten kommen sie mal zu den Manns, weil Alfred und Thomas sich nicht sonderlich leiden können und es die entspannten Großeltern etwas lächerlich finden, dass in der Poschingerstraße immer Ruhe – nein: Ru-he! – bewahrt werden muss, wenn der Dichter gerade dichtet oder denkt oder raucht oder ruht – also eigentlich immer.
Ansonsten hat der vom väterlichen Erbe verwöhnte Alfred eigentlich nie Probleme im Leben, aber gerade Mitte Februar 1933 leider doch: Der Nagel am großen Zeh des linken Fußes ist ihm eingewachsen und schmerzt in den engen Maßschuhen. »Er muckert schon lange«, schreibt seine Gattin Hedwig, nun müsse wohl endlich der Doktor nach Hause kommen. Sie selbst hat zwar 39 Grad Fieber und starken Husten, muss aber dennoch den ganzen Tag mit der Vorbereitung auf die kleine häusliche Operation »verplempern«, wie sie schreibt. Dabei wollte sie doch eigentlich das neue Buch mit den Briefen von Goethes Mutter zu Ende lesen. Um siebzehn Uhr kommt dann tatsächlich der Arzt und schneidet den Nagel erfolgreich frei.
Am nächsten Tag geht es Hedwig weiterhin überhaupt nicht gut, der Herr Gemahl mit verbundenem Zeh lässt sich aber trotzdem gerne weiter bedienen: »Sehr elend, dabei Alfred, dem es trefflich geht, versorgt.« Man kann förmlich hören, wie sie, die Tochter der Frauenrechtlerin und ausgebildete Schauspielerin, diese lebenslange Rolle quält.
Mit seinem Freund Kai Köster fährt Golo Mann übers Wochenende nach Weimar, er will sich ein wenig erholen vom Lernen fürs Staatsexamen. Sie wohnen standesgemäß im Hotel Elephant. Und sie gehen ins ehemalige Wohnhaus Goethes. Niemand ist da außer ihnen. Der alte Hauswart führt sie durch den Frauenplan 1, pustet hier und da ein wenig Staub von den Regalen und zeigt ihnen die Bücher, die Sammlungen, schließlich: den Lehnstuhl, in dem Goethe gestorben ist. Sie gehen weiter, man hört nichts außer den knarrenden Dielen, und Golo erschauert vor der Leere in dem großen, ausgestorbenen Haus.
Am Abend des 22. Februar kreuzen sich in Paris die Wege der Brüder Heinrich und Thomas Mann. Heinrich verbringt in der französischen Hauptstadt den ersten Abend seiner Emigration. Für Thomas ist es die dritte Station seiner Vortragsreise. Thomas wohnt mit Katia wie ein Staatsgast im Hôtel Majestic, wird gefeiert und geehrt und hält auch in Paris seine Rede über »Leiden und Größe Richard Wagners«. Dort sagt er, dass es sich für ihn verbiete, »in Wagner einen Vorläufer des Hitlerismus zu sehen«.
Morgen wollen Thomas und Katia weiter zur Erholung in die Schweiz reisen, um von dort dann im März nach Deutschland zurückzukehren. Heinrich aber zieht es nach Südfrankreich, ihm erscheint eine Rückkehr in die deutsche Heimat lebensbedrohlich und undenkbar. Das sagt er auch dem Bruder, als sie sich in einem Restaurant treffen, doch der will davon nichts wissen. Sie sind sehr verschieden, so ähnlich sie mit ihren buschigen Schnauzbärten aussehen mögen, zu sagen haben sie sich wenig. Inzwischen sind sie aber geübt darin, das zu überspielen. Lübeck als geistige Lebensform – das heißt eben auch: Haltung wahren. Gerader Rücken, unbewegte Miene. Wie Statuen ihrer selbst sitzen sie in ihren gestärkten Hemden und dicken Anzügen nebeneinander und schauen hinaus auf das Pariser Leben. Es wird wenig geredet und sich viel geräuspert.
»Was für Zeiten.« – »Ja, was für Zeiten.« Immerhin, auf diese Lesart der Wirklichkeit können sie sich einigen.
Als Kinder in Lübeck haben sie einmal ein Jahr lang nicht miteinander geredet. Sie haben nie jemandem erzählt, warum. Nach dem Krieg noch mal fast vier Jahre Schweigen, so groß ist ihr Streit über die großen politischen Fragen gewesen. Seit dem Tod der Mutter geht es wieder etwas besser, aber Thomas Mann ist sehr erleichtert, als Katia endlich zum Aufbruch mahnt und erhebt sich schnell. Heinrich aber bleibt noch lange alleine in dem kleinen Restaurant sitzen, schaut auf das Treiben in den Straßen. Er denkt an Nelly. Ihren warmen Körper vermisst er immer dann besonders, wenn er kurz in die Kältekammer seines Bruders gestiegen ist.
Was für eine seltsame Familie ist diese Familie Mann: alle unauflöslich miteinander verbunden, aber oft weniger durch Liebe als durch die Sehnsucht nach Anerkennung, durch Sentimentalität, durch herzliche Abneigung oder Angst. »Wir sind eine erlauchte Versammlung – aber einen Knacks hat jeder«, diagnostiziert Thomas Mann im Tagebuch ganz nüchtern.
Zum Beispiel sie: Monika Mann, das sogenannte Mönle. Schon vor ihrer Geburt hat sie gelernt, dass es angeraten ist, die Kreise des Vaters nicht zu stören. Sie sollte eigentlich am 6. Juni des Jahres 1910 geboren werden, doch der Tag ist für den Geburtstag des Vaters reserviert, den Nobelpreisträger, und so hat der seine Frau Katia gebeten, das Kind bitte erst am 7. Juni zur Welt zu bringen. Und Katia, die früh geübt hat, nicht nur ihre gesamte Umgebung zu disziplinieren, sondern auch sich selbst, ihre Gefühle genauso wie ihre Beckenbodenmuskulatur, hat getan wie geheißen. Monika ist wie gewünscht, also leicht verspätet, auf die Welt gekommen – und ihr ganzes Leben lang wird sie diese kleine Verspätung beibehalten. Und obwohl er selbst es genau so gewünscht hat, wird sie ihrem Vater nicht nur damit immerzu auf die Nerven gehen. Er findet sie als einziges seiner Kinder etwas aus der Form geraten, weil sie immer wieder Süßes aus der Speisekammer mopst. Und auch ihre Haare sind ihm viel zu wuschelig. Einmal, als er ihre Haarpracht wieder zu ungeordnet findet, nimmt er bei einem festlichen Essen der Familie ein kleines Messerbänkchen vom Tisch und versucht hartnäckig und mit unterdrückter Wut, es in ihrem wilden Schopf einzuwickeln. Sie hat es verstört und mit offenen Augen geschehen lassen. Die anderen Geschwister haben nur gekichert.
In diesem Februar ist die 22-jährige Moni in Berlin, die Eltern haben seit Wochen nichts mehr von ihr gehört. Von ein paar Bitten um Geldüberweisungen abgesehen, natürlich.
Ja, es vergeht im Hause Mann eigentlich keine Woche, in der nicht irgendein Kind wortreich um Geld bittet. Und Katia dann wortlos überweist. Zumindest diese Ressource ist im emotional sehr unbeheizten Hause Mann dank großelterlicher Zuwendungen und fließender Bucherlöse stets im Übermaß vorhanden.
Offenbar hat Heinrich Mann mit seiner Flucht nach Frankreich im buchstäblich letzten Moment gehandelt. Nur wenige Stunden später wird seine Wohnung in der Fasanenstraße von der Gestapo auf den Kopf gestellt und Nelly Kröger festgenommen. Sie wird tagelang verhört. Wo bitteschön ist Heinrich Mann? Sie sei nur die Hausangestellte, sagt sie, und wisse von gar nichts. Die Bardame vom Kurfürstendamm spielt die Unschuld vom Lande. Die Gestapo glaubt ihr zwar nicht, lässt sie aber nach drei Tagen dennoch laufen. Als potenzielle Informantin ist sie zu wichtig – denn Nelly unterhält nicht nur intime Beziehungen zu dem Sozialistenfreund Heinrich, sondern auch, damit ihr nicht zu langweilig wird mit dem alten Herrn, mindestens ebenso intime zu einem jungen kommunistischen Untergrundkämpfer aus der Wallstraße 23, Rudi Carius. Für den ist Heinrich Mann seit dem Roman Untertan und seinem Bekenntnis zum Sozialismus ein Held. Heini und Rudi verstehen sich also, ja, wahrscheinlich ist es die unkomplizierteste Dreiecksbeziehung in diesem Buch. Heinrich Mann ist in diesen Dingen sehr großzügig.
»Frau Thomas Mann« steht auf ihrem Briefkopf. Andere Frauen würde diese Konstruktion kleinmachen, zu einem bloßen Anhängsel ihres berühmten Gatten, doch Katia Mann, geborene Pringsheim, macht sie seltsamerweise groß. Sie fühlt sich nicht herabgewürdigt, sondern erhöht. Sie kennt das Spiel von ihrer Mutter, der »Frau Professor«. Und Katia ist die Gattin des größten Dichters deutscher Sprache, die stolze Mutter seiner sechs Kinder. Sie ist Thomas Manns Managerin, sie organisiert sein Leben und seinen Aufstieg – so sieht sie sich. Und das hebt ihr ohnehin nicht unerhebliches Pringsheim’sches Selbstbewusstsein in höchste Manneshöhen. Die Eheleute treffen sich in ihrer gepflegten Ausdrucksweise, im leicht spöttischen Blick auf den Rest der Welt, in Tommys stiller Freude über Katias glucksendes Stakkato – also der geteilten Überzeugung, etwas Besseres zu sein. Und das lässt Katia ihr Hauspersonal in der Poschingerstraße nur zu gerne spüren, oft wechseln die Kinderfräuleins, die Stubenmädchen und Köchinnen im Monatstakt.
Katias größte Schwäche ist ihre Liebe für Katzenzungen aus Zartbitterschokolade, immer liegt eine geöffnete Packung im Damensalon, der geheimen Kommandozentrale des Hauses, in der auch das Telefon steht. Wenn sie abhebt, und zwar immer direkt nach dem ersten Klingeln, und die Frau des Hauses dann laut »Mann« sagt, da halten sie die meisten Anrufer für ihren Gatten, so tief ist ihr Bass.
In ihrer Jugend galt Katia als beste Partie Münchens – nicht nur wegen ihres Reichtums und ihrer Schönheit, sondern auch wegen ihrer Intelligenz. Sie hat als erste Frau der Stadt das Abitur gemacht und tatsächlich ab 1901 Differentialmathematik bei ihrem Vater und Experimentalphysik bei Wilhelm Conrad Röntgen an der Münchner Universität studiert. Aber sie entschied sich dann doch lieber für das differenzierte Experiment, einen verheißungsvollen jungen Dichter zu heiraten. Und damit es gelingt, sorgt sie ein ganzes Leben lang dafür, dass die physikalischen Kräfte, die von innen und außen auf ihre Ehe einwirken, abgeleitet werden. Seltsamerweise kriegt sie das hin.
Aber offenbar nur unter völliger Selbstaufgabe: »Ich habe in meinem Leben nie tun können, was ich eigentlich tun wollte«, so wird sie ganz am Ende resümieren.
Das klingt bitter. Und nach Selbstverleugnung. In dieser Familie ist allerdings immer alles anders, als man denkt.
Denn Frau Thomas Mann lächelt, fast selig, als sie dieses Lebensfazit zieht.
Aber jetzt, in diesem Februar 1933, ist sie gerade erst 49 Jahre alt und also mitten dabei, zu tun, was sie nicht tun will. Nach langer Zugfahrt ist sie soeben mit ihrem Mann aus Paris in Arosa angekommen, in ihrem vertrauten Waldhotel, sie müssen jetzt ihr Zimmer beziehen, und sie hofft inständig, dass ihr Gatte sich auf der langen Zugfahrt nicht erkältet hat, denn dann, ja, dann ist er wirklich nicht auszuhalten.
Katia Manns Zwillingsbruder heißt übrigens Klaus, ist Professor für Kompositionslehre in Tokio und homosexuell. Aber er und seine Frau haben, um die Form zu wahren, dennoch zwei Kinder in die Welt gesetzt. Katia Mann ist also auch von Hause aus bereits vor ihrer Ehe über die Tiefen und Untiefen männlichen Begehrens unterrichtet.
Katias homosexuellem Sohn Klaus geht es gerade nicht gut. Ja, ihm geht es leider nie wirklich gut, er leidet von Anfang an, und zwar an sich und an der Welt und am Vater, aber in diesem Februar 1933 ist es selbst für seine Verhältnisse alarmierend.
Klaus versucht zu lesen, um sich zu beruhigen, Neues, Altes, bei Friedrich Hebbel findet er dann einen Satz, durch den er sich plötzlich erkannt fühlt: »Die allgemeinen Schmerzen als persönliche fühlen, großes Unglück!« Ja, ihn drückt der Beginn der Nazidiktatur, der Ausbruch von Bestialität und Dummheit auf eine jähe Weise nieder. Die Schwermut ist schon immer der Schatten seiner Unruhe, die Angst das Echo seiner Brillanz, die Eitelkeit die Tarnung seiner Verlorenheit. Er will alles anders machen als sein sonderbarer Vater, also sein Schwulsein ausleben, die Formlosigkeit feiern, nichts unterdrücken, aber dummerweise hat er sich dafür genau wie der Vater das Schreiben ausgesucht.
Und dummerweise hat er geglaubt, schon mit 26 Jahren, also im Jahre 1932, seine erste Autobiographie schreiben zu müssen, Kind seiner Zeit heißt sie. Die Zeitungen überziehen ihn mit Spott. Klaus ahnt da noch nicht, dass er längst dabei ist, parallel eine viel bessere Autobiographie zu schreiben: sein Tagebuch. Seine intimen Schilderungen der 1930er Jahre sind von verblüffender Genauigkeit und politischer Schärfe, sein Blick auf sich selbst von bestürzender Unbarmherzigkeit. Daraus wissen wir, dass ihn im Februar 1933 Selbstmordgedanken quälen. »Wenn ein Gift dastünde, würde ich sicher nicht zögern«, schreibt er am 19. Februar, »wenn nicht E (und M) wären. Dadurch gebunden.« E, Erika also, seine geliebte Schwester, mit der er gemeinsam durch die Welt hetzt, und – in Klammern – M, also Mielein, die Mutter. Mehr hält ihn nicht am Leben. Nachts träumt er, dass Erika ein Kind von ihm bekommt – aber dann ist das Traumkind doch von einem anderen.
Trost findet er bei den »unendlich schönen« Gedichten von Gottfried Benn, von ihm fühlt er sich verstanden wie von keinem anderen der deutschen Autoren seiner Zeit, immer wieder zitiert er dessen Kokain-Anbetung: »Den Ich-Zerfall, den süßen, tiefersehnten – den gibst Du mir«.
Ja, sein Ich-Zerfall schreitet voran in diesem Februar. Selbst, als er mit Erika das Pfeffermühlenfest im verwaisten Haus in der Poschingerstraße feiert, simuliert der rotgewandete Kardinal den Frohsinn nur, darin ist er immer schon sehr gut gewesen: »Verzweifelte Lustigkeit«, schreibt er nachts ins Tagebuch.
Die Todessehnsucht wird immer größer bei Klaus in diesem düsteren deutschen Februar, der dünne Vorhang zwischen Leben und Tod beginnt zu flattern. Seine Drogendosis steigt von Tag zu Tag. Erstaunt vermerkt er im Tagebuch: »Übrigens keine Spur von Todesangst.«
Genau die aber spürt seine Familie – und sie haben große Panik. Wenn er an die Mutter schreibt, die gerade in Arosa im Waldhotel angekommen ist: »Es geht nicht gut, es geht nicht gut, es geht keinesfalls gut«, dann meint er zwar die politische Lage. Aber alle wissen, dass er auch sich selbst meinen könnte. Schon zwei Schwestern haben Heinrich und Thomas Mann durch Selbstmord verloren. Carla im Jahre 1910 und 1927 Julia. Und auch Katia Manns ältester Bruder Erik, spielsüchtig und den Drogen verfallen, hat sich, von der Familie wegen seiner Unseriosität nach Argentinien verstoßen, das Leben genommen.
Alles dunkle, tiefdunkle Geschichten, die niemand auch nur antippen darf. Lieber verdrängen. Ja verdrängen, das kann wirklich jedes Mitglied der Familie Mann exzellent.
Und müsste das nicht eigentlich reichen an Leid für eine Familie, so fragen sich Heinrich und Thomas manchmal (aber natürlich nur jeder für sich). Und trotzdem: Wenn Klaus, der als drückende Last den Vornamen des berühmten Onkels und des noch berühmteren Vaters trägt, also – man glaubt es kaum – offiziell Klaus Heinrich Thomas Mann heißt, wenn er also so kokett mit dem Selbstmord flirtet, dann tun Vater und Onkel immer, als ginge sie das nichts an. Er wird schon nicht.
Aber E und M, der Schwester und der Mutter, denen schnürt es jedes Mal das Herz zu.
Es geht nicht gut, hat Klaus geschrieben. Es geht keinesfalls gut.
Oder etwa doch?
März
Am frühen Morgen des 1. März kommt Heinrich Mann nach zwölfstündiger Fahrt aus Paris im südfranzösischen Toulon am Bahnhof an. Ein leuchtender Tag, blauer Himmel, wolkenlos. In den vergangenen Jahren ist er oft zum Urlaub an seine geliebte Côte d’Azur gereist und hat das stilvolle Leben in Nizza genossen. Doch diesmal kommt er als Exilant. Sein alter Freund Wilhelm Herzog, der ihm Anfang Februar ins Exil nach Sanary-sur-Mer vorausgegangen ist und dem er beim Grenzübertritt ein Telegramm geschickt hat, holt ihn am Bahnsteig ab. Sie umarmen sich. Und Herzog schreibt später in sein Tagebuch: »Heinrich Mann. Glücklich entronnen dem 3. Reich. Lacht, freut sich wie ein Kind.«
Dann hat also wenigstens ein Mann gute Laune in diesem dramatischen März.
Golo fühlt sich so durchschaut wie noch nie zuvor in seinem Leben. Selbst sein Vater hat nicht so tief in seine Seele hineinblicken können wie dieser Hans Bauer. Er hat seinen alten Schulkameraden aus Salem zufällig wiedergetroffen, und weil beide in Hamburg studieren, ziehen sie zusammen. Und dann liegt eines Tages Bauers Tagebuch auf Golos Schreibtisch. Er kann nicht anders, als hineinzuschauen. Und findet dort Einträge über sich selbst, die ihn bis ins Mark erschüttern. Golo habe, so diagnostiziert Bauer, »ungeheure Schwierigkeiten, das als richtig Erkannte in die Tat umzusetzen«. Oh Gott, denkt Golo, so ist es. Und dann: »Die Eitelkeit wird erfolgreich durch seinen überaus starken Geist niedergehalten.« Und so weiter und so weiter. Golo traut seinen Augen nicht. Besonders schmerzhaft: Bauer erkennt auch seine körperlichen Hemmungen und die verklemmte Hinwendung zu Männern.
Vor ein paar Jahren hat sein Schulleiter aus Salem genau deswegen sogar an Thomas Mann geschrieben, es gebe bei Golo offenbar »abnorme Triebe«, die »ausgehungert« werden müssten. Es ist allerdings zu vermuten, dass er mit diesen erotischen Diätvorschlägen ausgerechnet bei Thomas Mann nicht an der richtigen Adresse gewesen ist.
Klar ist hingegen, wieso Golos Innerstes für diesen Hans Bauer so leicht zu lesen ist wie ein offenes Buch: Weil diese verlorene Seele offenbar Golos eigene Tagebücher von vorne bis hinten gelesen und dann dessen Seelenqualen in eigene Deutungen verwandelt hat, um ihn zu kränken. Dieses fingierte Tagebuch hat er dann auf Golos Tisch gelegt, um sicherzugehen, dass er es auch liest. Es ist wohl eine unglückliche Verliebtheit, die sich bei Bauer über ein ohnehin großes Unglück gelegt hat.
Kurz danach springt jener Hans Bauer vor eine Straßenbahn und nimmt sich das Leben. So kommt dann zu Golos Scham ein Gefühl der Schuld hinzu, weil er einem Verzweifelten nicht geholfen hat.
Sein ganzes Leben lang wird diese Geschichte Golo nicht mehr loslassen, die Demütigung, die Verstörung, der Selbstmord. Nie ist er so in den Abgründen seines Daseins umhergeirrt wie in diesen Tagen der Erniedrigung und des Erschreckens. Es ist wie »ein Blitzstrahl, der so dicht neben mir niederging«, schreibt er.
In Göttingen, wo er sich auf sein Staatsexamen fürs Lehramt vorbereiten will, wacht er nachts oft auf, weil ihm diese schmerzlichen Tage wieder im Albtraum erschienen sind. »Wäre ich ein Dichter, so würde ich es literarisch verwerten, aber es ist mir unmöglich, ja verhasst«, so schreibt er am 4. März an die Schwester des Verstorbenen, Lisl Bauer, die er auf Hans’ Beerdigung kennengelernt hat. Und dann plötzlich bricht, nein brüllt das nationale in das persönliche Drama hinein: »Indem ich dies schreibe, gellt die Stimme Hitlers aus einem Lautsprecher vom Marktplatz zu mir heraus durch die Nacht, dazu Freudenfeuer und Scheinwerfer, als hätte man Polen und Frankreich besiegt.«
Im überheizten Salon des Waldhotels Arosa, hoch oben zwischen den schneebedeckten Bergen, sitzen am 5. März Katia und Thomas mit ihrer aus München angereisten Tochter Elisabeth und vielen weiteren Gästen nach dem Abendessen gebannt vor dem Radio, um die Nachrichten vom Ausgang der deutschen Wahl zu verfolgen. Ab 21 Uhr treffen die Ergebnisse ein. Dröhnend erklären sich die Nationalsozialisten zum Sieger. Vor Erregung kann sich Katia nicht länger auf ihrem Stuhl halten, sie springt auf und empört sich: »Das ist doch überhaupt lächerlich, das sind doch gar keine freien Wahlen gewesen. Die Opposition haben sie ja längst eingesperrt.« Da kommt ein anderer Gast auf sie zu und flüstert: »Gnädige Frau, aber nehmen Sie sich doch bitte in Acht.« Katia erschrickt kurz, aber natürlich zeigt sie es nicht.
Sein neuer Verleger ist früher Arzt gewesen, darum nimmt Thomas Mann es zunächst wörtlich, als ihm Dr. med. Gottfried Bermann Fischer, der Schwiegersohn seines inzwischen recht altersschwachen Erstverlegers Samuel Fischer, in seinem Brief vom 9. März dringend dazu rät, den Aufenthalt in Arosa aus »gesundheitlichen Gründen« zu verlängern: »Ich höre, dass Sie schon so rasch ihre Kur abbrechen wollen. Ich halte das vom ärztlichen Standpunkt aus für vollständig verkehrt.« Langsam dämmert Thomas, dass ihn hier eine verschlüsselte Botschaft erreicht, vor allem, weil Fischer sodann warnt, dass es sonst »unerwartete Attacken« geben könnte. Irritiert liest er seiner Frau den Brief vor, als sie mit Medi vom Skifahren ins Hotel zurückkommt.
In der verwaisten Familienvilla in der Poschingerstraße 1 überlegen auch Klaus und Erika, wie sie ihren Eltern klarmachen können, dass sie auf keinen Fall aus Arosa zurück in die Heimat kommen dürfen. Die Lage der Nation ist besorgniserregend, spätestens seit dem Reichstagsbrand vom 27. Februar greifen die Nationalsozialisten durch und versetzen das ganze Land in Angst und Schrecken. Alles lodert, ein blinder Rausch. Die SA und die SS marschieren nun auch durch die Straßen Münchens, vor den Häusern der prominenten Juden und Pazifisten postieren sich die Nazischergen in ihren langen Ledermänteln. Überall Einschüchterungen, Durchsuchungen, Verhaftungen. Die Zeitungen wüten gegen die Juden und die Feinde der nationalen Erhebung. Am Münchner Rundfunk werden keine Juden mehr beschäftigt. Über allen öffentlichen Gebäuden der Stadt weht die Hakenkreuzfahne zum »Sieg der nationalen Revolution«. Und in Berlin wird Carl von Ossietzky, der feinsinnige, pazifistische Herausgeber der Zeitschrift Weltwoche, am 28. Februar, also direkt nach dem Brand des Reichstages, erst in Schutzhaft genommen und wenig später in das erste Konzentrationslager in der Nähe der Hauptstadt gebracht. Diesem Schicksal ist Klaus’ und Erikas Onkel Heinrich durch seine Flucht offenbar gerade noch zuvorgekommen. Trotzdem, die Einschläge kommen näher, die Geschwister verfolgen sie mit einer Mischung aus Bitterkeit und sensationslüsternem Entsetzen: Ob die Wirklichkeit es wohl noch toller treibt, als sie es sich in ihren schlimmsten Träumen und ihren derbsten Scherzen für die »Pfeffermühle« ausgemalt haben? Ob dieses Land wirklich alles zerstört, was seinen Wert, seinen Reiz und seine Würde ausmacht? Am 11. März notiert der ansonsten so redselige Klaus nur ein einziges Wort in seinem Tagebuch: »Wegfahren?« Noch setzt er ein Fragezeichen dahinter, aber es hat nur eine sehr kurze Halbwertszeit.
Die nationalsozialistischen Zeitungen verfolgen Erika und Klaus ohnehin bereits, nicht nur, weil sie offen homosexuell leben, sondern weil in Erikas Kabarett zu viele böse Witze auf Kosten der Nazis gemacht worden sind. Und auch, weil in München stadtbekannt ist, dass Hedwig und Alfred Pringsheim, die Eltern ihrer Mutter, jüdische Wurzeln haben. Das gilt in der »Rassenlogik« der Nationalsozialisten ebenso für ihre christlich getaufte Mutter – und damit auch für Erika und Klaus selbst. Dennoch erahnen allein die beiden Geschwister, die früher ganz unpolitischen Bohemiens, in diesem März die Dimension der drohenden Gefahr. Die Großeltern sind von irritierender, trotziger Sorglosigkeit. Als könnten ihr Reichtum und ihre gesellschaftliche Stellung sie schützen. Und auch ihr Vater in Arosa will den Ernst der Lage, anders als ihre Mutter, nicht begreifen, er will eigentlich gerne direkt zurück nach Deutschland in seine schöne Villa mit seinen Büchern und dem Grammophon und plant schon den gemeinsamen Familienurlaub in Nidden an der Kurischen Nehrung im Juli. Würde er nicht zurückkehren, so sagt er Katia, wäre das ein fatales Signal, denn das würde ja bedeuten, dass er an den Erfolg der Nationalsozialisten glaube.
Am 11. März melden Klaus und Erika für Punkt achtzehn Uhr ein Ferngespräch mit dem Ehepaar Thomas Mann an, zur Zeit Gast im Waldhotel in Arosa, Zimmer 210 und 211.
Thomas Mann fühlt sich sehr unwohl in seiner Haut. Er hat seit seinen Anfängen als Schriftsteller, die mit den Anfängen des Jahrhunderts zusammengefallen sind, penibel darauf geachtet, wie er gesehen wird. Er hat immer schon das Gefühl gehabt, eine symbolische Existenz zu führen. Mitten in seiner unmittelbaren Gegenwart denkt er sich selbst als historische Figur. Man kann das als Größenwahn bezeichnen, aber vielleicht ist er ja auch nur Realist?
Auf jeden Fall behagt es ihm überhaupt nicht, dass auch er sich nun, Anfang März 1933, wie andere berühmte Schriftsteller der Weimarer Republik, etwa Erich Maria Remarque oder Alfred Döblin, im Ausland aufhält, während sich im »Reich«, wie er es immer nennt, die großen Umwälzungen vollziehen. Thomas Mann sieht sich als wahren Patrioten – und findet den Patriotismus der Nationalsozialisten samt ihrem allabendlichen Fackel-Pathos nur lächerlich. Er will nicht, dass der Eindruck entsteht, »diese Kreaturen«, wie er sie verächtlich nennt, hätten die Macht, ihn außer Landes zu treiben. Dass seine Frau und Kinder jüdische Wurzeln haben, das findet er naiverweise gerade überhaupt nicht der Rede wert.
Ihn treibt etwas ganz anderes um. Thomas Mann weiß, dass die anderen geflüchteten Autoren sich als »Emigranten« sehen. Doch er, der große Thomas Mann, der deutsche Nobelpreisträger, er will partout kein Emigrant sein. So fühlt er sich nicht. Und so kann es deshalb doch auch nicht sein (in rührender Weise hält er seine Eigenwahrnehmung zeitlebens für die einzig denkbare Wirklichkeit).
Wenn Katia das Wort »Emigrant« ausspricht, verzieht er darum den Mund. Er? Nein, bitte nicht. Er hat das Gefühl, das sei unter seinem Niveau. Er will nicht Teil einer Zwangsgemeinschaft sein. Ein Thomas Mann lässt sich von niemandem sagen, an welchem Ort er zu sein hat! Zugleich spürt er, dass sein Fernbleiben von München langsam genau das vermuten lässt. Darum betont er in all seinen Gesprächen und Briefen, er sei nur ein bisschen länger auf Urlaub. Und kehre selbstverständlich bald zurück. Als sei seine Heimat nur in einem kurzen, bedauerlichen Rausch, den er eben abwarten wolle. Das hofft er tatsächlich immer noch, auch wenn ihm langsam klarwird, dass er vergeblich hofft. An das »liebe Fräulein Herz«, also jene Nürnberger Verehrerin, die er als eine Art ausgelagertes Archiv und Kummerkasten nutzt, schreibt er am 10. März aus dem Waldhotel: »Kann nicht recht essen und nicht recht schlafen, und der Gedanke eines vollständigen Umsturzes meiner Existenz, die Vorstellung, ins Exil gehen zu müssen, ein Siebenundfünfzigjähriger, der mit der Kulturüberlieferung und der Sprache seines Landes so tief verbunden, so sehr auf sie angewiesen ist, hält mich in ununterbrochener Erregung und Erschütterung.« Da hat man die innere Zerrissenheit von Thomas Mann in einem Satz, sogar vom »Exil« spricht er, also natürlich nur von der »Vorstellung, ins Exil gehen zu müssen« und auch nur, solange diese Vorstellung in einem Briefumschlag bleibt. Er habe, so schreibt er weiter an die Herz, ein paar Münchner Freunde brieflich um vertraulichen Rat gebeten, ob seine Rückreise nach Deutschland angeraten sei. Wenn er am nächsten Tag, also am 11. März, keine »Warnung« bekomme, dann hoffe er, so schreibt Thomas Mann, am 12. März endlich nach München zurückzukehren.
Noch ist Zeit bis zum Anruf bei den Eltern. Klaus geht ein wenig durch den Garten, die Sonne scheint prachtvoll vom Himmel, es ist ein herrlicher Vorfrühlingstag. Der Blick geht weit von hier, bis zu den Bergen; dreht man sich, sieht man die Türme der Frauenkirche. Aus dem müden Gras recken sich überall die ersten Schneeglöckchen nach oben. In den Birken hüpfen die Spatzen umher, und die ungeduldigen Heckenrosen auf der Terrasse vor Vaters Arbeitszimmer treiben schon aus. Die rosa Knospen des Mandelbaums sammeln ihre Kräfte. Von unten dringt das vertraute Rauschen der Isar zu ihm herauf. Gedankenverloren berührt Klaus die Statue des Hermes, die vom Garten aus seit langem über die Familie wacht. Er fragt sich, ob der Gott der Reisenden sie wohl wirklich alle schützen kann auf ihren Irrfahrten.
Dann dreht Klaus sich um, blickt auf das prachtvolle Haus. Wann hat eine deutsche Schriftstellerfamilie wohl schon einmal so würdig gewohnt?
Seit zwanzig Jahren ist die Poschingerstraße 1, familienintern »Poschi« genannt, ihre Heimat. 1913, kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs, haben Thomas und Katia das Grundstück gekauft, ihre ersten vier Kinder haben sie da schon mit im Gepäck: Erika und Klaus, Golo und Monika. Und dann sind hier, in der Poschi, 1918 und 1919 noch Elisabeth und Michael dazugekommen. In der weitläufigen Villa ist für alle reichlich Platz. Unten in der Garage stehen drei Autos, der Horch, der Buick und der kleine rote DKW. Im Keller wohnen fünf Hausangestellte, neben der besagten Kurz Marie aus Niederbayern, dem Kinderfräulein und Mädchen für alles, gibt es noch die Köchin Anna, die Hausmädchen Sophie und Maria und den Chauffeur Hans Holzner. Das Essen wird mit einem kleinen Speiseaufzug aus der Küche im Keller direkt ins Esszimmer transportiert, damit es die ideale Temperatur behält. Und wenn jemand von den Herrschaften nach einem neuen Haarschnitt verlangt, dann kommt der Friseur nach Hause. Willkommen im Grand Hotel Mann. »Ich fürchte mich nicht vor Reichtum«, so hat Thomas Mann es einst in seinem Brautbrief an Katia geschrieben.
Das Fundament für diesen Wohlstand hat Thomas Manns Roman Buddenbrooks gelegt. Untertitel: »Verfall einer Familie«. Lustig, denkt Klaus, dass für den Vater der finanzielle Aufstieg seiner Familie mit der Erzählung des Niedergangs seiner Herkunftsfamilie begonnen hat. Von der Volksausgabe bei S. Fischer haben sich inzwischen über eine Million Exemplare verkauft. Und dann kommen die stetig sprudelnden Geldquellen der Großeltern Ofei und Offi dazu, der Erlös vom Zauberberg und so weiter, und der Nobelpreis legt 1929 um alles noch einmal einen Goldrand. Ja, in der Poschingerstraße 1 lässt es sich wohl sein, hier residiert sichtbar ein Dichterfürst. Oder sollte man besser sagen: residierte?
Es ist achtzehn Uhr. Klaus und Erika gehen aus der Diele nach nebenan, ins Zimmer der Mutter, wo der Telefonapparat steht. Sie beginnen das Gespräch sehr ernst, Mielein gibt den Hörer an Thomas weiter, was selten genug geschieht. Erika, der die tiefstehende Sonne durchs Fenster ins Gesicht scheint, sagt ganz ruhig: »Das Wetter hat umgeschlagen. Das Klima ist sehr schlecht. Es wird euch nicht förderlich sein hier.« Und als der Vater die Geheimbotschaften nicht begreift und antwortet, das schlechte Wetter störe ihn doch nicht, in zwei Tagen seien sie wieder in München, da wird Erika ganz direkt, auch wenn sie eigentlich Angst hat, dass die Leitung schon abgehört wird: »Vater, hörst du, es ist dringend angeraten, fürs Erste in Arosa zu bleiben.« Schweigen am anderen Ende der Leitung. Langes Schweigen. Dann versteht der Zauberer.