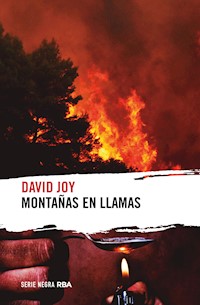11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Polar Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Gewinner des Dashiell Hammett Award 2020. Als sein süchtiger Sohn mit seinem Dealer in Konflikt gerät, muss Raymond Mathis alles tun, um ihn ein letztes Mal aus der Klemme zu retten. Raymond ist frustriert über die Langsamkeit und die Beschränkungen, die ihm das Gesetz auferlegt und beschließt, die Angelegenheit selbst in die Hand zu nehmen. Nach einem Arbeitsunfall, der ihn arbeitslos machte und ihm nur Schmerzen hinterließ, jagte Denny Rattler jahrelang seinem nächsten Höhepunkt hinterher. Er unterstützt seine Angewohnheiten durch sorgfältig geplante Diebstähle und hält sich dabei an strenge Regeln, die dafür sorgen, dass er nicht ins Gefängnis kommt. Doch als Denny sich Chancen bieten, Chancen, denen er nicht so leicht widerstehen kann, trifft er zwei Entscheidungen, die alles verändern. Seit Monaten ist die DEA vergeblich auf der Suche nach Drogen in den Bergen, als ein Hinweis – nur ein Wort – einen Agenten auf den Weg bringt, den Fall aufzuklären. . . aber er wird Hilfe von unerwarteter Seite brauchen. Während der Zufall diese gegensätzlichen Männer der verschiedenen Seiten dieser unerbittlichen Drogenseuche zusammenbringt, könnte jeder zu der Erkenntnis kommen, dass seine Chance auf Erlösung bei den anderen liegt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
DARK PLACES
David Joy
Wenn diese Bergebrennen
Aus dem Amerikanischen von Sven KochHerausgegeben von Jürgen Ruckh
Originaltitel: When These Mountains Burn
Copyright: © 2020 by David Joy
Alle Rechte vorbehalten, einschließlich des Rechts der vollständigen oder teilweisen Vervielfältigung in jeglicher Form.
Diese Ausgabe wurde nach Absprache mit G.P. Putnam’s Son veröffentlicht, ein Imprint der Penguin Publishing Group, einer Division von Penguin Random House LLC
Deutsche Erstausgabe, 1. Auflage 2024
Aus dem Amerikanischen von Sven Koch
Mit einem Nachwort von Steph Post, übersetzt von Sven Koch
© 2024 Polar Verlag e. K., Stuttgart
www.polar-verlag.de
Redaktion: Andrea Stumpf
Korrektorat: Andreas März
Umschlaggestaltung: Britta Kuhlmann
Coverfoto: © Joaquin Corbalan / Adobe Stock
Autorenfoto: © Ashley T. Evans
Satz/Layout: Martina Stolzmann
Gesetzt aus Adobe Garamond PostScript, InDesign
Druck und Bindung: Nørhaven, Agerlandsvej 3, 8800 Viborg, DK
Printed in Denmark 2024
ISBN: 978-3-910918-00-9eISBN: 978-3-910918-01-6
Für Ron Rash, Mentor und Freund.
Und für die Verschwundenen und das Verschwinden.
Unter den Geliebten geliebt habe ich die Hilflosen.
Maurice Manning
Inhalt
EINS
ZWEI
DREI
VIER
FÜNF
SECHS
SIEBEN
ACHT
NEUN
ZEHN
ELF
ZWÖLF
DREIZEHN
VIERZEHN
FÜNFZEHN
SECHZEHN
SIEBZEHN
ACHTZEHN
NEUNZEHN
ZWANZIG
EINUNDZWANZIG
ZWEIUNDZWANZIG
DREIUNDZWANZIG
VIERUNDZWANZIG
FÜNFUNDZWANZIG
SECHSUNDZWANZIG
SIEBENUNDZWANZIG
ACHTUNDZWANZIG
NEUNUNDZWANZIG
DREISSIG
EINUNDDREISSIG
ZWEIUNDDREISSIG
DREIUNDDREISSIG
VIERUNDDREISSIG
FÜNFUNDDREISSIG
SECHSUNDDREISSIG
SIEBENUNDDREISSIG
ACHTUNDDREISSIG
NEUNUNDDREISSIG
VIERZIG
DANKSAGUNG
EINS
Der Regen hinterließ auf der staubigen Windschutzscheibe nur Schlieren. Während er mit beiden Händen das Lenkrad knetete, überlegte Raymond Mathis, ob es im Haus noch etwas gegeben hatte, was das Stehlen lohnte. Beim Anblick der offenen Tür hatte er schon auf der Auffahrt gewusst, wer eingebrochen hatte. Aber es war bereits alles weg, was nicht niet- und nagelfest war. Als Erstes war das verschwunden, was sich gut zu Geld machen ließ, aber inzwischen stahl der Junge sogar jeden Krempel, der noch was bringen konnte.
Im Zwinger neben dem Haus bellte Rays letzter Hund. Früher mal hatte er im ganzen Jackson County die besten Hunde zur Jagd auf Waschbären und Streifenhörnchen gezüchtet, schwarz-braune Terrier, die alles, was klettern konnte, auf die Bäume trieb und verbellte. Und noch früher, ehe Fremde das Land mit PRIVATBESITZ-Schildern zupflasterten, hatte er Beagle gehabt, die Kaninchen durchs Unterholz hetzten. Der letzte davon war Tommy Two-Ton, eine magere Hündin mit ergrauter Schnauze, die jetzt auf zitternden Hinterläufen balancierte und sich am windschiefen Maschendrahtzaun abstützte.
Als er auf das Haus zuging, war Ray froh, dass der Junge wenigstens den Hund in den Zwinger gesperrt hatte. Tommy war alt und blind, aber ihr Geruchssinn war scharf wie eh und je. Bei einem Einbruch zu Beginn des Sommers hatte der Junge die Tür offen gelassen, und Tommy war weiß Gott was nachgejagt und blieb fast eine Woche verschwunden, ehe Ray sie halb verhungert, hinkend und hechelnd zwei Täler weiter am Straßenrand auflas. Wenn ein Hund eine Fährte aufnahm, gab es kein Halten mehr, und in dieser Hinsicht waren Hunde und Menschen nicht so verschieden. Daher machte Ray ihr genauso wenig einen Vorwurf wie dem Jungen. Beide waren hinter etwas her und schadeten sich dadurch selbst, aber er wusste, dass ein Drang manchmal stärker sein konnte als jede Vernunft.
»Na, Hunger?«, sagte Ray und zog den Schubriegel an der Zwingertür auf. Die Holzpfähle des Geheges mit fünf Hundehütten waren vergraut, steckten aber noch so fest im Boden wie an dem Tag, an dem er sie gesetzt hatte. Der Regen tropfte vom Blechdach und versickerte sofort in der Erde. Die Hündin jaulte so melancholisch und einsam, als wäre seit Jahren niemand mehr bei ihr gewesen. Kaum war die Tür offen, trottete sie zum Haus und schüttelte sich mit flappenden Ohren trocken.
Es war seit Monaten der erste Regen in den Bergen. Der Boden war so ausgetrocknet, dass Ray zu hören glaubte, wie die Erde das kleinste bisschen Feuchtigkeit aufsaugte wie ein Verdurstender. In den Bergen gab es mehrere Waldbrände, Rauch lag in der Luft, und laut Wetterbericht war weit und breit keine Regenfront in Sicht. Ray kam dieser Schauer eher wie ein grausamer Scherz vor. Dennoch stand er da, sah zum Himmel, ließ die Tropfen auf seine Lider fallen und betete um ergiebigen Regen.
Er trug seinen Hut mit schmaler Krempe tief ins Gesicht gezogen. Seine Latzhose hatte dunkle Flecken an den Knien, die rechte Schulter der Canvasjacke war grob geflickt. Mit seinen eins fünfundneunzig, den einhundertfünfzig Kilo und Unterarmen dick wie Holzpfähle war er ein Bär von einem Mann. Er hatte die großen Hände seines Vaters, in denen fast alles verschwand. Ray erinnerte sich an eine Viehauktion, bei der ein alter Mann gescherzt hatte, mit solchen Pranken könne man auch Gott die Hand schütteln. Ray hatte das nie bezweifelt.
Im Regen sah das holzverschalte Farmhaus unter den grün vermoosten Dachschindeln aus Zedernholz fast silbern aus. Der leichte Wind ließ die Haustür sanft hin und her schwingen. Im vorderen Zimmer brannte Licht. Der Junge hatte keinen Schlüssel gebraucht, weil Rays Tür nicht abgeschlossen war. Dafür gab es so weit draußen keinen Grund. Er könnte das Schloss austauschen und sich angewöhnen, abzusperren, aber dann würde der Junge wahrscheinlich ein Fenster einwerfen oder die Tür eintreten, und Ray hätte noch mehr zu reparieren. Vielleicht nahm er es deswegen hin. Oder vielleicht hegte er tief im Herzen noch einen Funken Hoffnung, der ihn denken ließ: Eines Tages kommt er zurück, ohne was stehlen zu wollen. Eines Tages kommt er einfach nach Hause.
Manchmal gab er sich die Schuld für die Fehler des Jungen. Als seine Frau Doris Krebs bekam, gab Ray nichts darauf, dass die Schmerztabletten so schnell verschwanden. Alle seine Gedanken kreisten um seine langsam dahinschwindende Frau. Er fragte sich, ob er sich deswegen Vorwürfe machen musste, aber nüchtern betrachtet hatte es vor den Tabletten Crystal gegeben, und vor dem Crystal andere Tabletten, und davor Alkohol und Gras und alles, was der Junge in die Finger bekam. Vor wenigen Wochen erst hatte ihn der Sheriff in Sylva vor dem Rose’s an einer Ziegelmauer lehnend entdeckt, im Arm eine Nadel, der Mund offen, das Gesicht weiß wie der Tod, und daran war niemand schuld als der Junge selbst.
Ray sah in ihm immer noch den Jungen, und in mehrerlei Hinsicht traf das auch zu. Er glich einem Kind im Körper eines Manns. Ricky war einundvierzig und lief stramm auf den Sarg zu. Manchmal fragte sich Ray, ob Menschen schon gebrochen geboren wurden, und das war ein furchtbarer Gedanke, denn er bezog sich auf sein eigen Fleisch und Blut, seinen eigenen Sohn.
Tommy Two-Ton stand vor ihrem Fressnapf vor der Küche. Ray kniete sich neben sie und kraulte sie hinter den Ohren. Die Hündin lehnte sich mit ihrem ganzen Gewicht gegen Rays Hand. Tommys Augen waren von einem milchigen Schleier überzogen, und sie schnupperte, als Ray durch die Küche in die Speisekammer zu dem offenen Futtersack ging.
In der Küche war die Besteckschublade aufgezogen. Bis auf das darin ausgelegte abgeschabte Papier mit Blumenmuster war sie leer. Ray schloss die Augen und rieb sich die Nasenwurzel. Das Sammelsurium an Besteck war nicht mehr da.
»Gab eh mehr Gabeln als Löffel und mehr Löffel als Messer. Stimmt doch«, grummelte Ray der alten Hündin zu, als er den schweren Sack über den Fressnapf hielt und durch die abgerissene Ecke Trockenfutter hineinschüttete. Tommy fing an zu fressen und blickte ihn beim Kauen mit ihren milchigen Augen an, ohne im Geringsten zu verstehen, was der alte Mann sagte. Aber sie war zufrieden.
Im Schlafzimmer klippte Ray die Hosenträger auf und ließ die Latzhose am Fußende des Betts auf den Boden fallen. Er trug jeden Tag Latzhose und am Sonntag die Ausgehlatzhose, genau wie sein Vater und Großvater, die darin auch beerdigt wurden. Das Schmuckkästchen aus Kastanienholz, das er seiner Frau bei einem Mountain Heritage Day gekauft hatte, stand da, wo sie es zuletzt hingestellt hatte, mitten auf der Schlafzimmerkommode. Er betrachtete sich im Spiegel. Der dichte grau gesprenkelte Bart begann knapp unter seinen Augen und reichte ihm fast bis zur Brust. Sein Mund lag hinter einem dichten Haarvorhang, was seine Worte wie aus dem Nichts kommen und seine Miene unergründlich scheinen ließ. Er hob seinen Hut am Kniff, fuhr sich mit den Fingern durch das, was von seinem Haar übrig war, und atmete seufzend aus. Die kleine Kupferlasche, die das Schmuckkästchen verschloss, ragte nach oben. Eine Weile stand er da und fuhr mit dem Finger am Deckelrand entlang, bis er den Mut fand, das Kästchen zu öffnen.
Das kleine Silbermedaillon und der silberne Ehering von Doris’ Mutter lagen auf einer Seite des mit schwarzem Samt ausgeschlagenen Bodens. Der Ehering war zu einem krummen Oval verzogen und dort, wo er der Mutter bei der Arbeit in den Kohlfeldern zwischen den Fingern rieb, fast durchgescheuert. Weil Doris nie gerne Schmuck getragen hatte, hatte sie ihren eigenen goldenen Ehering und den Verlobungsring mit dem kleinen Diamanten, den Ray bei Hollifield’s gekauft hatte, ehe er um ihre Hand angehalten hatte, mit einem grünen Faden zusammengebunden. Sonst war in dem Kästchen nur eine alte Ein-Cent-Münze, die ihr ein kleines Mädchen einmal spontan an der Fleischtheke von Harold’s Supermarket geschenkt hatte. Die Münze war eins der Dinge, die einem zufällig in die Hände fallen und die man genauso zufällig sein Leben lang behält.
Ray machte das Kästchen zu und klappte die Verschlusslasche nach unten, stützte sich mit den Handknöcheln auf die Kommode und beugte sich zum Spiegel vor. Seine Augen waren blutunterlaufen und gelblich, die hellblaue Iris fast grau. Er war dankbar, dass manche Dinge noch heilig waren. Auch wenn das nicht so bleiben mochte, so galt es doch für den Moment.
Mit geschlossenen Augen atmete er ein, bis nichts mehr in seine Lunge passte. Er fragte sich, wo der Junge sein mochte. Das leise Trommeln des Regens auf dem Dach verstummte, und die Stille erstickte die letzten Gedanken. Es war kaum genug Regen gefallen, um den gröbsten Staub von der Welt zu waschen. Ray konnte sich nicht erinnern, wann das letzte Mal eines seiner Gebete erhört worden war.
ZWEI
Ein Waldbrand am Moses Creek beleuchtete den Bergkamm von hinten und ließ ihn wie einen Scherenschnitt aussehen, aber der Wind wehte in die andere Richtung, sodass kaum Gefahr bestand, das Feuer könnte den Grat überspringen und Wayehutta erreichen, ein verlorenes, von den Einheimischen wie worry hut ausgesprochenes Nest. Wie jeden Abend saß Raymond auf seiner Veranda und hörte den Polizeifunk, während er eine Backwoods-Zigarre rauchte und Redbreast-Whiskey auf das knackende Eis in einem Marmeladeglas goss.
Ein Mensch brauchte Beständigkeit, etwas, das ihm Halt gab, wenn die Welt aus den Fugen geriet. Früher oder später musste das geschehen, und dann lag es an der Einstellung, ob man den Kopf in den Sand steckte oder das Unvermeidliche mit erhobenem Haupt hinnahm. Komme, was wolle, Ray begann jeden Tag mit einer Kanne Kaffee und einem Buch und beendete ihn mit vier Fingerbreit eines anständigen Whiskeys und einer billigen Zigarre.
Aus dem Funkverkehr ging hervor, dass der Wald rund um den Campingplatz, wo die öffentlichen Jagdgebiete begannen, Feuer gefangen hatte. Die Feuerwehr hatte Schutzschneisen geschlagen und den Brand eingedämmt, aber »eingedämmt« war in letzter Zeit ein relativer Begriff geworden. Die ganze Region war strohtrocken. Sobald sich ein Feuer verzehrt hatte, trug der Wind Glut oder Funken weiter, und das nächste Stück Land brannte zu einem verkohlten Flecken nieder. Im Grunde jedoch war es erstaunlich, dass das nicht schon früher passiert war, so viel war Ray nach dreißig Jahren als Waldarbeiter klar. Der Wald war jahrzehntelang vernachlässigt worden und jetzt voll von Brennmaterial. Wer nur ein bisschen was von der Sache verstand, hatte es kommen sehen müssen.
Paffend rauchte Ray die Zigarre an, zupfte einen Tabakkrümel von seiner Zungenspitze und wischte ihn an den Stiefelabsatz. Auf dem Schoß hatte er ein Buch, das er im Sommer im City Lights Bookshop gekauft hatte. Es handelte von der zunehmenden Ausbreitung der Kojoten in Amerika. Seit Doris’ Tod ließen ihn die Tiere nicht mehr los. Anfangs wusste er gar nicht, warum. Vielleicht, überlegte er, lag es an den vielen schlaflosen Nächten, in denen er sie im Wald hinter dem Haus hörte. Aber je länger er nachdachte, desto überzeugter war er, dass es mit seiner Beobachtung zusammenhing, wonach die Kultur der Berge und ihrer Bewohner langsam, aber sicher verschwand, während die Tiere, die seit mehr als hundert Jahren verfolgt wurden, gediehen. Irgendwie bewunderte er sie fast, oder vielleicht, vielleicht war es sogar Neid.
Den ersten Kojoten im Jackson County hatte Raymond in den späten Achzigern in einem Waldstück in Whiteside Cove gesehen. Inzwischen gab es schon viele. Niemand war mehr überrascht, wenn er einen am Highwayrand liegen sah, morgens oder abends in der Dämmerung überfahren. Manchmal, wenn er spätnachts im Bett lag und einen Streifenwagen oder einen Krankenwagen vorbeifahren hörte, heulten die Kojoten mit der Sirene. Einer nach dem anderen stimmte ein, bis ein Kojotenchor die Nacht um ihn erfüllte. Die Forschung sagte, dass die Kojoten auf diese Weise feststellen, wie viele es von ihnen gab. Aber für Ray war die Begründung weniger wichtig als das, was er empfand. Nämlich fast eine Art Freude, ein Gefühl, das er sonst kaum noch kannte. Allein die Vorstellung ließ ihn lächeln, als er auf seinem Stuhl vor und zurück schaukelte.
Er hatte seinen Whiskey fast ausgetrunken, als im Haus das Telefon klingelte. In einer Ecke des Vorderzimmers stand ein Korbschaukelstuhl, in dem seine Frau gesessen und telefoniert hatte – mit ihrer Schwester, mit Freundinnen, Werbeanrufern und allen anderen, die Lust auf ein Schwätzchen hatten, weil Doris nun mal gern plauderte. Sie und Ray hatten sich in dieser Hinsicht gut ergänzt, weil er maulfaul war und den Mund nicht aufbrachte, während sie für zwei erzählen konnte.
»Ja«, knurrte Ray in die Sprechmuschel. Seine Stimme war tief und rau, die Worte schienen nie ganz aus seinem Rachen herauszufinden. Mit Zeige- und Mittelfinger fischte er den Zigarrenstummel aus dem Mundwinkel, damit er beim Sprechen wenigstens die Lippen bewegen konnte. Am anderen Ende hörte er Atemgeräusche, aber niemand sagte was. »Hallo?«
»Dad«, wimmerte es. »Dad …« Atemlos. »Die bringen mich um.«
Raymond fuhr sich mit einer Hand übers Gesicht und zwickte die Augen zusammen, um sicherzugehen, dass er nicht träumte. Kurz überlegte er aufzulegen, zögerte aber. Er drückte den Hörer in seiner Hand so fest, dass er das Plastik knirschen hörte.
Die Stimme des Jungen klang wie damals, als er im Alter von zehn aus dem Haus Gary Greens anrief, nachdem er mit einer Baumarktlupe und einem Pappbecher Benzin dessen Scheune abgefackelt hatte. Sie klang wie bei Rickys erster Festnahme, und wie bei der zweiten, der dritten. Es war immer dieselbe Panikstimme, die Ich-steck-bis-zum-Hals-in-der-Scheiße-Stimme, die Ray schon so oft gehört hatte, dass er sie kaum noch ertrug. Er hatte sie so satt. Dennoch schaffte er es nicht aufzulegen.
Ricky schien jede Sekunde in Tränen auszubrechen, als er stockend wiederholte: »Die bringen mich um.«
»Was um alles in der Welt redest du, Ricky? Kein Mensch will dich umbringen.«
»Sie sollten auf Ihren Sohn hören, Mr. Mathis.« Eine andere Stimme schaltete sich ein.
Ray hörte, wie Ricky im Hintergrund bettelte.
»Wer ist da? Mit wem spreche ich?«
»Das tut nichts zur Sache«, sagte der Mann. »Aber Sie sollten mich anhören. Ich hab Ihnen was Wichtiges zu sagen.«
»Und was?«
»Ihr Sohn ist ein Junkie, Mr. Mathis.«
»Ich weiß nicht, wer Sie sind und was Sie wollen, aber das ist keine große Offenbarung. Ich kenne meinen Sohn und krieg seit zwanzig Jahren solche Anrufe.«
»Ich glaube, Sie haben mich nicht verstanden, Mr. Mathis. Ihr Sohn schuldet mir sehr viel Geld, und irgendwie müssen diese Schulden beglichen werden.«
»Die Schulden meines Sohnes sind eine Sache zwischen ihm und Ihnen. Ich weiß nicht, warum Sie mich da mit reinziehen. Mich gehen seine Schulden nichts an.«
»Wenn Sie Ihren Sohn so gut kennen, dann wissen Sie auch, dass Sie ihn auf den Kopf stellen und schütteln können, und es fällt immer noch kein Cent aus seinen Taschen.«
»Das triffts ungefähr«, sagte Ray.
»Und deswegen kommen Sie ins Spiel. Deswegen führen wir dieses Gespräch. Wie gesagt, Ihr Sohn schuldet mir sehr viel Geld, und irgendwie müssen diese Schulden beglichen werden.«
Der Mann sprach seltsam ruhig, und diese Gelassenheit unterschied diesen Anruf von allen, die Ray wegen seines Sohns bekommen hatte. Diesmal rief nicht Ricky an und bettelte um ein paar Dollar, die ihm aus der Klemme helfen sollten. Und es rief keiner seiner zugedröhnten Kumpel an und lallte so verwaschen, dass Ray kaum verstand, während er dahinbrabbelte, Ricky sei im Gefängnis und brauche Geld für die Kaution. Diesmal war es anders. Es war todernst. Ray spürte es am Ziehen in seinem Magen.
»Um wie viel Geld gehts denn?«
»Zehntausend Dollar.«
»Zehntausend Dollar?« Ray schnaubte ungläubig. »Also, da fällt mir nichts mehr ein.«
»Immerhin nicht so teuer wie eine Beerdigung, oder?« Die Stimme blieb ausdruckslos. »Aber«, fuhr der Mann fort, »das ist nun mal genau die Summe, die er mir schuldet.«
»Ich weiß nicht, wie Sie drauf kommen, dass jemand so eine Summe einfach aus dem Hut zaubert, aber ich kann Ihnen jetzt schon sagen …«
»Ich unterbrech hier mal, Mr. Mathis. Ihr Sohn scheint da anderer Meinung. Laut ihm sind Sie vor Kurzem zu ein bisschen Geld gekommen.«
Ray schloss die Augen und presste die Kiefer aufeinander. Er wusste sofort, was Ricky dem Mann erzählt hatte, und er hätte es nicht leugnen können, selbst wenn er gewollt hätte. Der Sylva Herald hatte über die Geschichte berichtet. Wochenlang war sein Gesicht auf der Titelseite gewesen, als er sich mit den Behörden wegen eines Stücks Land gestritten hatte.
Als Ray nach dreißig Jahren im Forstdienst in den Ruhestand getreten war, hatte er erschreckend schnell gemerkt, dass er fürs Nichtstun ungeeignet war. Daher hatte er sechs Monate nach der Pensionierung ein kleines Stück Land am Highway 107 gekauft und einen Verkaufsstand für Obst und Gemüse errichtet. Mathis Produce lief zehn Jahre lang gut, bis der Bundesstaat ihn zum Verkauf zwang, um die Straße zu verbreitern. Mehr als ein Jahr dauerte das Hickhack, über das die Zeitungen und das Lokalfernsehen berichteten, aber vor Kurzem war tatsächlich der Scheck gekommen und die Sache abgeschlossen.
Im Hintergrund begann Ricky zu schreien, und Ray stockte der Atem. Man konnte so stark sein, wie man wollte, es gab Momente im Leben, die einen zutiefst erschütterten, es gab Dinge, die einem das Blut in den Adern gefrieren ließen. Für eine Mutter oder einen Vater genügte es schon, wenn sie ihr Kind weinen hörten. Er hatte diese Art Verletzlichkeit nicht gekannt, bis er den Jungen zum ersten Mal in Armen gehalten hatte.
»Nehmen wir an, ich hätte das Geld und würde es Ihnen geben. Was würde Sie daran hindern, uns gleich bei der Übergabe zu töten?«
»Wenn Sie sich an die Abmachung halten, tu ich das auch.«
»Ich soll jemand vertrauen, der mich erpressen …«
»Das ist keine Erpressung«, unterbrach der Mann. »Es ist eher so was wie Barmherzigkeit.«
Eine Weile sagte keiner etwas, dann ergriff der Mann wieder das Wort.
»Ich rufe aus Höflichkeit an, Mr. Mathis. Ich lasse Ihnen die Wahl. Zahlen Sie, was mir zusteht, oder beerdigen Sie Ihren Sohn. Die Entscheidung liegt bei Ihnen.«
Ray empfand sich schon länger wie aus der Zeit gefallen. Er verstand die Welt nicht mehr. Er kam sich vor, als betrachtete er ein Puzzle, sähe die Lücken und hielte die fehlenden Teile in der Hand, ohne zu begreifen, wie sich alles zusammenfügte. Er fragte sich, wie oft er seinen Sohn noch retten musste, und die Antwort zerriss ihm das Herz, denn am liebsten hätte er sofort aufgelegt. Am liebsten hätte er sich um nichts mehr gekümmert und alles vergessen.
Er sah auf ein Foto, das mit Reißnägeln neben die Tür geheftet war. Es war eine Schwarz-Weiß-Aufnahme seiner Frau mit etwa fünfundzwanzig Jahren. Mit den Perlohrringen, die er ihr geschenkt hatte, stand sie an der Spüle, Sonnenlicht fiel durch die Vorhänge, und weil er das Foto zu lange belichtet hatte, waren ihr Gesicht und ihr Oberkörper ganz weiß. Auf dem Herd neben ihr stand eine Kaffeekanne.
»Mr. Mathis?«
»Ich bin noch dran«, sagte Ray.
»Wie siehts aus?«
Ray betrachtete das Porträt seiner Frau und atmete tief ein. Dann hielt er die Luft an, bis ihm schwindlig wurde. »Wo soll ich Sie treffen?«
Als er nach dem Telefonat ins Schlafzimmer ging, spürte er die Beine nicht mehr. Er kniete sich vor den Safe im Schrank. Darin waren mehrere Geburtsurkunden und Sozialversicherungsausweise, dazu ein vergilbter Trauschein und die Sterbeurkunde seiner Frau. Neben einem Bündel mit einem Gummi zusammengehaltener Hundertdollarscheine lag ein stummelläufiger Revolver. Das Geld war der Rest, der von der Entschädigung übrig war.
Ray wog das Bündel in seiner Hand, so als schätzte er dessen Gewicht. Seine Augen waren auf den Revolver gerichtet, mit den Gedanken war er jedoch woanders.
»Das ist wirklich das letzte Mal«, sagte er leise zu sich.
Der Gedanke verfestigte sich wie ein Griff von Händen, die ihn an den Schultern packten, und er schloss die Augen, um dem Gefühl die Zeit zu geben, in ihm Wurzeln zu fassen. Schließlich verschloss er den Safe, stand auf und steckte das Geld ein. An der Haustür hielt er vor dem Bild seiner Frau inne und fuhr ihren Umriss mit der Fingerspitze ab.
DREI
Mit zehntausend Dollar in cash auf dem Beifahrersitz und einem Gewehr auf dem Schoß fuhr Ray in Richtung des Qualla Boundary. Die doppelläufige Snake Charmer war auf fünfunddreißig Zentimeter gekürzt und der Schaft abgesägt und rund geschliffen wie der Griff eines alten Colts. Ray bewahrte sie unter dem Sitz auf, um sie bei einer Begegnung mit Waldklapperschlangen und Kupferkopfvipern zur Hand zu haben, aber die schweren Bleigeschosse, die er vor dem Losfahren geladen hatte, würden auch problemlos einen Menschen zur Strecke bringen.
Sobald er im Qualla Boundary war, gab es kein Zurück. In mancher Hinsicht war das Gebiet des Eastern Band of Cherokee Indians eine andere Welt, ein Ort mit eigenen Gesetzen. Die US-Regierung war nicht ganz bei Trost, falls sie glaubte, unter die Vergangenheit wäre ein Schlussstrich gezogen, nur weil sie zweihundertdreißig Quadratkilometer Land unter besonderen Schutz stellte und ein paar Casinolizenzen vergab. Manche Cherokee nahmen keine Zwanzigdollarscheine an, weil sie das Gesicht von Andrew Jackson nicht sehen wollten. Der Pfad der Tränen war kein abgeschlossenes historisches Ereignis. Es gab ihn noch heute. Der Staat hatte nie aufgehört, die Ureinwohner zu betrügen. Kein einziges Ereignis in der Geschichte lieferte ein Fundament für echtes Vertrauen. Daher gab es Orte, an denen Weiße nicht willkommen waren, Orte, von denen jeder, der in der Gegend aufgewachsen war, wusste, dass man sie nachts besser mied, und Raymond hatte dafür Verständnis. An ihrer Stelle würde er genauso empfinden.
Er fuhr nach Big Cove mit heruntergelassenen Fenstern, damit die kalte Nachtluft ihn wach hielt. Irgendwo in Windrichtung schwelten drei Quadratkilometer Wald, und der Rauch hatte sich wie Nebel auf die Straße gelegt. Die Scheinwerfer drangen kaum durch den Schleier, und fast wäre Ray an dem Wegweiser vorbeigefahren – ein ausgeblichener Elchschädel an einem Baumstamm.
Ein Schotterweg, gerade breit genug für ein Auto, schlich in den Wald. Als Ray seinen International Scout tiefer in die Dunkelheit lotste, kratzte der Berglorbeer links und rechts des Wegs mit seinen kleinen spitzen Blättern an den Türen des alten Geländewagens. Rostige Stahlträger mit quer liegenden Pappelbalken dienten als wacklige Brücke über einen kiesigen Bach, das rote Viehgatter gleich auf der anderen Seite stand offen. In dichtem Abstand an Baumstämme genagelte Schilder verboten den Zutritt, aber beunruhigt war Ray vor allem über die Warnung vor Videoüberwachung.
Der Schotterweg war von dichtem Unterholz gesäumt, darüber wölbten sich Baumkronen, sodass kein Sternenlicht auf den Boden drang. Aber irgendwann lichtete sich rechts der Bewuchs und gab den Blick auf einen sanften Abhang frei, den heruntergekommene Mobilheime und Wohnwagen sprenkelten. Ihre Fenster schienen von gelblichem Dunst beschlagen, dazwischen sah Ray Silhouetten, deren dunkle Gesichter nur von glühenden Zigarettenspitzen erhellt wurden. Weil er Blicke auf sich spürte, packte er zur Beruhigung den Gewehrschaft fester und strich mit dem Zeigefinger über den Abzug. Das Land weitete sich zu einer Ebene mit vereinzelten Kiefern, und zwischen den Stämmen tauchten die Fenster eines Hauses auf. Eine große Scheune rechts davon wurde von dem wenigen Licht aus dem kleineren Haus erhellt. Als er darauf zufuhr, trat ein Mann in den Strahl seiner Scheinwerfer, und sobald Ray nah genug war, hob der Mann eine Hand, um Ray zu stoppen.
Der Mann hatte seine Bergschuhe nicht zugebunden, und die Zungen standen so weit ab, dass sich die Jeans am Schaft staute. Das schwarze T-Shirt mit der Aufschrift SOUTHERN CHARM über der linken Brust spannte. Er war nicht allzu groß, die Adern an seinen dürren Armen traten deutlich hervor. Ein rotes Tuch über seinem Gesicht ließ nur seine Augen frei. Die langen Haare waren zurückgebunden, und als er an Rays Geländewagen kam, war zu erkennen, dass sein von Gummis zusammengehaltener Pferdeschwanz fast über den ganzen Rücken herunterhing.
»Stellen Sie auf Parken, Mr. Mathis.« Er sprach kehlig, die Vokale dunkel und gedehnt, ein Cherokee-Akzent und typisch für jemand aus Big Cove. Trotzdem artikulierte er jedes Wort merkwürdig klar und entschieden.
»Wo ist der Junge?«
»Mr. Mathis, ich hab gesagt, Sie sollen die Automatik auf Parken stellen.« Der Mann beugte sich vor und stützte beide Unterarme auf den Türrahmen. In dem Moment richtete Ray sein Gewehr auf das Gesicht des Manns.
»Sie können mir meinen Sohn bringen oder sich ein Zusatzloch im Kopf verpassen lassen«, sagte Ray. »Wie Sie wollen. Mir ist das egal.«
»Ich glaube, Sie sollten das lieber weglegen.« Der Mann sprach unaufgeregt, ohne das geringste Anzeichen von Furcht. »Es gibt keinen Grund, aufeinander zu schießen.« Er hob den Blick und nickte in Richtung Beifahrersitz. »Das ist rein geschäftlich, Mr. Mathis. Ich will nur das Geld, das mir zusteht. Nicht mehr.«
Ray zog das Gewehr so weit zurück, dass der Mann es nicht packen konnte, und sah zur Seite. Am Beifahrerfenster stand ein Riesenkerl und blickte mit großen Augen am Lauf eines Sturmgewehrs entlang. Er war hellhäutig und kahl geschoren, und sein Gesicht war ebenfalls mit einem Tuch verdeckt. In dem spärlichen Licht schimmerte sein Schädel bläulich wie ein Rotkehlchenei.
»Wie gesagt, ich will nur, was mir zusteht«, wiederholte der Mann. »Also legen Sie das Gewehr weg, stellen Sie auf Parken, und dann klären wir alles.«
Ray spannte den Doppelhahn seiner Flinte und hielt den Lauf weiter auf den Mann am Fenster gerichtet. »Das Geld liegt auf dem Beifahrersitz«, sagte er. »Sagen sie dem Kerl, er solls nehmen und mir meinen Sohn bringen, dann sind wir weg.«
Der Mann antwortete nicht. Er sah auf das Gewehr, dann zu Ray, schließlich zu dem anderen und nickte.
Ray hörte, wie der Kahlgeschorene das Geld nahm, und im nächsten Moment tauchte er im Licht der Scheinwerfer auf. Er wog bestimmt zweihundert Kilo. Er trug ein fleckiges Unterhemd, und sein Bauch flappte über eine Basketball-Shorts. Tätowierungen zogen sich beide Arme hinauf. Er warf das Geldbündel auf die Motorhaube und postierte sich mit dem Sturmgewehr im Anschlag vor der Stoßstange.
»Muss ichs zählen?«
»Schaffen Sies bis hundert?«
Mit einem Grinsen schüttelte der Mann am Fenster den Kopf, packte den oberen Türholm mit beiden Händen und lehnte sich zurück, so als wollte er sich wie an einem Trapez daran schwingen. »Wissen Sie, Mr. Mathis, Sie sind okay.« Mit einer Hand klopfte er aufs Dach und trat einen Schritt zurück. »Ich mag Sie«, sagte er.
Er ging zur Motorhaube, nahm das Geld, ließ die Scheine kurz über den Daumen laufen und schob sich mit einem Blick auf Ray das Bündel in die hintere Hosentasche. »Hol ihn«, sagte er.
Der Koloss senkte das Sturmgewehr. Seine Miene verriet, dass er seinen Partner ungern alleine ließ.
»Hol ihn, hab ich gesagt.«
Ray stellte die Automatik auf Parken und stieg aus, ohne den Motor auszuschalten. Der Mann zog eine Zigarettenpackung aus der Tasche und fingerte eine Zigarette heraus. Er stellte sie auf Rays Motorhaube, fuhr mit zwei Fingern daran entlang und drehte sie mehrmals von der Spitze auf den Filter und zurück.
»Hören Sie, Mr. Mathis, mir macht das hier keinen Spaß, aber so ist das Geschäft. Mit Junkies ist es immer schwierig. Das ist nicht gegen Sie gerichtet. Es ist halt nur so.«
»Aha, nur ein Geschäft.« Raymond stand mit dem Gewehr an der Seite da, beobachtete das Haus und wartete, dass sein Sohn gebracht wurde.
Der Mann lehnte sich mit dem Rücken gegen den International Scout und stützte die Ellenbogen auf die Motorhaube. »Wenn es kein Geschäft wäre, wären Sie gar nicht lebend hier angekommen. Wär auch egal gewesen. Mein Geld hätte ich so oder so gekriegt. Also ja, es ist ein Geschäft.«
»Nach heute Abend machen Sie keine Geschäfte mehr mit diesem Jungen.«
»Wie meinen Sie das?«
»Das ist, glaub ich, ganz einfach. Selbst wenn er auf Knien bei Ihnen angerutscht kommt – Sie geben ihm keinen Stoff mehr«, sagte Ray. »Sondern einen Tritt in den Hintern.«
»So was kann ich nicht versprechen.« Er steckte sich die Zigarette durch das Tuch in den Mund, sodass der Stoff eine kleine Kluft zwischen seinen Lippen bildete. Mit einer Hand schützte er die Feuerzeugflamme, als er die Zigarette anzündete, und stieß den Rauch dann durch den Stoff aus. »Wenn jemand mit einer Handvoll Scheinen bei mir auftaucht, hab ich kein Recht, ihn wegzuschicken.«
»Wenn Sie meinem Sohn noch was verkaufen, liefere ich Sie persönlich in der Hölle ab.«
»Suchen Sie die Schuld da nicht bei dem Falschen, Mr. Mathis? Es gibt doch diese Autoaufkleber.« Er nahm einen tiefen Zug von der Zigarette. »Wie heißts da gleich: ›Nicht Waffen töten, sondern Menschen.‹ Stimmt doch, oder?«
»Und genauso stimmts, dass ich Ihnen eine Kugel verpasse, wenn Sie dem Jungen noch was verkaufen«, knurrte Ray.
Licht und Rauch tauchten den Platz in gelben Dunst, alles wirkte wie unter einem Farbfilter. Zwei Gestalten kamen um das Haus herum, und als sie in den Scheinwerferkegel traten, sah Ray, dass der Koloss sich Ricky über die Schulter geworfen hatte. Ein schmaler Jugendlicher mit einem Karton in Händen ging neben ihm. Er schien nicht älter als fünfzehn. Rote zottelige Haare hingen ihm über die Ohren, und seine Hose schlackerte um seine Hüften, sodass er sehr breitbeinig gehen musste, damit sie nicht herunterglitt. Auch sein Gesicht war von einem Tuch bedeckt.
Der Koloss ließ Ricky wie einen Sack zu Boden fallen. Der Kopf prallte einmal vom harten Lehm zurück. Raymond ging hin und kniete sich neben ihn. Rickys Kleidung war zerrissen, die Haare waren blutverkrustet, beide Augen zugeschwollen, die Haut darum violett wie eine Pflaume. An einem Mundwinkel war die Lippe aufgeplatzt, über einem Ohr klaffte ein Riss. Er war schwer verprügelt worden, und so, wie er aussah, konnte Ray nicht sagen, ob er mehr tot oder lebendig war.
Er hielt Ricky zwei Finger an den Hals und fühlte den Puls. Das Herz schlug schwach, aber regelmäßig. Ray hörte, wie sich Luft durch die verklebten Nasenlöcher zwängte, kurze, flache Atemzüge. Er nahm Rickys Hände. Die Knöchel waren blutig, und dieses kleine Detail war Ray ein Trost, denn es bedeutete, dass sich der Junge trotz der aussichtslosen Lage nicht ohne Gegenwehr ergeben hatte.
Ray schob die Arme unter Rickys Körper und hob ihn wie ein Kind hoch. Rickys Kopf baumelte hin und her, während ihn sein Vater zum Wagen trug. Ray öffnete die Beifahrertür, setzte Ricky auf den Sitz und legte ihm den Sicherheitsgurt an. Dem Jungen fiel das Kinn auf die Brust, so als schliefe er.
Ray schlug die Tür zu und ging hinten um den Wagen herum. Als er einsteigen wollte, ergriff der Mann wieder das Wort.
»Ich vermute, das Besteck gehört Ihnen.«
Ray drehte sich um. Der Mann stand ein paar Meter vor der Stoßstange im Licht der Scheinwerfer und tippte mit dem Fuß gegen den Karton, in dem es metallen klapperte. Ray nahm das Gewehr vom Fahrersitz, lief vor den Wagen und hob den Gewehrlauf vor das Gesicht des Manns. Der bleiche Koloss, der etwas seitlich stand, richtete das Sturmgewehr auf Rays Kopf.
»Ich will, dass Sie sich den Kerl im Auto genau ansehen. Merken Sie sich sein Gesicht«, sagte Ray. »Mit dem machen Sie keine Geschäfte mehr, verstanden?«
Der Mann sah Ray in die Augen, streckte den Arm nach links aus und drückte den Lauf des Sturmgewehrs nach unten. »Wenn das passieren soll, Mr. Mathis, dann müssen Sie Ihrem Sohn wohl Hilfe besorgen.«
VIER
Denny Rattler war nicht so dumm, irgendwo einzusteigen und sich alles zu krallen, was er in die Finger bekam. Für ihn war ein Einbruch eher eine Kunstfertigkeit, ein Zaubertrick, den man so elegant ausführen konnte, dass der Hausbesitzer nicht mal merkte, dass er beklaut worden war.
In den meisten Todesanzeigen waren reihenweise Namen von Leuten aufgeführt, die zum Zeitpunkt der Beerdigung nicht zu Hause waren. Er musste nur im Cherokee One Feather nachsehen, dass jemand »heimgegangen war zum Schöpfer und Herrn«, und sich an die Angehörigen halten. In den Bergen waren die Familienbande so eng, dass die Hinterbliebenen oft in Rufweite beieinanderwohnten. So konnte er aus einem Fenster raus- und ins nächste reinklettern und sich von Haus zu Haus und von Mobilheim zu Mobilheim durcharbeiten und war verschwunden, noch ehe Erde auf das Grab fiel.
Laut Zeitung war Bobby Bigmeat mit sechsundzwanzig Jahren von einem Herzinfarkt dahingerafft worden. Es trauerten die Wolfes, Cucumbers, Locusts und Hornbuckles sowie ein halbes Dutzend Bigmeats. Die Trauerfeier begann mittags. Denny zog den Ventilatorkasten aus Gig Wolfes Fenster und kletterte in das hintere Schlafzimmer.
Der Teppich war von einem so heftigen Ochsenblutrot, dass es geradezu theatralisch wirkte. Diese Farbwucht ließ Denny beinahe schwindeln, während er sich nach Verwertbarem umsah. Zwei schwarze, fast quadratische Frauenkleider lagen auf dem ordentlich gemachten Bett. Gigs Frau musste so breit wie hoch sein. Am Bett waren die Messingkopfstücke mit Handtüchern umwickelt, damit sie nicht scheppernd gegen die Wand schlugen. Darüber hing das Gemälde einer pastelligen Blumenlandschaft. Auf einer Bettseite brannte eine Lampe auf einem Nachtkästchen, und er ging hinüber, um den Inhalt der Schublade zu checken. Neben der Lampe lag eine billige Lesebrille auf einer Erbauungsbroschüre, und als er die Schublade aufzog, entdeckte er neben einer Schachtel Papiertaschentücher eine kleine Taschenpistole mit rosa Griff. Die meisten Diebe würden diesen Fehler begehen.
Die Tür aufbrechen und ein Haus leer räumen war okay, wenn man hinterher aus der Gegend verschwand und das Diebesgut woanders verhökerte. Aber wenn man vor Ort blieb, hielt man den Ball besser flach. Wenn ein Hausbesitzer von dem Bruch gar nichts bemerkte, rief er auch keine Cops, und man brauchte sich nicht verstecken. Dennys Regeln waren ganz einfach: nie mehr als fünf Dinge mitnehmen, und nichts klauen, was offen rumlag. Wenn nur ein, zwei Sachen fehlten und die von Stellen verschwunden waren, an die man nur selten sah, bemerkten die meisten den Diebstahl überhaupt nicht, oder sie dachten, sie hätten das Zeug irgendwo verlegt. In beiden Fällen war man fein raus.
Er schob die Schublade wieder zu und widmete sich der Schmuckschachtel auf der Kommode links von ihm. Die Armbänder und Ringe in der mit Samt ausgeschlagenen Box waren säuberlich in Schlitze gesteckt, die Ohrringe in das Fach rechts davon gelegt. Nichts davon nahm er. Stattdessen hob er den Einlegeboden und sah in das untere Fach. Es war meistens so: Ketten mit geknickten Gliedern und einzelne Ohrringe lagen unten und wurden vergessen, genau wie aus der Mode gekommener Schmuck oder ungeliebte Stücke, bei denen es nichts machte, wenn sie eingeschmolzen wurden. Er prüfte die Schließen von drei Halsketten, bis er eines mit der Silberprägung .925 fand. Das nahm er – eine verworrene Schlangenkette, etwa drei Millimeter stark, die mit Glück fünfundzwanzig Dollar brachte.
Im Vorderzimmer ging er sofort zu dem Waffenschrank schräg gegenüber der Eingangstür. Hinter der Glastür lagen verschiedene Flinten und Büchsen ordentlich auf Plüschsatteln. Der Schrank war verschlossen, aber diese Schlösser waren ein Witz. Wenn Gig Wolfe so dumm war wie die meisten, dann hatte er den Schlüssel wahrscheinlich auf den Schrank gelegt, aber Denny zog einfach sein Klappmesser heraus, fuhr mit der Klinge den Schlitz entlang und ließ das Schloss aufschnappen.
Als er sich im Spiegel der Schrankrückwand sah, erschrak er. Sein Gesicht war eingefallen, fahl, ausgezehrt von den Drogen. Der struppige Schnurrbart hatte in der Mitte eine Lücke, die Wangen waren von schütteren Stoppeln bedeckt. Seine Haare waren schlampig geschnitten, hinten so lang, dass sie auf seinen Schultern aufstanden, der Pony schief. Um seinen Oberkörper flatterte ein fleckiges NASCAR-T-Shirt, das er von einem Rennen in Bristol hatte, der Kragen ausgeleiert. Gelbbraune Haut und pechschwarze Haare ergaben einen harten Kontrast, aber am meisten fielen ihm die veränderten Augen auf – vor ein paar Monaten hatte er diesen hohlen, leeren Blick noch nicht gehabt. Als er sich betrachtete, überkam ihn Scham. Um sich abzulenken, widmete er sich wieder den Gewehren.
Ein Weatherby-Jagdgewehr Kaliber .270 mit spiegelglatt poliertem Monte-Carlo-Schaft aus Walnussholz wurde als stolzes Schmuckstück in vorderster Position präsentiert. Für diese Büchse allein bekäme er vermutlich fünfhundert Dollar, aber Gig würde sofort merken, dass sie fehlte, wenn er sich das nächste Mal zum Abendessen auf seinen schäbigen Stuhl setzte. Deswegen entschied sich Denny für eine alte Iver-Johnson-Einzelladerbüchse ganz hinten im Schrank, die Gig vermutlich als Kind geschenkt bekommen hatte und gar nicht mehr benutzte, sondern nur aus Sentimentalität aufbewahrte. Ihr Verschwinden würde er wahrscheinlich erst bemerken, wenn er den Schrank wieder einmal ausräumte, um die Waffen zu ölen. Denny kam nicht in den Sinn, dass ein solcher Verlust zehnmal schwerer wiegen könnte.
Als Nächstes suchte er die Kruschschublade in der Küche. Auch darin lag, was er erwartet hatte. Immer steckten die Leute ihre alten Handys in irgendeine Schublade, statt sie gleich wegzuwerfen. In dieser lagen Schraubenzieher und ein Hammer, eine Tupperdose voll Schrauben und Muttern, alte Schlüssel, ein rostiges Messer und eine Rolle Klebeband mit Tarnmuster. Bei dem iPhone 5 war nicht mal das Display gesprungen. Vermutlich war das 5er wegen des 6er ausgemustert worden, und bald würde das 6er gegen ein 7er eingetauscht, weil jeder Amerikaner immer das Neueste und Beste haben musste und dumm wie Stroh war.
Denny ging im Kopf seine drogenzentrierte Kalkulation durch. Fünfundzwanzig Dollar für die Kette, hundertfünfundzwanzig für das Gewehr, noch mal hundert für das iPhone. Ein Bündel kostete hundertfünfundzwanzig. Bei zehn Briefchen pro Bündel ergab das zwanzig. Mit zwanzig Briefchen käme er gut durch die Woche, wenn er im selben Tempo weiterballerte. Blieb er gechillt, reichte es vielleicht sogar für eineinhalb Wochen, aber eigentlich hatte er noch nie gehört, dass man weniger nahm, wenn man viel Stoff hatte.
Eineinhalb Wochen, dachte er und hatte den befriedigendsten Gedanken des ganzen Vormittags. Weiter in die Zukunft wagte er nicht zu denken. Das Leben bestand aus kaum noch was anderem, als einen Fuß vor den anderen zu setzen, wobei es, wenn er ehrlich war, nie viel anders gewesen war. Zeit seines Lebens hatte sich die Zukunft immer nur bis zur nächsten Mahlzeit erstreckt, und jetzt war die Situation nicht groß anders.
Mit der Kette um den Hals, dem iPhone in der Tasche und dem Gewehr im Arm ließ er alles andere, wie er es vorgefunden hatte. Wieder im Freien, schob er den Ventilatorkasten zurück ins Fenster und schlich seitlich an dem Mobilheim entlang. Zwei Krähen krächzten von den kahlen Ästen einer abgestorbenen Hemlocktanne, aber es war niemand da, der ihre Warnung hätte hören können. Die sengende Sonne stand hoch am Himmel. Denny hatte noch genug Zeit für einen weiteren Besuch.
FÜNF
Junkies nannten die Ansammlung von Mobilheimen und Wohnwagen Outlet Mall. Was immer man wollte – hier gab es nichts, was es nicht gab.
In dem schmalen Wohnwagen mit grünem Plastikvordach wurde Heroin verkauft, Crystal gabs in dem mit einer Trump-Fahne statt eines Vorhangs im Fenster. Manchmal wurde eine Fuhre junger Mexikanerinnen angekarrt, die in einem alten Charger aus den Siebzigern mit orangen Zierstreifen für hundert Dollar ihre Dienste anboten. Aber die Mädchen waren schon eine Weile nicht mehr da gewesen, soweit Denny es mitbekommen hatte, und er war oft genug hier, um das meiste mitzubekommen.
Sobald er die Tür öffnete, griff Jonah Rathbone zwischen die Couchkissen und zog eine .357 Magnum heraus, die er sich wie ein Baby quer über den Schoß legte. Jonah trug abgeschnittene Jeans und ein weißes Trägerhemd mit der früher neonfarbenen, jetzt aber verblichenen Airbrush-Aufschrift MYRTLE BEACH. Er lehnte so weit auf der Couch zurück, dass sein Hintern vor dem Polster in der Luft hing. Eine hagere junge Weiße lag am anderen Ende der Couch zusammengerollt, die Beine unter einem schwarzen T-Shirt eng an den Körper gezogen. Dunkle Schatten lagen um ihre halb geschlossenen Augen, die zu Boden blickten. Sie schaukelte hin und her, so als müsste sie für die Erddrehung sorgen.
»Verdammt, Denny, schon mal was von Anklopfen gehört?« Jonah schluckte und fuhr sich durch die Haare. Denny konnte den Blick nicht von dem gravierten Rahmen des großen Revolvers abwenden. Jonah nahm die Waffe wieder in die Hand und wollte den schweren Ruger lässig am Abzugsbügel um den Finger kreisen lassen, brachte aber nur ein unrundes Eiern zustande. »Was für einen Scheiß bringst du heute?«
Denny trat ein und breitete sein Angebot auf dem schweren Couchtisch mit Eisengestell aus. Als Erstes legte er das Gewehr hin, dann ließ er die Silberkette parallel neben dem Lauf auf den Tisch gleiten. »Ach, und dann hätte ich noch das da«, sagte er und fischte das Handy aus der Gesäßtasche seiner Jeans.
»Wann klaust du endlich mal was, das was bringt?«
»Das Gewehr ist locker hundertfünfzig wert«, sagte Denny. »Zusammen mit der hübschen Kette und dem iPhone sind das bestimmt zweihundertfünfzig.«
Jonah warf den Revolver beiläufig zwischen sich und die junge Frau. Er nahm das Gewehr, betrachtete es kurz und legte es an, um auf Dennys Nabel zu zielen. Nach einem Blick auf den Stempel auf dem Lauf legte er es zurück auf den Tisch. »Mann, Denny, eine Iver Johnson! Echt jetzt, was soll ich mit dem Teil anfangen? Wann bringst du mir mal was, das ich verkaufen kann? Fuck, eine Benelli, eine Mossberg, irgendwas.«
»Das Gewehr und das Handy sind doch leicht verdientes Geld«, sagte Denny. »Locker zweihundertfünfzig.« Es war immer dasselbe. Denny versuchte, den Preis hochzureden, und Jonah versuchte, ihn zu drücken. Das Problem war, dass Jonah am längeren Hebel saß. Er wusste, dass Denny nie ohne Stoff abziehen und ins Pfandhaus gehen würde. Jonah nahm die Kette und sah auf die Schließe. Kopfschüttelnd schoss er sie auf wie eine Leine und warf sie auf die junge Frau am anderen Couchende.
»Was soll das sein? Ein Gramm Silber?« Jonah lachte. »Also echt, was soll ich damit anfangen?«
»Ich geb dir alles für zweihundert, aber drunter geh ich nicht.«