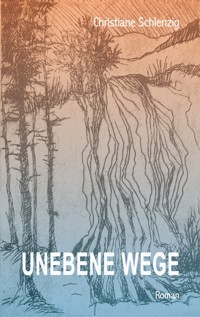Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Hilferuf hält die Ich-Erzählerin Judith vier Tage lang im Bann. Plötzlich wird sie mit der Pflegededürftigkeit alter Menschen, der Arbeit des Pflegepersonals, mit Lieblosigkeit, Anonymität konfrontiert. Ein bewegender Roman, der zart und eindringlich zugleich die Kostbarkeit selbstbestimmten Lebens aufzeigt, den Umgang der jungen Generation mit alten Menschen, und den Leser mitnimmt auf eine Reise durch das Leben dreier Generationen unserer Zeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 132
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christiane Schlenzig
Wenn jede Stunde zählt
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Prolog
Der Anruf
Die Villa
Die Residenz
Katja
Treff mit Böhler
Katja und Udo
Judiths Plan
Erna
Murmann
Die Vernissage
Der dritte Abend
Katja
Judith
Katja
Die Entführung
Epilog
Impressum
Impressum neobooks
Prolog
R
Die übliche Geräuschkulisse, das übliche Bild nach einer Gerichtsverhandlung dieses Ausmaßes.
Journalisten, Reporter. Autotüren werden aufgerissen und zugeschlagen. Reifen quietschen auf dem Asphalt.
Wieder einmal fragt er sich, muss man Fehlurteile hinnehmen wie ein technisches Versagen oder Unwetterschäden? Was wäre vermeidbar gewesen?
Was macht einen guten Richter aus?
Gesetzeskenntnis genügt nicht. Scharfblick?
Intelligenz? Weisheit, … gab es bei Salomo.
Wieder einmal ist er drauf und dran, seinen Anwaltsberuf an denNagel zu hängen.
Wären da nicht all die Petitionen, die Prozesse, die Urteile, all die Beweisführungen …
All die unschuldig Angeklagten, für deren Freispruch er gekämpft hat, die Flüchtlinge, die er vor der Ausweisung gerettet hat, die Häuser, deren Abriss er verhinderte.
Warum haben Wirtschaftskriminelle die größere Verhandlungsbasis? Warum wird ihnen die Chance eingeräumt, diesen Prozess endlos in die Länge zu ziehen?
Arnold wirft seine schwarze Robe ab und verlässt durch den Hinterausgang das Gerichtsgebäude.
Der Anruf
Ein fensterloser Raum. Mein Kopf schmerzt. Mir ist kalt, so kalt, als würden Eiskristalle durch meine Adern fließen. Mutter hockt in einer dunklen Ecke, ruft nach mir, immer und immer wieder, bis ihre Stimme nur noch röchelt, keucht und japst.
Sie braucht meine Hilfe, doch ich stehe bewegungslos an der Tür, komme nicht vorwärts, meine Füße sind schwer und kraftlos …
Der Traum der Nacht ist in mir, als ich am Morgen barfuss im Schlafanzug in den Korridor schwanke, um den Anrufbeantworter noch einmal abzuhören.
Gestern Abend, als ich von einer Weiterbildung nach Hause kam, blinkte das Lämpchen an der Feststation. Ich hatte auf die Abhörtaste gedrückt, stand zwischen Korridor und Küche, zog meinen Mantel aus, hängte ihn auf den Kleiderbügel.
… eine neue Nachricht, fremde Laute, hastig, nach Luft schnappend: Hier ist Erna aus Köln. Ich brauche Hilfe, ich …, dann schien die Stimme in der Kehle steckengeblieben. Eine plötzliche Hitze stieg mir in den Kopf. Ich sah meine Mutter, das eingefallene Gesicht, wie ein vom Baum gefallener Apfel, fleckig, ausgetrocknet. Mit seltsam gebrochener Stimme hatte sie letzte Worte gestammelt: Kümmere dich um Erna!
Ein Worthauch nur, urplötzlich ist er wieder in mir. Die Alpträume sind zurückgekehrt.
Mutters dünne Hände auf dem geblümten Betttuch, die leer gewordene Haut um ihre Knochen; aus der Zeit gefallen. Tageslicht und Dunkelheit hatten ihren Sinn verloren. Manchmal hatte ich dagesessen, die Wand angestarrt und auf Mutters Tod gewartet. Als ihr Kopf zur Seite kippte, Erleichterung.
Ein warmes Erschauern, das sich wie Scham über meinen Körper breitete.
Dann saß ich vor Mutters Adressbuch, beschriftete schwarzumrandete Umschläge, … nach langer schwerer Krankheit, … in tiefer Trauer. Mit dem Kugelschreiber kämpfte ich mich durch ihr akribisch geführtes Namensverzeichnis.
Erna Meyerring. Mutter hatte mir erzählt, dass sie nach den Kriegswirren – die Schulen waren geschlossen worden – viele Jahre nichts mehr von ihrer Schulfreundin gehört hatte. Erst zu einem Klassentreffen hatte man Erna über den Suchdienst im Radio ausfindig machen können.
Im Adressbuch war Ernas Name mit einem Rotstift angekreuzt. Was hatte es mit dieser Freundin auf sich? Warum sollte ich mich um sie kümmern?
Erna aus Köln war für mich die Tante aus dem Westen, die zu Weihnachten Päckchen geschickt hatte und regelmäßig im Frühjahr ein großes Paket mit getragenen Sachen: Kleider, Pullover, Schuhe.
Erna war zur Beerdigung gekommen. Ich sehe sie auf dem Bahnhof stehen. Ein schwarzer Hut mit breiter Krempe. Eine fremde Dame, mit der mich nichts verband, weder Abneigung noch Sympathie.
Sie schien zunächst niemanden zu registrieren, in gebückter Haltung starrte sie dem Zug hinterher, wie er sich aus der bunkerhaften Halle herausbohrte, ein dunkles Loch am Ende des Bahnsteiges. Sie schaute sich ängstlich nach allen Seiten um, hatte wohl nach über zwanzig Jahren noch nicht begriffen, dass ihre Sicherheitspolizei auch unsere, unsere auch ihre war …, einig Vaterland.
Wie ein Spürhund hatte sie die Ostluft abgeschnuppert, diese schließlich für akzeptabel befunden. Ihren Rücken aufrichtend, war sie langsam durch die Halle zum Parkplatz gegangen, ein Blick über den Bahnhofsvorplatz, eine Geste mit den Armen, ihre Armreifen klapperten, und schon bewegte sie sich wie ein Gegenstand von unschätzbarem Wert. Ihr dunkelbraun gefärbtes Haar schaute leicht gewellt unter der schwarzen Hutkrempe hervor, die Ohrgehänge mit den kleinen Diamanten funkelten bei jeder Kopfbewegung.
Ich fuhr Mutters Freundin ins Hotel, am nächsten Tag sah ich ihren Hut, ihre graziöse Gestalt im schwarzen Meer der Trauergemeinde.
Gleich nach der Beerdigung hatte Georg sie an den Zug nach Köln gebracht.
Eine übliche Dankeskarte, … für die Blumen und trostreichen Worte am Grab, dann war diese Frau in irgendeine meiner Gehirnzellen abgetaucht.
Nun spukt seit gestern Abend dieser ominöse Anruf in meinem Kopf herum: Erna aus Köln, ich brauche Hilfe, gepaart mit Mutters letzten Worten.
Warum sollte ich mich um Erna kümmern?
Hat sie keine Familie, Kinder, Verwandtschaft? Warum ruft diese Erna mich an?
Mutter stand bis zuletzt mit ihrer Freundin in Briefkontakt.
Ich hatte die Umschläge frankiert – manchmal auf die Waage gelegt, wenn mir einer der Briefe etwasschwerer vorkam –, zum Postkasten gebracht. Jede Woche, in fast gleichem Rhythmus, entnahm ich dem Briefkasten einen Brief aus Köln. Ich sehe das Strahlen in Mutters Augen, wenn ich sie zum Sessel ans Fenster geleitete, ihr die Post in den Schoß legte, sie mit zittrigen Händen Ernas Brief öffnete. Wie ein junges Mädchen, das Liebesbriefe empfängt, hatte ich manchmal gedacht. Eifersucht?
Vielleicht …
Ich höre den Anrufbeantworter noch einmal ab, schreibe mir die Telefonnummer auf und wähle die Nummer. Nach wenigen Sekunden schaltet sich sinfonische Bläsermusik ein, eine Computerstimme bittet um etwas Geduld. Ich warte. Nach gefühlten fünf Minuten kommt das Besetztzeichen.
Unruhig laufe ich in der Wohnung hin und her.
Ich gehe in die Küche, schalte die Herdplatte ein, stelle die Pfanne auf das glühende Rund, gieße Olivenöl in die Pfanne, lasse es heftig zischen, schlage mit zittrigen Fingern ein Ei in das Öl. Fett spritzt auf das Ceranfeld und Eierschalen schwimmen zwischen Eidotter und Öl. Als ich die Schalensplitter herausangeln will, klingelt das Telefon. Ich schiebe die Pfanne zur Seite, laufe in den Flur, greife zum Hörer: Ja, hallo.
Indem ich meinen Namen nenne, wird am anderen Ende aufgelegt. In der Küche leuchtet mir die rote Herdplatte bedrohlich entgegen. Das glibberige Ei mit den Schalenresten starrt mich an. Ärgerlich nehme ich die Pfanne und kratze den Inhalt in den Mülleimer. Ich mag jetzt nichts essen …, ein dumpfes Gefühl drückt in meiner Magengrube.
Die Gedanken sind plötzlich mit Dingen verflochten, die mir bisher fremd waren. Ich setze mich an den Schreibtisch, wo sich die Aktenordner und Manuskripte stapeln. Ich hoffe inständig, dass sich alles schnell aufklären wird, und ich mich meiner alltäglichen Arbeit zuwenden kann.
Ich öffne den Laptop, schalte ihn an, blättere im Kölner Telefonverzeichnis, suche unter Meye Ingeburg, Meyer Horst, Meyer Karl. Meyerring Rudolf.
Das könnte die Adresse sein. Meyerring ist schließlich ein seltener Name. Die Telefonnummer jedoch ist mit der auf dem Anrufbeantworter nicht identisch. Trotzdem notiere ich mir Namen und Nummer, schaue auf die Uhr: Es ist Mittagszeit, ich zwinge mich, mit einem Anruf zu warten, schalte den Laptop aus, lege den Notizblock dazu, so als könnten die beiden eine geheime Verbindung eingehen.
Um mich abzulenken, schaue ich im Kühlschrank nach, stelle fest, dass nur noch ein kleiner Rest Butter da ist, Milch und Käse fehlen. Es könnte ja möglich sein, dass mein Magen irgendwann nach etwas Essbarem schreit. Außerdem beruhigt Einkaufen die Nerven, schärft die Konzentration und ordnet die Gedanken.
Als ich vom Supermarkt zurückkomme, den Korb auf dem Küchentisch abgestellt habe, greife ich noch einmal zum Hörer, tippe die Telefonnummer vom Anrufbeantworter ein.
Ich warte, und siehe da, es meldet sich eine Männerstimme. Ich erkundige mich nach Erna Meyerring. Die Stimme dröhnt hart an mein Ohr: Die Dame ist zurzeit nicht zu erreichen. Mit wem spreche ich bitte? Meine Frage und alle weiteren lässt der übellaunige Herr unbeantwortet, mit dem Hinweis: Am Telefon geben wir fremden Personen keine Auskunft. Warum das? Soll ich sechshundert Kilometer fahren, um mir eine Auskunft einzuholen? Das ist Ihr Problem, brummelt es an mein Ohr. Und das Gespräch ist beendet. Eine Möglichkeit, über Erna Meyerring etwas zu erfahren, erhoffe ich mir nun noch durch die Adresse aus dem Kölner Telefonverzeichnis. Doch als ich klopfenden Herzens die Nummer von Rudolf Meyerring gewählt habe, heißt es: Der Teilnehmer ist zurzeit nicht erreichbar.
Erna Meyerrings Hilferuf lässt mich nicht zur Ruhe kommen. Warum ruft sie mich an? Vielleicht hat sie Hannas Nummer noch nicht gelöscht, ist in der Zeile verrutscht, hat sich vertippt?
Ich komme mir vor wie ein Schiff, das ohne Kurs durch die Dunkelheit steuert.
Mutters Adressbuch, die Briefe …
Mutter bewahrte die Post aus Köln in ihrem Schreibtisch auf, sorgfältig nach Datum sortiert und mit einem Gummiband zusammengehalten.
Wo sind die Papierbündel hingekommen? Bei der Umräumung ihres Zimmers in einen der Container? … der Biedermeierschreibtisch!
Ein Erinnerungsstück an meine Kindheit. Wir hatten ihn in der Bodenkammer abgestellt, weil er nicht zu unserem Mobiliar passte. Ich haste die Bodentreppe hinauf, als wolle ich all die Handgriffe
an Mutters Sterbebett, die ich dem Pflegedienst überlassen hatte, wettmachen.
Und tatsächlich. Die Briefe liegen fein säuberlich gebündelt neben einem Stapel Kinderbücher in einem der Schubfächer des Schreibtisches.
Ich nehme die Bündel an mich, laufe hinunter, brühe mir einen Kaffee auf, setze mich ans Wohnzimmerfenster in den Ohrensessel und beginne den Papierstoß vom Gummiband zu befreien, dabei stelle ich fest, dass der oberste Brief ungeöffnet ist. Irgendjemand musste den Brief unter das Gummiband gesteckt haben.
Das Datum des Poststempels ist Mutters Sterbetag. Hastig ziehe ich ihn heraus, reiße den Briefumschlag auf, falte das Briefpapier auseinander, starre auf die Buchstaben, als könne ich daraus eine verschlüsselte Botschaft entnehmen:
Liebste Hanna,
weißt Du noch, wie wir in unsere Schulhefte mit dem Füllfederhalter in Längsrichtung unsere Namen schrieben? Und solange die Schrift noch nass war, das Heft kräftig zudrückten. Es entstanden auf beiden Heftseiten symmetrische Gebilde. Zarte Spinnen, krakenartige Gestalten, grinsende Gesichter, die wir lange betrachteten, überrascht und erschreckt zugleich. Wir versuchten, daraus unsere Zukunft zu lesen und zu deuten. Ich sah in meinen Schriftzeichen großäugige Dämonen, die mich anstarrten, nachts im Traum noch mit mir redeten.
Deine Gestalten waren fröhliche Männlein. Noch heute glaube ich fest daran, dass sie Dich durchs Leben getragen haben.
Du hast eine Familie. Du hast eine Tochter. Dieses Glück ist mir versagt geblieben. Du darfst Dich nicht aufgeben. Deine Familie braucht Dich, Du wirst die Krankheit besiegen! Weißt Du noch, wie wir als Kinder Tapferkeit geübt haben? Wir hatten keine Angst zu fallen, wir mussten keine Angst haben, weil wir einfach aufstehen konnten, den Dreck abklopfen und weiterlaufen.
Plötzlich fließen mir Tränen über die Wangen und irgendwann finde ich mich auf meinem Bett wieder, schluchzend wie ein Kind.
Vielleicht hatte Mutter mit mir reden wollen, über ihre Krankheit, ihre Angst? Warum ist mir meine Sprachlosigkeit nicht aufgefallen?
Erna Meyerring hatte mit ihren Briefen Mutter mehr geholfen, als ich es vermocht hatte. Sie schien aus Ernas Worten Kraft geschöpft zu haben. Da ist es wieder, mein Schuldgefühl, mit anderen Dingen beschäftigt gewesen zu sein, in der Zeit als Mutter mich brauchte …
Ich bin fest entschlossen, Erna Meyerring aufzusuchen. Ich setze mich an den Schreibtisch, klicke auf dem Laptop die Website meines Verlages an und bitte um Aufschub der anstehenden Termine.
Mein Terminkalender für die kommenden Monate ist voll. Ich habe noch zwei umfangreiche Manuskripte durchzuarbeiten. Doch der plötzliche Anruf zwingt mich, die Gedanken an meinen Arbeitsalltag in eine Warteschleife zu schieben. Ich suche im Internet nach einer günstigen Zugverbindung, drucke mir die Fahrkarte aus und buche ein Hotelzimmer für zwei Nächte.
Die Villa
Der ICE nach Köln hält mich fünfeinhalb Stunden im Bann. Ich habe mir in der Ruhezone einen Fensterplatz mit Tisch reserviert, klappe den Laptop auf, sehe in meinem Postfach nach und checke die Mails. Der Verlag gibt mir eine Auszeit von vier Tagen. Ich lehne mich in die Polster zurück, schließe die Augen: … Kümmre dich um Erna! Indem Wälder, Wiesen, Ortschaften an mir vorbeifliegen, hole ich das Briefbündel aus der Tasche und beginne in Ernas Briefen zu lesen:
Liebe Hanna!
Das Klassentreffen, ein Austauschen von Erinnerungen.
Du wirst Dich gewundert haben, dass ich so wortkarg neben Dir saß. Ich wollte die Geschehnisse und dunklen Punkte meines Lebens nicht vor Euch ausbreiten. Meine alles beiseite witzelnde Sprache, mit der ich mich geschmückt hatte, war mein Panzer.
Ich wollte für Euch die reiche beneidenswerte Erna aus dem Westen bleiben. Aber Du, die einzige in meinem Leben, der ich vertraue, Du sollst wissen, wie es mir ergangen ist, nachdem wir uns aus den Augen verloren hatten.
Weißt Du noch? 1945 - wir hatten schulfrei, wohl wegen der ständig zu befürchtenden Luftangriffe, außerdem hieß es, das Heizmaterial wäre knapp geworden. Du warst aufs Land zu Deinen Großeltern gezogen.
Ich verbrachte die Zeit oft im Luftschutzkeller, Mutter hielt meine Hand, und ständig spürte ich ihre Angst neben mir. Dann an einem der Tage…, ein Krach, ein mächtiger Knall. Stille. Dann ein erneutes Beben.
Die Erinnerung, wie ich mit staubblinden Augen, mit blutenden Händen mich aus dem Schutt herausgekratzt habe, wie ich auf der Straße stand, die keine Straße mehr war, sondern ein schauriges Gebirge aus Trümmern und Asche. Um mich herum Krater, Bombentrichter. So etwas vergisst man nie. Menschliche Überreste. Eine Stille, in die sich Schreie einlagerten, ein Stöhnen, ein Ächzen. Ich suchte nach meiner Mutter.
Ich schaufelte in den Gesteinsbrocken. Ich weiß nicht, ob ich weinte, ob ich schrie. Plötzlich ein Gesicht über mir. Rußgeschwärzt. Ein Gesicht, das nicht meiner Mutter gehörte …
Ich fand mich in einem fremden Bett, einer fremden Umgebung wieder. Wie ich dort hingekommen war, wusste ich nicht. Marie, die Frau, die sich im Trümmerfeld meiner angenommen hatte, redete nicht, sie brachte mir ein Glas Wasser, ein Stück Brot, stellte beides auf dem kleinen run-
den Tisch ab, gestikulierte mit beiden Händen, bewegte ein wenig die Lippen und verschwand hinter der schweren Eichentür. Anfangs dachte ich, sie wäre taubstumm. Als ich mühsam das Brot in mich hineingestopft hatte, mit den Augen den Raum abtastete, kam sie erneut herein, strich über meine Wolldecke und legte etwas bunt Schillerndes darauf, ich erkannte Mutters Haarspange, berührte sie vorsichtig, wollte fragen, sah Maries traurige Augen, und fragte nicht.
Ich spürte in meinem Brustkorb ein Knistern, als ob etwas zerbricht, und wünschte mir ein steinernes Herz …
Meyerrings Villa, in der ich aus meinem Schockzustand erwacht war, ist das einzige Haus gewesen, das im ganzen Umkreis unzerstört geblieben war. Menschen, zusammengewürfelt auf engstem Raum – Flüchtlinge, Ausgebombte, hatten hier Unterschlupf gefunden. Marie ließ mir keine Zeit zum Nachdenken oder zu Grübeleien. Sie steckte mich in die Küche – Essenausgabe, Geschirrspülen, ich lernte kochen: Fitzfädelsuppe, Rübenbrei …, die ganze Palette der Nachkriegsgerichte.
Während Marie ihre Stummheit langsam verlor, nahm meine zu. Ich lag auf der nassgeweinten Bettdecke wie auf einer Insel. Mit angezogenen Knien, die Arme darum geschlungen, brachen all die ungeweinten Tränen aus mir her-
aus. Ich war krank vor Sehnsucht nach meiner Mutter, spürte einen Abgrund in mir, als wäre die ganze Welt nur noch eine riesige, menschenleere Hütte. Um mich zu trösten, schloss ich die Augen, griff nach der bunten Haarspange, spürte Mutters warme Hand.
Erinnerst Du Dich? Wir wollten studieren … Ich träumte davon, Ärztin zu werden. Nun hatte ich weder eine Studienmöglichkeit noch eine Familie.
Im Sommer neunzehnhundertachtundvierzig stand plötzlich ein junger Mann im Torbogen. Sohn Rudolf, der bei den Großeltern auf dem Lande gewohnt hatte, kam, um sich von den Eltern zu verabschieden. Er sagte, er wolle nach Amerika auswandern.
Ich lehnte am Türholz und schaute wie auf ein Bühnenstück. Ich sehe noch Marie, wie sie sich mit der Schürze die Tränen abwischte: Was willst du in Amerika.