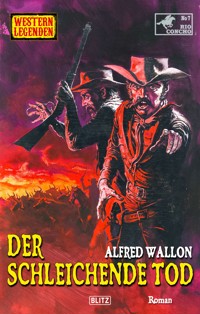
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Western Legenden (Historische Wildwest-Romane)
- Sprache: Deutsch
Es waren harte und unruhige Zeiten im Winter des Jahres 1863. Drüben im Osten tobte der unselige Bruderkrieg zwischen Nord und Süd, der Tausende von Soldaten das Leben kostete. Im fernen Texas dagegen waren die Siedler und Farmer von den Behörden fast völlig vergessen worden – und sie mussten ums Überleben kämpfen. Denn ihre neue Heimat war ein Land, das seit Urzeiten den zahlreichen Stämmen der Comanchen gehörte – und dieses Land würden die roten Völker mit ihrem Blut verteidigen. Dafür waren sie bereit, auch mit zwielichtigen Waffenhändlern Geschäfte zu machen. Aber sie bekamen von ihnen nicht nur Gewehre, sondern auch den schleichenden Tod. Dieser Band enthält die beiden Erzählungen "Der schleichende Tod" und "Saat der Gewalt". RIO CONCHO Band 7 der historischen Familiensaga von Alfred Wallon
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 286
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
In dieser Reihe bisher erschienen:
9001 Werner J. Egli Delgado, der Apache
9002 Alfred Wallon Keine Chance für Chato
9003 Mark L. Wood Die Gefangene der Apachen
9004 Werner J. Egli Wie Wölfe aus den Bergen
9005 Dietmar Kuegler Tombstone
9006 Werner J. Egli Der Pfad zum Sonnenaufgang
9007 Werner J. Egli Die Fährte zwischen Leben und Tod
9008 Werner J. Egli La Vengadora, die Rächerin
9009 Dietmar Kuegler Die Vigilanten von Montana
9010 Thomas Ostwald Blutiges Kansas
9011 R. S. Stone Der Marshal von Cow Springs
9012 Dietmar Kuegler Kriegstrommeln am Mohawk
9013 Andreas Zwengel Die spanische Expedition
9014 Andreas Zwengel Pakt der Rivalen
9015 Andreas Zwengel Schlechte Verlierer
9016 R. S. Stone Aufbruch der Verlorenen
9017 Dietmar Kuegler Der letzte Rebell
9018 R. S. Stone Walkers Rückkehr
9019 Leslie West Das Königreich im Michigansee
9020 R. S. Stone Die Hand am Colt
9021 Dietmar Kuegler San Pedro River
9022 Alex Mann Nur der Fluss war zwischen ihnen
9023 Dietmar Kuegler Alamo - Der Kampf um Texas
9024 Alfred Wallon Das Goliad-Massaker
9025 R. S. Stone Blutiger Winter
9026 R. S. Stone Der Damm von Baxter Ridge
9027 Alex Mann Dreitausend Rinder
9028 R. S. Stone Schwarzes Gold
9029 R. S. Stone Schmutziger Job
9030 Peter Dubina Bronco Canyon
9031 Alfred Wallon Butch Cassidy wird gejagt
9032 Alex Mann Die verlorene Patrouille
9033 Anton Serkalow Blaine Williams - Das Gesetz der Rache
9034 Alfred Wallon Kampf am Schienenstrang
9035 Alex Mann Mexico Marshal
9036 Alex Mann Der Rodeochampion
9037 R. S. Stone Vierzig Tage
9038 Alex Mann Die gejagten Zwei
9039 Peter Dubina Teufel der weißen Berge
9040 Peter Dubina Brennende Lager
9041 Peter Dubina Kampf bis zur letzten Patrone
9042 Dietmar Kuegler Der Scout und der General
9043 Alfred Wallon Der El-Paso-Salzkrieg
9044 Dietmar Kuegler Ein freier Mann
9045 Alex Mann Ein aufrechter Mann
9046 Peter Dubina Gefährliche Fracht
9047 Alex Mann Kalte Fährten
9048 Leslie West Ein Eden für Männer
9049 Alfred Wallon Tod in Montana
9050 Alfred Wallon Das Ende der Fährte
9051 Dietmar Kuegler Der sprechende Draht
9052 U. H. Wilken Blutige Rache
9053 Alex Mann Die fünfte Kugel
9054 Peter Dubina Racheschwur
9055 Craig Dawson Dunlay, der Menschenjäger
9056 U. H. Wilken Bete, Amigo!
9057 Alfred Wallon Missouri-Rebellen
9058 Alfred Wallon Terror der Gesetzlosen
9059 Dietmar Kuegler Kiowa Canyon
9060 Alfred Wallon Der lange Weg nach Texas
9061 Alfred Wallon Gesetz der Gewalt
9062 U. H. Wilken Dein Tod ist mein Leben
9063 G. Michael Hopf Der letzte Ritt
9064 Alfred Wallon Der letzte Mountain-Man
9065 G. Michael Hopf Die Verlorenen
9066 U. H. Wilken Nächte des Grauens
9067 Dietmar Kuegler Die graue Schwadron
9068 Alfred Wallon Rendezvous am Green River
9069 Marco Theiss Die Mathematik des Bleis
9070 Ben Bridges Höllenjob in Mexiko
9071 U. H. Wilken Die grausamen Sieben
9072 Peter Dubina Die Plünderer
9073 G. Michael Hopf Das Gesetz der Prärie
9074 Alfred Wallon Tag der Vergeltung
9075 U. H. Wilken 5000 Dollar für seine Leiche
9076 Lee Roy Jordan Wo Chesterfield geht
9077 U. H. Wilken Knie nieder und stirb
9078 A. Wallon Der Tod des Falken
9079 L. R. Jordan Viva Chesterfield
9080 D. Kuegler Verdammten von Shenandoah
9081 L. R. Jordan Eiskalter Job für Chesterfield
9082 A. Wallon Der schleichende Tod
9083 A. Mann Hungrige Wölfe
DER SCHLEICHENDE TOD
RIO CONCHO NO.07
WESTERN LEGENDEN
BUCH 82
ALFRED WALLON
Dieses Buch gehört zu unseren exklusiven Sammler-Editionen
und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.
In unserem Shop ist dieser Roman auch als E-Book lieferbar.
Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt. Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.
Copyright © 2025 Blitz Verlag, eine Marke der Silberscore Beteiligungs GmbH, Andreas-Hofer-Straße 44 • 6020 Innsbruck - Österreich
Titelbild: Rudolf Sieber-Lonati
Logo: Mario Heyer
Satz: Gero Reimer
Alle Rechte vorbehalten
www.Blitz-Verlag.de
ISBN: 978-3-68984-622-0
9082 vom 05.10.2025
INHALT
Der schleichende Tod
Saat der Gewalt
Alfred Wallon
DER SCHLEICHENDE TOD
Dichte Wolken hingen am weiten Himmel der westlichen Plains. Wind kam auf und ließ den Mann am unruhig flackernden Campfeuer leise frösteln. Erste Schneeflocken tanzten im Wind – die ersten Boten des bald einsetzenden Winters. Aber all dies nahm der schweigsame Mann am Feuer überhaupt nicht wahr. Stattdessen starrte er in die flackernden Flammen des Campfeuers, während seine Gedanken immer wieder abschweiften in eine Zeit, die erst zwei Jahre zurücklag – aber doch kam es ihm mittlerweile vor wie eine halbe Ewigkeit …
Seine rechte Hand bemühte sich, nach einem Stück trockenen Holzes zu greifen und dem Feuer neue Nahrung zu geben. Aber das gelang ihm erst nach mehreren Versuchen. Die Finger der rechten Hand waren so gut wie taub, reagierten nur ganz selten noch auf Befehle, die sie eigentlich hätten ausführen müssen, wenn es eine gesunde Hand gewesen wäre. Nur die dicke Narbe, die sich gebildet hatte, zeugte davon, dass dem nicht so war. Sie zeichnete die Handfläche und den Rücken der rauen Hand und würde ihn bis ans Rest seines Lebens daran erinnern, dass er nicht mehr der Mann war, der einst einen gefürchteten Namen gehabt hatte …
Die Gedanken des Mannes brachen ab, als er weiter drüben bei den Büschen die lachenden Stimmen von Bush und Lancer vernahm. Er wandte kurz den Kopf und sah, wie der dicke Bush in seinen Händen eine Flasche Hostetter-Brandy schwenkte und grinste.
„Willst du auch ‚nen Schluck?“, fragte er und schüttelte die Flasche dabei. „Ist das einzig Richtige, um die Kälte zu vergessen.“
Der Mann mit der zernarbten Hand schüttelte nur stumm den Kopf und erhob sich stattdessen vom wärmenden Campfeuer. Schwer waren seine Schritte, als er an Bush und Lancer vorbeiging, ohne sie richtig wahrzunehmen.
Hätte er in diesem Moment auf die Blicke der beiden Männer geachtet, so wäre ihm ganz sicher aufgefallen, dass sie sich jetzt ihren Teil dachten. Denn ein Mann, der bei solch einem miesen Wetter einen Schluck guten Brandys ausschlug, war nur schwer zu verstehen.
Der Mann in dem olivfarbenen Staubmantel verließ die Senke und ging stattdessen hinauf zum höchsten Punkt des Hügels, von dem man einen guten Überblick über die weite, mit dornigen Büschen und Gestrüpp bewachsenen Ebene hatte.
„Pike …“, murmelte er ungeduldig und suchte mit seinen grauen Augen immer wieder den Horizont ab. „Verdammt, warum braucht er nur so lange? Ob etwas schiefgelaufen ist?“
Das waren Fragen, auf die er zumindest jetzt keine Antwort erhalten würde. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als ebenso lange hier auszuharren, bis Pike Richardson und der Rest der Männer aus San Angelo wieder zurückkehrten.
Heute früh, kurz nach Sonnenaufgang, waren sie aufgebrochen und nach San Angelo geritten. Der Mann mit dem versteinerten Gesicht und der zernarbten Hand konnte nur schätzen, wie viel Zeit seitdem verstrichen war, denn die Sonne hatte sich hinter den dichten grauen Wolken versteckt und würde sich für den Rest des Tages wahrscheinlich nicht mehr blicken lassen.
Es war ein trüber und diesiger Monat, dieser November des Jahres 1863. Mehr als zwei Jahre waren vergangen, seit er zum letzten Mal hier unten im Süden gewesen war – aber ein Mann wie Rawhide Jones vergaß bis heute nicht, was damals geschehen war und ihn fast hätte zerbrechen lassen. Damals hatte er mit einigen anderen einen flüchtigen Nigger verfolgt, aber alles war schiefgegangen. Der Schwarze hatte unerwartete Hilfe von einem Brasada-Rancher und dessen Cowboys bekommen!
Und der so siegessichere Rawhide Jones hatte damals eine bittere Niederlage hinnehmen müssen, die er bis heute nicht vergessen hatte. Denn bei diesem Kampf war seine rechte Hand zerschossen worden – die Hand, mit der er seinen Revolver handhabte. Zu einem elenden Krüppel war er verkommen, und das vergaß ein Mann wie Rawhide Jones nie! Auch wenn er damals das Weite hatte suchen müssen, so hatte er all die Jahre über einen entsetzlichen Hass in sich getragen, der immer größer geworden war.
Der Wunsch nach Vergeltung war es, der sein weiteres Leben bestimmte und zu einem fixen Ziel für ihn wurde. Pike Richardson, der damals an seiner Seite gewesen war, hatte Jones geholfen, nicht ganz zu zerbrechen.
Jones hatte bitter begreifen müssen, dass er kein unbesiegbarer Revolvermann mehr war, sondern nur noch ein Krüppel, der auch nicht mehr dazu taugte, niedere Arbeiten in einem Stall oder im Saloon zu verrichten. Er musste lernen, mit diesem neuen – in seinen Augen so unwürdigen Leben fertigzuwerden, und allein hätte er das nie geschafft. Pike, der alte Gefährte von damals, hatte zu ihm gestanden und ihn wieder aufgerichtet. Aber Narben in Jones’ Seele waren trotzdem geblieben, und die würden nie mehr verheilen …
Es waren karge Jahre gewesen, die sie hatten durchmachen müssen. Aus den einstigen Sklavenjägern waren Gelegenheitsdiebe und Wegelagerer geworden. Bis dann der Tag gekommen war, wo sie in Denver einem Spieler in einer Seitenstraße aufgelauert und ihn dann hinterrücks niedergestochen hatten.
Der arme Teufel hatte einfach Pech gehabt. Nur eine knappe Stunde zuvor hatte er bei einer spannenden Pokerpartie einen gehörigen Geldbetrag gewonnen – und das war Jones und Richardson nicht entgangen. Gleich nach Ende des Spiels waren sie ihrem Opfer gefolgt und hatten ihm das Geld gestohlen. Den sterbenden Spieler hatten sie blutend in der Seitenstraße liegen gelassen und waren nur kurz darauf aus Denver verschwunden.
Seit diesem Tag hatte sich die Pechsträhne von Rawhide Jones verzogen, und er konnte sich wieder daran erinnern, dass es da noch einen Mann gab, dem er nicht verziehen hatte, dass er ihn zum Krüppel gemacht hatte. Der Name des Mannes war Tom Calhoun, und er besaß eine Ranch inmitten des weiten Dornbuschlandes von West-Texas – noch nicht einmal zehn Meilen von diesem einsamen Camp hier entfernt …
Die Gedanken des ehemaligen Sklavenjägers brachen ab, als er plötzlich Hufschläge in der Ferne hörte. Nur wenige Sekunden später erkannte er auch schon die Silhouetten von drei Männern.
„Endlich“, murmelte Jones und wartete gespannt ab, bis Richardson und die beiden anderen Männer das Camp erreicht hatten und dann ihre Pferde zügelten. Pike grinste, als er Rawhide Jones zunickte.
„Wir haben alles bekommen, was wir wollten“, sagte er. „Und keiner hat neugierige Fragen gestellt – noch nicht einmal der Storekeeper.“
„Was ist mit der Garnison?“, wollte Rawhide Jones wissen. „Habt ihr euch in der Nähe mal unauffällig umgesehen? Wie viele Soldaten gibt es dort? Nun los, redet endlich, was ihr herausgefunden habt. Schließlich hängt eine Menge davon ab.“
„Vergiss Fort Concho, Mann!“, winkte der hagere Matt Hauser ab, ein Einwanderer aus dem fernen Germany, der nicht viel Glück im Land der Träume gehabt hatte und deswegen sehr rasch an Kerle wie Jones und Pike Richardson geraten war. „Die Garnison ist so gut wie ausgestorben. Die sind wahrhaftig fast alle nach Osten gezogen, um sich dort die Köpfe einschlagen zu lassen. Die Welt ist total verrückt geworden, Rawhide. Wenn ich da was zu sagen hätte, dann …“
„Das hast du aber nicht, Hauser!“, fiel ihm Jones ins Wort. „Aber es gefällt mir, was ich gerade gehört habe. Wenn der Ärger erst angefangen hat, dann wird die Armee gar keine Zeit mehr haben, sich auf unsere Fährte zu setzen. Wir können dann in aller Ruhe untertauchen, während hier alles in einem Chaos versinkt.“
„Wie lange brauchen wir denn noch, bis wir endlich am Ziel sind?“, erkundigte sich nun der kleinere Titus Chesterfield. „Dieses verdammte Land ist so einsam, dass man beinahe verrückt wird. Wer hier draußen siedelt, der muss komplett wahnsinnig sein.“
„Dann muss dieser Wahnsinn ansteckend sein, Chesterfield“, belehrte ihn Jones. „Als ich das letzte Mal hier war, da war dieses Land wirklich noch dünn besiedelt. Aber in diesen zwei Jahren hat sich verdammt viel getan. Umso mehr Erfolg werden wir mit unserem Plan haben – verlasst euch drauf. Ihr müsst nur tun, was ich euch sage. Dann kann gar nichts mehr schiefgehen.“
Er trug diese Worte mit solch einer Überzeugung vor, dass keiner der Männer den geringsten Zweifel daran hegte, dass Rawhide Jones’ Plan einige Risiken beinhaltete. Nur Richardson wusste genau, dass es nicht so ungefährlich war, wie Hauser, Chesterfield, Bush und Lancer vermuteten. Aber diese vier Männer waren ohnehin nur einfältige Burschen, die für Dollars alles taten!
Jones und Richardson hatten sie gebraucht, um ihre schmutzigen Pläne zu verwirklichen, denn sie hatten nicht viele Fragen gestellt und sie waren skrupellos genug, um auch über Leichen zu gehen.
„Ich denke, morgen Abend werden wir am Ziel sein“, erwiderte Jones auf die Frage seines Kumpans hin. „Dann sind wir mitten in der Comancheria – und somit in Quanah Parkers Reich. Er wird uns ganz sicher mit offenen Armen empfangen, wenn er sieht, was für wertvolle Gewehre wir ihm mitgebracht haben …“
Seine Miene verzog sich kaum bei diesen Worten, aber in seinen Augen leuchtete ein kaltes Feuer. Denn nur er selbst und Pike Richardson wussten wirklich, was auf dem Planwagen war, den sie mit sich führten. Die anderen vier Männer glaubten, dass es darum ging, den Comanchen Gewehre und Munition zu bringen, für die sie dann mit Gold bezahlt wurden. Das stimmte auch, denn auf dem Wagen befanden sich wirklich Gewehre, die Rawhide Jones günstig bekommen hatte, weil der Versorgungsoffizier in Fort Stanton bestechlich gewesen war und Spielschulden gehabt hatte.
Aber der Wagen beinhaltete noch eine ganz andere, weitaus gefährlichere Fracht. Nämlich zahlreiche Decken und Kleidung, die aus dem Armeehospital, ebenfalls von Fort Stanton, stammten. Dort hatte vor Wochen die Cholera gewütet, und die Decken stammten direkt aus den Krankenquartieren. Eigentlich hatte man sie verbrennen wollen, um jeglichen weiteren Ansteckungsherd zu vernichten. Aber Rawhide Jones hatte dem Versorgungsoffizier noch ein paar weitere Geldscheine in die Hand gedrückt und dann dafür als zusätzliche Beigabe die Decken erhalten.
In Fort Stanton war man froh darüber, auch wenn der Offizier nicht so recht verstanden hatte, was Rawhide Jones mit diesen alten Lumpen und Decken noch anfangen wollte. Nun, hätte er es wirklich gewusst, dann hätte er alles Menschenmögliche unternommen, um sie ihm nicht zu geben. Aber ein Mann, der Schulden hat und in der Klemme steckt, weil er deswegen um seine militärische Karriere fürchten muss, der denkt über die Folgen einer solchen Handlung nicht lange nach. Dann zählt nur noch Geld …
Die Cholera war auch für die Weißen eine gefährliche Krankheit. Aber mit den richtigen Medikamenten war sie in den Griff zu bekommen. Bei den Comanchen dagegen würde diese Krankheit schlimme Folgen auslösen. Was bedeutete, dass sich die Comanchen dann bitter rächen würden – erst recht bei den Farmern und Siedlern, die in diesem Teil des Landes lebten. Es war der Plan eines wahnsinnigen, menschenverachtenden Schurken – der Plan eines Halunken namens Rawhide Jones, der so voller Hass war, dass dieser sein weiteres Handeln bestimmte. Ihm war es völlig gleichgültig, ob später auch unschuldige Menschen starben. Er wollte seine Rache, und er wollte, dass der Brasada-Rancher Calhoun endlich nach zwei Jahren die Quittung dafür bekam, dass er ihn zu einem Krüppel gemacht hatte.
Natürlich hätte Jones ihm auflauern und dann aus dem Hinterhalt niederschießen können – ganz bestimmt hätte es irgendwann dafür eine gute Gelegenheit gegeben. Aber dies wäre keine Genugtuung für einen Mann wie Rawhide Jones gewesen. Er wollte nicht nur den Tod von Tom Calhoun – er wollte die gnadenlose Vernichtung all derer, die sich damals gegen ihn verschworen hatten!
„Hoffentlich haben die Rothäute genügend Gold, um die Gewehre zu bezahlen“, meinte Matt Hauser. „Nicht, dass sie uns Büffelfelle oder alte Häute dafür zum Tausch anbieten. Sie haben doch Gold, Jones – oder?“
„Darüber musst du dir nicht den Kopf zerbrechen, Hauser“, antwortete Jones. „Es wird alles so ablaufen, wie ich es geplant habe. Und für uns springt genug dabei raus, sodass wir uns keine Gedanken mehr machen müssen, wovon wir die nächsten Wochen und Monate leben …“
Mit diesen Worten stellte er die übrigen Kumpane zufrieden. Ihm selbst ging es nicht um das Gold, das die Comanchen für die Gewehre bezahlten. Selbst wenn er gar nichts dafür bekommen hätte, wäre er zufrieden gewesen. Denn ihm ging es einzig und allein um die mit Cholera infizierten Decken. Sie sollten den Tod zu den Comanchen bringen. War es nicht eine Ironie des Schicksals, dass die Roten dafür dann auch noch bezahlten?
* * *
„Mir gefällt diese verdammte Stille nicht, Bob“, meinte Dave Harmon zu dem dunkelhäutigen Brasada-Cowboy. „Es ist viel zu ruhig hier draußen – und das schon seit einigen Wochen. Fast kommt‘s mir vor, als ob es in diesem Landstrich gar keine Comanchen mehr gäbe.“
„Sie sind da, Dave“, erwiderte Bob Rennington. „Aber wenn du sie siehst, ist es meistens schon zu spät. Sei froh, dass wir den Herbst über wenigstens ein bisschen Ruhe hatten. Du bist doch nicht scharf auf ein Feuergefecht mit Quanah Parkers Comanchen Kriegern? Wie du weißt, hat der mit dem Boss noch eine alte Rechnung zu begleichen …“
„Es ist ein weites und unübersichtliches Land, Bob“ sagte Dave und zog sich unwillkürlich den Kragen seiner Felljacke ein wenig höher.
Denn der raue Wind kündigte den Winter an. Vor einer halben Stunde hatte es kurz zu schneien begonnen. Nicht viel, und auch nicht heftig – aber es hatte ausgereicht, um einige Flecken des Dornbuschdickichts weiß zu färben. Aus diesen Flecken würde in Kürze ein dichter, vor Frost klirrender Teppich werden. Noch war es aber nicht so weit.
Die beiden Cowboys gehörten zu Rancho Bravo, der Ranch Tom Calhouns, die mitten in der Brasada lag – am Rande der weißen Zivilisation. Tom Calhoun hatte die beiden Cowboys ausgeschickt, um nach verirrten Rindern zu suchen. Vor zwei Tagen hatte ein schwerer Gewittersturm die Ranch heimgesucht und einen Teil der Rinder in totale Panik versetzt. Sie waren aus dem Corral ausgebrochen, bevor die Männer von Rancho Bravo etwas dagegen unternehmen konnten.
Zwar war es ihnen gelungen, den größten Teil der Herde rasch wieder einzufangen, aber gut fünfzig Rinder waren in den Busch geflüchtet, und in diesem wirren Dickicht konnte eine Suche sehr lange dauern. Dave und Bob waren nicht weit von Rancho Bravo entfernt – vielleicht gerade mal zwei Meilen. Auch wenn der Boss seine Rinder zurückhaben wollte, so lag ihm das Wohl seiner Cowboys mehr am Herzen.
Dave und Bob hatten sich freiwillig gemeldet, um nach den versprengten Rindern zu suchen und sie wieder zurückzubringen. Tom Calhoun hatte dem aber nur zugestimmt, wenn die beiden Männer immer in der Nähe der Ranch blieben. Denn die Tatsache, dass die Comanchen der Ranch lange keinen Besuch mehr abgestattet hatten, um Rinder zu stehlen, musste nichts bedeuten. Tom Calhoun wollte das Leben seiner Männer nicht riskieren – lieber opferte er die Rinder. Auch wenn es diesmal fast 50 Stück waren. Denn erfahrene Cowboys wie Dave Harmon und Bob Rennington waren nicht mit Gold aufzuwiegen!
Ein klagendes Brüllen erklang plötzlich – und ein Lächeln schlich sich in die Züge des schwarzen Cowboys.
„Na siehst du?“, meinte er daraufhin. „Wir müssen gar nicht mehr lange suchen – ich glaube, wir haben es schon gefunden …“
Mit diesen Worten gab er seinem Pferd die Zügel frei und trieb es auf eine Gruppe von Fettholzbüschen zu. Sowohl Bob als auch Dave trugen schwere lederne Chaps, und auch die Pferde hatten dicke Decken unter den Sätteln, die einen großen Teil ihrer Flanken vor den scharfen Dornen der Brasadahecken schützten. Meist waren es giftige Dornen, die böse, eiternde Wunden verursachen konnten, und der Heilprozess war sehr schmerzhaft. Jeder der Rancho Bravo-Cowboys hatte mit den Dornen schon Bekanntschaft gemacht, und deshalb war es oberstes Gebot, sich dagegen so gut wie möglich zu schützen. Bob trieb das Pferd an den Dornenranken entlang, bis sich im Busch ein Pfad auftat, den die Rinder wohl geebnet hatten. Er sah es an den frisch abgeknickten Zweigen.
Dave folgte seinem Freund, und nur wenige Minuten später stießen die Cowboys auf zehn Rinder. Die nervösen Tiere befanden sich in einer halbkreisförmigen Mulde. Sie hatten wohl das Wasser gerochen, das sich vom Regen der letzten Nacht hier angesammelt hatte.
„Na dann wollen wir mal“, meinte Dave und holte das Lasso vom Sattelhorn. „Treiben wir sie von zwei Seiten hinaus aus dem Busch. Einverstanden?“
Bob nickte, holte ebenfalls sein Lasso und hielt es dann griffbereit. Mit einem anfeuernden Schrei dirigierten die Männer ihre erfahrenen Pferde hinunter in die Mulde und scheuchten die Rinder auf. Die Longhorns ließen sich dann willig hinaustreiben. Eine gute Viertelstunde später waren die Tiere jenseits der Dornenhecken.
Eine Routinearbeit für gute Cowboys wie Bob und Dave. Und jetzt würden sie die Rinder so schnell wie möglich wieder zurück zur Ranch bringen.
„Warte mal, Dave“, sagte Bob, als er mehr durch Zufall seinen Blick nach Westen wandte und am Horizont winzige dunkle Konturen zu erkennen glaubte. „Schau doch mal dort hinten – kannst du das auch erkennen?“
„Was denn?“, fragte Dave, der natürlich jetzt auch in Bobs Blickrichtung schaute. Aber außer der weiten, von Büschen und Gestrüpp bewachsenen, trostlosen Ebene konnte er gar nichts sehen.
„Ganz dort hinten war was zu erkennen“, klärte Bob ihn auf. „Sah aus wie ein Wagen, der von einigen Reitern eskortiert wurde. Jetzt sehe ich aber gar nichts mehr.“
„Das Licht kann einem manchmal hier draußen etwas vorgaukeln, Bob. Ein Wagen in dieser Wildnis? Wer würde denn so verrückt sein, um hier …“
„Ich weiß es nicht", schnitt ihm Bob das Wort ab. "Warte hier – ich bin gleich wieder zurück."
Er hörte nicht, was Dave ihm zurief, sondern gab seinem Pferd die Zügel frei. Das Tier preschte sofort los, hinaus in die weite Ebene der Brasada.
Kurze Zeit darauf fand er die tiefen Furchen von schweren Wagenrädern. Genau dort, wo er es vermutet hatte. Und es gab auch noch Hufspuren von mehreren Reitern – sie führten alle weiter nach Westen.
„Dort gibt es doch nichts“, murmelte Bob gedankenverloren, während er aus dem Sattel stieg und kurz die Spuren näher untersuchte. „Nur Comanchenland …“
Die Furchen, die der Wagen hinterlassen hatte, waren tief. Also musste dieser Wagen eine schwere Ladung transportieren. Nur gab es weiter westlich gar keine Ansiedlungen, für die solch eine Ladung bestimmt sein konnte.
Bob geriet ziemlich ins Grübeln, als er wieder in den Sattel stieg und zurück zu Dave ritt. Denn am liebsten wäre er diesen Spuren gefolgt, um herauszufinden, was sie zu bedeuten hatten. Aber er konnte auch Dave mit den Rindern nicht allein lassen, denn der Boss hatte ihnen beiden einen Auftrag gegeben, und den galt es zu erfüllen.
„Es sind tatsächlich Wagenspuren, Dave“, sagte Bob, als er die neugierigen Blicke des Freundes sah. „Ein ziemlich schwerer Wagen sogar. Eine Handvoll Männer hat diesen Wagen begleitet – und die Spuren führen kerzengerade nach Westen.“
Er bemerkte den ganz erstaunten Blick Daves und fuhr deshalb fort:
„Genau das, was du jetzt sagen willst, habe ich auch schon vermutet. Jenseits des Horizontes gibt es nichts außer Staub und Steinen, Dave. Wer mit einem Planwagen hier draußen unterwegs ist, muss einen verdammt guten Grund dafür haben.“
„Wir sollten es dem Boss erzählen“, schlug Dave vor. „Er wird es bestimmt wissen wollen.“
„Nicht nur der Boss“, murmelte Dave und wandte sich schweren Herzens den Rindern zu, die zurück zur Ranch getrieben werden mussten. Irgendwie konnte er sich selbst keinen Reim darauf machen, warum er so versessen darauf war, diesen Spuren im Sand auf den Grund zu gehen. Irgendwie hatte er ein mulmiges Gefühl bei der ganzen Sache, und ihm wäre viel wohler gewesen, wenn Captain Amos Calhoun und seine Texas-Rangers jetzt hier gewesen wären. Denn die hätten ganz sicher sehr schnell herausgefunden, was diese Spuren zu bedeuten hatten. So aber blieb es nur bei Vermutungen – und eine unergründliche Laune des Schicksals verhinderte ebenfalls, dass Bob heute einem Mann begegnete, der ihn vor zwei Jahren fast zu Tode gehetzt hatte …
* * *
„… und ich sage Ihnen, die Burschen waren nicht ganz astrein, Marshal!“, ereiferte sich der bärtige Seamus Growan mit aufgeregter Stimme. „Denen habe ich gleich angesehen, dass das Männer vom schnellen Eisen sind. Ich wünschte, Sie hätten die Männer sehen können – dann wüssten Sie sofort, was ich damit sagen will. Halunkengesichter waren das. Eins schlimmer als das andere. Ungewaschene Kerle – nur die Revolver in ihren Holstern waren ordentlich sauber. Marshal, ich war heilfroh, als die Kerle endlich meinen Laden wieder verlassen haben. Solche wie die meidet man lieber …“
Tate Clayburn hörte die ganze Zeit über den Worten des irischen Storebesitzers zu, ohne ihn zu unterbrechen. Er ließ seine Blicke über die Auslagen im Schaufenster und dann zu den Waren in den Regalen schweifen und sah kurz zu einem Schild aus glänzendem Weißblech, auf dem in großen Buchstaben TEN HIGH – KENTUCKY STRAIGHT SOUR MASH BOURBON WHISKEY eingestanzt war. Vor dem Schild standen auf einer Anrichte zwei Flaschen, eine davon zu einem Viertel geleert. Offensichtlich war Seamus Growan jetzt drauf und dran, dem Saloon Konkurrenz zu machen, indem er jetzt auch Whiskey verkaufte – und dem Label nach zu urteilen, war das noch nicht einmal eine minderwertige Marke.
„Hören Sie mir überhaupt zu, Marshal?“, riss ihn Growans Stimme wieder aus seinen Gedanken. „Ich sage Ihnen noch einmal, dass das gefährliche Revolvermänner waren, die bestimmt nichts Gutes im Schilde führen.“
Liebend gerne hätte sich Tate Clayburn selbst ein Bild von der Sache gemacht. Aber ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt war er in der Garnison gewesen.
Dafür hatte es einen Grund gegeben, denn zwei Soldaten aus Fort Concho hatten gestern Abend im Saloon dem Whiskey etwas zu sehr zugesprochen. Die angetrunkenen Soldaten hatten sich mit dem schwarzen Schmied Moses Rennington anlegen wollen, aber dabei dann den Kürzeren gezogen.
Clayburn hatte die Soldaten daraufhin eingebuchtet und in der Zelle ihren Rausch erst einmal ausschlafen lassen. Früh am nächsten Morgen hatte er die beiden Störenfriede zum Kommandanten gebracht – und dort bekamen sie dann die Standpauke ihres Lebens. Damit war diese Sache erledigt gewesen. Sie hatte höchstens zwei Stunden gedauert.
Die Kerle, die Seamus Growan solche Sorgen machten, mussten also nach San Angelo gekommen sein, kurz nachdem Tate Clayburn das Office mit den Soldaten verlassen und sich auf den Weg zur Garnison gemacht hatte. Und sie waren bereits wieder verschwunden, bevor der Marshal wieder zurückgekehrt war.
„Ich weiß nicht, was diese Kerle vorhaben, Mr. Growan“, antwortete Clayburn schließlich. „Aber mit unserer Stadt scheint es ja wohl nichts zu tun zu haben – sonst wären sie ganz bestimmt länger geblieben. Was erwarten Sie denn jetzt? Soll ich denen nachreiten und ihnen sagen, dass Ihnen ihre Gesichter nicht gefallen haben? Meine Befugnisse enden an der Stadtgrenze – falls Sie das vergessen haben sollten …“
„Ihre vielleicht – aber nicht die der Ranger, Marshal“, fügte Growan hinzu und sah bei diesen Worten aus dem Fenster, als er einen Reitertrupp entdeckte, der gerade die Straße und den Store passierte. Es waren Amos Calhoun und zehn weitere Texas-Ranger. „Vielleicht sollte ich denen mal erzählen, was ich gesehen habe. Die interessieren sich sicher dafür …“
Clayburn überhörte den stillen Vorwurf in den Worten des Storebesitzers. „Nicht nötig – ich mache das schon“, sagte er zu Growan, nickte ihm noch kurz zu und verließ den Laden wieder. Als er die Tür des Stores hinter sich zuschlug, hörte er, wie Growan etwas Unverständliches vor sich hinmurmelte, aber er schenkte ihm keine Beachtung mehr.
Der Himmel mochte wissen, warum einige der Stadtbewohner in den letzten Tagen so gereizt reagierten. Vielleicht lag das auch an dem Wetterumschwung. Solch ein trübes, kaltes Klima konnte dem einen oder anderen durchaus aufs Gemüt schlagen. Er überquerte die schlammige Straße und ging auf die Ranger zu. Amos Calhoun, der grauhaarige erfahrene Hüne, der schon so viele Kämpfe in seiner aktiven Dienstzeit erlebt hatte, wandte den Kopf, als er den Marshal von San Angelo kommen sah. Ein kurzes Lächeln schlich sich in seine sonnenverbrannten Züge.
„Haben Sie einen Augenblick Zeit für mich?“, fragte ihn Clayburn. „Ich würde gern was mit Ihnen besprechen.“
„Sicher“, nickte der erfahrene Rangercolonel. „Um was geht‘s denn?“
„Seamus Growan meinte gerade, dass er den gefährlichsten Halunken westlich des Mississippi begegnet ist“, sagte Tate Clayburn ironisch. „Ich kann‘s nur nicht genau beurteilen, weil ich selbst die Kerle nicht gesehen habe.“
In kurzen Sätzen berichtete er Amos Calhoun, was Growan beobachtet hatte und welche Sorgen er sich deshalb machte.
„Das muss nichts zu bedeuten haben“, sinnierte der Rangercolonel. „Vielleicht waren das wirklich nur Durchreisende. Sie wissen doch selbst, wer in den letzten Wochen und Monaten hier alles durchgekommen ist. Diejenigen mit dem schnellen Eisen hatten immer nur ein und dasselbe Ziel – nämlich Mexiko. Reisende soll man bekanntlich nicht aufhalten. Was meinen Sie?“
„Ich bin Ihrer Meinung, Colonel“, stimmte ihm Clayburn sofort zu. „Aber es würde einen besorgten Mann wie Seamus Growan ganz sicher beruhigen, wenn ich ihm sage, dass Sie auf Ihrem nächsten Patrouillenritt die Augen aufhalten. Verdammt, nun sehen Sie mich nicht so an – was kann ich dafür, dass die Menschen im Moment hier so gereizt sind? Im Augenblick leben wir hier noch in einer friedlichen Oase – aber draußen sieht es ganz anders aus. Gibt es Anzeichen dafür, dass sich die Comanchen bis in die Nähe von San Angelo wagen, Colonel? Haben Sie Spuren gefunden, die auf so was hinweisen?“
Der Hüne mit den buschigen Schläfen schüttelte den Kopf.
„Nein, Marshal. Weiß der Teufel, wo sich die Comanchen versteckt halten. Seit Wochen geben sie sich viel zu ruhig – und das ist schon ein ziemliches Wunder, wenn man bedenkt, was diesen Sommer so alles passiert ist. Ich bin sicher, wir müssen bald wieder mit weiteren Überfällen rechnen. Aber auf San Angelo werden sie‘s wohl kaum abgesehen haben – dazu leben zu viele Menschen hier, die sich wehren können.“
„Ich werde es Growan sagen“, sagte der Gesetzeshüter. „Passen Sie auf, dass Sie mit Ihren Männern nicht doch noch in einen Hinterhalt geraten, Colonel – dieses Land braucht die Ranger mehr denn je.“
„So schnell sind wir nicht unterzukriegen“, erwiderte Amos Calhoun und nickte daraufhin seinen Männern zu. Der Rangertrupp setzte sich wieder in Bewegung und verließ San Angelo in Richtung Südwesten.
Clayburn blickte ihnen nur kurz nach, dann setzte er seinen Weg fort. Er hatte jetzt keine Lust, noch einmal mit Growan zu sprechen. Das konnte er auch noch später tun. Zuerst stand ihm der Sinn mehr nach einem ordentlichen Frühstück – und das bekam er nur in Amy Stewarts Restaurant. Oder lag es vielleicht auch daran, dass er Amys Gegenwart der von Growan vorzog?
Möglich war das schon, denn Clayburn kannte Amy noch von früher her – aus einer Zeit, wo er vor einigen Jahren Policeofficer in San Francisco gewesen war. Nach einigen turbulenten Ereignissen, die zum Sturz eines mächtigen Mannes namens Henderson geführt hatten, war er zusammen mit Amy Stewart nach Texas gekommen, um hier in San Angelo noch einmal von vorn zu beginnen.
Mittlerweile hatten die Bürger Tate Clayburn als Marshal akzeptiert – auch wenn er meist ein schweigsamer und zurückhaltender Mann war, der ziemlich zurückgezogen lebte. Das Gesetz vertrat er allerdings mit eiserner Faust, und ihm war es zu verdanken, dass es in San Angelo ruhig blieb – auch wenn hier und da mal Fremde kamen, die Ärger machen wollten. Aber Clayburn hatte solchen Streithammeln immer sehr deutlich klargemacht, dass man sich in seiner Stadt besser friedlich verhielt, wenn man mit dem Gesetz keinen Ärger haben wollte. Und das hatten die meisten mittlerweile begriffen.
Drüben aus der Schmiede von Moses Rennington ertönten laute Hammerschläge. Moses war jeden Morgen schon früh auf den Beinen, denn für einen geschickten Schmied wie ihn gab es immer eine Menge zu tun.
Clayburns Weg führte ihn weiter an der Praxis von Doc Paul Bendell vorbei. Der grauhaarige Arzt hatte sich mittlerweile gut hier eingelebt, ebenso wie Reverend Brian Shaw, der damals zusammen mit dem Doc unter recht gefährlichen Umständen nach Texas gekommen war. Beide hatten die Chance für einen neuen Anfang genutzt – genau wie Tate Clayburn. Und keiner von ihnen hatte es bisher bereut.
San Angelo brauchte einen guten Doc, und auch für einen Geistlichen wie den Reverend gab es in dieser Stadt viel zu tun. Deshalb hatte Shaw bereits mit dem Bau einer Kirche begonnen, die hoffentlich noch vor Weihnachten fertiggestellt war. Die Menschen von San Angelo konnten dann ihr erstes Weihnachtsfest in einer richtigen Kirche begehen und wenigstens für ein paar Stunden vergessen, dass außerhalb der Stadt noch zahlreiche Gefahren auf die mutigen Siedler und Farmer warteten.
Aber diese Situation würde sich auch die kommenden Jahre über nur wenig ändern. Denn Texas war immer noch ein raues und wildes Land, und die Zivilisation des Ostens war weit, sehr weit entfernt.
* * *
Tom Calhoun blickte unwillkürlich nach seinem Gewehr, das nur wenige Schritte von ihm entfernt im Gras lag. Er hatte Schritte gehört und sah dann seinen ältesten Sohn John den Hügel heraufkommen.
„Ich hab‘ mir schon gedacht, dass du hier oben bist, Pa“, sagte John zu ihm und blickte dabei auf das schlichte Grab unter den drei mächtigen Eichen, das von einem kleinen, schmiedeeisernen Zaun umgeben war. Seine Miene wirkte traurig, genau wie das graubärtige Gesicht von Tom Calhoun. Dieser ruhige Ort auf der Spitze des Hügels, an dessen Fuß sich das Ranchhaus befand, war die letzte Ruhestätte von Toms Frau und Johns Mutter Sarah. Einige Jahre waren schon ins Land gegangen, seit ein Comanchenpfeil die mutige Frau getötet hatte, aber Tom und seine beiden Söhne hatten bis heute ihren Tod nicht überwinden können. Sie hatten zwar gelernt, damit zu leben – aber die Lücke war nach wie vor da, und sie machte sich jeden Tag irgendwie bemerkbar. Meist durch unbedeutende Kleinigkeiten, die einem dann erst richtig klar machten, was es heißt, eine Mutter zu verlieren …
„Dave und Bob sind wieder zurück, Pa“, sagte John. „Sie haben fast fünfzig Rinder mitgebracht und bringen sie gerade in den Corral.“
„Ich weiß, Junge“, erwiderte Tom. „Ich hatte das von hier oben schon gesehen. Ich wäre auch gleich gekommen, aber es fällt nicht leicht, von hier oben wieder wegzugehen, wenn ich daran denke, dass …“
Er brach ab und suchte nach den passenden Worten, fand sie aber nicht. John sagte nichts dazu, sondern nickte nur. Er kannte seinen Vater gut genug, um zu ahnen, was er hatte sagen wollen. Tom Calhoun hatte schwere Rückschläge hinnehmen müssen, und das hatte ihn gezeichnet. Zuerst der Tod von Johns Mutter, und dann hatten sie vor mehr als einem Jahr auch noch Billy verloren. Die Comanchen hatten ihn entführt, und alle Versuche, ihn wieder zurückzuholen, waren bisher gescheitert. Sie wussten nur, dass Billy noch am Leben war – aber das war auch schon alles …
„Kommt du jetzt mit?“, fragte John und sah, wie sein Vater nickte. Tom Calhoun verließ das Grab seiner Frau und folgte seinem ältesten Sohn hinunter zum Ranchhaus, wo die übrigen Cowboys draußen beim Corral die Ausbesserungsarbeiten so gut wie vollendet hatten. Dave und Bob kamen also genau zum richtigen Zeitpunkt, um die versprengten Rinder wieder zurückzubringen.





























