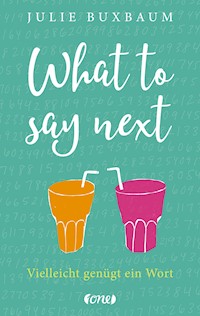
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ONE
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Eine berührende Geschichte, über zwei Jugendliche, die trotz oder gerade wegen ihrer Unterschiede perfekt füreinander sind.
Kit und David könnten unterschiedlicher nicht sein. Sie ist beliebt, er mit Asperger-Syndrom gilt an der Highschool als Außenseiter. Doch als Kits Vater bei einem Autounfall stirbt, kann sie nicht weitermachen wie bisher. Deshalb setzt sie sich in der Mittagspause von nun an zu David. Denn während alle anderen sie bemitleiden, ist seine schonungslose Ehrlichkeit genau das, was Kit gerade braucht. Und während sie sich immer weiter aus ihrer Trauer herauskämpft, nimmt David Stück für Stück einen größer werdenden Platz in ihrem Herzen ein ...
"Aufrichtig, bezaubernd, tiefgründig und wahr. ICH LIEBE ES VON GANZEM HERZEN!" Jennifer Niven (All die verdammt perfekten Tage)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungZitatKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19Kapitel 20Kapitel 21Kapitel 22Kapitel 23Kapitel 24Kapitel 25Kapitel 26Kapitel 27Kapitel 28Kapitel 29Kapitel 30Kapitel 31Kapitel 32Kapitel 33Kapitel 34Kapitel 35Kapitel 36Kapitel 37Kapitel 38Kapitel 39Kapitel 40DanksagungenÜber dieses Buch
Kit und David könnten unterschiedlich nicht sein. Sie ist beliebt, er mit Asperger-Syndrom gilt als Außenseiter. Doch als Kits Vater bei einem Autounfall stirbt, kann sie nicht weitermachen wie bisher. Statt in der Schule die Mittagspause mit ihren Freundinnen zu verbringen, setzt sie sich von nun an zu David. Seine ehrliche Art tut ihr gut, und seine analytischen Fähigkeiten bringen Kit auf eine Idee: David soll ihr dabei helfen herauszufinden, ob der Tod ihres Vaters irgendwie hätte verhindern werden können. Und so starten sie das »Unfall-Projekt«. Während der Suche nach möglichen Hinweisen lernen sie sich nicht nur besser kennen, sondern entdecken auch Gefühle füreinander …
Über die Autorin
Julie Buxbaum, geb. 1977 in Rockland County, New York, studierte u. a. an der Harvard Law School und arbeitete zwei Jahre als Anwältin in einer großen New Yorker Kanzlei, bevor es sie in die Sonne nach Los Angeles zog. Dort hing sie die Juristerei an den Nagel und fing an zu schreiben. Ihr Debütroman wurde in 25 Sprachen übersetzt. Absender: Glück ist ihr erstes Jugendbuch, zu dem sie eine anonyme E-Mail einst inspirierte. Sie lebt mit ihrem Mann, ihren zwei Kindern und einem unsterblichen Goldfisch in Los Angeles.
J U L I E B U X B A U M
Vielleicht genügt ein Wort
Aus dem amerikanischen Englisch von Anja Malich
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Copyright © 2017 by Julie R. Buxbaum Inc.Titel der amerikanischen Originalausgabe: »What to say next«
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Umschlaggestaltung: Tanja Østlyngennach einer Illustration von Thomas Slaterund einem Design von Jenny Carrow
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-1651-2
one-verlag.de
luebbe.de
Für Josh, den Chef meines ersten Teams.Ich bin sehr froh, lebenslang bei euch Mitglied sein zu dürfen.Ich liebe dich.Und für Indy, Elili und Luca: ihr seid mein Ein und Alles,mein Zuhause, mein Team, mein Leben.
The book of love is long and boring.No one can lift the damn thing.
The Magnetic Fields
Kapitel 1
DAVID
Ein Wunder ist geschehen: Kit Lowell hat sich gerade in der Schulkantine zu mir gesetzt. Ich habe immer allein gesessen, und wenn ich immer sage, ist es keine Übertreibung wie bei den meisten anderen. Ich besuche diese Highschool jetzt seit 622 Tagen, und seitdem hat sich wirklich noch nie jemand beim Mittagessen zu mir gesetzt, weshalb es gerechtfertigt ist, von einem »Wunder« zu sprechen, dass sie nun neben mir sitzt und noch dazu so dicht, dass sich unsere Ellbogen fast berühren. Mein erster Impuls ist, nach meinem Notizbuch zu greifen und unter ihrem Namen nachzuschlagen. Unter K für Kit, nicht unter L für Lowell, denn ich mag ein Faible für Fakten und wissenschaftliche Herangehensweisen haben, aber bei Namen bin ich schlecht. Zum einen liegt es daran, dass es sich um vollkommen willkürlich gewählte Wörter ohne jeden Zusammenhang handelt, zum anderen passen sie meiner Meinung nach selten zu den Leuten, die so heißen, was, wenn man darüber nachdenkt, nur logisch ist. Immerhin geben Eltern ihrem Kind den Namen zu einem Zeitpunkt, an dem sie weniger über es wissen als jemals danach. Dieser Brauch entbehrt also jeglicher Logik.
Kit ist das beste Beispiel, auch wenn sie eigentlich Katherine heißt, aber ich habe noch nie gehört, dass jemand sie so genannt hat, nicht einmal in der Grundschule. Kit sieht jedenfalls überhaupt nicht wie Kit aus, was nach etwas Geradem und Kastenförmigem klingt, leicht verständlich und mit schrittweiser Anleitung. Das Mädchen neben mir hingegen sollte ein Z in ihrem Namen haben, denn sie ist verwirrend und zickzackförmig und taucht an den unvorhersehbarsten Orten auf – wie dem Tisch in der Kantine, an dem ich gerade Mittag esse – und die Zahl Acht würde auch zu ihr passen, weil ihre Figur an die einer Sanduhr erinnert, und ein S ebenfalls, weil es mein Lieblingsbuchstabe ist. Ich mag Kit, weil sie nie gemein zu mir war, was man von den meisten anderen in meiner Schule nicht behaupten kann. Schade, dass sich ihre Eltern bei ihrem Namen so vertan haben.
Ich heiße David, was auch nicht passt, weil es viele Davids auf der Welt gibt – als ich es das letzte Mal geprüft habe, waren es allein in den USA 3 786 417 –, und so würde man aufgrund meines Vornamens glauben, dass ich wie viele andere wäre. Oder zumindest relativ neurotypisch, was der weniger anstößige Fachbegriff ist, wenn man zum Ausdruck bringen will, dass jemand normal ist. Was bei mir noch nicht vorgekommen ist. In der Schule sagt sowieso niemand etwas zu mir, abgesehen vom gelegentlichen Homo oder Schwachkopf, was beides nicht stimmt, weil ich einen IQ von 168 habe und mich nicht zu Jungs, sondern zu Mädchen hingezogen fühle. Außerdem ist Homo ein abwertender Begriff für einen homosexuellen Menschen, und unabhängig davon, dass sich meine Schulkameraden bei meiner sexuellen Neigung irren, gehört es sich nicht, so abfällig zu reden. Meine Mom sagt Sohn – womit ich kein Problem habe, weil es den Tatsachen entspricht –, und mein Vater sagt David, was sich anhört wie ein kratziger Pullover mit einem zu engen Ausschnitt. Meine Schwester nennt mich Little D, was aus unerklärlichen Gründen perfekt passt, auch wenn ich überhaupt nicht klein bin. Ich bin 1,88 Meter groß und wiege 75 Kilo. Meine Schwester hingegen ist nur 1,61 Meter und wiegt 47 Kilo. Eigentlich sollte ich sie Little L nennen, für Lauren, aber das tue ich nicht. Ich nenne sie Meini. So habe ich sie schon genannt, als ich noch ein Baby war, weil es sich schon immer so angefühlt hat, als wäre sie die Einzige auf dieser verwirrenden Welt, die wirklich zu mir gehört.
Meini wohnt nicht mehr bei uns, weil sie aufs College geht, und ich vermisse sie. Sie ist meine beste Freundin – streng genommen ist sie meine einzige Freundin, und einen Freund habe ich auch nicht, aber ich bin mir sicher, dass sie selbst dann meine beste Freundin wäre, wenn ich Freunde hätte. Bislang ist sie der einzige Mensch, der mir geholfen hat, mir mein Dasein ein wenig zu erleichtern.
Inzwischen hat wahrscheinlich jeder mitbekommen, dass ich anders bin. Normalerweise dauert es nicht lange, bis die Leute es merken. Ein Arzt hat mal behauptet, ich wäre »an der Grenze zum Asperger-Syndrom«. Dabei kann man das Asperger-Syndrom heute gar nicht mehr haben, weil es 2013 aus dem DSM-5 (die aktuelle Version des Werks Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen) gestrichen wurde. Von Menschen mit den entsprechenden Eigenschaften wird seitdem gesagt, sie hätten Hochfunktionalen Autismus (kurz HFA), was ebenfalls irreführend ist. Das Spektrum des Autismus ist vielschichtig und verläuft nicht linear.
Der Arzt war ganz offensichtlich ein Idiot. Ich habe nämlich aus Neugier selbst zu diesem Thema recherchiert (ich habe mir ein gebrauchtes DSM-4 auf eBay besorgt; Nr. 5 ist zu teuer gewesen), und auch wenn mir der medizinische Hintergrund fehlt, um eine vollständige Diagnose zu stellen, glaube ich nicht, dass mir diese Störung zugeschrieben werden kann.
Ja, ich bringe mich hin und wieder im Umgang mit anderen in schwierige Situationen, ich mag Ordnung und Routine, und wenn mich etwas interessiert, kommt es vor, dass ich mich nur noch darauf konzentriere und alles andere ausschalte. Ja okay, ungeschickt bin ich auch. Aber wenn es sein muss, kann ich anderen in die Augen sehen. Ich zucke auch nicht zusammen, wenn man mich berührt. Ich verstehe die meisten Redewendungen, selbst wenn ich für alle Fälle in meinem Notizbuch eine Liste dazu führe. Außerdem möchte ich mich gern als empathisch bezeichnen, bin mir aber nicht sicher, ob es stimmt.
Ich weiß gar nicht, ob es wichtig ist, ob ich das Asperger-Syndrom habe oder nicht, zumal es eigentlich gar nicht mehr existiert. Es ist lediglich eine Bezeichnung. Nehmen wir zum Beispiel das Wort Footballer. Würden sich genügend Psychiater dafür einsetzen, könnte man auch diese Gruppe als gestört in die DSM-Liste aufnehmen, sofern mindestens zwei der folgenden Eigenschaften zutreffen: 1) athletisch gebaut, was besonders beim Tragen enger Sporthosen zur Geltung kommt, 2) unnatürlich entspannter Umgang mit dem Anschnallen einer harten Kunststoffschale über den Penis, 3) ein Arschloch sein. Egal, ob man mich als Aspie, Sonderling oder Schwachkopf bezeichnet, Tatsache ist, dass ich gern mehr wie alle anderen wäre. Nicht unbedingt wie die Footballer. Ich will niemand sein, der Leuten wie mir das Leben schwer macht. Aber wenn ich die Chance hätte, mich auf irgendeine Art und Weise kosmisch upgraden zu lassen – von der Version David 1.0 zu 2.0, was bedeuten müsste, immer zu wissen, wie man in Alltagsgesprächen reagiert –, würde ich es sofort tun.
Wenn Eltern ihren Kindern Namen geben, ist wahrscheinlich oft der Wunsch Vater des Gedankens. So als wenn man im Restaurant sein Steak »medium rare« bestellt und dann hofft, es genau so zu bekommen, wie man es haben will, auch wenn es keine allgemein anerkannte Definition von »medium rare« gibt.
Meine Mom und mein Dad haben einen David bestellt. Und stattdessen mich bekommen.
In meinem Notizbuch steht:
KIT LOWELL: Größe: 1,63 Meter. Gewicht: ca. 57 kg. Welliges, braunes Haar, das sie bei Tests, an regnerischen Tagen und meistens auch montags zu einem Pferdeschwanz zusammenbindet. Sie hat einen ockerfarbenen Teint, weil ihr Dad – er ist Zahnarzt – weiß ist und ihre Mutter indische (keine indianischen!) Wurzeln hat. Nummer in der Klasse: 14.
Aktivitäten: Schülerzeitung, Spanisch-AG, Club für Schulmarketing
Nennenswerte Begegnungen:
1) 3. Klasse: Sie hielt Justin davon ab, mir von hinten die Unterhose hochzuziehen.
2) 6. Klasse: Sie hat mir etwas zum Valentinstag geschenkt (Anmerkung: KL hat allen Jungs was zum Valentinstag geschenkt, nicht nur mir, aber immerhin. Es war nett. Abgesehen von dem Glitter. Denn Glitter klebt und lässt sich nicht kontrollieren, und ich mag grundsätzlich keine Dinge, die kleben oder sich nicht kontrollieren lassen.)
3) 8. Klasse: Sie hat mich nach dem Matheunterricht gefragt, wie ich beim Test abgeschnitten habe. Ich habe gesagt: Volle Punktzahl. Und sie: Wow, da hast du bestimmt viel für gelernt. Darauf ich: Nein, quadratische Gleichungen sind einfach. Darauf sie: Ähm, okay. (Als ich das Gespräch später für Meini wiederholt habe, meinte sie, ich hätte sagen sollen, dass ich dafür gelernt hätte, auch wenn es nicht stimmt. Aber ich bin kein guter Lügner.)
4) 10. Klasse: Kit hat mich angelächelt, als nur unsere beiden Namen über den Lautsprecher als Halbfinalisten in der Matheolympiade verkündet wurden. Ich wollte ihr gratulieren, aber da rief Justin Cho schon: »Wahnsinn, Kit«, und hat sie umarmt. Und danach hat sie mich nicht mehr gesehen.
Wichtige Merkmale
1) An kalten Tagen zieht sie sich die Ärmel über die Hände anstatt Handschuhe anzuziehen.
2) Ihr Haar ist nicht lockig, aber glatt ist es auch nicht. Die einzelnen Strähnen sind wie Kommas, die in verschiedene Richtungen zeigen.
3) Sie ist das hübscheste Mädchen der Schule.
4) Meistens sitzt sie im Schneidersitz auf ihrem Stuhl, auch wenn die Sitzfläche noch so klein ist.
5) An ihrer linken Augenbraue hat sie eine blasse Narbe, die wie ein Z aussieht. Einmal habe ich Meini gefragt, ob sie glaubt, dass ich diese Narbe jemals würde berühren dürfen, weil ich zu gern wissen würde, wie sie sich anfühlt, worauf Meini geantwortet hat: »Träumen darf man, Little D, aber ich fürchte Nein.«
6) Sie fährt einen roten Toyota Corolla mit dem Nummernschild XHD893.
Freunde:
Fast jeder, aber am meisten hängt sie mit Annie und Violet ab, und manchmal auch mit Dylan (dem Mädchen, nicht dem Jungen). All ihre Freundinnen – mit Ausnahme von Kit selbst – haben geglättetes Haar, kaum Akne und überdurchschnittlich große Brüste. Letztes Jahr ist Kit fünf Tage lang mit Gabriel Händchen haltend durch die Schule gelaufen, und ab und zu sind sie auch stehen geblieben, um zu knutschen, aber das ist inzwischen wieder vorbei. Ich mag Gabriel nicht.
Nachtrag: Was schön ist: Laut Meini gehört sie auf die Nette-Leute-Liste, was ich genauso sehe.
Natürlich öffne ich das Notizbuch nicht vor ihren Augen. So blöd bin selbst ich nicht. Aber ich berühre den Umschlag, weil es mich beruhigt. Das mit dem Notizbuch war Meinis Idee. Nach dem Zwischenfall in der Umkleide vor ein paar Jahren befand sie, dass ich zu gutgläubig bin. Im Gegensatz zu mir sagen die meisten Leute anscheinend oft nicht die Wahrheit. Man nehme zum Beispiel die oben erwähnte Lüge mit dem Test. Warum soll ich lügen, wenn es darum geht, ob ich für einen Test gelernt habe oder nicht? Das ist doch lächerlich. Quadratische Gleichungen sind wirklich einfach. Das ist eine Tatsache.
»Dein Dad ist also tot«, sage ich, weil es das Erste ist, was mir einfällt, nachdem sie sich neben mich gesetzt hat. Diese Information habe ich noch nicht in mein Notizbuch aufgenommen, weil ich es erst seit Kurzem weiß. Meistens bin ich der Letzte in der Schule, der etwas über die anderen mitbekommt, wenn ich es überhaupt erfahre. Aber heute Morgen haben Annie und Violet vor Violets Schließfach darüber geredet, das sich zufällig neben meinem befindet. Annie meinte: »Seit der Sache mit ihrem Dad ist Kit voll neben der Kappe. Ich weiß, dass es schwer ist und alles, aber sie ist irgendwie echt, ich weiß auch nicht, aber sie ist echt gemein.« Normalerweise interessiert mich nicht, was andere in der Schule erzählen – das meiste ist einfach nur langweilig, und ich betrachte es eher als Hintergrundmusik – schrill und laut, Heavy Metal oder so –, aber das ist dann irgendwie doch zu mir durchgedrungen. Danach haben sie angefangen, über die Beerdigung zu reden und wie seltsam es gewesen ist, dass sie mehr geheult hätten als Kit, dass es nicht gut sei, alles in sich reinzufressen, was überhaupt keinen Sinn ergibt, weil Gefühle keine feste Substanz sind, die man essen könnte, und außerdem sind sie keine Ärztinnen.
Ich wäre gern zur Beerdigung von Kits Dad gegangen, nicht zuletzt, weil er ebenfalls auf meiner Nette-Leute-Liste steht, und wenn jemand von dieser Liste stirbt, sollte man doch wohl zu dessen Beerdigung gehen. Kits Vater, Dr. Lowell, ist – war – mein Zahnarzt, und er hat sich nie darüber beschwert, dass mein schalldichter Kopfhörer seinem Bohrer im Weg sein könnte. Nach der abschließenden Zahnreinigung hat er mir immer einen roten Lolli geschenkt, was mir irgendwie kontraproduktiv vorkam, aber gefreut habe ich mich dennoch.
Ich sehe Kit an. Was meinten ihre Freundinnen eigentlich damit, dass sie »neben der Kappe« wäre. Ist Kit sonst unter der Kappe? Neben welcher Kappe überhaupt? Kit und Kappe, das passt überhaupt nicht. Heute sieht sie sogar noch ordentlicher aus als sonst. Sie trägt ein weißes, bis oben zugeknöpftes Herrenhemd, das sicher frisch gebügelt ist. Ihre Wangen sind rosig, und die Augen glänzen ein wenig feucht. Ich muss mich abwenden, weil sie so atemberaubend schön ist, dass ich es kaum ertrage, sie anzusehen.
»Ich wünschte, jemand hätte es mir früher erzählt, denn ich wäre gern zur Beerdigung gekommen. Er hat mir immer Lollis geschenkt«, sage ich. Kit starrt stur geradeaus, ohne darauf zu reagieren. Ich verstehe es als Aufforderung weiterzusprechen. »Ich glaube nicht daran, dass man nach dem Tod in den Himmel kommt. Da halte ich es wie Richard Dawkins. Ich glaube, die Leute reden es sich nur ein, damit der Tod nicht ganz so furchterregend ist. Zumindest an den Himmel mit Engeln und weißen Wolken glaube ich nicht. Glaubst du daran?«, frage ich. Kit beißt von ihrem Sandwich ab, sieht mich aber nach wie vor nicht an. »Ich bezweifle es, dafür halte ich dich für viel zu intelligent.«
»Nimm’s nicht persönlich, aber würde es dir etwas ausmachen, wenn wir uns nicht unterhalten?«, fragt sie.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht wirklich eine Antwort auf diese Frage haben will, aber ich gebe sie ihr trotzdem. Meini hat die Worte »Nimm’s nicht persönlich« auf die Achtgeben-Liste gesetzt. Anscheinend folgt darauf meistens etwas Schlechtes. »Das wäre mir sogar lieber. Nur noch eins zum Schluss: Dein Dad hätte nicht sterben dürfen. Das ist einfach ungerecht.«
Kit nickt, und die Haarkommas wippen auf und ab. »Jep«, sagt sie. Und dann essen wir schweigend unser jeweiliges Sandwich zu Ende – meins ist mit Erdnussbutter und Marmelade, weil Montag ist.
Aber es ist ein angenehmes Schweigen.
Finde ich zumindest.
Kapitel 2
KIT
Ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich beschließe, mich in der Mittagspause nicht zu Annie und Violet an den Tisch zu setzen. Ich spüre ihre Blicke, als ich bei ihnen vorbeigehe. Es ist der perfekte Tisch, weil er direkt vor der Essensausgabe steht und man von dort alle sehen kann. Ich sitze dort sonst immer mit ihnen. Jeden Tag. Wir sind beste Freundinnen – ein Dreiergespann seit der Mittelstufe –, und deshalb ist mir sehr wohl bewusst, was für eine Riesensache es ist, dass ich nicht einmal die Hand zum Gruß hebe. Aber bereits beim Eintreten, als ich sah, wie sie die Köpfe zusammengesteckt haben, redeten und lachten, und einfach normal waren, als wäre alles wie immer – ja, mir ist bewusst, für sie ist alles wie immer, ihre Familien sind nicht mehr oder weniger kaputt, als sie es waren, bevor meine Welt zusammenbrach –, wusste ich, dass es nicht ging. Ich konnte mich einfach nicht zu ihnen setzen, mein Putenbrustsandwich herausholen und so tun, als wäre ich dieselbe Kit wie früher. Die Kit, die Witze über ihr Outfit macht. Über das Hemd, das ich heute aus irgendeinem unerfindlichen Grund zum Gedenken an meinen Dad angezogen habe, ein alberner Versuch, mich ihm näher zu fühlen, auch wenn ich mich damit wahrscheinlich noch mehr zum Außenseiter mache und noch unsicherer bin, wie ich mit der Sache umgehen soll. Was mich erst recht wieder an alles erinnert. Allerdings kann ich sowieso nicht vergessen, was passiert ist, nicht eine Sekunde.
Ich komme mir blöd vor. Macht die Trauer das mit einem? Es ist, als würde ich mit einem Raumanzug durch die Schule laufen – mit einem Trübsalhelm, so undurchdringlich wie Glas. Niemand hier versteht, was ich durchmache. Wie auch? Ich verstehe es ja selbst nicht.
Mir erschien es einfach sicherer, mich ganz nach hinten zu setzen, abseits von meinen Freundinnen, die inzwischen längst wieder mit anderen wichtigen Dingen beschäftigt sind, wie zum Beispiel der Frage, ob Violets Oberschenkel in der neuen High-Waist-Jeans nicht zu dick aussehen. Und abseits von all den anderen, die in den letzten beiden Wochen mit aufgesetzt betroffener Miene zu mir gesagt haben: »Kit, es tut mir so, so, so leid, das mit deinem Daaaad.« Dabei ziehen alle das Wort Dad extra lang, als hätten sie Angst vor dem nächsten Satz, der unweigerlich kommen wird, vor dem Moment des freien Falls, in dem sie sich überlegen müssen, was sie als Nächstes sagen sollen. Meine Mom meint, es sei nicht unsere Aufgabe, den anderen das Gefühl des Unbehagens zu nehmen – es geht um uns, nicht um sie, hat sie mir direkt vor der Beerdigung gesagt –, aber ihre Art zu trauern, sich mitfühlenden Fremden schluchzend um den Hals zu werfen, ist mir fremd. Was meine Art ist, habe ich dagegen noch nicht herausgefunden.
Langsam fange ich an zu glauben, dass es sie nicht gibt.
Heulen werde ich jedenfalls nicht, das wäre viel zu einfach und respektlos. Wegen schlechter Noten oder Hausarrest habe ich geheult, und einmal peinlicherweise sogar wegen eines missratenen Haarschnitts. (Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass es drei lange, unschöne Jahre gedauert hat, bis der Pony wieder rausgewachsen war.) Aber das hier? Das ist viel zu groß für ach so alberne Mädchentränen. Es ist zu groß für alles.
Tränen wären ein Privileg.
Mich neben David Drucker zu setzen, halte ich für die beste Lösung, weil er immer so still ist, dass man ihn fast vergisst. Er ist sonderbar – meistens sitzt er da und zeichnet kleinteilige Fischbilder in ein Skizzenbuch –, und wenn er redet, starrt er einem auf den Mund, als hätte man etwas zwischen den Zähnen. Nicht dass man mich falsch versteht: Auch ich habe Hemmungen und bin sehr häufig unsicher, aber ich habe gelernt, es zu überspielen. David hingegen scheint nicht einmal zu versuchen, wie alle anderen zu sein.
Auf einer Party oder bei einem Footballspiel habe ich ihn noch nie gesehen, nicht einmal bei einer dieser nerdigen AGs, die eigentlich gut zu ihm passen würden, wie dem Mathe- oder dem Codierungsclub. Ich bin nämlich ein großer Fan dieser Nerd-AGs, da sie sich gut in Collegebewerbungen machen, auch wenn ich persönlich eher zu den literarisch orientierten neige, die zumindest als etwas cooler gelten. Aber eigentlich bin ich selbst ein ziemlicher Nerd.
Vielleicht ist es keine schlechte Idee, sich einfach gar nicht um die anderen zu scheren. Eine clevere Strategie, um durch die Highschool zu kommen. Jeden Tag im Unterricht erscheinen und die Hausaufgaben machen, aber sonst immer mit riesigem schalldichtem Kopfhörer auf den Ohren rumlaufen und auf diese Weise einfach abwarten, bis die Schule vorbei ist.
Ich bin vielleicht oft unsicher und ein bisschen zu sehr darauf bedacht, gemocht zu werden, aber bevor das mit meinem Dad passiert ist, war ich trotzdem nie still. Deshalb fühlt es sich seltsam an, jetzt mit nur einer anderen Person am Tisch zu sitzen und die Lärmkulisse der Kantine am liebsten ausschalten zu wollen. Es ist das genaue Gegenteil meiner vorherigen Überlebensstrategie, als ich mich immer mitten ins Getümmel geworfen habe.
Seltsamerweise ist Davids ältere Schwester Lauren bis zu ihrem Abschluss im letzten Jahr das beliebteste Mädchen der Schule gewesen. In jeder Hinsicht anders als er: Jahrgangssprecherin und Ballkönigin (irgendwie ist es ihr gelungen, auch etwas so klischeehaft Spießiges durch ihre selbstironische Art cool wirken zu lassen). Sie war mit Peter Malvern zusammen, den alle Mädchen, mich eingeschlossen, aus der Ferne verehrten, weil er Bass spielt und einen Bartwuchs hat, von dem die meisten Typen in meinem Alter nur träumen können. Lauren Drucker ist eine lebende Legende – schlau, cool und schön –, und wenn ich noch mal von vorn anfangen und als jemand anders wiedergeboren werden könnte, würde ich gern sie sein, auch wenn wir uns nie persönlich kennengelernt haben. Ihr würde ein Pony bestimmt super stehen.
Ohne Lauren und die unausgesprochene Drohung, sie würde höchstpersönlich jeden fertigmachen, der ihrem kleinen Bruder blöd kommt, wäre David in Mapleview gnadenlos unter die Räder gekommen. Aber so wird er in Ruhe gelassen. Und das meine ich wörtlich. Um ihn herum ist es immer ruhig, weil er die ganze Zeit allein ist.
Ich hoffe, er nimmt mir nicht übel, dass ich nicht reden will. Zum Glück wirkt er nicht beleidigt. Er mag sonderbar sein, aber die Welt ist auch ohne Leute, die sich beschissen benehmen, beschissen genug, und an der Sache mit dem Himmel ist tatsächlich was dran. Nicht dass ich das Bedürfnis habe, mit David Drucker über das, was mit meinem Vater passiert ist, zu reden – kein Thema läge mir ferner, vielleicht abgesehen von der Frage, ob Violets Oberschenkel zu dick sind, denn wen interessiert schon ihre blöde Jeans, aber zufällig bin ich seiner Meinung. Das mit dem Himmel ist wie mit dem Weihnachtsmann – eine Geschichte, die man leichtgläubigen Kindern auftischt. Auf der Beerdigung haben tatsächlich vier Leute zu mir gesagt, mein Vater wäre jetzt an einembesseren Ort, als wäre es mit einem Karibikurlaub zu vergleichen, einen Meter unter der Erde zu liegen. Noch schlimmer waren die Kollegen meines Vaters, die sich erdreistet haben zu behaupten, er wäre zu gut für diese Welt gewesen. Was überhaupt keinen Sinn ergibt, wenn man auch nur eine Sekunde darüber nachdenkt. Dürfen demnach nur schlechte Menschen leben? Bin ich deshalb noch immer hier?
Mein Dad war der beste Mensch, den ich mir vorstellen kann, aber zu gut für diese Welt war er sicher nicht. Und er ist jetzt auch nicht an einem besseren Ort. Genauso wenig glaube ich, dass alles aus einem Grund geschieht, dass es Gottes Wille war oder seine Zeit zu gehen gekommen ist, als hätte er einen Termin gehabt, den er nicht verpassen durfte.
Nein. Das kann mir niemand weismachen. Wir alle kennen die Wahrheit. Mein Dad hat beschissenes Pech gehabt.
Irgendwann setzt David seinen Kopfhörer auf und zieht ein großes Buch mit festem Einband hervor, auf dem steht: Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen IV. Da wir fast alle Fächer zusammen haben und beide diese zusätzlichen Vorbereitungskurse fürs College machen, weiß ich mit Sicherheit, dass er es nicht für die Schule braucht. Wenn er seine Freizeit gern mit »psychischen Störungen« verbringt, meinetwegen, ich würde ihm allerdings ein Tablet oder einen Reader empfehlen, damit es nicht unbedingt jeder sofort mitkriegt. Wenigstens die wichtigste Mapleview-Regel sollte er befolgen: Lass nicht allzu sehr den Freak raushängen, sondern halte dich lieber zurück, um keinen Verdacht zu erregen, wenn’s sein muss unter dem metaphorischen Astronautenhelm. Das ist vielleicht der einzige Weg, um hier lebendig wieder rauszukommen.
Den Rest der Mittagspause widme ich mich stumpf kauend meinem Sandwich. Ab und zu meldet das Handy eine neue Nachricht von meinen Freundinnen, und ich versuche, dann nicht zu ihrem Tisch zu schauen.
Violet: Haben wir was falsch gemacht? Warum sitzt du da drüben?
Annie: WTF!!?!?!?
Violet: Schreib wenigstens zurück und sag uns, was los ist.
Annie: K! Erde an K!
Violet: Sag mir einfach die Wahrheit: Daumen rauf oder runter bei der Jeans?
Wenn man zwei beste Freundinnen hat, liegt irgendeine immer mit einer anderen im Clinch. Indem ich nicht zurückschreibe, bin ich heute sozusagen freiwillig diejenige, die außen vor ist. Aber ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, dass ich einfach nicht bei ihnen sitzen kann. Dass es mir wie Verrat vorkäme, mit ihnen an dem Tisch direkt vor der Essensausgabe über belangloses Zeug zu quatschen. Ich überlege, ob ich Violet schreiben soll, was ich von ihrer Hose halte, aber der Tod meines Vaters hat leider den Nebeneffekt, dass ich alles ohne Filter wahrnehme. Und dass ihre Oberschenkel nicht das Problem sind, dafür aber ihr Bauch, der durch die hohe Taille ein wenig aufgebläht wirkt, behalte ich lieber für mich.
Meine Mom hat mir nicht erlaubt, heute zu Hause zu bleiben, obwohl ich förmlich darum gebettelt habe. Ich wollte diese Kantine nicht betreten, wollte nicht von einem Unterrichtsraum zum nächsten gehen und mich jedes Mal aufs Neue für ein weiteres unangenehmes Gespräch wappnen. Wenn ich ehrlich bin, waren die Leute nett zu mir. Und sie wirkten sogar einigermaßen aufrichtig, was hier echt Seltenheitswert hat. Es ist nicht ihre Schuld, dass mir alles – Schule an sich – plötzlich so unglaublich dumm und sinnlos vorkommt.
Als ich am Morgen aufgewacht bin, ist leider die segensreiche Dreißig-Sekunden-Amnesie ausgeblieben, die ich in letzter Zeit als so wertvoll erlebt habe, diese traumhafte halbe Minute, in der mein Kopf ganz leer und frei von jeder Qual ist. Stattdessen hatte ich eine brennende Wut im Bauch, die alles andere ausschaltete. Seit dem Unfall ist nun schon ein ganzer Monat vergangen. Dreißig unwirkliche Tage.
Fairerweise muss ich zugeben, dass meine Freundinnen es gar nicht richtig machen konnten: Wenn sie es direkt angesprochen hätten, wenn sie etwas Mitfühlendes gesagt hätten wie: »Kit, ich weiß, dass es heute genau einen Monat her ist, seit dein Vater gestorben ist. Der Tag ist deshalb bestimmt besonders schwer für dich«, hätte es mich trotzdem geärgert, weil ich mich dann hätte zusammenreißen müssen, um nicht mitten in der Schule die Fassung zu verlieren. Allerdings bin ich mir ziemlich sicher, dass Annie und Violet es nicht erwähnten, weil sie gar nicht daran gedacht haben. Lachend haben sie heute Morgen, als ich kam, an ihren identischen Starbucks-Lattes genippt und weiter darüber geredet, mit welchem Typen sie am liebsten auf den Abschlussball gehen würden, während sie von mir wahrscheinlich dachten, mein Montagsfrust wäre in dieser Woche einfach nur besonders ausgeprägt. Von mir wird erwartet, dass ich einfach so weitermache.
Dass ich wieder die Alte bin.
Und nicht im Hemd meines Vaters durch die Gegend schleiche.
Heute vor einem Monat.
Seltsam, dass ausgerechnet David Drucker es genau auf den Punkt gebracht hat: Dein Dad hätte nicht sterben dürfen. Das ist einfach ungerecht.
»Du gehst doch schon seit zwei Wochen wieder zur Schule«, hat meine Mom beim Frühstück gesagt, nachdem ich einen letzten Vorstoß gestartet hatte, zu Hause bleiben zu dürfen. »Das Schlimmste hast du doch bereits hinter dir.« Von wegen! Blaue Augen, Knochenbrüche, innere Blutungen und sichtbare Narben, alles hätte ich in Kauf genommen, vielleicht auch, gar nicht mehr da zu sein. Stattdessen: nicht einmal ein Kratzer. Das schlimmstmögliche Wunder.
»Gehst du denn heute zur Arbeit?«, habe ich sie gefragt, weil es mir nur logisch erschien, dass es auch für sie hart sein müsste, Businesskleidung und High Heels anzuziehen und ins Büro zu fahren, wenn es mir so schwerfällt, zur Schule zu gehen. Meine Mom wusste natürlich um die Bedeutung dieses Tages. Am Anfang, als wir aus dem Krankenhaus kamen, hat sie die ganze Zeit geheult, während ich viel zu benommen dafür war. In den ersten Tagen, in denen sie ständig in Tränen aufgelöst war, saß ich reglos mit angezogenen Knien da und fror, obwohl ich mich in eine Million Schichten eingewickelt hatte. Auch einen Monat später ist mir noch nicht wieder richtig warm geworden.
Meine Mom hingegen hat sich zusammengerauft und wird langsam wieder zu der Person, die ich von früher kenne. Wenn man sie am Wochenende mit Yogahose, Turnschuhen und Pferdeschwanz sieht, oder sie direkt nach dem Unfall erlebt hat, als sie am Boden zerstört, fahl und in sich zusammengefallen war, kann man sich kaum vorstellen, dass meine Mom in ihrem Arbeitsleben eine taffe Businessfrau ist. Sie ist Geschäftsführerin einer Agentur für Onlinewerbung namens Disruptive Communications. Manchmal bekomme ich mit, wie sie ihre Angestellten anherrscht und dabei Ausdrücke verwendet, für die ich Hausarrest bekäme. Hin und wieder ist ihr Foto auf dem Cover von Fachmagazinen abgebildet und dazu eine Schlagzeile wie »Die vielfältige Zukunft des viralen Marketings.« Sie ist die Frau hinter dem Videoclip mit den singenden Hunden und Katzen, der über sechzehn Millionen Mal angeklickt wurde, und hinter dem Pop-up für Müsli mit den multiethnischen schwulen Vätern. Bevor sie Witwe wurde, war sie ziemlich gut drauf.
»Natürlich gehe ich arbeiten. Warum nicht?«, fragte meine Mom zurück, nahm ihre noch nicht leer gegessene Müslischüssel und stellte sie mit so viel Schwung in die Spüle, dass sie klirrend zersprang.
Dann verließ sie das Haus in ihrer »Arbeitsuniform« – schwarzer Cashmerepullover, Bleistiftrock und Stilettos. Kurz kam mir der Gedanke, die Scherben aus der Spüle zu räumen, und mich dabei aus Versehen und vollkommen unbeabsichtigt zu schneiden. Nur ein bisschen. Ich war neugierig, ob ich es überhaupt merken würde. Doch auch wenn ich seit dem Tod meines Dads dazu neigte, jeder Kleinigkeit eine höhere Bedeutung zuzumessen, weshalb ich zum Beispiel unbedingt in seinem Hemd zur Schule gehen musste, kam mir die Scherben einzusammeln auf einmal doch zu metaphorisch vor. Selbst für meine Begriffe. Soll sich meine Mom später selbst drum kümmern.
Kapitel 3
DAVID
Nach dem Mittag mit Kit Lowell setze ich den Kopfhörer ab. Normalerweise behalte ich ihn außerhalb des Unterrichts ja immer auf, um den Lärm meiner Umgebung nur als unbestimmtes Rauschen wahrzunehmen, wenn ich durch die Gänge gehe. Das ganze Geplapper und die vielen Leute machen mich nervös und lenken mich ab, wodurch ich viel leichter stolpere. Der kürzeste Abstand zwischen zwei Punkten ist eine gerade Linie, aber die Jungs jagen, von Aggressionen gesteuert, unaufhörlich von links nach rechts und wieder zurück. Dabei rammen sie sich gegenseitig die Fäuste in den Rücken, gehen mit einem Lächeln im Gesicht von hinten auf den anderen los und klatschen beim High-five mit voller Wucht die Hände gegeneinander. Warum müssen sie sich eigentlich ständig anfassen? Die Mädchen sind vergleichsweise weniger zappelig, doch auch sie bleiben dauernd stehen, bevor sie sich im nächsten Moment unvermittelt wieder in Bewegung setzen, und die ganze Zeit umarmen sie sich, obwohl sie sich gerade in der letzten Pause gesehen haben.
Heute aber absolviere ich den Gang mit offenen Ohren, weil ich wissen will, ob jemand etwas über Kits Dad sagt. Ich habe seinen Namen gegoogelt und die Traueranzeige gefunden, die vor drei Wochen und vier Tagen im Daily Courier stand. Nur drei kurze Sätze, die bei aller Prägnanz einige relevante Fakten unerwähnt lassen, wie die Lollis und dass er überhaupt ein netter Mann war.
Dr. med. Dent. Robert Lowell verstarb am Freitag, den 15. Januar bei einem Verkehrsunfall. Geboren am 21. September 1971 in Princeton, New Jersey, war er die vergangenen zwölf Jahre in Mapleview als Zahnarzt tätig. Er hinterlässt seine Frau Mandip und die gemeinsame Tochter Katherine.
Was ich durch meine kleine Recherche bislang erfahren habe: 1) Kits Vater hieß Robert mit Vornamen, was irgendwie passend ist: ein bekanntes Wort mit einer geraden Anzahl an Buchstaben. Bislang ist er für mich immer nur der Zahnarzt gewesen, was eine viel zu eingeschränkte Sichtweise war, wenn ich darüber nachdenke. 2) Kits Dad ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen, was wahrscheinlich nicht ganz korrekt ist, weil die meisten Leute nicht bei dem Unfall selbst sterben, sondern erst danach im Rettungswagen oder im Krankenhaus. Ich muss die genauen Umstände herausfinden.
Auf dem Gang kommt mir Gabriel entgegen.
GABRIELFORSYTH: Lockiges Haar, marmorierte Augen, Clownmund.
Nennenswerte Begegnungen:
1) 7. Klasse: Hat meine Oreos genommen, ohne zu fragen. Er hat sie sich einfach aus meiner isolierten Lunchbox geschnappt und ist damit weggegangen.
2) 10. Klasse: Hat mit Kit L. Händchen gehalten (das ist zwar keine Begegnung mit mir, aber trotzdem erwähnenswert.)
3) 11. Klasse: Sitzt in Physik neben mir, weil uns der Lehrer am ersten Schultag des Jahres die Plätze so zugeteilt hat. Als er gesehen hat, wie weit er von Justin Cho entfernt ist, hat er gesagt: »Mist, ist das Ihr Ernst, Mr Schmidt?«, wofür er eine erste Verwarnung kassiert hat. Ich habe ihn nicht darauf hingewiesen, dass es ein ziemlich guter Platz ist, was Akustik und Tafelsicht betrifft. Meini meinte, es wäre gut, solche Infos für mich zu behalten. Meini zufolge gehört er auf die Liste derer, denen nicht zu trauen ist.
Freunde:
Das Lacrosseteam und das Tennisteam (wobei es viele Überschneidungen gibt, weil zu unterschiedlichen Jahreszeiten gespielt wird). Sein bester Freund seit der 2. Klasse ist Justin Cho.
Ich sehe ihn nicht an, sondern halte den Kopf gesenkt, um darauf achten zu können, wer vor mir stehen bleibt beziehungsweise weitergeht.
»Klar Mann, nach dem Training im Pizza Palace«, sagt Gabriel. Angesichts der Turnschuhe und dieser Aussage bin ich zu 99 Prozent sicher, dass er mit Justin redet. Meinen Notizbucheintrag für Justin werde ich hier nicht wiedergeben, weil ich ihn oft genug gelesen und mich gefragt habe, warum er mich so sehr hasst. Ich habe keine Lust mehr darauf. Es ist und bleibt eine unlösbare Gleichung. Die Liste unserer nennenswerten Begegnungen ist fünf Seiten lang. Er steht auf der Nicht-zu-vertrauen-Liste ganz oben.
Der Pizza Palace ist der Bewertungswebsite Yelp zufolge der zweitbeste Italiener in Mapleview. Rocco finden die meisten Leute noch besser. Wenn sich Gabriel mit mir verabreden würde, rein theoretisch, würde ich vorschlagen, zu Pizza Pizza Pizza zu gehen, wo es vor 17 Uhr zwei Stücke zum Preis von einem gibt, und meiner Meinung nach ist die minimale Einbuße in der Qualität durch das, was man für sein Geld bekommt, mehr als gerechtfertigt. Allerdings ist mir klar, warum sie sich bei Pizza Palace treffen wollen – wobei dieses kleine Lokal an der Hauptstraße nichts mit einem Palast zu tun hat –, denn so günstig Pizza Pizza Pizza auch ist, es klingt einfach blöd, den redundanten Namen laut auszusprechen.
Ich probiere aus, wie sich Gabriel angehört hätte: »Klar Mann, nach dem Training bei Pizza Pizza Pizza«, und stelle fest, dass es sich in der Tat albern anhört, als ich in eine Gruppe Mädchen hineinrenne, die sich vor einem Schließfach versammelt hat. Jessica, Willow (übrigens die einzige Willow in unserem 397 Schüler starken Jahrgang und sogar in der gesamten Schule mit 1579 Schülern) und Abby. Meini hat die drei in meinem Notizbuch in Großbuchstaben und mit Leuchtstift hervorgehoben als: DIEBELIEBTESTENSCHNEPFEN.
Als Meini diese Bezeichnung mir gegenüber zum ersten Mal verwendet hat, musste sie mich erst einmal darüber aufklären, dass es sich hierbei nicht um ein Oxymoron handelt und jemand sowohl beliebt sein kann, was für mich eigentlich immer damit einherging, von vielen Leute gemocht zu werden, und gleichzeitig eine Schnepfe, was für mich immer das genaue Gegenteil bedeutete. Auf der Highschool besteht aber offensichtlich eine negative Korrelation zwischen beliebt sein und der Anzahl von Leuten, die dich wirklich mögen, dafür aber eine positive Korrelation zwischen beliebt sein und Leuten, die mit dir befreundet sein wollen. Nachdem ich eingehend darüber nachgedacht habe, ergibt es für mich Sinn, allerdings stelle ich fest, dass ich beides bin: Außenseiter und ein wunderbares Beispiel dafür, dass Korrelation noch nicht Kausalität impliziert. Ich bin freundlich zu allen, ohne dass ich irgendetwas davon hätte: Weder mögen mich die anderen noch wollen sie mit mir befreundet sein.
»Pass doch auf«, sagt Jessica und verdreht die Augen. Als wäre ich absichtlich in sie hineingerannt. Haben die Leute aus meinem Jahrgang noch immer nicht bemerkt, dass das Gefühl mittlerweile auf Gegenseitigkeit beruht? Sie wollen nichts mit mir zu tun haben? Gut. Dann will ich auch mit ihnen nichts zu tun haben. Meini ist davon überzeugt, dass es auf dem College besser wird, doch ich bezweifele es. »Und warum führst du dauernd Selbstgespräche?«
Habe ich etwa mit mir selbst geredet? Es ist gut möglich. Irgendwie ist es ironisch, dass ich die Überlegungen zu Pizza Pizza Pizza, und wie albern der Name klingt, wenn man ihn laut ausspricht, tatsächlich geäußert habe … und natürlich laut. Manchmal merke ich einfach nicht, was in meinem Kopf stattfindet und was außerhalb.
»Tut mir leid«, murmele ich mit gesenktem Kopf und hebe das Buch auf, das ihr runtergefallen ist. Sie bedankt sich nicht.
»Freak«, sagt Abby und lacht, als wäre die Bezeichnung komisch oder gar originell. Ich zwinge mich, sie anzusehen, ihr direkt in die Augen zu blicken, weil Meini behauptet, dann wirke ich menschlicher. Zwar habe ich auch in diesem Fall keine Ahnung, warum ich menschlicher wirken muss, warum alle meinen, ich sei eine Ausnahme von der allgemein anerkannten Erkenntnis, dass wir alle Menschen sind und Gefühle haben. Ich tue es trotzdem. Derart groß ist Meinis Einfluss auf mich. »Warum starrst du mich so an?«
Kurz überlege ich, ob ich Abby einfach fragen und es unumwunden ansprechen soll: »Was habe ich dir denn getan?« Ich bin schließlich mit Jessica zusammengestoßen, nicht mit ihr. Zwischen Abby und mir gab es keine einzige nennenswerte Begegnung, weder eine positive noch eine negative. Doch in dem Moment klingelt es, es wird laut und hektisch, weil alle zum Unterricht losrennen, und ich habe als Nächstes Physik. Was bedeutet, die nächsten fünfundvierzig Minuten neben Gabriel zu sitzen und zu versuchen, die Tatsache auszublenden, dass er penetrant nach Axe Anarchy für Ihn riecht und sich alle fünfunddreißig Sekunden räuspert. Trotz der guten Akustik und der tadellosen Tafelsicht hätte ich mich ohne ihn bedeutend wohler gefühlt.
Zehn Minuten nachdem Mr Schmidt seinen Vortrag über das Dritte Newtonsche Gesetz begonnen hat, das ich auf Latein aufgeschrieben habe, damit es nicht so langweilig ist, schlüpft Kit durch die Tür in den Klassenraum.
»Hab die Zeit vergessen«, sagt sie und setzt sich auf ihren Platz zwei Reihen und einen Stuhl nach rechts versetzt hinter mir. Nicht die beste Entschuldigung, wenn man bedenkt, dass es in der Schule eine laute Klingel gibt, die jeden daran erinnert, dass der Unterricht beginnt. Mr Schmidt nickt allerdings nur und herrscht sie weder an noch gibt er ihr eine Verwarnung, wie er es normalerweise tun würde. Als wir einmal zu einem Trauerbesuch bei unseren Nachbarn waren, hat Meini mir erklärt, bei Leuten, die gerade einen Angehörigen verloren haben, würden andere Regeln gelten. Ich frage mich, wie lange es gilt – nicht das Totsein natürlich, sondern dass man anders behandelt wird. Wäre Mr Schmidt bei mir auch nachsichtiger, wenn mein Dad gestorben wäre?
Wahrscheinlich nicht. Mein Dad arbeitet als Forscher in einem medizinischen Labor. Ich bezweifle, dass er bei vielen Leuten auf der Nette-Leute-Liste steht, insbesondere, weil er nicht der Typ ist, der es auf irgendwelche Listen schafft, es sei denn wissenschaftliche. Wenn jedoch meine Mutter sterben würde, dann würden alle betroffen sein. Sie und Meini sind sich in der Hinsicht ähnlich: Beide werden von allen gemocht. Ob an der Supermarktkasse oder im Drogeriemarkt, meine Mom bleibt stehen, um ein paar Worte mit anderen Erwachsenen zu wechseln. Sie kennt alle Namen der Schüler meines Jahrgangs samt der dazugehörigen Eltern, und manchmal ergänzt sie sogar Informationen in meinem Notizbuch. Von ihr habe ich erfahren, dass Justin und Jessica zusammen waren – sie hat sie knutschend in der Stadt gesehen – und später auch, dass sie sich getrennt haben. Irgendwie hat sie es bei der Maniküre aufgeschnappt, weil sie im gleichen Nagelstudio war wie Jessicas Mom.
Meini ist das genaue Gegenteil von mir. Sie hat im Abschlussjahr einen Preis nach dem anderen abgeräumt: beliebteste Schülerin des Jahrgangs, attraktivste Schülerin, Schüler oder Schülerin mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, später erfolgreich zu sein. Ich hingegen rechne nicht damit, auch nur irgendeine Anerkennung zu bekommen. Eine Sache haben Meini und ich jedoch meiner Meinung nach gemein: Auch Meini ist ein Beispiel dafür, dass Korrelation noch nicht Kausalität impliziert. Sie ist beliebt, aber keine Schnepfe. Ihretwegen muss ich allerdings das gesamte Gebiet der Genetik infrage stellen, da wir zu 50 Prozent die gleiche DNS haben.
Meine Eltern sind seit zwanzig Jahren verheiratet und lieben sich immer noch. Was statistisch gesehen bemerkenswert ist.
Meine Mom sagt: »Gegensätze ziehen sich an.«
Mein Dad sagt: »Ich habe einfach sehr viel Glück gehabt.«
Meini sagt: »Mom ist insgeheim total seltsam und Dad insgeheim total normal, deshalb kommen sie so gut miteinander zurecht.«
Ich habe mir bislang nicht besonders viel Gedanken über ihre Ehe gemacht, aber ich bin froh darüber, dass meine Eltern noch zusammen sind. Ich hätte keine Lust, jedes zweite Wochenende meine Tasche zu packen, in einer anderen Wohnung zu schlafen und mir an einem fremden Waschbecken die Zähne zu putzen. Meine Mom meint, mein Dad und ich wären uns sehr ähnlich, was mir Anlass zum Optimismus gibt. Wenn er jemanden wie meine Mutter dazu bringen konnte, ihn zu lieben – jemanden, der allgemein als supernett und wunderbar gilt –, und nicht nur zu lieben, sondern ihn so sehr zu lieben, dass sie den Rest des Lebens mit ihm verbringen will, dann gibt es vielleicht auch für mich noch Hoffnung.
Mitten im Unterricht, als Mr Schmidt gerade beginnt, Gleichungen an die Tafel zu schreiben, steht Kit auf und geht. Ohne Erklärung. Ohne um Erlaubnis zu bitten, auf die Toilette gehen zu dürfen. Ohne Entschuldigung. Sie geht einfach.
Nachdem sich die Tür hinter ihr geschlossen hat, beginnt das Getuschel.
Justin: »Das war jetzt cool.«
Annie: »Sie muss sich uns gegenüber öffnen, mit uns reden. Aber sie lässt niemanden an sich ran.«
Violet: »Ihr Dad ist GESTORBEN, Annie, das heißt, er ist tot, für immer fort. Ein bisschen mehr Verständnis wäre da schon angesagt.«
Gabriel: »Ich habe Hunger.«
Annie: »Ich habe noch einen Müsliriegel.«
Gabriel: »Damit rettest du mir jetzt gerade das Leben.«
So geht es die ganze Zeit. Um mich herum wird geredet und geredet, aber ich nehme nur zusammenhanglose Wortfetzen wahr, als würde ich mit verbundenen Augen Flipper spielen. Was hat der Tod von Kits Vater damit zu tun, dass Gabriel hungrig ist?
»Ladies and Gentlemen, fahren wir fort«, sagt Mr Schmidt und klatscht ohne nachvollziehbaren Grund dreimal in die Hände – klatsch, klatsch, klatsch. Bevor ich weiß, was ich tue, habe ich die Hand gehoben: »Ja, Mr Drucker?«
»Würden Sie mich bitte entschuldigen?«
»Entschuldigen? Wir sind hier im Unterricht und nicht am Essenstisch. Wir machen weiter im Stoff.«
»Ich meinte, kann ich bitte ins Krankenzimmer? Ich habe Migräne«, sage ich, auch wenn es nicht stimmt. Meini wäre stolz auf mich. Sie sagt, ich muss lernen, nicht immer die Wahrheit zu sagen. Dass Lügen leichter wird, je öfter man es tut. Kurz ziehe ich in Erwägung zu stöhnen, als hätte ich Schmerzen, entscheide dann aber, dass es zu viel des Guten wäre.
»Na gut, dann geh schon«, sagt Mr Schmidt, und ich erhebe mich und verlasse den Raum, genau wie Kit es kurz zuvor getan hat. Verpassen werde ich auf jeden Fall nichts. Das Physikbuch habe ich letzten Sommer bereits durchgelesen. Die wenigen Unklarheiten ließen sich mit einer kurzen Googlerecherche klären und mit einem kostenlosen Stanford-Onlinekurs vertiefen.
Sobald ich auf dem leeren Gang stehe, holt mein Kopf meinen Körper ein, und mir wird bewusst, was ich gerade getan habe. Auch wenn Mr Schmidts Unterricht langweilig und totale Zeitverschwendung ist, sitze ich die Stunden normalerweise ab und tue, was von mir verlangt wird. Meistens halte ich den Mund. Wenn ich die Highschool nicht abbrechen und auf anderem, viel komplizierterem Wege meinen Schulabschluss erlangen will, habe ich eigentlich keine andere Wahl.
Erst jetzt wird mir klar, was ich vorhabe: Ich will Kit finden. Ich muss einfach wissen, wohin sie gegangen ist.
Ich renne den Gang hinab und aus der Schultür, ohne auf Señora Rubenstein, die Spanischlehrerin, zu achten, die mir mit ihrem starken Akzent hinterherruft: »Adónde vas, Señor Drucker?«
Ich lasse den Blick über den Parkplatz zu meiner Rechten schweifen, der knapp 200 Meter nordöstlich vom Eingang der Schule liegt. Keine Kit weit und breit. Ihr roter Corolla, der fast immer in der zweiten Reihe auf dem sechsten Parkplatz von vorn steht, Nummer dreiundvierzig des Oberstufenbereichs, ist aber noch da.
Ich gehe um die Schule herum zum Sportplatz, von dessen Tribüne man einen recht guten Blick über Mapleview hat. Vielleicht sitzt sie dort oben, um sich ein wenig den Kopf freipusten zu lassen. Sportveranstaltungen mag ich gar nicht – sie sind mir zu laut und voll –, Tribünen hingegen habe ich schon immer gemocht, wie alle vertikal, von oben nach unten angeordneten Dinge.
»Hat Mr Schmidt dich geschickt?«, fragt Kit. Sie sitzt nicht auf der Tribüne, wie ich gedacht habe, sondern im Kiosk. Dort verkaufen Leute aus der Schülervertretung bei Footballspielen Hotdogs, Limonade und Süßigkeiten zu überhöhten Preisen. Jetzt brennt dort drinnen kein Licht und sie kauert mit angezogenen Knien auf dem schmutzigen Fußboden. Wahrscheinlich hätte ich sie gar nicht bemerkt, wenn sie nichts gesagt hätte.
»Nein. Ich habe ihn angelogen und behauptet, ich hätte Migräne«, antworte ich und zwinge mich, ihr in die Augen zu sehen. Es ist leichter als sonst, weil hier drinnen so wenig Licht ist. Kits Wangen sind von der Kälte gerötet. Ihre Augen sind grün. Sie sind natürlich schon immer grün gewesen, aber heute kommen sie mir besonders grün vor. Ab jetzt werden sie meine Definition der Farbe Grün sein. Bislang war es Kermit der Frosch, und manchmal der Frühling, der für mich die Farbe Grün repräsentierte. Aber das ist vorbei. Von nun an ist Grün für mich mit Kits Augen verbunden. Untrennbar. Genauso wie ich, wenn ich an die Zahl Drei denke, aus einem unerfindlichen Grund immer gleichzeitig den Buchstaben R vor mir sehe.
»Ich wollte damit keinen Trend setzen«, sagt Kit, und ich lache, auch wenn es vielleicht nicht wirklich ein Witz ist, aber doch so etwas in der Art.
»Für den Fall, dass du es noch nicht bemerkt haben solltest, ich bin gegen Trends normalerweise immun«, antworte ich und deute auf meine bequeme Cargohose, die laut Meini »ein modisches Verbrechen« ist. Seit Jahren will sie mit mir shoppen gehen und behauptet, ich könne viel besser aussehen, wenn ich mir nur ein kleines bisschen mehr Mühe geben würde. Aber ich gehe eben nicht gern shoppen. Das Shoppen an sich finde ich gar nicht mal so schlimm. Viel schlimmer sind danach die neuen Klamotten, das ungewohnte Gefühl des Stoffes auf der Haut.
Kit sieht zu mir auf und blickt dann über meine Schulter in Richtung der Schule.

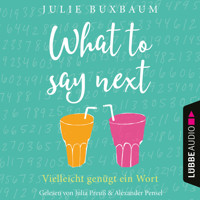













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













