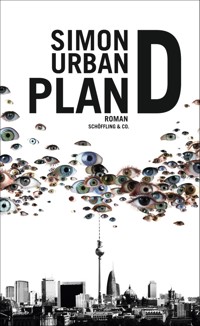12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein furioser Schelmenroman über einen Juristen, dem die Sicherungen durchbrennen: böse, treffsicher und extrem witzig. Wo endet ein inselbegabter Jurastudent, der an den starren Regelwerken des Gesetzes verzweifelt und beschließt, das Recht selbst in die Hand zu nehmen? In einer Gefängniszelle! Was aber zwischendurch geschieht, ist so unglaublich und derart gnadenlos und witzig erzählt, dass einem die Luft wegbleibt. Bereits als Kind findet der Held dieses Romans zur Juristerei: Er bereitet ein Verfahren gegen seine Großmutter vor, den Drachen der Familie – und verurteilt sie im Wohnzimmer in Abwesenheit zum Tode. Berufung: nicht möglich. Dass ein Jurastudium im beschaulichen Freiburg einem solchen Charakter nicht gut bekommt, ahnt man schnell. Auch hier kann er die Finger nicht von den Gesetzen lassen, und nimmt das Recht in die eigene Hand. Simon Urban gehört zu den großen, mutigen Erzähltalenten seiner Generation. In seinem neuen Roman entfesselt er eine furiose Geschichte um einen Außenseiter, der zum dunklen Rächer wird. Und der zuvor auszieht, um sich auf einer weltweiten Recherchereise am Unrecht und Recht der Welt zu schulen … »Wie alles begann und wer dabei umkam« ist eine bitterböse Gesellschaftsanalyse und eine literarisch brillante Auseinandersetzung mit den Regelwerken, die unser aller Leben bestimmen. Wo sind Widerworte gegen das Gesetz gefragt – und wo eskaliert das eigene Ungerechtigkeitsempfinden in wahnwitzige Selbstjustiz?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 581
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Simon Urban
Wie alles begann und wer dabei umkam
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Simon Urban
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Simon Urban
Simon Urban, geboren 1975 in Hagen, Studium der Germanistik und Komparatistik in Münster, Studium am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Sein Roman »Plan D« (2011), in dem die DDR heute noch existiert, wurde in elf Sprachen übersetzt. 2014 erschien der Roman »Gondwana«. 2013 war er Writer in Residence beim International Writing Program der Universität Iowa. Für die ARD schrieb er die Erzählvorlage zum Spielfilm »Exit« (2020). Er lebt in Hamburg und Techau (Ost-Holstein). Sein Roman »Wie alles begann und wer dabei umkam« wurde mit dem Hamburger Literaturpreis 2021 ausgezeichnet.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Bereits als Kind findet der Held dieses Romans zur Juristerei: Er bereitet ein Verfahren gegen seine Großmutter vor, den Drachen der Familie – und verurteilt sie im Wohnzimmer in Abwesenheit zum Tode. Berufung: nicht möglich. Dass ein Jurastudium im beschaulichen Freiburg einem solchen Charakter nicht gut bekommt, ahnt man schnell. Auch hier kann er die Finger nicht von den Gesetzen lassen, und nimmt das Recht in die eigene Hand. Simon Urban gehört zu den großen, mutigen Erzähltalenten seiner Generation. In seinem neuen Roman entfesselt er eine furiose Geschichte um einen Außenseiter, der zum dunklen Rächer wird. Und der zuvor auszieht, um sich auf einer weltweiten Recherchereise am Unrecht und Recht der Welt zu schulen …
»Wie alles begann und wer dabei umkam« ist eine bitterböse Gesellschaftsanalyse und eine literarisch brillante Auseinandersetzung mit den Regelwerken, die unser aller Leben bestimmen. Wo sind Widerworte gegen das Gesetz gefragt – und wo eskaliert das eigene Ungerechtigkeitsempfinden in wahnwitzige Selbstjustiz?
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Motto
Prolog
Teil I
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
Teil II
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
Dank
Für Toni
Der Mensch kann zwar tun, was er will. Er kann aber nicht wollen, was er will.
Arthur Schopenhauer
Ein verständiger Mensch kann so etwas durchaus lesen, um sich ein Bild der Verruchtheit der Welt zu machen.
Samuel Pepys
Sehr geehrter Herr Doktor Horn,
wie Sie vermutlich bereits der Presse entnommen haben, steht meine Hinrichtung nun unmittelbar bevor – einen genauen Termin gibt es nur deshalb noch nicht, weil sich die Klage vor dem EGMR derart lange hingezogen hat, dass die Behörde in Berlin bislang keine rechtliche Planungssicherheit besaß (so wurde es mir zumindest erklärt). Aber mit der Entscheidung von Montagmorgen hat sich das bekanntlich geändert. Jetzt wird die Sache Fahrt aufnehmen, schon weil der Innenminister sich diesbezüglich im Frühjahr unnötig weit aus dem Fenster gelehnt hat. Es sieht momentan also alles danach aus, als blieben mir, grob geschätzt, ein bis zwei Wochen in dieser Welt, die mich trotz all der Berichterstattung und Interviews etc. nie wirklich verstanden hat. Das soll keineswegs pathetisch oder sentimental klingen, es bedeutet schlicht: Manche Erkenntnisse bleiben unvermittelbar; sie sind für immer dazu verdammt, in dem Hirn zu verweilen, das sie ausgebrütet hat. Einen Flamingo können Sie auch nicht in die Arktis umsiedeln.
Nur der Vollständigkeit halber, sozusagen um Ihr hoffentlich halbwegs zutreffendes Bild von mir nicht durch unnötige Spekulationen zu trüben: Ich hatte mir bezüglich des EGMR nie irgendwelche Illusionen gemacht und Matthias Ludynia von vornherein prophezeit, dass seine Individualbeschwerde keinen Erfolg haben wird. Aber Sie kennen ihn ja, der Mann ist Menschenrechtsanwalt durch und durch, er konnte einfach nicht anders, als es wenigstens zu probieren. Sei’s drum. Letztendlich war diese allerletzte Runde doch zu etwas gut, denn ich habe mich selten so treffend porträtiert gesehen wie im Urteilsspruch der Straßburger Kammer. Falls Sie einmal die Muße finden sollten, ihn vollständig zu lesen, kann ich Ihnen jetzt schon versprechen, es lohnt sich. Was aber noch wichtiger ist: Ich hatte knapp acht Monate Nachspielzeit, um noch einmal das ganze Manuskript durchzuarbeiten und finale Korrekturen vorzunehmen. Wir sollten Ludynia also unbedingt in die Danksagung aufzunehmen; er hat mit seiner verzweifelten Klageschrift zwar nicht mein Leben gerettet, aber unseren Lesern garantiert einige Stilblüten, sprachliche Missgriffe und Ungenauigkeiten erspart.
Ich übersende Ihnen hiermit nun sprichwörtlich eine Ausgabe letzter Hand, die Sie in dem von uns vereinbarten und vertraglich fixierten Rahmen redigieren können; Géraldine Stegmüller wird diesen Arbeitsprozess als meine Bevollmächtigte vor Ort begleiten und nach der Vollstreckung des Urteils meine Interessen wahrnehmen. Ich weiß um die Vergeblichkeit von Wünschen, die ihrer möglichen Erfüllung weit voraus sind, dennoch möchte ich Sie an dieser Stelle darum bitten, den Lektoratsprozess einvernehmlich – bestenfalls sogar harmonisch – zu gestalten. Betrachten Sie das gerne als meinen letzten Willen.
Was das Manuskript selbst betrifft, so empfinde ich es bereits jetzt als ziemlich lesbar, und wenn wir ganz ehrlich zueinander sind, wissen wir beide, dass diese Autobiografie nicht aufgrund ihres literarischen Gehalts gekauft werden wird, sondern dass ihr Reiz in einem vermeintlichen oder wahrhaftigen Blick hinter meine psychischen Kulissen liegt. Wäre ich im Hauptberuf Schriftsteller und nicht das, was ich bin (oder zumindest mit einigem Erfolg zu sein vorgebe), hätte ich den Stoff übrigens gerne als Schelmenroman verfasst. Doch diese Idee kam mir erst im Februar und somit deutlich zu spät, was ich durchaus bedauere. Mir ist natürlich klar, dass Sie einem solchen Vorhaben niemals zugestimmt hätten – ich habe das Authentizitäts-Mantra nicht vergessen, dennoch würde mich Ihre Meinung interessieren, falls Sie mir rechtzeitig genug auf dieses Schreiben antworten sollten: Hätten Sie es für möglich gehalten?
Wie auch immer: Das Konvolut, wie Sie es gerne nennen, ist in meinen Augen so wahr wie irgend möglich geraten, und wenn es doch Abweichungen von den polizeilich ermittelten Sachverhalten gibt oder ich mich z.B. in Bezug auf Daten oder Namen punktuell irren sollte, ist das keine Fiktionalisierung durch die Hintertür, sondern meinem nicht unbedingt herausragenden Gedächtnis geschuldet. In dieser Hinsicht haben Sie sich zwar einen unzuverlässigen Erzähler eingebrockt, aber keinen Lügner. (Außerdem steht Ihnen, wie besprochen, mein Archiv von beinahe 950 Minikassetten zur Verfügung, die größtenteils auch als verschriftlichte Protokolle vorliegen; Frau Stegmüller kennt sich damit halbwegs aus und ist gerne behilflich.)
Bezüglich der erotischen Aspekte, über die wir bei Ihrem letzten Besuch so lange diskutiert haben, bin ich stur geblieben; sie komplettieren nun mal den Menschen und taugen in ihrer Banalität nicht zum Skandal, was sie für mich in der jetzigen Form vertretbar macht.
Sie sehen, ich habe bis hierher getan, was ich konnte. Nun gebe ich an Sie ab und muss – im Gegensatz zu den anderen Autoren Ihres Hauses – definitiv nicht mit der Kritik leben, die dem Werk zuteilwerden wird.
Es scheint mir, als sollten nun gewichtige Abschiedsworte folgen (wie ich Sie kenne, landet dieser Brief umgehend im Archiv und wird noch in hundert Jahren von irgendwelchen Soziologen oder Psychologen gelesen), aber ich gestehe: Mein Kopf ist leer. Vielleicht habe ich ihn leer geschrieben. Vielleicht fürchtet ein unkontrollierbarer Teil von mir auch etwas, was ich selbst gar nicht verspüre, und ist in Schockstarre verfallen. Ich kann Ihnen jedenfalls versichern, es liegt etwas überaus Tröstliches darin, in Ermangelung real existierender Götter vor sich selbst Zeugnis abzulegen und dabei zu realisieren, dass man tatsächlich nichts bereut (oder: nichts bereuen kann, selbst wenn es mitunter verlangt wird).
Falls Sie mich jetzt, hier in der Zelle, auf den Kopf zu fragen würden, ob ich nicht gerne noch ein paar gute Jahre hätte, ganz klassisch, irgendwo in der Sonne, dann könnte ich das unmöglich verneinen. So aufrichtig möchte ich auch auf den letzten Metern bleiben. Ich bin ja, wie Sie wissen, niemals lebensmüde o.Ä. gewesen. Trotzdem ist mir, vor allem auf die eigene Existenz bezogen, Qualität wichtiger als Quantität. Sie sehen mich also eher sentimental als verzweifelt, eher melancholisch als frustriert. Gestern Nacht fiel mir dazu ein Satz ein, der mich eine ganze Weile amüsierte und den ich Ihnen gerne für den Buchrücken vorschlagen möchte (oder fürs Umschlagcover, Sie sind der Profi). Er lautet: Je bewusster man seine Entscheidungen trifft, desto besser kann man mit den Konsequenzen sterben. Verwenden Sie ihn gerne, wenn Sie mögen.
Ich wünsche Ihnen nun alles Gute, dazu zählt ausdrücklich auch, dass Sie den rekordverdächtigen Vorschuss wieder einspielen, von dem ich – außer einer opulenten Henkersmahlzeit – wohl nichts mehr haben werde, vor allem aber: hartnäckige Standhaftigkeit gegenüber den selbstsüchtigen Moralisten, die Ihnen für den Teufelspakt, den Sie mit mir eingegangen sind, sicher noch lange die Hölle heißmachen werden. Seien Sie gewiss, dass auch die Anmaßendsten unter ihnen eines Tages erschlaffen. Sich permanent über andere zu erheben, zählt nun mal zu den anstrengendsten Tätigkeiten, die es gibt.
Vor dem Fenster geht gerade die Sonne unter; auf diesen Moment freue ich mich täglich, denn ich kann nicht anders, als darin die vorweggenommene Ankündigung eines neuerlichen Aufgangs zu sehen (unterstehen Sie sich, das spirituell zu interpretieren). Ich bin ein schlechter Mensch, der aufgrund dieser Eigenschaft viel Gutes tun konnte, und wenn es Ihnen gelingen sollte, mich so in Erinnerung zu behalten oder zumindest in diesem Sinne zu vermarkten, wäre ich Ihnen auch über das nahe Ende hinaus dankbar.
Mit herzlichen Grüßen, J.H.
Teil I
1
Je älter wir werden, desto mehr müssen wir verschweigen. Wenn ich in meinem Leben eine Überzeugung gewonnen habe, der ich bedenkenlos den Stellenwert eines Naturgesetzes zuschreibe, dann ist es diese: Jedes Jahr häuft neue Empfindungen und Haltungen an, die wir in uns einzuschließen verdammt sind, weil ihre öffentliche Äußerung unsere soziale und ökonomische Existenz erst gefährden und schließlich vollständig vernichten würde.
Ich gehe inzwischen davon aus, dass alle Menschen diese Erfahrung machen und dass alle Menschen sie als gleichermaßen verstörend oder sogar schizophren empfinden. Plötzlich entdecken sie Standpunkte in sich, die stark von gültigen Konventionen, grundlegenden Werten ihres persönlichen Umfelds oder vom jeweils herrschenden Zeitgeist abweichen. Die wenigsten stellen sich diesem Phänomen, realisieren oder akzeptieren ihre von der Gesellschaft tabuisierten Empfindungen und versuchen, irgendwie mit den Folgen klarzukommen. Die Meisten machen es sich einfacher und verdrängen das alles, so gut es eben geht. Was sie allesamt tun, ist schweigen. Nur in sehr seltenen, existenziellen, emotionalen oder berauschten Momenten blitzt manchmal ein wenig von dem auf, was eigentlich nie sichtbar werden sollte. Dann blicken wir auf die einsame Spitze eines Eisbergs, die sich für ein paar Sekunden in monströser Schonungslosigkeit aus dem tintigen Wasser erhebt, bevor sie für immer darin verschwindet. Und uns wird bewusst, was wir zwangsläufig entdecken würden, wenn wir uns trauten, nur einmal wirklich tief zu tauchen.
Ich denke über das Phänomen des überlebensnotwendigen Verschweigens bereits seit mehreren Jahrzehnten nach. Die ersten Beobachtungen dazu habe ich als 13-Jähriger gemacht, meine Eltern und ich wohnten damals noch im Haus meiner Großmutter. Mein Großvater war 1984 überraschend an einer Lungenentzündung eingegangen, was seiner ohnehin verbitterten Frau den Rest gab beziehungsweise nahm. Meine Großmutter, eine knochige, leptosome Erscheinung in zumeist hellen Kleidern, stakste von nun an auf der Suche nach neuen Opfern durch ihr Eigentum, wie der cremefarben verklinkerte Bungalow in der Nähe von Stuttgart familienintern genannt wurde. Sie hatte das gemeinsame Leben mit meinem Großvater so inbrünstig gehasst wie ihn selbst, nun brachte dieses Leben sie viel zu früh um die tägliche Zielscheibe ihres hoch entwickelten Sadismus. Dass der Jupp! (ich merkte erst Jahre nach dem Tod der Großmutter, warum sie einen Kosenamen zum Schimpfwort umfunktioniert hatte: in der verächtlich hervorgestoßenen Silbe Jupp! ließ sich sehr viel mehr gebündelte Abscheu zum Ausdruck bringen als mit den beiden geschmeidigen Silben Josef) sich seiner Bestimmung als Hauptschuldiger für alles, was jemals passiert war und noch passieren konnte, einfach so entzog, machte aus ihrer zielgerichteten Bösartigkeit eine wahllose.
Für meinen Großvater hingegen wird der Tod wohl zu den angenehmeren Erfahrungen seines Lebens gehört haben. Er tauschte ewige Ruhestörung gegen ewige Ruhe, und das schien mir schon als Kind ein ziemlich gutes Geschäft zu sein.
Meine Eltern und ich hausten von 1977 an in der kleinen und ziemlich dunklen Einliegerwohnung im Souterrain des Eigentums, während die Großmutter nach der plötzlichen Desertion ihres Mannes auf mehr als 130 Erdgeschossquadratmetern residierte. Rückblickend frage ich mich, warum meine Eltern dieses Mietverhältnis, das in Wahrheit ein kostenpflichtiges Abhängigkeitsverhältnis war, überhaupt so lange mitgemacht haben. Vorteile brachte es meines Wissens nicht mit sich. Selbst die jeweils Mitte des Monats in bar zu begleichende Pacht für unsere dreieinhalb schummrigen Zimmer sowie die ungenutzte Kellersauna enthielt keinen Hauch von Familienrabatt.
Das plötzliche Verschwinden des Großvaters in seiner Funktion als verantwortlicher Sünder verschärfte unsere Wohnsituation zusätzlich. Da die Natur auch einer Frau wie meiner Großmutter rudimentäre, genetisch festgeschriebene Kindes- und Enkelliebe nicht ersparen kann, richteten sich ihre Angriffe allerdings nur gelegentlich gegen meinen Vater oder mich, dafür jedoch umso häufiger gegen ihre Schwiegertochter, was wohl nicht anders zu erwarten gewesen war. Am Beispiel meiner Mutter studierte ich in diesen Jahren mit wachsender Ernüchterung, dass ein gutmütig-friedvoller Charakter zu den größten Katastrophen zählt, die einem das Erbgut einbrocken kann. Ich habe jedenfalls nie einen ausgelieferteren Menschen erlebt als die Frau, die mich geboren hat. Vermutlich müsste ich eine langwierige Therapie über mich ergehen lassen, um halbwegs professionell klären zu können, welchen Einfluss die damaligen Verhältnisse tatsächlich auf meine Adoleszenz nahmen. In einem Punkt bin ich mir aber absolut sicher: Ich lernte damals, dass bedingungslose Duldsamkeit nie Mitleid produziert, sondern ausschließlich mehr Leid. Die Wehrlosigkeit der Mutter erwies sich in immer neuen Variationen als dringend benötigter Treibstoff für den rasenden großmütterlichen Hass. Erst viel später stieß ich auf Adornos Satz, nach dem nur derjenige geliebt wird, der schwach sein kann, ohne Stärke zu provozieren. Darin, dass die Mutter von der Großmutter nie geliebt wurde, waren Adorno und ich uns jedenfalls einig.
Worin genau die Vergehen der Mutter bestanden, habe ich akribisch in einer Art Tagebuch festgehalten, was mich heute, ehrlich gesagt, erstaunt. Mit welcher Motivation ich diese Notizen 1985 (wie gesagt, im Alter von gerade mal 13 Jahren) machte, kann ich rückblickend nicht mehr feststellen. Vielleicht hatte ich das unbestimmte Gefühl, eine Art Student zu sein, der zufällig in ein faszinierendes Experiment zu Strukturen und Strategien der Machtausübung geraten war und sichergehen wollte, das Gelernte nie wieder zu vergessen.
Meine Aufzeichnungen belegen, dass besonders viele Fehler der Mutter darin bestanden, die täglichen Aufträge ihrer Vermieterin unvollständig oder zur falschen Zeit auszuführen. Am 17. Mai 1985 hatte meine Mutter zum Beispiel die Pferdesalbe, mit der die Großmutter auf ärztlichen Rat hin täglich ihre Gelenke einreiben musste, nicht schon vormittags um 11:00 Uhr aus der Quellen-Apotheke in Botnang (Stuttgart-West) besorgt, sondern – wie ich schriftlich festhielt: infolge eines Staus im Stadtgebiet, verursacht durch den Unfall eines Notarztwagens, dessen Fahrer bei ca. Tempo 130 die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und einen Brückenpfeiler rammte – erst gegen 13:30 Uhr. Eine Woche später war die Wäsche der Großmutter nicht, wie gefordert, bis zum frühen Nachmittag gewaschen, getrocknet und geplättet, sondern erst gegen 19:00 Uhr (in diesem Fall gibt es keine Entschuldigung). Schon am nächsten Tag hatte meine Mutter bereits gegen 08:05 Uhr begonnen, das mit Orientteppichen ausgelegte Wohnzimmer der Großmutter zu saugen, obwohl eigentlich 08:30 Uhr vereinbart worden war und die Großmutter ihre Frisur noch nicht vollständig hergerichtet hatte. Den Grund für das verfrühte Saugen habe ich mit blauer Tinte auf weißem Kästchenpapier festgehalten: Meine Mutter wollte sichergehen, dass sie das Mittagessen (die Abkürzung Köklo wird wohl für die von mir damals über alles geliebten Königsberger Klopse stehen) um exakt 12:00 Uhr auf den Tisch bringen konnte, denn in diesem Punkt hatte sich Elisabeth wiederholt als besonders empfindlich erwiesen. Wenn die Aufträge meiner Großmutter keinerlei Aufschub duldeten, läutete sie im Treppenhaus ein kleines Glöckchen aus Nymphenburger Porzellan (das handgemalte Motiv zeigte eine mit einem Wollknäuel spielende Katze), dessen durchdringender Klang bis in den letzten Winkel des Souterrains zu hören war, woraufhin meine Mutter sofort aufsprang und hastig ins Obergeschoss lief, denn das penetrante Glockenläuten endete erst, wenn die Großmutter ihre Arbeitsanweisung erteilt hatte.
Blättere ich heute in dieser kindlichen Dokumentation einer familiären deutschen Tyrannei des ausgehenden 20. Jahrhunderts, bleibt mir nichts anderes übrig, als festzustellen, dass meine Mutter massiv gestört gewesen sein muss. Sie wurde während unserer insgesamt neun dämmrigen Souterrainjahre für ihre Arbeit wie eine durchschnittliche Putzfrau bezahlt (laut meiner Unterlagen zunächst mit fünf D-Mark in der Stunde, später – dank der zaghaften Intervention meines Vaters – mit 50 Pfennig mehr) und hatte sich offenbar selbst mit dem Argument überzeugt, auf diese Weise Nebenverdienst und familiäre Solidarität unter einen Hut bringen zu können. Ihren Lohn erhielt sie monatlich in bar, er wurde von unserer Miete abgezogen. Meine Mutter übergab der Großmutter, die sich zu diesem Anlass feierlich an den sonst ungenutzten Schreibtisch (ich sollte erst später erfahren, dass es sich dabei um ein Original von David Roentgen handelte) ihres verstorbenen Mannes setzte, 250 D-Mark Pacht inklusive Nebenkosten und erhielt 120 D-Mark Lohn zurück. Das kam mir vor, als würde meine Mutter 130 D-Mark bezahlen, um für meine Großmutter schuften zu dürfen.
Mein Vater taucht in meiner Erinnerung an diese Zeit kaum auf. Er schaffte viel (als leitender Bauingenieur) und verschwand am Wochenende mit ausschließlich männlichen Freunden zum Angeln, wenn man konzentriertes Dosenbiertrinken am Ufer eines Forellenzuchtteichs in Büsnau so nennen möchte. Obwohl ich davon ausgehe, dass er meine Mutter angesichts der unangenehmen Begleitumstände ihrer Arbeit im Eigentum insgeheim bedauerte, habe ich keine einzige Situation notiert, in der er sich vor den Augen und Ohren meiner Großmutter auf die Seite seiner Ehefrau geschlagen hätte. Er ist mir vor allem als konfliktscheuer, in sich gekehrter Mann ohne jedes Talent für Kommunikation und Humor in Erinnerung geblieben, dessen einziger Lösungsansatz immer darin bestand, Problemen in einem unbeobachteten Moment auszuweichen, statt sie anzupacken.
Ein alter Freund des Vaters, dem ich vor vielen Jahren zufällig in Düsseldorf begegnete und der mich vor lauter Verwunderung über unser unerwartetes Zusammentreffen mitten in einer Millionenstadt (das war natürlich Blödsinn) sofort auf mehrere Biere in eine neblige Raucherkneipe einlud, sagte bei unserer Verabschiedung in melancholischem Tonfall, mein Herr Papa sei nun mal ein Mann, mit dem man keinen Krieg gewinnen könne. Ich muss ihn daraufhin ziemlich perplex angesehen haben, denn er entschuldigte sich sofort für seine Wortwahl, und es kostete mich mehrere Minuten, ihn davon zu überzeugen, dass ich keineswegs pikiert oder beleidigt war, sondern ihm im Gegenteil sehr für diese Formulierung dankte – denn zum einen hatte ich es in all den Jahren selbst nie geschafft, meinen Vater so knapp und treffend zu charakterisieren, zum anderen konnte ich Gespräche über ihn nun mit einem einzigen Satz beenden.
Zu den Begriffen, die meine Großmutter unwiderruflich geprägt hat, zählt besonders das Wort Mangelhaftigkeit. Es bezeichnete in ihrem Sprachgebrauch alles, was andere Menschen falsch machten, und schien sich dabei an der Schulnotenterminologie zu orientieren, denn in besonders drastischen Fällen von Fremdversagen wurde auf die Formel vollkommen ungenügend zurückgegriffen. Wie genau sie meine Mutter fertigmachte, entschied die Großmutter nach keinem erkennbaren Schema, vielleicht war es Tagesform. Ihr Repertoire umfasste spöttische Blicke, Nachäffen, hämische Kommentare, verletzende und erniedrigende Bloßstellungen, polemische Beleidigungen, akribisch gesammelte Vorwürfe, dreiste Lügen (heute würde man wohl Fake News sagen), plötzliches enthemmtes Losbrüllen und die Drohung der Kündigung von Einstellung (gemeint war wohl: Anstellung) sowie Souterrainwohnung (ich lernte bei dieser Gelegenheit, dass Immobilienbesitz nicht vorrangig Geld, sondern Macht bedeutet). Meine Mutter ertrug die Beschimpfungen meist stumm, wenn sie etwas zu ihrer Entschuldigung vorzubringen hatte, tat sie es leise und sachlich. Waren wir anschließend im Souterrain unter uns, nahm sie die Großmutter sofort gegen meine Vorwürfe in Schutz, weil die Oma nun mal einsam sei, pommersches Temperament besäße, es nicht so meine, vor Kurzem den Mann verloren habe, streng erzogen worden wäre, es nie einfach gehabt habe, auch ihr Päckchen tragen müsse, einer ganz andere Generation angehöre, es nicht besser wisse und trotz allem immer noch meine Großmutter sei. Die Mutter verstand die Großmutter besser als die Großmutter sich selbst. Sie war ihre erfolgreichste Verteidigerin, sie wurde nie laut und sie weinte nie. Meine Mutter war geboren, um hinzunehmen.
Ich nicht.
Natürlich verhinderten die konkreten Umstände und mein jugendliches Alter, dass ich damals irgendetwas hätte tun können. Die Großmutter herrschte unangefochten über unser kleines Reich, und meine Eltern waren in vielfacher Hinsicht unfähig und unwillig, aus eigener Kraft etwas an ihrer Situation zu ändern. Für meinen abwesenden Vater erwies sich die Lage unterm Strich sogar als gar nicht so übel; der einseitige Konflikt der Frauen ließ beiden Lagern kaum Kraft für Konflikte mit ihm übrig. Außerdem spekulierte er wohl darauf, eines Tages das Eigentum zu übernehmen, und hielt sich schon deshalb zurück. Meine Mutter hingegen war in dem Glauben erzogen worden, dass nichts auf der Welt heiliger sei als die Familie. Hätte sie das Handtuch geworfen, wäre ihr zwangsläufig die Hauptschuld am Scheitern unserer Irrenhausgemeinschaft zugeschrieben worden, außerdem muss man ihr wohl eine nahezu vollkommene Lethargie unterstellen, was die Beseitigung von Missständen angeht.
Mir fehlte es also nicht nur an Reife und an Mitteln, sondern auch an Verbündeten. Woran es mir nicht fehlte, war der feste Wille, die Ungerechtigkeit, die sich tagtäglich vor meinen Augen abspielte, vollständig zu erfassen, sachlich, aber schonungslos zu bewerten und auf diese Weise ein Gegengewicht zur großmütterlichen Gemeinheit zu schaffen. Das Verhalten meiner Eltern zeigte mir, dass ich dabei keine ernst zu nehmende Hilfe von ihnen erwarten durfte. Obwohl es zweifellos ihre Pflicht gewesen wäre, die mehr als problematische Lage mit ihrem Sohn offen zu besprechen und einzuordnen, kam von meinem Vater gar nichts und von meiner Mutter lediglich der wiederholte hilflose Versuch, mir die hausintern tobenden Schlachten als ganz normale Scharmützel zu verkaufen, die nun mal nicht zu umgehen seien, wenn man mit drei Generationen unter einem Dach lebe. Ich bin überzeugt, dass die Mutter, wenn sie in diesen Jahren an einen Lügendetektor des FBI angeschlossen worden wäre, von einem im Grunde recht harmonischen Miteinander im Eigentum zu berichten gewusst hätte, ohne damit den Verlauf der Aufzeichnungsnadel auch nur im Geringsten aus der Ruhe zu bringen. Sie sah, was sie sehen wollte. Dass ihre allumfassende Milde der Hochleistungsmotor einer Tragödie war, die meine Mutter sich nicht eingestehen konnte, weil die dazu notwendige Verurteilung des großmütterlichen Handelns von ihrer Milde unmöglich gemacht wurde, wäre ihr nie in den Sinn gekommen.
Am 3. Juni 1985 begann ich mit den Prozessvorbereitungen gegen die Großmutter. Auch wenn mein gerade mal neun Quadratmeter großes sogenanntes Jugendzimmer voller Batman- und Nena-Poster eher einen denkwürdigen als einen würdigen Gerichtssaal abgab, reichte es für meine Zwecke vollkommen aus. Weder die Zeugen noch die Angeklagte selbst würden schließlich persönlich zur Hauptverhandlung erscheinen. Ich hatte im Bücherschrank des Großvaters einen alten Kommentar zum StGB gefunden, dessen hellgrauer Einband die Trockenheit der Materie bereits ästhetisch auf den Punkt brachte, und mich rund drei Wochen lang mit Schuldfähigkeit,Täterschaft und Teilnahme sowie mit Straftaten gegen die persönliche Ehre befasst. Mein besonderes Interesse galt Abschnitt 14 des StGB und dort § 185 (Beleidigung), § 186 (Üble Nachrede) sowie § 187 (Verleumdung). Außerdem lag mein Augenmerkt auf § 234 (Menschenhandel zum Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft) und § 223b (Misshandlung von Schutzbefohlenen).
Das Verfahren erwies sich als kompliziert. Meine Probleme begannen damit, dass die geschädigte Person zugleich die Anwältin der Angeklagten war (meine Mutter), dass einer der beiden Zeugen (mein Vater) die Aussage verweigerte und der Hauptbelastungszeuge (ich) nebenbei auch noch als Staatsanwalt, Richter und Protokollführer fungieren musste. Gleichzeitig fehlte mir ein Gutachter, der die Angeklagte auf ihre Schuldfähigkeit hin hätte untersuchen können. Auch die Rolle des ermittelnden Polizeibeamten übernahm ich schließlich selbst. Denn wenn ich für die Taten meiner Großmutter ein angemessenes Urteil finden wollte, konnte ich auf eine stichhaltige Beweisaufnahme, die vor Gericht meinen eigenen Fragen standhielt, nicht verzichten.
Obwohl diese Ausgangssituation erhebliche Hürden mit sich brachte, war ich äußerst motiviert, den Prozess tatsächlich stattfinden zu lassen und erfolgreich abzuschließen. Für die Vorbereitung erwies sich vor allem ein Diktiergerät als hilfreich, das mein Vater früher bei Baustellenkontrollen verwendet hatte, um sich im Winter nicht andauernd mit eisigen Fingern Notizen über den Fortschritt der Arbeiten machen zu müssen. Später hatte er damit die Unterhaltungen seiner Saufkumpane am Forellenteich aufgenommen und eine Zeit lang ernsthaft mit dem Gedanken gespielt, diese an Banalität nicht zu überbietenden Dialoge als Grundlage für einen Live-Angel-Ratgeber (was auch immer das sein sollte) zu verwenden. Seit mein Vater selbst kaum noch Baustellenkontrollen durchführte und überdies erkannt hatte, dass niemals ein Verleger die kargen Dialoge der angetrunkenen Forellenfreunde Büsnau in Buchform bringen würde, lag das Gerät der Marke Grundig in einer Schublade und diente mir nun nicht nur zum Protokollieren von Aussagen, sondern auch als unersetzliches Werkzeug meiner Ermittlungen.
Ich versteckte es angeschaltet in einer Seitentasche meines Fjällräven-Rucksacks und führte über einen Zeitraum von rund vier Monaten 63 Gespräche. Dabei war es mir wichtig, auch Personen außerhalb des Eigentums zu Wort kommen zu lassen. Denn um im Hauptverfahren bestehen zu können, musste ich ein möglichst vielschichtiges Bild unserer Familiensituation aus den unterschiedlichsten Perspektiven zeichnen (das hatte ich in der Fernsehserie Perry Manson gelernt). Ich unterhielt mich mit mehreren Nachbarn und Nachbarskindern, mit der Cousine meiner Mutter und dem Halbbruder meines Vaters. Ich täuschte Fieber vor und zwang unserer Hausärztin Dr. Strathmann bei laufendem Tonband ein Gespräch über meine Großmutter und die Sorgen auf, die ich mir um ihren nervlichen Zustand machte. Ich sprach mehrfach mit der Mutter in ihrer ihr unbewussten Funktion als Anwältin der Großmutter und versuchte zumindest zweimal meinen Vater zum Reden zu bringen, womit ich erwartungsgemäß keinen Erfolg hatte. Von sämtlichen Vernehmungen fertigte ich Protokolle auf unserer Olympus-Schreibmaschine an, verstaute sie in einem unauffälligen Schulschnellhefter mit dem Titel Material Sozialkunde und schloss die Mappe in meinem Schreibtisch ein. Fünfmal besuchte ich unter dem nicht mal erfundenen Vorwand, mich für ein Jurastudium zu interessieren, öffentliche Verhandlungen am Amtsgericht und am Schwurgericht Stuttgart.
Nach Beendigung der Verhöre versteckte ich das Diktiergerät an insgesamt 24 Tagen im Wohnzimmer der Großmutter und zeichnete kleine bis große Scharmützel auf, die ich anschließend ebenfalls verschriftlichte und nach Intensität der Auseinandersetzungen sortierte. Als sich die inhaltlichen Vorwürfe der Großmutter sowie ihre Methoden und Strategien erkennbar zu wiederholen begannen, schloss ich die Beweisaufnahme ab.
Während die Organisation des Prozesses mir immer wieder Schwierigkeiten bereitete und außerdem deutlich langwieriger gewesen war, als ich erwartet hatte, brauchte ich für die Urteilsfindung nur einen Samstag, den 14. Dezember 1985. Meine Eltern besuchten von Freitagabend bis Sonntagabend einen Schulfreund meines Vaters in Kassel, meine Großmutter absolvierte gerade ihren jährlichen Kuraufenthalt in Bad Oeynhausen (eine als Nervenpflege getarnte Rundreise durch westfälische Wirtschaften). Nachdem ich meine Arbeit bislang ausschließlich im Jugendzimmer verrichtet hatte, verlegte ich die Hauptverhandlung ins Wohnzimmer der Großmutter, der Schreibtisch des Großvaters diente mir als Richterpult. Die Angeklagte, ihre Anwältin, die Klägerin und die wichtigsten Zeugen erschienen in Form von zum Teil gerahmten Porträtfotos im Sitzungssaal, die ich im Halbkreis auf Stühlen und Sesseln verteilte.
Ich eröffnete den Prozess mit der Verlesung der Anklageschrift, an der ich rund drei Wochen lang gefeilt hatte. Darin warf ich der Großmutter Beleidigung, Verleumdung und üble Nachrede in 24 Fällen vor (wobei eine geschätzte Dunkelziffer von weit über 1.000 Taten seit 1977 genannt wurde), außerdem vorsätzliche Körperverletzung durch seelische Folter (bei gleicher Anzahl von Taten und Dunkelziffer) sowie Menschenhandel zum Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft in neun Fällen (in denen meine Mutter Tätigkeiten wiederholt und unbezahlt ausführen musste, weil die Großmutter mit der ersten Ausführung nicht zufrieden gewesen war). Als Beweismittel präsentierte ich sämtliche Abschriften meiner Tonbandaufnahmen und verlas exemplarische Passagen laut. Darin fielen Beleidigungen wie blöde Kuh, Minderbemittelte, Schlunze, Versagerin, gehirnlose Närrin, strunzdummes Vieh oder besonders häufig: du dämliches Sauweib. Außerdem wurde der Mutter wiederholt vorgeworfen, eine krankhafte Erbschleicherin zu sein, die die Großmutter unter den Lehm bringen wolle (offenbar eine pommersche Redensart) etc.
Während ich als Hauptbelastungszeuge sämtliche Anklagepunkte einschließlich ihrer fehlenden Rechtfertigung bestätigen konnte, blieb mein Vater stumm. Sein Halbbruder sagte auf Tonband aus, die Mutter sei der führende Box-Sack von Baden-Württemberg – so viel einzustecken und sich dann hängen zu lassen, schaffe sonst niemand. Die Cousine der Mutter begann zu weinen, als sie auf das Verhalten der Großmutter angesprochen wurde. Ich spielte ihr Schluchzen, Schnaufen und Schniefen in voller Länge ab (fast fünf Minuten), anschließend sagte die Cousine, die Großmutter bekomme in der Hölle einen Platz in Luzifers Loge, so viel sei sicher. Ich rief Frau Dr. Strathmann als vereidigte Gutachterin in den Zeugenstand und bat sie um eine Einschätzung der großmütterlichen Schuldfähigkeit. Dr. Strathmann gab zu Protokoll, dass die Angeklagte sich ihrer Überzeugung nach bester geistiger Gesundheit erfreue und die beschriebenen familiären Konflikte keine Folge psychischer Erkrankungen seien, sondern vielmehr als charakterlich gelagert betrachtet werden müssten. Der Halbonkel hingegen kam zu der Diagnose, die Omma habe ordentlich einen an der Marmel, vielleicht auch Hirntumor. Meine Mutter brachte zur Verteidigung vor, was sie immer vorgebracht hatte. Das Gericht nahm ihre Argumente zur Kenntnis. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft machte es kurz und forderte die Höchststrafe.
Die Sonne war schon hinter den Blautannen verschwunden, mit denen der Großvater das Eigentum umstellt hatte, als die Urteilsverkündung begann. Ich sprach die Großmutter in sämtlichen Anklagepunkten schuldig. Aufgrund der eklatanten Zahl von Wiederholungstaten, des Fehlens jedes nachvollziehbaren Motivs sowie jeder Form der Einsicht oder Reue stellte ich außerdem die besondere Schwere der Schuld fest. Da die Großmutter der Mutter quasi vorsätzlich und wortwörtlich das Leben nehme, bewertete ich ihre Handlungen als wiederholten Mordversuch. Um 18:04 Uhr verkündete ich das Strafmaß und verurteilte die Großmutter zum Tode. Eine Berufung war nicht möglich.
2
Das Leben besteht, wenn wir ehrlich sind, aus einer quasi nahtlosen Aneinanderreihung unterschiedlichster Leidensphasen, die sich gegenseitig die Klinke in die Hand geben, das Individuum in immer neuer Weise malträtieren, ihm jede Hoffnung auf ungetrübtes Glück rauben und somit – weltgeschichtlich betrachtet – vermutlich auch noch die Erfindung der Religionen begünstigt haben, was die ganze Sache nicht unbedingt besser macht.
Gravierenden Veränderungen unterworfen zu sein, stellt bedauerlicherweise eine hartnäckige Konstante der menschlichen Existenz dar, die Pubertät nimmt hier jedoch eine besonders perfide Sonderrolle ein. Ich blieb zwar länger als andere Teenager von den Auswirkungen der einsetzenden Geschlechtsreife verschont, aber als ich schon glaubte, eine rühmliche Ausnahme zu sein, erwischte es mich umso heftiger, was mir damals wie eine gerechte Strafe für meine grenzenlose Naivität vorkam.
Die Hormone machten aus mir innerhalb weniger Monate einen mit eiternden Pickeln gesprenkelten, schwammigen Freak, der umso hässlicher zu werden schien, je mehr er in exakt den Mädchen, die ihn mit geradezu bewundernswerter Vollendung ignorierten, den Sinn seines Daseins ausmachte.
An den einfühlsam gemeinten Blicken meiner Mutter konnte ich Tag für Tag ablesen, wie sehr sie mich für mein altersgemäßes Schicksal bemitleidete, was mein Wohlbefinden nicht unbedingt steigerte. Sie hatte ihren Jungen unter erheblichen Schmerzen auf die Welt gebracht und in gewisser Weise schämte ich mich regelrecht dafür, ihr als Lohn für die erlittenen Strapazen nun einen derart unerfreulichen oder vielmehr unästhetischen Anblick bieten zu müssen. Als mir schließlich sogar mein Vater eines Morgens am Frühstückstisch unvermittelt auf die Schulter klopfte und Das wird schon wieder murmelte (es war klar, dass er nicht den kürzlich ausgebrochenen Volksaufstand in Algerien meinte, sondern meine plötzliche Verwandlung in einen notgeilen Streuselkuchen), wurde mir das ganze Ausmaß der Tragödie bewusst. Ich war nicht mehr ich, und ich würde es aller Voraussicht nach auch nie wieder sein. Wenn es überhaupt eine Chance auf Heilung gab, dann bestand sie darin, innerhalb der nächsten Jahre ein anderes, mir erträgliches Ich zu werden, das nicht länger als willfähriger Sklave eines wabbeligen, von Akne geplagten Körpers und seines obszönen Gehirns herhalten musste. Ich gestehe, dass mir die Aussicht auf eine derartige Metamorphose an den meisten Tagen meiner Adoleszenz ungefähr so realistisch erschien wie die Wiedervereinigung der Bundesrepublik Deutschland mit der DDR.
Auch wenn mein Denken in dieser Hochphase der Diktatur des Testosterons (O-Ton meiner Aufzeichnungen, die ich trotz chronischer Unkonzentriertheit fortzuführen versuchte) von allerhand schmutzigen Fantasien, idiotischen Ängsten und quälenden Zweifeln an der eigenen Zukunftsfähigkeit überschattet wurde, war mir die Ironie der Tatsache, dass mein Körper gerade biologisch auf ein Sexualleben vorbereitet wurde, das ich nicht genießen konnte, weil mich der Vorbereitungsprozess hemmungslos entstellte, durchaus bewusst. Warum bekommt der Mensch die Jugend in einem Alter, in dem er nichts davon hat? lautete eine ironische Überlegung von George Bernard Shaw, die ich mal in irgendeinem Poesiealbum gelesen hatte, und dieser Frage konnte ich mich nur anschließen.
Projektionsfläche meiner mit leichter Verspätung, aber dafür umso hartnäckiger erwachten Lust waren die brünetten Weber-Girls, die ebenfalls allesamt aufs Eberhard-Ludwigs-Gymnasium (von uns nur Ludi genannt) gingen; zu meinem Bedauern stellte sich allerdings umgehend heraus, dass fast sämtliche männliche Mitschüler meinen exzellenten Frauengeschmack teilten. (Ich schätze, die wenigen desinteressierten Ausnahmen gaben es nur nicht zu, um sich interessant zu machen, oder studierten an der anderen Fakultät, wie mein Vater Homosexualität gerne umschrieb.)
Die älteste Schwester des Terzetts, Julia Weber, war zwei Stufen über mir und galt als konkurrenzlose Oberstufenschönheit – so wie es sie in jedem prototypischen Highschool-Drama aus Hollywood geben muss –, was »JW«, wie wir sie mit teenagerhafter Ehrfurcht nannten, automatisch zur personifizierten Unerreichbarkeit erhob; die mittlere Schwester Lilian ging in meine Parallelklasse, sie war mit einem o-beinigen Fußballproleten namens Marc-René Pelzer zusammen, der in der B-Jugend der Bezirksliga Württemberg als vielversprechendes Nachwuchstalent gehandelt wurde und so glatt aussah wie die gestylten Popper auf der BRAVO (also so ziemlich das exakte Gegenteil von mir); die jüngste Schwester Charlotte war eine Stufe unter uns und stimmte in den wesentlichen äußeren Merkmalen mit Julia und Lilian überein; zu meinem Leidwesen hatte sie allerdings die überdimensionale Nase ihres Vaters geerbt, außerdem neigte sie zu Übergewicht (am Po).
Meine Versuche, Lilian in ein tiefgründiges Gespräch über ein bedeutsames Thema zu verwickeln, um ihr so zu beweisen, dass ich zumindest ein pickliger Schwamm mit Intelligenz und Haltung war, schlugen allesamt fehl, denn wie sich herausstellte, hatten wir keinerlei Gemeinsamkeiten (einzige Ausnahme: die Kunst-AG). Lilian war offenkundig ihrem Fußballfreund verfallen, der sie im Laufe der Beziehung einer strammen Bezirksliga-Gehirnwäsche unterzogen und so in ein willenloses Groupie ohne eigene Interessen verwandelt hatte, was für mich mindestens ein Halbjahr lang den Inbegriff der menschlichen Tragödie darstellte.
Die umwerfend hübsche 16-Jährige mit dem eleganten blassen Gesicht, den eichhörnchenbraunen Augen, dem immer ganz leicht geöffneten Kussmund, den hüftlangen Haaren und den schönsten Händen (und Fingernägeln), die ich kannte, lungerte in jeder freien Minute auf schlammigen Provinzsportplätzen in Ditzingen, Gerlingen oder Möhringen herum, konnte aktuelle Tabellenstände aus der Region runterbeten und über strittige Abseitspositionen palavern, war aber nicht in der Lage, etwas Sinnvolles auf die Frage zu antworten, ob sie sich manchmal ebenfalls wünsche, ein unschuldiges, geliebtes Tier zu sein, das reines Glück empfinden könne, ohne im Umkehrschluss den gräulichen Jammer der Welt gewahr werden zu müssen. Vielleicht war sie auch an meiner Sprache gescheitert, die ich mir, wie ich glaubte, bei Schiller geliehen hatte.
Ihre Beziehung machte auf mich jedenfalls den Eindruck einer geradezu pathologischen Abhängigkeit, wobei ich mir bisweilen einredete, dass die bemitleidenswerte Jungfrau Lilian notfalls mit Gewalt aus den Klauen des o-beinigen Popperteufels Marc-René befreit werden müsse, der offenkundig ihr Seelenheil gefährdete, wobei ich zugegebenermaßen keinen blassen Schimmer hatte, wie genau eine solche Befreiungsaktion vonstattengehen sollte (und das mit der Jungfrau stimmte vermutlich auch nicht).
Als wir gegen Ende des Schuljahres eine Utopie in Aquarell anfertigen sollten, war auf Lilians Bild natürlich Marc-René Pelzer mit dem WM-Pokal zu sehen, woraufhin irgendjemand das gehässige Kompliment fallen ließ, Utopien seien zwar wünschenswert, aber leider nicht realisierbar, insofern könne man dieses Werk durchaus als gelungen bezeichnen. Ich hatte Nicolae Ceauşescu am Galgen gemalt (die Zunge hing ihm lang und rot aus dem Hals wie einer k.o. geschlagenen Comicfigur), was mir aufgrund der expliziten Gewaltdarstellung eine Fünf minus einbrachte und kurz vor dem Ende des Schuljahrs noch die Kunstnote versaute.
»Schöne Mädchen stinken nicht«, behauptete Martin Herminghaus, der in Religion und Erdkunde neben mir saß, in einer unserer großen Pausen, und weil Martin meines Wissens noch nie zuvor von Mädchen gesprochen hatte, geschweige denn von ihrem Geruch, war ich überzeugt, dass er ziemlich lange über diese Angelegenheit nachgedacht haben musste.
»Könnte sein«, sagte ich, weil ich dazu keine Meinung hatte.
»Überleg doch mal«, sagte Martin, »wirklich schöne Mädchen sind perfekt, sonst wären sie ja nicht wirklich schön. Das würde überhaupt nicht passen, wenn die stinken würden. Denn das wäre ja nicht perfekt.«
Wir grübelten eine Weile über diese These und schlürften unsere Tuffi-Vanillemilch, die man montags und mittwochs für 50 Pfennig beim Hausmeister kaufen konnte, wenn er gute Laune hatte.
»Schätze, du hast recht«, sagte ich, weil mir der Gedanke, je länger ich ihn drehte und wendete, absolut logisch vorkam.
»Wer ist die Schönste für dich?«, fragte Martin. »JW?«
»Klar, wer sonst.«
»Kann JW stinken?«
»Ich glaub nicht.«
»Stell dir vor, Klassenfahrt in der 12. Wie immer mit Reisen Reymann, gut gereist ist halb am Ziel, ohne Klimaanlage. JW ist viel zu warm angezogen und schwitzt jetzt den ganzen Tag. Sie hat ihre Adidas Monte Carlos an, dicke Tennissocken …«
»O.k.«, sagte ich und wunderte mich darüber, dass ich Martin bislang dermaßen unterschätzt hatte. Offenbar war er neuerdings auch ein Opfer der Pubertät.
»Stellst du es dir vor?«
»Ja.«
»Mach die Augen zu. Bis ich dir sage, du sollst sie wieder aufmachen.«
Ich schloss die Augen. Martins Stimme war jetzt so eindringlich und geheimnisvoll wie die eines französischen Hypnotiseurs, den ich mal bei Wetten, dass..? gesehen hatte. »Die Sonne knallt auf die Scheiben. Es riecht nach diesen ollen Stoffsitzen. Nach Käsestullen. Fleischwurst. Ahoi-Brause. Spürst du, wie verdammt warm es im Bus ist?«
»Ja.«
»JW hat fünf Stunden in dieser Hitze ausgehalten. Fünf Stunden! Nur, um sich in Konstanz irgendwelche behämmerten Pfahlbauten von so Steinzeitheinis anzugucken. Jetzt ist sie endlich wieder zu Hause. Sie schließt sich im Badezimmer ein, zieht ihre Sachen aus und steht komplett nackt vor dir.«
Ich schluckte.
»Alles klar?«
»Alles klar«, sagte ich und ärgerte mich im gleichen Moment darüber, dass meine Stimme plötzlich belegt war.
»Und?« Martin klang plötzlich hinterhältig. »Stinkt sie?«
»Nein! Niemals!«
»Wie riecht JW? Sag es mir. Und Augen zu!«
»Ja, ja … keine Ahnung, wie die riecht …«
»Stell dir ihre Muschi vor!«
»Was?!«
»Kämpf dich durch das Dickicht! Versuch, deine Nase zwischen ihre Beine zu kriegen! Und Augen zu!«
Mittlerweile konnte ich die Erregung körperlich spüren. Mir war so warm, als hätte ich selbst stundenlang in einem unklimatisierten Reisebus gesessen, und irgendwie fühlte es sich inzwischen auch so an, als sähe ich die nackte Julia Weber tatsächlich vor mir, vermutlich setzte sich das Bild allerdings aus mehreren Playboy-Postern zusammen, die ganz unten in meiner Sockenschublade lagerten. Langsam fingen meine Shorts an, im Schritt heftig zu spannen, und ich musste die Beine zusammenpressen, damit Martin nicht sehen konnte, was er mit seinem blöden Gerede angerichtet hatte.
»Bist du drin mit deiner Nase?«
Ich hörte, wie mein Atem schneller wurde.
»Hey! Bist du drin?!«
»Ja …!«
»Schnuppern!«
Ich schnupperte.
»Und?!«
»Es riecht ein bisschen … seltsam … salzig …«
»Gefällt dir das?«
»Ja.«
»Schwör es!«
»Ich schwöre!«
»Du kannst die Augen wieder aufmachen, du perverse Sau.«
Das wilde Gejohle, das augenblicklich von allen Seiten losbrach, riss mich mit Wucht aus meinem betörenden Traum, und da mich außerdem die Sonne blendete (wir saßen, wie immer, auf den gammeligen Holzbänken hinter der Aula, weil die Raucher behaupteten, ihre Camels und Luckys würden im Schatten nach nichts schmecken), brauchte ich ein paar Sekunden, um die Situation zu erfassen.
Kai, ein langhaariger Lulatsch, der regelmäßig Reggaepartys in leer stehenden Industriehallen organisierte, um dort den ganzen Abend lang Bob Marley auflegen und lauthals mitgrölen zu können, hielt mir ein offenkundig getragenes, altrosafarbenes Höschen mit weißer Spitzenbordüre direkt vors Gesicht. Die anderen acht oder neun Jungs aus meiner Klasse, die zu Martins Clique zählten, mussten sich im Laufe der Vorführung heimlich angeschlichen haben, jedenfalls bekamen einige von ihnen schon gar keine Luft mehr, so heftig waren ihre Lachflashs; alle keuchten, brüllten und jaulten ihre Begeisterung heraus, Wie geil war das denn! Alter, der Hammer! Ich scheiß mich gleich ein!, ihre milchbärtigen Gesichter liefen rot an, und der an Asthma leidende Sascha Paulsen wirkte sogar, als würde er von Krämpfen geschüttelt und müsste dringend ärztlich versorgt werden. Ich saß wie festgefroren auf meiner Bank und versuchte, nicht in Tränen auszubrechen, was mir tatsächlich irgendwie gelang.
Es dauerte mehrere Minuten, bis sich alle wieder halbwegs unter Kontrolle hatten und nur noch ab und zu ein gequältes Wimmern ertönte, weil jemand kurz davorstand, einen Rückfall zu erleiden.
»Hast deinem Namen ja alle Ehre gemacht, Hartmann«, rief Jens Schmidthals grinsend und bohrte mir seinen Zeigefinger in die Brust.
Martin wurde ausgiebig zu seinem Erfolg beglückwünscht, denn so krass, heftig und mega war ihm bislang offenbar noch niemand auf den Leim gegangen. Er tröstete mich mit dem Versprechen, dass ich beim nächsten Mal als Zuschauer dabei sein würde, genau wie alle anderen, die er vor mir drangekriegt habe, und erst als Kai verriet, dass das getragene Höschen von seiner 19-jährigen Schwester stamme (die aussah wie Kai mit Lippenstift, was nicht unbedingt von Vorteil war), wurde mir übel.
Ich verdrückte mich aufs Klo neben der Hausmeisterbude, in dem die Oberstufenschüler traditionell ihre besten Gillies (aus den Tiefen der Nase hochgezogene, dickflüssige Schleimportionen) an die Decke rotzten, sodass dort unzählige Stalaktiten aus getrocknetem Glibber zu bestaunen waren, und als ich mich über eine der historisch anmutenden Kloschüsseln beugte und mir einen Finger in den Hals steckte, hatte ich schlagartig Erfolg.
Die absonderliche Mischung aus Wut, Selbstmitleid, Scham, Magensäure und hilfloser Geilheit auf Julia Weber blieb mir ebenso lange in Erinnerung wie die überraschende Feststellung, dass Tränen deutlich salziger schmecken können als das Nudelkochwasser meiner Mutter.
Ich wusste damals noch nicht, dass frühe Niederlagen die Schlüssel zu zukünftigen Siegen sind.
Als im November 1989 die Mauer fiel und erste Stimmen vorsichtig darüber zu spekulieren begannen, dass dieser politische Prozess mit etwas Glück vielleicht sogar ein wiedervereinigtes Deutschland hervorbringen könne, schöpfte ich augenblicklich Hoffnung für meine körperliche Verfassung. Wenn der Sturz Erich Honeckers möglich war, musste auch das Ende meiner pickligen Fettleibigkeit denkbar sein. Vielleicht erwies sich der Untergang der Diktatur des Testosterons ja, genau wie der Untergang der sozialistischen Diktatur, als eine reine Frage der Zeit.
Weil es der Zufall (oder wer auch immer) so wollte, traf ich an irgendeinem Nachmittag auf dem Heimweg vom REWE-Markt in der Rückertstraße, wo ich 30 Tafeln Milka-Joghurt-Schokolade zum Sonderpreis von 89 Pfennig pro Stück erstanden hatte, Charlotte Weber, die mit feuchten Augen neben ihrem nagelneuen Santa-Cruz-Skateboard auf dem Bordstein saß und fluchte, weil sie sich bei einem missglückten Ollie den Fuß verdreht hatte. Der Knöchel oberhalb ihres rechten Airwalks sah tatsächlich geschwollen aus, zumindest war er bei genauem Hinsehen ein kleines bisschen dicker als der linke.
Sie konnte vor Schmerzen nicht auftreten, weshalb ich ihr anbot, sie nach Hause zu begleiten und ihr Board zu tragen, was sie sofort dankbar annahm. Sie legte mir unaufgefordert einen Arm um die Schulter, humpelte los, schimpfte über den Scheißtag, der ihr erst eine Fünf in Deutsch eingebracht habe für die Analyse eines beknackten Gedichts, das im Übrigen gar kein Gedicht sei, weil es sich nicht mal reime, und jetzt auch noch die Kacke mit dem Knöchel etc. Weil wir nur im Schneckentempo vorankamen und es bereits dämmerte, stellte ich sie irgendwann auf ihr Rollbrett, ließ ihren Arm, wo er war, und schob sie vorsichtig zu der mit Stuck verzierten Gründerzeitvilla, die ein perfektes Puppenhaus für sie und ihre beiden Schwestern abgab.
Während Charlotte im Bad verschwand, um den geschwollenen Knöchel zu kühlen, erschien ihre Mutter auf der Bildfläche. Ich hatte die Frau noch nie zuvor gesehen, dennoch reichte mir ein einziger Blick, um sicher zu sein, wer in dieser Familie als genetische Garantie für überbordende Schönheit gelten durfte.
»Ich bin dir unendlich dankbar!«, rief die Mutter und schloss mich erstaunlich fest in ihre Arme, »unendlich dankbar!« Sie wiederholte ihre Dankbarkeit noch ein paarmal und roch dabei intensiv nach Jil Sander Sun, sodass ich, während sie mich an sich presste, unauffällig an ihrem Hals schnüffelte.
»Keine Ursache, Frau Weber.«
»Halt! Stopp!« Sie löste sich von mir, der Duft blieb. »Ich bin die Susanne!«
Mir wurde klar, dass ich gerade die unverhoffte Chance auf einen Image-Neuanfang erhielt – zumindest, was Charlottes Eltern und die engelsgleiche JW anging (die vermutlich noch nie etwas von meiner Existenz vernommen hatte) –, also beschloss ich, so selbstbewusst, locker und humorvoll wie möglich aufzutreten, denn ich wollte meine Zugangsberechtigung zu den heiligen Hallen der Weber-Girls ungern wieder verlieren.
Als Susanne tatsächlich Anstalten machte, mir zum Dank für die Rettung ihrer jüngsten Tochter von den lebensgefährlichen Gehwegen Botnangs 30 D-Mark zu schenken (die ich natürlich ablehnte – meines Erachtens hatte ich sehr viel mehr verdient als die paar schnöden Kröten), schuf ich stattdessen die Basis für eine langfristige Beziehung und sah der Frau, so treuherzig es mir möglich war, in die Augen.
»Darf ich Sie um was bitten, Susanne?«
»Aber immer!«
»Ich gebe ab und zu Deutsch-Nachhilfe, um mein Taschengeld aufzubessern. Also falls Sie in der Nachbarschaft mal von Schülern hören, die …«
»Dann melde ich mich natürlich bei dir«, sagte Susanne und kramte hastig in einer potthässlichen pastellfarbenen Designerkommode nach Block und Stift, »fest versprochen, gib mir sofort deine Nummer!«
Zum Abschied nahm sie mich noch einmal in den Arm, wenn auch leider nur sehr kurz, dennoch schlief ich an diesem Abend in meinem Pullover. Er duftete nach einer Utopie, die sich zur Abwechslung mal als realisierbar erwiesen hatte.
Ich war fest davon ausgegangen, erst in einigen Tagen angerufen zu werden, doch das Telefon klingelte schon am nächsten Morgen. Charlotte hatte ihre völlig missratene Gedichtanalyse (Botschaft des Tauchers, Enzensberger) gebeichtet. (Sie war über die Zeilen pfeifen die schiedsrichter / schon zum letzten elfmeter irgendwie auf die Bezirksliga Württemberg gekommen und interpretatorisch in Fußballsphären abgedriftet, die Enzensberger nie im Sinn gehabt hatte.) Susanne bestimmte mich ohne Umschweife zu Charlottes neuem Nachhilfelehrer, was mir von nun an nicht nur zweimal pro Woche (Montagnachmittag und Donnerstagnachmittag) für je anderthalb Stunden freien Eintritt ins Haus der Familie Weber sicherte, sondern darüber hinaus auch noch eine überdurchschnittlich gute Bezahlung von elf Mark und fünfzig Pfennig die Stunde, die man nicht mal als Ferienjobber in der Kläranlage der Stadtentwässerung Stuttgart bekam.
3
Obwohl ich bereits davon ausgegangen war, noch vor dem Abitur an Langeweile zu sterben, fing das Gymnasium plötzlich an, mir Spaß zu machen. In den Hauptfächern ging es endlich um ernst zu nehmende Inhalte und auch die Arbeitsmethoden wurden zumindest ansatzweise wissenschaftlich, was meinen Notendurchschnitt auf ein Allzeithoch trieb. Als ich meinen Eltern an einem milden Sommernachmittag des Jahres 1989 das Abschlusszeugnis der 12. Klasse präsentierte (sie saßen gerade auf ihrer Veranda, ein idiotischer Euphemismus für zehn öde Waschbetonquadratmeter, die zu unserer Souterrainwohnung gehörten und im Mietvertrag extra berechnet wurden), blickte ich zu meiner Überraschung in zwei vor Erleichterung entgleiste Gesichter. Offenbar spukte ich schon länger als Obdachloser durch ihre Albträume, zeltete unter der Rosensteinbrücke und erhitzte mir die zusammengeschnorrte Dose Ravioli in Tomatensauce mit einem gestohlenen Campingkocher.
»Er hat ja doch Grips«, kommentierte meine Großmutter, während ich mir vorstellte, wie ihr durch ein Samuraischwert säuberlich abgetrennter Schädel vom Rumpf plumpste, die Terrassenstufen hinunterhüpfte, ein paar Meter über den Rasen kullerte und schließlich verkehrt herum vor dem alten Apfelbaum liegen blieb.
An freien Nachmittagen besuchte ich weiterhin öffentliche Verhandlungen am Landgericht oder Amtsgericht Stuttgart, die für meine Begriffe deutlich unterhaltsamer waren als das TV-Programm der öffentlich-rechtlichen Sender. (Privatfernsehen galt unserer Matriarchin als Kokolores, Tutti Frutti sogar als sittenwidrig.) An guten Tagen wurden Fälle wie der einer verarmten Rentnerin verhandelt, die ein gefrorenes Hähnchen unter ihrem Hut aus dem Edeka-Laden schmuggeln wollte, durch die zügig einsetzende Unterkühlung des Großhirns aber bereits an der Kasse in Ohnmacht fiel. Ein diebischer Sachse hingegen hatte in einer Boutique Unmengen Damenunterwäsche in seinen Regenschirm gestopft, den Schirm angesichts eines heftigen Nieselregens allerdings gleich nach Verlassen des Geschäfts gedankenverloren geöffnet, sodass zahlreiche Höschen und Büstenheber (eine absurde BH-Variante, bei der die Brüste quasi heraushängen; den entsprechenden Produktabbildungen in Peek & Cloppenburg-Prospekten verdankte ich meine ersten Impressionen von echten Nippeln) um ihn herumflatterten.
Mein Lieblingsprozess blieb lange der Fall des früheren Bäckermeisters aus Leonberg, der seine Frau mitten im Winter vom Bahnhof abholen wollte und aufgrund einer defekten Heizung dreiundzwanzig brennende Teelichter im Fußraum seines goldenen Opel Senator verteilte; man muss dazu sagen, dass seine Frau unter chronisch kalten Beinen litt, vermutlich eine Durchblutungsstörung. Auf Höhe von Schloss Solitude war die schwarz-weiß karierte Bäckerhose, die der Mann auch als Rentner Tag für Tag trug, weil er keine andere besaß, in Flammen aufgegangen, und nur das beherzte Eingreifen eines polnischen LKW-Fahrers, der zufälligerweise über einen Handfeuerlöscher verfügte, hatte Schlimmeres verhindert. Vor Gericht gab sich der Bäcker betont uneinsichtig und behauptete, im privaten Kfz machen zu können, wozu er Lust habe, schließlich zahle er für den Wagen einen Haufen Steuern, was ihm meinen uneingeschränkten Respekt sowie eine Verurteilung nach § 315c (Gefährdung des Straßenverkehrs) zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten einbrachte.
Im Großen und Ganzen waren die Prozesse für mich eine Art Lebenstheater, das mir die faszinierende Absurdität, Tristesse, Dämlichkeit, Erbärmlichkeit und Lächerlichkeit – also kurz gesagt: die Wirklichkeit – der Erwachsenenwelt schonungslos vorführte, einen exklusiven Blick hinter die Kulissen einer Zukunft gewährte, die jeden jungen Menschen erwartete, und dabei auch noch den Vorzug hatte, von realem Personal zu handeln statt von erfundenen Stellvertretern. Ich staunte regelmäßig darüber, dass diese abgründigen und deprimierenden Vorstellungen jugendfrei waren, Filme wie Der weiße Hai hingegen nicht. Ehekrisen, Finanznöte, Krankheiten, Arbeitslosigkeit, pathologische Eifersucht oder angeborene Dummheit stellten in meinen Augen jedenfalls den sehr viel größeren Horror dar als ein überdimensionaler Carcharodon aus Pappmaché.
Man könnte sagen, dass mir in dieser Zeit nicht viel fehlte, außer vielleicht das ersehnte Ende der Diktatur des Testosterons oder wahlweise eine Freundin, was meine Mutter zu meinem Erstaunen genauso sah, wie ich. Sie vertrat die offensive Auffassung, dass es mir guttäte, mit jemandem zu gehen (ein hirnrissiger Ausdruck, der eher nach Wandertag als nach Defloration klang, wie ich fand), weshalb sie sich für ihre Verhältnisse äußerst spendabel zeigte und mir im Sommer 1989 unaufgefordert das Taschengeld erhöhte.
Die Nachbarssöhne Rüdiger Sturm und Thorsten Eickelkamp, mit denen ich bereits seit der Grundschule verglichen wurde (meistens gewann Rüdiger, ab und zu Thorsten, selten ich), waren in dieser Angelegenheit, wie eigentlich in allen Angelegenheiten, schneller gewesen. Rüdiger hatte die mondgesichtige, aber dafür als 1-a-Tittenmaus anerkannte Daniela Bohne klargemacht; Thorsten war laut eigener Aussage bereits seit Monaten mit der rothaarigen Viola Hildebrandt zusammen, die sich schon als 14-Jährige den Witz vom rostigen Dach und vom feuchten Keller hatte anhören müssen, weshalb sie ihn irgendwann einfach selber machte und von diesem Moment an als besonders verrucht galt.
Da Rüdiger und Thorsten sich beide von Kopf bis Fuß in Windsurfing Chiemsee kleideten und regelmäßig mit ihren Perlen an den Händen vor unserem Küchenfenster entlangschlurften, war meine Mutter zwangsläufig zu dem Schluss gelangt, dass ich bislang unter anderem deshalb noch keine Freundin abbekommen hatte, weil ich markentechnisch nicht mithalten konnte. Ich tat ihr den Gefallen und bestellte für das Geld, das sie meinem Vater aus dem Kreuz geleiert hatte, im SportScheck-Katalog lustlos einen Chiemsee-Rucksack mit gepunkteten Kängurus, einen grauen Chiemsee-Fleece-Pullover mit überdimensionalen Plus-Minus-Aufnähern, ein Chiemsee-T-Shirt mit Jumper-Motiv, ein Chiemsee-Longsleeve mit abstoßendem barocken Neon-Muster auf polizeigrünem Grund sowie eine 450 Mark teure, in hellen Blautönen gehaltene Chiemsee-Snowboardjacke, die in meiner Klasse tatsächlich für Aufsehen sorgte, weil zwar alle das Modell kannten, es sich aber niemand leisten konnte.
Auch diese halbherzige Markenoffensive machte aus mir allerdings keinen Nachwuchscasanova, was zu erwarten gewesen war, schließlich änderte die sündhaft teure Verpackung nichts am Inhalt, und irgendwann reichte es meiner Mutter endgültig. Sie stellte mich zur Rede, als wir abends bei heftigem Regen über die zuverlässig verstopfte Heilbronner Straße fuhren, was für ihr taktisches Geschick sprach, denn eine bessere Falle hätte sie kaum wählen können.
»Läuft’s gut mit Charlotte?«
»Was?«
Meine Mutter trat auf die Bremse. Wir waren am Ende eines Staus angelangt, den sie vermutlich ebenfalls eingeplant hatte.
»Läuft’s gut? Mit Charlotte?«
»Ja, klar. Läuft.«
»Was macht ihr Vater noch mal?«
»Er füllt alle möglichen Tiere in Dosen, damit sie von ein paar anderen Tieren gegessen werden können.«
»Das muss ja auch irgendwer machen«, sagte meine Mutter, klopfte mit der rechten Hand zwei Marlboros aus einer halb leeren Schachtel, schob eine der beiden Zigaretten zurück und zündete sich die andere mit einer Schnelligkeit an, die vermutlich auch Martin Herminghaus und seine Raucherfreunde zutiefst beeindruckt hätte. »Und wie heißt das Zeug?«
»Mausis Hähnchen-Schmaus.Bellos Rinder-Schmaus. Et cetera.«
»Ich glaub, das hab ich schon mal irgendwo gesehen.«
Ich war noch nie der Meinung gewesen, dass man auf Aussagen antworten musste. Die Wagen links von uns setzten sich inzwischen wieder in Bewegung.
Meine Mutter kurbelte ihr Fenster einen Spalt herunter und blies den Rauch in die Dunkelheit. »Und was macht ihre Deutschnote?«
»Schwankt zwischen drei und vier.«
»Magst du sie denn?«
»Jeder mag Charlotte«, sagte ich und wappnete mich für die alles entscheidende Frage, doch statt mich weiter zu verhören, gab meine Mutter plötzlich Gas, zog auf die linke Spur, warf ihre Kippe aus dem Fenster, kurbelte die Scheibe wieder hoch und legte mir die rechte Hand auf den Oberschenkel. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich erstarrte sofort.
»Ich finde jedenfalls, dass du trotz … also, dass du auch mit deinen Hautproblemen immer noch ein süßer Kerl bist«, sagte meine Mutter zur Windschutzscheibe. »So schlimm sind die nämlich gar nicht. Dein Vater und ich, wir lieben dich sehr. Und wir möchten, dass du das weißt.«
Ich schämte mich augenblicklich für meine Unfähigkeit, aus diesem gut gemeinten Angebot mehr machen zu können als eine quälend lange Heimfahrt, deren Sprachlosigkeit von einem erbarmungslosen Scheibenwischerintervall in dreisekündige Brocken zerhackt wurde. Selbst ein zaghaftes Nicken misslang mir. Die Hand mit den rot lackierten Nägeln lauerte noch bis zum Herderplatz auf meinem Oberschenkel wie eine exotische fünfbeinige Spinne; am liebsten hätte ich sie weggeschlagen, aber auch dazu fehlte mir wohl die Kraft oder zumindest die finale Entschlossenheit.
Meine Mutter wollte ihren einzigen Sohn glücklich sehen, sie war vollkommen unschuldig an diesem Verlangen, das begriff ich absolut, und natürlich ging sie davon aus, dass ich unsterblich in Charlotte Weber verliebt sei, unter meiner Akne leide wie verrückt, auch darunter, plötzlich so ein plumper Kloß geworden zu sein, den selbst die teuerste Windsurfing-Chiemsee-Jacke nicht zum Stufenschwarm umdekorieren konnte. Dabei war die Wahrheit einfach nur eine abwegige, aber nicht minder legitime Variante aus dem grotesken Varieté menschlicher Bedürfnisse und Zwänge, allerdings eine Wahrheit, die man einer Mutter nicht zumuten konnte, und zwar aus dem einfachen Grund, weil sie zu der für Mütter unzumutbaren Sorte von Wahrheiten gehörte (so was gibt es und niemand kann etwas dagegen tun).
Auch wenn JW der Traum meiner schlaflosen Nächte blieb (ich hörte in meinem Jugendzimmer regelmäßig sehr laut The Arms of Orion und stellte mir vor, wie wir ein mystisch-verruchtes Leben als Liebespaar in Gotham City führten), fand ich zunehmend Gefallen an Charlotte. Tatsächlich stand meine Nachhilfeschülerin ihren Schwestern in Sachen Attraktivität nicht nur in nichts nach, sie erwies sich darüber hinaus auch noch als außerordentlich humorvoll, kein bisschen arrogant, eitel oder naiv und tatsächlich cool, was mich, wenn ich ehrlich bin, in Summe ziemlich scharf machte; außerdem beeindruckte sie mich mit ihren dreisten Sprüchen, nahm grundsätzlich kein Blatt vor den Mund und war generell ganz anders unterwegs als der Großteil ihrer Altersgenossinnen.
Ich staunte darüber, wie schnell es mir gelungen war, Charlottes vermeintliche Makel (Nase, Po) als unwiderstehliche Reize zu dechiffrieren, nachdem ich sie erst mal kennengelernt hatte; von diesem Moment an wünschte ich mir nichts sehnlicher, als ihre ausladende Papageiennase bzw. ihren prallen, aber absolut fest wirkenden Hintern mit meinen Lippen zu berühren oder, bestenfalls, sogar mein Gesicht an ihrem Arsch zu reiben.
Dass Charlotte erst 15 war, fiel nicht weiter ins Gewicht, denn es zeigte sich rasch, dass auch die jüngste der Weber-Schwestern keinerlei Interesse an mir hatte (was ich ihr nicht verübeln konnte, der Blick in den Spiegel ließ mich ja selber nicht gerade in Freudentränen ausbrechen). Sie schwärmte für amerikanische Skateboarder, Snowboarder oder Surfer, und obwohl wir uns gut verstanden und ich es regelmäßig schaffte, sie zum Lachen zu bringen, war mir vollkommen klar, dass eine minimale physische Grenzüberschreitung meinerseits das Kartenhaus unserer unschuldigen Nachhilfefreundschaft hinweggeweht hätte wie der 1976er-Tsunami die philippinischen Holzhäuser am Golf von Moro.
Ich musste der Tatsache ins Gesicht sehen, dass sie mich als einen Gedichte, Dramen und Erzählungen analysierenden Fettwanst betrachtete, der in seinem ganzen Leben noch nie an eine Muschi gedacht hatte (gut, ein bisschen naiv war sie schon); man konnte vermutlich sogar sagen, dass ich für sie schlicht kein Mann war, eher schon eine Art harmloses, trotteliges Neutrum. Nur aus diesem Grund durfte ich stundenlang in ihrem mit Guns-’N’-Roses-Postern tapezierten Zimmer hocken, sie ohne BH im Schlafanzug sehen oder ihre Pillenpackungen bzw. Tampons und Damenbinden vom Schreibtisch räumen, um dort meine Rilke-Kopien auszubreiten. (Das einzige, was sie an mir interessant fand, war, dass ich hieß wie einer von den Drei ???.)
Ich fühlte mich, als sei ich ein fröhlicher junger Mops-Rüde, mit dem man gefahrlos auf dem Bett herumtollen konnte (nur, dass wir das leider nie taten), hatte aber keinerlei Zweifel daran, dass ebendieser junge Rüde achtkantig aus dem Paradies vertrieben werden würde, sobald auch nur ein einziges Mal sein knallroter Hundepenis zum Vorschein käme.
Da in absehbarer Zeit kein amerikanischer Skateboarder, Snowboarder oder Surfer aus mir werden würde (tatsächlich hatte ich mich einmal telefonisch beim US-Generalkonsulat in München danach erkundigt, ob es möglich sei, die Staatsbürgerschaft zu wechseln – war es nicht), schminkte ich mir die vage Hoffnung auf Heavy-Petting mit Charlotte notgedrungen ab. Natürlich lief ich auch Lilian und JW auf den mit dicken Teppichen belegten Treppen und Fluren der Villa Weber regelmäßig über den Weg, es gelang mir jedoch nicht, aus dieser exklusiven Situation, von der sämtliche männliche Schüler des Ludi nur träumen konnten, was sie vermutlich auch taten, irgendein erotisches Kapital zu schlagen.
Lilian beschränkte sich darauf, mich betont nüchtern zu grüßen (sie nahm mir den gehässigen Kommentar zu ihrer Utopie in Aquarell offenbar immer noch übel), und wenn ich sie in ein Gespräch über den banalen Stufentratsch verwickeln wollte, den sogar ich mitbekam, dann dauerten unsere bemühten Dialoge meist keine Minute.
Marc-René Pelzer, der jeden zweiten Tag bei Lilian übernachtete, tätschelte mir, wenn wir uns begegneten, mitleidig den Rücken, so als würde er einen untalentierten Balljungen trösten, der gerade über seine losen Schnürsenkel gestolpert und mit dem Gesicht in einem Kilo dampfender Bernhardinerscheiße gelandet war. Er schien in mir eine Art bezahlten Verehrer zu sehen, den Charlottes Eltern engagiert hatten, um ihr Nesthäkchen zaghaft auf die Existenz einer männlich dominierten Welt vorzubereiten, denn ab und zu flüsterte er mir im Vorbeigehen Dinge wie Die kleine Drecksau kriegst du noch rum, Long Dong! oder Heute schon kräftig einen weggesteckt, mein langschwänziger Elch? ins Ohr. Ich wusste nicht, ob er mich verarschen, irritieren oder ermutigen wollte bzw. ob ich mir diese Bemerkungen nur einbildete oder ob er sie tatsächlich machte (ich schätze Letzteres).
JW selbst schwebte wortlos an mir vorbei, als sei ich ein ramponiertes Möbelstück, das man besser nicht berührt, weil man daran hängen bleiben und sich das Oilily-Kleid oder die Elbeo-Strumpfhose aufreißen könnte. Ich wäre tatsächlich nicht besonders verwundert gewesen, wenn sie mich eines Tages eigenhändig aus dem Haus gezerrt und am Straßenrand abgestellt hätte, pünktlich zum Sperrmüll.
Das Einzige, was ich von ihr zu hören bekam, war der Klang ihrer Querflöte. Sie musizierte wie verrückt, häufig mit ihrer besten Freundin, die JW mehrmals pro Woche am Klavier begleitete, und was die beiden jungen Musikantinnen (Susanne) gemeinsam ablieferten, konnte man durchaus bühnenreif nennen. Die Pianistin hieß Elena, ging mit JW in die 12. Klasse und war eine hochgeschossene, sehr behaarte Tochter griechischer Einwanderer, weshalb sie ab und zu Lieder von Mikis Theodorakis spielte und auf diese Weise die mit Abstand fröhlichsten bzw. menschlichsten Momente in der Weber-Villa schuf, wie ich rückblickend feststellte.
Es konnte geschehen, dass Susanne, wenn auf dem Flügel die Klänge des Zorbas-Sirtaki erklangen, aus der Küche gelaufen kam, sich bei ihrer ältesten Tochter einhakte, mit ihr wie wild durchs Wohnzimmer galoppierte und schließlich zu der immer schneller werdenden Musik albern herumhampelte. Auch Lilian und Charlotte mussten mitmachen, ob sie wollten oder nicht, sodass schließlich ein vor Vergnügen kreischendes Quartett einen Cancan tanzte, was natürlich überhaupt nicht zu dem Sirtaki passte, den Elena fehlerlos und mit abenteuerlichem Tempo in die Tasten hämmerte. Am Ende lagen sich alle lachend in den Armen, hielten sich aneinander fest und schienen so etwas wie Freundinnen fürs Leben