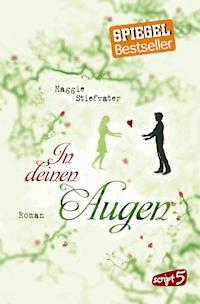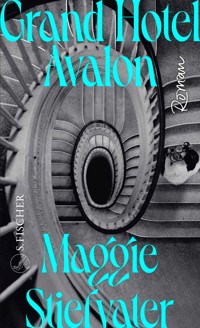12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Dreamer-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Die Träumer wandeln unter uns – und die Geträumten auch … »Wie der Falke fliegt« ist der 1. Teil der neuesten Urban-Fantasy-Reihe von Bestseller-Autorin Maggie Stiefvater – und entführt erneut in die geheimnisvolle Welt der Raven-Boys-Reihe. Ronan Lynch ist ein sogenannter Träumer. Er kann sowohl Wunderbares als auch Entsetzliches aus seinen Träumen in die fragile reale Welt holen. Jordan Hennessy ist eine Diebin. Je näher sie dem Traum-Objekt kommt, hinter dem sie her ist, desto untrennbarer ist sie mit ihm verbunden. Carmen Farooq-Lane ist eine Jägerin, die Träumer jagt. Denn ihr Bruder war ein Träumer – und ein Mörder. Carmen hat gesehen, was Träume einem Menschen antun können. Und sie hat den Schrecken gesehen, den die Träumer verursachen können. Doch das war nichts im Vergleich zu der Zerstörung, die bald entfesselt werden wird … Albträume, die zum Leben erwachen, erbarmungslose Jäger und eine unwahrscheinliche Liebe: Wie schon in ihrer Urban-Fantasy-Reihe »Raven Boys« verwebt Maggie Stiefvater auf unnachahmliche Weise übernatürliche Elemente mit unserer realen Welt zu einem geheimnisvoll-fesselnden Fantasy-Roman. »Wie der Falke fliegt« setzt die Geschichte um die »Raven Boys« fort, kann aber auch unabhängig von der Reihe gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 613
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Maggie Stiefvater
Wie der Falke fliegt
Aus dem amerikanischen Englisch von Jessika Komina und Sandra Knuffinke
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ronan Lynch ist ein sogenannter Träumer. Er kann sowohl Wunderbares als auch Entsetzliches aus seinen Träumen in die fragile reale Welt holen.
Jordan Hennessy ist eine Diebin. Je näher sie dem Traumobjekt kommt, hinter dem sie her ist, desto untrennbarer ist sie mit ihm verbunden.
Carmen Farooq-Lane ist eine Jägerin, die Träumer jagt. Denn ihr Bruder war ein Träumer – und ein Mörder. Carmen hat gesehen, was Träume einem Menschen antun können. Und sie hat den Schrecken gesehen, den die Träumer verursachen können. Doch das war nichts im Vergleich zu der Zerstörung, die bald entfesselt werden wird …
Inhaltsübersicht
Widmung
Zitat
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
Danksagung
Den Zauberern gewidmet, die mich aus meinem tausendjährigen Schlaf geweckt haben
Ich will weder Käfig noch Haube,
Ich will nicht den Arm, nicht das Eisen,
Jetzt, wo ich gelernt habe, kühn
Über dem Wind und dem Staube,
Im wallenden Nebel zu kreisen,
Durch taumelnde Wolke zu ziehen.
William Butler Yeats, Der Falke
Wenn es gefährlich ist, ein bisschen zu träumen, dann ist das Heilmittel dagegen nicht, weniger zu träumen, sondern mehr, ja die ganze Zeit zu träumen.
Marcel Proust, Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, Band II
Sind Sie sicher, dass ein Fußboden nicht auch eine Zimmerdecke sein kann?
M. C. Escher, Über das Leben als Grafikkünstler
Prolog
Das hier wird eine Geschichte über die Lynch-Brüder.
Sie waren drei an der Zahl, und wenn du einen von ihnen nicht mochtest, versuchtest du es am besten mit einem der anderen, denn vielleicht traf ja derjenige, der den meisten zu süß oder zu sauer war, genau deinen Geschmack. Die Lynch-Brüder, die Lynch-Waisen, sie alle waren auf gewisse Art Traumtypen. Und zwar nicht nur, weil sie verdammt gut aussahen.
Sie sorgten für sich selbst. Ihre Mutter, Aurora, war den Tod so vieler schöner Träume gestorben, grausam, unschuldig, plötzlich. Ihr Vater, Niall, war getötet worden, oder ermordet, je nachdem, als wie menschlich man ihn betrachten wollte. Ob es noch weitere Lynchs gab? Unwahrscheinlich. Dazu war diese Familie einfach zu gut im Sterben.
Träume sind nicht das beste Fundament für ein sicheres Leben.
Und da die Gefahr eine stetige Begleiterin der Lynch-Brüder war, hatte jeder von ihnen mit der Zeit seine eigene Strategie entwickelt, damit umzugehen. Declan, der Älteste, rollte der Sicherheit den roten Teppich aus, indem er so langweilig wie nur möglich war. Darin war er unschlagbar, ein wahres Naturtalent. Er entschied sich einfach stets – ob in der Schule, in der Freizeit oder bei der Partnerwahl – für die ödeste aller verfügbaren Optionen. Mancher Langweiler ließ immerhin erahnen, dass sich tief in ihm ein interessanter, vielseitiger Mensch verbarg. Declans bewusst praktiziertes Langweilertum dagegen ließ keinen Zweifel daran, dass sich tief in ihm ein nur noch größerer Langweiler verbarg. Unsichtbar war Declan allerdings nicht, denn unsichtbar zu sein hatte schon wieder etwas viel zu Aufregendes, Geheimnisvolles an sich. Er war schlicht und ergreifend uninteressant. Er war ein Collegestudent, ein angehender Politiker, ein junger Mann von einundzwanzig Jahren, der noch sein ganzes Leben vor sich hatte. Aber manchmal fiel es schwer, sich all das vor Augen zu rufen. Manchmal fiel es schwer, sich Declan vor Augen zu rufen.
Matthew, der Jüngste, hüllte sich in Sicherheit, indem er so liebenswürdig wie möglich war. Er war höflich, sanftmütig, nachgiebig. Er konnte sich für alles Mögliche begeistern, und das niemals auf ironische Weise. Er lachte über Wortspiele. Er fluchte wie ein Engel und sah sogar aus wie einer: Vom goldgelockten Kind war er zu einem goldgelockten siebzehnjährigen Adonis herangewachsen. All diese zuckersüße, reizvoll zerstrubbelte schiere Lieblichkeit wäre womöglich unerträglich gewesen, wenn Matthew Lynch sich nicht zusätzlich bei jeder Mahlzeit von oben bis unten vollgekleckert hätte, ein stinkfauler Schüler und zudem nicht übermäßig intelligent gewesen wäre. So aber wollte man ihn einfach in den Arm nehmen und knuddeln. Und Matthew war das nur recht.
Ronan, der Mittlere, kämpfte für seine Sicherheit, indem er sich so Furcht einflößend wie möglich gab. Wie alle Lynch-Brüder ging er regelmäßig in die Kirche, obwohl die meisten dort überzeugt waren, dass er längst auf die dunkle Seite gewechselt hatte. Er trug nichts als Schwarz und hielt sich einen Raben als Haustier. Er rasierte sich den Schädel und über seinen Rücken rankte sich ein mit Dornen und Klauen bewehrtes Tattoo. Er ging mit essigsaurer Miene durchs Leben und war schweigsam. Und wenn er doch mal die Rede an seine Umwelt richtete, entpuppten seine Worte sich allzu oft als Messerklingen, die einem scharf und schimmernd und schmerzhaft unter die Haut drangen. Er hatte blaue Augen. Blaue Augen gelten ja im Allgemeinen als schön, aber seine konnte man nicht so bezeichnen. Seine waren nicht kornblumen-, himmel-, baby-, indigo- oder azurblau. Seine waren gletscher-, sturm-, kältetodblau. Alles an ihm schien ihn als Typen zu klassifizieren, der dir die Brieftasche klauen oder dein Baby fallen lassen würde. Er war stolz auf seinen Familiennamen und machte ihm alle Ehre. Selbst sein Mund war stets so geformt, als hätte er ihn gerade eben noch ausgesprochen.
Die Lynch-Brüder hüteten eine Menge Geheimnisse.
Declan war ein Sammler klangvoller, eigentümlicher Phrasen, die er niemals in der Öffentlichkeit benutzen würde, und besaß ein strahlendes, ebenso eigentümliches Lächeln, das niemand je zu sehen bekam.
Matthew hatte eine gefälschte Geburtsurkunde und keine Fingerabdrücke. Manchmal, wenn er seinen Gedanken nachhing, spazierte er unbewusst schnurgeradeaus. Auf etwas zu? Von etwas weg? Dieses Geheimnis hütete er sogar vor sich selbst.
Das gefährlichste aller Geheimnisse aber war Ronan. Wie so viele Geheimnisse war auch dieses innerhalb der Familie weitergegeben worden – in diesem Fall vom Vater zum Sohn. Das Gute an Ronan Lynch: Manchmal, wenn er einschlief und träumte, wurde sein Traum Wirklichkeit. Das Schlechte an Ronan Lynch: Manchmal, wenn er einschlief und träumte, wurde sein Traum Wirklichkeit. Monster und Maschinen, Stürme und Sehnsucht, Wald und Wahnsinn.
Träume sind nicht das beste Fundament für ein sicheres Leben.
Seit dem Tod ihrer Eltern versuchten die Lynch-Brüder, sich unauffällig zu verhalten. Declan hielt sich das ganze Traumthema so weit wie möglich vom Leib und war ans College gegangen, um das ödeste Fach der Welt zu studieren. Politikwissenschaft. Ronan beschränkte seine Albtraumspiele so gut er konnte auf die Farm seiner Familie im ländlichen Virginia. Und Matthew – tja, Matthew musste eigentlich nur darauf achten, dass er nicht aus Versehen davonspazierte.
Declan wurde langweiliger; Ronan langweilte sich. Matthew versuchte, sich von seinen Füßen nicht an Orte tragen zu lassen, die er nicht verstand.
Aber alle wollten sie mehr.
Es war nur eine Frage der Zeit, bis der Erste von ihnen kapitulierte. Niall war ein hitzköpfiger Träumer aus Belfast gewesen, getrieben von einem inneren Feuer, Aurora eine goldene Traumgestalt, in deren Augen sich der grenzenlose Himmel spiegelte. Den Söhnen der beiden war das Chaos vorherbestimmt.
Es war ein stürmischer Oktober, ein ungebärdiger Oktober, eine dieser rastlosen Zeiten, die einem bis in die Knochen drangen und von innen heraus Unruhe stifteten. Zwei Monate zuvor hatte das Semester begonnen. Die Bäume waren ausgezehrt und grantig. Das trockene Laub gab sich schreckhaft. Abends heulte der Winter durch Ritzen und Spalten, bis die angeheizten Kamine ihn für ein paar weitere Stunden nach draußen verbannten.
In diesem Oktober jedoch war etwas erwacht. Etwas, das sich stöhnend reckte und streckte, auch wenn niemand es bislang zu Gesicht bekommen hatte. Später sollte es einen Namen erhalten, aber fürs Erste begnügte es sich damit, die dem Übersinnlichen zugeneigten Wesen dieser Welt aufzustören. Wie die Lynch-Brüder.
Declan kapitulierte als Erster.
Während der jüngste Bruder in der Schule saß und der mittlere Bruder sich auf der Farm verschanzte, öffnete Declan eine Schublade in seinem Schlafzimmer und nahm einen Zettel heraus. Allein beim Anblick der Telefonnummer darauf schlug sein Herz schneller. Er hätte sie vernichten sollen; stattdessen tippte er sie nun in sein Handy ein.
»Lynch?«, fragte die Stimme am anderen Ende der Leitung.
»Ja«, antwortete Declan knapp. »Ich brauche den Schlüssel.« Dann legte er auf.
Er erzählte niemandem von dem Anruf, nicht mal seinen Brüdern. Was machte schon ein Geheimnis mehr oder weniger aus, wenn das Leben ohnehin voll davon war?
Langeweile und Geheimnisse: eine hochentzündliche Mischung.
Und bald würde etwas brennen.
1
Kreaturen jeglicher Art schliefen ein.
Am dramatischsten traf es die Katze; ein schönes Tier, wenn man Katzen mochte, mit einem zarten Gesicht und langem Fell, fluffig wie Zuckerwatte. Sie war eine Schildpattkatze, was bedeutete, dass es sich mit ziemlicher Sicherheit um ein Weibchen handelte, denn die charakteristische Dreifarbigkeit setzte für gewöhnlich zwei X-Chromosomen voraus. Möglicherweise war diese Regel jedoch nicht von Relevanz hier draußen in Kerry, in diesem beschaulichen Häuschen, von dem so gut wie niemand wusste. Hier walteten andere Kräfte als bloß die der Natur. Vielleicht war die Schildpattkatze nicht mal eine Katze. Sie war katzenförmig, aber das galt schließlich auch für so manche Geburtstagstorte.
Sie hatte mit angesehen, wie er getötet worden war.
Sein Name war Caomhán Browne gewesen. War es noch immer. Wie ein gutes Paar Stiefel hielten Namen sich oft länger als ihre Besitzer. Man hatte sie gewarnt, er könne gefährlich sein, und tatsächlich hatte er ihnen alles entgegengeschleudert, was ihm in die Hände fiel, nur nicht das, was sie fürchteten. Ein Beistelltischchen. Einen drallen kleinen Fernsehsessel mit verblichenem Blümchenmuster. Einen Stapel Designmagazine. Einen Flachbildschirmfernseher von bescheidener Größe. Er war sogar mit dem Kruzifix von der Flurwand auf Ramsay losgegangen, was Ramsay in erster Linie amüsant gefunden hatte. Heiliger Bimbam, war sein einziger Kommentar gewesen.
Eine der Frauen trug edle Lammleder-Stilettoboots, die eine nicht unwesentliche Menge Blut abbekommen hatten. Einer der Männer neigte zu Migräne und spürte, wie die Traummagie erste Anzeichen einer Aura an den Rändern seines Blickfelds aufflimmern ließ.
Am Ende hatten Lock, Ramsay, Nikolenko und Farooq-Lane sowohl Browne als auch die Katze in der urigen Küche des irischen Feriencottages in die Ecke gedrängt, weshalb Browne zu seiner Verteidigung nichts als ein dekorativ an die Wand genagelter Reisigbesen und die Katze blieben. Der Besen war zu nichts zu gebrauchen, nicht mal zum Fegen, die Katze schon eher, wenn man sie geschickt warf. Allerdings waren nur die wenigsten Menschen geschickte Katzenwerfer und Browne gehörte nicht dazu. Der Moment, in dem ihm das dämmerte, war deutlich zu erkennen.
»Bitte tun Sie den Bäumen nichts«, sagte er.
Sie schossen. Mehrmals. Munition war billig, ein Schnitzer dagegen konnte einen teuer zu stehen kommen.
Die Schildpattkatze konnte von Glück reden, dass sie mit dem Leben davonkam, denn sie hockte direkt hinter Browne. Und die Durchschlagkraft von Pistolenkugeln ist schließlich allgemein bekannt. Doch alles, was das Tier traf, war Blut. Es stieß einen gespenstischen Zornesschrei aus. Plusterte seinen Schwanz zur Flaschenbürste auf und anschließend den Rest seines Zuckerwattefells. Und dann warf es sich auf die Angreifer, denn ob man es glaubt oder nicht, die Schnittmenge zwischen wurfbereiten Katzen und Menschen beläuft sich auf einhundert Prozent.
Für den Bruchteil einer Sekunde schien alles darauf hinzudeuten, dass eine der anwesenden Personen in Kürze eine Katze am Leib tragen würde.
In dem Moment jedoch ging ein letzter Schauder durch Browne und er regte sich nicht mehr.
Die Katze fiel zu Boden.
Ihr Körper klatschte mit einem unverwechselbaren Laut auf die Holzdielen: das charakteristische, vielschichtige Fllompp eines leblosen Knochensacks, wie es sich mit keinen Mitteln der Welt reproduzieren lässt. Genau dieses Geräusch machte die Katze und blieb ebenfalls liegen. Anders als in Brownes Fall jedoch hob und senkte, hob und senkte, hob und senkte sich weiter ihre Brust.
Sie war so unerklärlicher- wie unnatürlicherweise eingeschlafen.
»Was für ’n kranker Scheiß«, merkte Ramsay an.
Durch ein Fenster über der kleinen weißen Spüle hatte man Blick auf eine sattgrüne Weide mit drei zotteligen Ponys, die im aufgewühlten Matsch am Tor standen. Sie waren halb auf die Knie gesunken, gegeneinandergekippt wie Saufkumpane nach einer durchzechten Nacht. Zwei Ziegen brachten noch ein fragendes Meckern heraus, ehe sie dasselbe Schicksal ereilte. Auch Hühner waren zu sehen, die, längst eingeschlummert, als bunte Häufchen das Grün der Weide sprenkelten.
Caomhán Browne war etwas, was die Regulatoren als Zed bezeichneten. Folgendes machte einen Zed aus: Manchmal, wenn er aus dem Schlaf erwachte, hielt er etwas in den Händen, wovon er geträumt hatte. Daher war die Katze, wie schon vermutet, gar keine Katze. Sondern bloß ein katzenförmiges Objekt, das Brownes Bewusstsein generiert hatte. Und wie alles Lebendige, was Browne herbeigeträumt hatte, konnte auch sie nicht fortbestehen, wenn er tot war.
»Wir sollten uns die Uhrzeit notieren, für alle Fälle«, sagte Nikolenko.
Alle wandten sich wieder ihrer Beute zu, oder ihrem Opfer, je nachdem, als wie menschlich man Browne betrachten wollte. Farooq-Lane warf einen Blick auf ihr Handy und tippte eine Nachricht.
Dann machten sie sich auf die Suche nach dem anderen Zed.
Dunkle Wolken überzogen den Himmel und tauchten die Hügelkuppen ringsum in Schatten. Die kleine Farm war von einem Wäldchen umschlossen. Hübsche, moosbewachsene Bäume, doch das Vibrieren der Luft war hier sogar noch spürbarer als zuvor in der Hütte. Das Problem war nicht, dass ihnen in dieser Atmosphäre das Atmen schwerfiel. Sondern das Denken. Oder vielmehr: nicht zu viel zu denken. Langsam wurden sie alle ein bisschen nervös; hier draußen wirkte die Bedrohung so viel greifbarer.
Der andere Zed versuchte nicht mal, sich zu verstecken. Lock fand ihn mit verstörend leerem Blick auf einem Baumstumpf hockend.
»Ihr habt ihn umgebracht, oder?«, fragte der Zed. »Ach, du«, fügte er dann hinzu, als Farooq-Lane neben Lock trat.
Irgendein kompliziert-vertrauter Austausch vollzog sich zwischen dem Zed und Farooq-Lane.
»Es muss nicht so enden«, sagte Farooq-Lane. Sie erschauderte. Aber nicht vor Kälte. Nicht vor Angst. Das hier war einfach einer von diesen Momenten verheerender Unausweichlichkeit. »Du musst bloß mit dem Träumen aufhören.«
Lock ließ ein Räuspern vernehmen, wie um einzuwenden, dass die Sache so simpel nun leider auch nicht sei, sagte aber nichts.
»Ach ja?« Der Zed spähte hoch zu Farooq-Lane. Seine gesamte Aufmerksamkeit war auf sie gerichtet, als wären die anderen gar nicht da. Was wohl nur fair war, schließlich war ihre gesamte Aufmerksamkeit auch auf ihn gerichtet. »Dann sterbe ich genauso. Von dir hätte ich mehr Einsicht erwartet, Carmen.«
Lock hob seine Pistole. Er sprach es nicht aus, aber dieser verdammte Zed jagte ihm eine Scheißangst ein, und zwar unabhängig von dem, was er getan hatte. »Dann haben Sie Ihre Wahl getroffen.«
Ramsay hatte unterdessen seine Benzinkanister aus dem Kofferraum des Mietwagens geholt. Darauf hatte er sich schon den ganzen Tag gefreut. Kraftstoff. Dann wollen wir mal kräftig Stoff geben, dachte er, grinsend über seinen lahmen Witz. Jetzt verströmte das Wäldchen einen krebserregend süßlichen Benzingeruch und Ramsay versetzte dem letzten Kanister einen Tritt Richtung Cottage. Möglicherweise gehörte er zu den Katzenwerfern unter den Menschen.
»Wir müssen die Straße im Auge behalten, während es brennt«, sagte Lock. »Na los, bringen wir’s hinter uns.«
Der Zed musterte sie matt interessiert. »Leute, warum ich, ist mir ja klar. Aber Browne? Der war doch noch ein Welpe. Wovor habt ihr eigentlich Angst?«
»Jemand kommt«, sagte Lock. »Jemand kommt, um der Welt ein Ende zu setzen.«
Hier draußen, in diesem summenden Wald, klangen Dinge wie »der Welt ein Ende setzen« nicht nur realistisch, sondern sogar äußerst wahrscheinlich.
Ein Galgenlächeln verzerrte das Gesicht des Zeds. »Ich dachte, das wärt ihr.«
Lock schoss. Mehrmals. Es war ziemlich eindeutig, dass die erste Kugel ihren Zweck erfüllt hatte, aber Lock machte so lange weiter, bis die Scheißangst nachließ. Während die Schüsse durch das Tal hallten, plumpste irgendwo tiefer im Wald etwas mit demselben Geräusch zu Boden wie zuvor in der Küche die Katze. Nur schwerer. Alle waren froh, dass dieser Traum eingeschlafen war, bevor sie ihm begegnen konnten.
Nachdem wieder Stille eingekehrt war, wandten sich sämtliche Überlebende Carmen Farooq-Lane zu.
Ihre Augen waren fest zugekniffen, ihr Gesicht zur Seite gedreht, als wäre sie selbst auf eine Kugel gefasst gewesen. Ihre Lippen bebten, aber sie weinte nicht. Allerdings wirkte sie plötzlich jünger. Normalerweise präsentierte sie sich so glatt und businessmäßig – Leinenanzüge, Haarknoten –, dass ihr Alter schwer zu schätzen war. Man sah nichts als die beherrschte, erfolgreiche Geschäftsfrau. Dieser Moment jedoch ließ ihre Fassade einstürzen und entlarvte sie als die Frau Mitte zwanzig, die sie war. Es war keine schöne Erkenntnis. Man hatte das Bedürfnis, ihr schleunigst eine warme Decke umzulegen, um ihr ihre Würde zurückzugeben. Wenigstens konnte nun niemand mehr ihre Loyalität infrage stellen; sie steckte genauso tief drin wie sie alle und hatte die Sache eisern durchgezogen.
Lock legte ihr väterlich die Hand auf die Schulter. »Beschissene Situation«, brummte er mit seiner tiefen Stimme.
Schwer zu sagen, ob Farooq-Lane sich dadurch getröstet fühlte.
Dann wandte Lock sich an die anderen. »Sehen wir zu, dass wir hier fertig werden.«
Ramsay entzündete ein Streichholz. Damit steckte er zuerst eine Zigarette für Nikolenko und dann eine für sich an. Erst danach, kurz bevor die Flamme ihm die Finger versengte, schnippte er das Hölzchen ins benzingetränkte Gestrüpp.
Der Wald begann zu brennen.
Farooq-Lane wandte sich ab.
Ramsay blies eine Wolke Zigarettenrauch in Richtung des toten Zeds und fragte: »Und, haben wir jetzt die Welt gerettet?«
Lock gab den Zeitpunkt von Nathan Farooq-Lanes Tod in sein Handy ein. »Wird sich zeigen.«
2
Ronan Lynch war im Begriff, der Welt ein Ende zu setzen.
Zumindest seiner eigenen. Er würde ihr ein Ende setzen und dabei eine neue erschaffen. Ein Ronan Lynch würde sich auf diese Reise begeben, aber am Ziel eintreffen würde ein anderer.
»Kommen wir zum springenden Punkt«, sagte Declan. Ein Klassiker unter den declanschen Gesprächsaufhängern. Weitere Greatest Hits waren: Wir sollten uns mal zusammensetzen wegen …, Packen wir das Problem bei der Wurzel … und Im Interesse aller Beteiligten schlage ich vor … »Ich hätte gar nichts dagegen, dich mein Auto fahren zu lassen, wenn du mal unter hundertzwanzig bleiben würdest.«
»Und ich hätte gar nichts dagegen, bei dir mitzufahren, wenn du mal nicht schleichen würdest wie ein Hundertzwanzigjähriger«, entgegnete Ronan.
Der Oktober erstrahlte in voller Pracht; die Bäume knallbunt, der Himmel wolkenlos, in der Luft ein Prickeln. Die drei Brüder führten ihre Diskussion mitten auf dem Parkplatz eines Ein-Dollar-Ladens, und sämtliche Kunden, die kamen und gingen, starrten sie an. Tatsächlich bildeten sie ein auffallend seltsam zusammengewürfeltes Trio: Ronan mit den bedrohlichen Springerstiefeln und dem bedrohlichen Gesichtsausdruck, Declan mit den perfekt gebändigten Locken und dem dienstbeflissenen grauen Anzug, Matthew mit der himmelschreiend hässlichen Karohose und der leuchtend blauen Daunenjacke.
»Es gibt Flecken, die breiten sich schneller aus, als du Auto fährst. Mit dir am Steuer brauchen wir vierzehn Jahre, bis wir da sind. Siebzehn. Vierzig. Hundert. Mit Glück schaffen wir’s noch rechtzeitig zu deiner Beerdigung.«
Die Lynch-Brüder unternahmen ihren ersten gemeinsamen Ausflug seit dem Tod ihrer Eltern. Sie waren gerade eine Viertelstunde unterwegs gewesen, als Declan einen Anruf erhalten hatte, den er nicht im Auto annehmen wollte. Und nun verzögerte sich durch die Fahrerdebatte alles noch mehr. Bis jetzt hatte Ronan hinter dem Lenkrad gesessen, und die Meinungen darüber, ob ihm dieses Privileg weiterhin gewährt werden sollte, gingen auseinander. Die Fakten: Es war Declans Auto, Ronans Reise, Matthews Freizeit. Declan hatte einen Brief von seiner Versicherung bekommen, die ihm aufgrund seines vorbildlichen Fahrverhaltens bessere Konditionen angeboten hatte. Ronan hatte einen Brief vom Amt bekommen, in dem ihm nahegelegt wurde, sein Fahrverhalten zu ändern, wenn er seinen Führerschein behalten wollte. Matthew wiederum stand dem ganzen Thema leidenschaftslos gegenüber und meinte, wenn er jemals nicht genügend Freunde haben sollte, die ihn durch die Gegend kutschierten, dann wüsste er, dass irgendwas in seinem Leben falschlief. Davon abgesehen war er dreimal durch die Fahrprüfung gefallen.
»Am Ende liegt die Entscheidung sowieso bei mir«, konstatierte Declan, »weil es nun mal mein Auto ist.«
Er fügte nicht hinzu und ich außerdem der Älteste bin, aber es schwang dennoch mit. Das hatte in der Vergangenheit schon zu Streitereien epischen Ausmaßes zwischen den Brüdern geführt. Da war es ein bedeutender Fortschritt, dass diesmal niemand darauf zu sprechen kam.
»Ha«, höhnte Ronan. »Sonst will die Karre ja auch keiner haben.«
»Immerhin ist diese Karre sicher«, murmelte Declan, ohne von seinem Handy aufzusehen. Die Minuten verrannen, während er irgendeine Nachricht oder E-Mail beantwortete, so, wie er es immer tat: indem er ausschließlich mit dem linken Daumen und dem rechten Zeigefinger tippte.
Ronan versetzte einem der Volvo-Reifen einen Tritt. Er wollte endlich los. Er musste endlich los.
»Wir wechseln uns alle zwei Stunden ab«, bestimmte Declan schließlich auf seine nichtssagende Art. »Das wäre nur fair, oder? Du bist zufrieden. Ich bin zufrieden. Alle sind zufrieden.«
Falsch. Zufrieden war nur Matthew, weil das bei ihm eben der Dauerzustand war. Und tatsächlich wirkte er mal wieder so glücklich und froh wie der sprichwörtliche Mops im Haferstroh, als er es sich kurz darauf mit seinen Kopfhörern auf der Rückbank bequem machte. »Ich brauch auf jeden Fall noch Knabberkram«, verkündete er.
Declan überreichte Ronan den Schlüssel. »Wenn sie dich rauswinken, bist du zum letzten Mal mein Auto gefahren.«
Dann brachen sie auf, diesmal richtig, und Washington, D.C., schrumpfte hinter ihnen im Rückspiegel.
Ronan konnte noch immer nicht ganz fassen, dass Declan sich überhaupt zu diesem Unterfangen bereit erklärt hatte. Einen solchen Aufwand zu betreiben, nur damit Ronan drei Mietwohnungen in einem anderen Bundesstaat besichtigen konnte, musste für Declan doch eindeutig in die Kategorie »kompletter Unsinn« fallen. Ronan, mit seinen gefährlichen Träumen, sollte woanders schlafen als in den Schobern oder bei Declan in der Stadt? Wohl kaum. Woanders wohnen als in den Schobern oder bei Declan in der Stadt? Nie im Leben.
Ronan wusste nicht, warum Declan bei dieser Aktion mitspielte. Er wusste nur, dass er eine achtstündige Autofahrt davon entfernt war, herauszufinden, ob für ihn ein neues Leben beginnen würde. Abgesehen von einer besonders leidvollen Phase kurz nach dem Tod ihres Vaters, Niall, hatte er nie irgendwo anders gewohnt als auf der Farm seiner Familie, auch »die Schober« genannt. Er liebte die Schober, hatte die Nase voll von den Schobern, wollte weg, wollte bleiben. In den Schobern wusste Ronan seine Kindheitserinnerungen in greifbarer Nähe und seine beiden Brüder in sicherer Entfernung. Hier konnte er sich seinen Träumen hingeben, sie unbesorgt um sich scharen. Hier wusste er, wer er war.
Wer würde Ronan Lynch in Cambridge, Massachusetts, sein?
Er hatte keine Ahnung.
In Maryland machten sie einen Fahrerwechsel und kauften an einer Tankstelle Knabberkram für Matthew. Den dieser sich, wieder auf dem Rücksitz, auch direkt mit hörbarem Vergnügen einverleibte. Während Declan auf die Interstate auffuhr, ermahnte er Matthew, beim Kauen den Mund zuzumachen; vergeblich, wie schon so oft in den vergangenen siebzehn Jahren.
»Am besten gibt man ihm nur noch weiche Sachen zu essen«, empfahl Ronan. »Irgendwelches Gummizeugs. Das macht am wenigsten Lärm.«
Matthew lachte. Das Einzige, was er noch lustiger fand als Witze über Declan, waren Witze über ihn selbst.
Nachdem sie wieder ein paar Minuten unterwegs waren, erkundigte Declan sich gedämpft bei Ronan: »Wie lange ist es her, dass du zum letzten Mal was geträumt hast?«
Matthew, der Kopfhörer trug und außerdem voll und ganz in irgendein Handyspiel vertieft war, bekam nichts mit, und selbst wenn, hätte es keinen Unterschied gemacht. Ronan hielt seine Träume nicht vor ihm geheim. Aber Declan machte nun mal aus allem gern ein Geheimnis.
»Nicht so lange.«
»Wie lange?«
»Keine Ahnung, lass mich kurz ’nen Blick in meinen Traumkalender werfen, da steht bestimmt ganz genau drin, wie lange ›nicht lange‹ ist.« Ronan schüttete sich den gesamten Rest einer Tüte Schokoerdnüsse in den Mund in der Hoffnung, dass das Gespräch damit beendet war. Er wollte nicht über seine Träume reden, sich dabei jedoch auf keinen Fall anmerken lassen, dass er nicht über seine Träume reden wollte. Obwohl er sich verschluckte, schaffte er es irgendwie, unbekümmert dabei zu wirken. Gleichgültig. Alles im grünen Bereich, sagte sein Erdnussgemümmel. Reden wir über was anderes, schlug sein Erdnussgemümmel vor. Du machst dir schon wieder völlig grundlos Sorgen, schickte sein Erdnussgemümmel hinterher.
Declan hielt einen Proteinriegel zwischen Finger und Lenkrad geklemmt, machte jedoch keine Anstalten, ihn auszupacken. »Tu nicht so, als würde ich mir grundlos Sorgen machen.«
Es gab zwei wesentliche Gründe, warum ein Ausflug mit Übernachtung für einen Träumer nicht die beste Idee war. Der erste und offensichtlichste war die Tatsache, dass Ronan sich niemals hundertprozentig sicher sein konnte, beim Aufwachen nicht irgendwas aus seinem Traum mitzubringen. Manchmal waren die Sachen harmlos – eine Feder, ein toter Zierfisch, eine Topfpflanze. Aber manchmal waren es auch gestaltlose Melodien, von denen dem Hörer übel wurde, ausgehungerte Echsen oder zweitausend linke Lederschuhe, Größe zweiundvierzigeinhalb. So was war schon unangenehm genug, wenn es in den Schobern passierte (Echsenbisse konnten verdammt schmerzhaft sein). Aber wenn Ronan sich bei Declan in der Stadt oder in einem Hotelzimmer befand oder auf einem Rastplatz im Auto eingenickt war … nun ja.
»Soll ich dir dein Yuppie-Frustfutter auspacken?«, bot Ronan großzügig an.
»Lenk nicht ab«, wies Declan ihn zurecht, reichte ihm aber nach kurzem Zögern den Riegel.
Ronan schälte ihn aus der Hülle und nahm einen Probebissen, ehe er ihn Declan zurückgab. Das Ding sorgte für ein Mundgefühl, als wäre man mit dem Gesicht voran in einen Haufen dreckigen Sand gefallen.
»Kultiviert wie immer.« Declan pustete auf das angebissene Ende, als würden sich dadurch die Ronan-Keime verflüchtigen. »Manchmal frage ich mich, ob du die Sache hier eigentlich ernst nimmst.«
Der zweite Grund, warum ein Träumer keine Übernachtungsausflüge unternehmen sollte, war das Nachtschwarz: ein poetischer Name, den Ronan einem alles andere als poetischen Phänomen gegeben hatte. Es hatte sich erst vor Kurzem eingestellt, daher wusste er bisher nur, dass ihm, wenn er zu lange nichts aus seinen Träumen geholt oder zu viel Zeit fern der sanften Hügellandschaft von West Virginia verbracht hatte, eine schwarze Flüssigkeit aus der Nase zu rinnen begann. Dann den Augen. Dann den Ohren. Unternahm er nichts, spürte er, wie das Schwarz seine Brust füllte, sein Gehirn, seinen ganzen Körper. Ihn langsam tötete. Vielleicht konnte man etwas dagegen tun, aber Ronan kannte nun mal keine anderen Träumer, die er um Rat hätte fragen können. Er war in seinem ganzen Leben nur zwei anderen seiner Art begegnet – seinem Vater und einem inzwischen toten Mitschüler von der Highschool – und keiner der beiden hatte je etwas Derartiges erwähnt. Wie würde er ein Leben in Cambridge verkraften? Und wie lange? Tja, das konnte er wohl nur rausfinden, indem er es probierte.
»Ich bin dran mit Musikaussuchen«, meldete sich Matthew vom Rücksitz.
»Nein«, sagten Declan und Ronan wie aus einem Mund.
Declans Handy in der Mittelkonsole buhlte um Aufmerksamkeit. Ronan wollte danach greifen, doch Declan schnappte es ihm so hastig weg, dass er beinahe von der Fahrbahn abgekommen wäre. Ronan erhaschte einen Blick auf den Anfang einer eingegangenen Nachricht: Der Schlüssel ist …
»Alter, komm mal klar«, sagte Ronan. »Ich spann dir schon nicht deine Perle aus.«
Declan warf das Handy in sein Türfach.
»Neuer Personal Trainer?«, fragte Ronan weiter. »Neuer Proteinriegelhersteller? Neuer Inneneinrichter mit heißen Tipps für robuste Auslegeware?«
Declan antwortete nicht. Matthew summte fröhlich zur Musik in seinen Kopfhörern mit.
Keiner seiner Brüder hatte irgendwas darüber verlauten lassen, wie er zu Ronans Umzugsplänen stand, und Ronan wusste nicht, ob es den beiden einfach egal war oder sie davon ausgingen, dass sowieso nichts daraus würde.
Er wusste auch nicht, was ihm lieber wäre.
New York: Wieder ein Tankstellenstopp. Matthew joggte beschwingt Richtung Toiletten. Declan telefonierte. Ronan tigerte auf und ab. Der Wind entwickelte einen erstaunlichen Einfallsreichtum dabei, sich unter seinen Kragen zu wieseln, und sein Puls war so flüchtig und substanzlos wie die dünnen Oktoberwolken am Himmel.
Die dürren Bäume am Rand des Rastplatzes erinnerten eher an eine triste Ansammlung von Streichhölzern als an ein Wäldchen. Es waren keine heimischen Arten. Verunsicherte Fremde in diesem urbanen Lebensraum. Aus irgendeinem Grund jedoch führte ihr Anblick Ronan die volle Tragweite seines Vorhabens vor Augen. Jahrelang hatte sich in seinem Leben nichts verändert. Gut, er hatte die Highschool geschmissen, was er bis heute nicht bereute, zumindest nicht ernsthaft, und seine Freunde hatten ihren Abschluss gemacht. Zwei von ihnen, Gansey und Blue, hatten ihn eingeladen, sie auf eine Rundreise durch mehrere Bundesstaaten zu begleiten, aber zu dem Zeitpunkt hatte Ronan nirgends hingewollt. Alles, was er gewollt hatte, war …
»… Adam?« Matthew hatte eine Frage gestellt, von der Ronan jedoch nur das Ende aufgeschnappt hatte. Sein Bruder war kurz zuvor mit einer Tüte Gummizeug zurückgekommen, das er nun erfreulich geräuscharm vertilgte. »Siehst du, mit kronstuktiver … konstruktiver Krist… – Mann. Mit konstruktiver Kritik kann ich was anfangen.«
Adam.
Adam Parrish war das Ziel dieser Reise.
Gibt es irgendeine Version von dir, die mit mir nach Cambridge ziehen könnte?, hatte er an dem Tag gefragt, als er Henrietta verlassen hatte.
Vielleicht. Ronan hatte ihn seit Semesterbeginn ein einziges Mal besucht und das war eine ziemliche Hauruckaktion gewesen. Er war einfach mitten in der Nacht ins Auto gestiegen, hatte den Tag mit Adam verbracht und sich dann direkt wieder auf den Heimweg gemacht, ohne eine Sekunde geschlafen zu haben. Das Risiko hatte er nicht eingehen wollen.
Aber es galt die Unschuldsvermutung: Ronan Lynch konnte in Cambridge leben, solange ihm niemand das Gegenteil bewies.
Adam.
Ronan vermisste ihn wie einen Lungenflügel.
Jetzt tauchte auch Declan wieder auf. Er sah auf seine Uhr und zog dabei ein Gesicht, als hätte diese ihn schon allzu oft enttäuscht. Dann öffnete er die Fahrertür.
»Was soll das? Ich bin dran«, protestierte Ronan. Wenn er sich jetzt nicht aufs Fahren konzentrieren konnte, würde sein Gehirn in den letzten zwei Stunden bis Cambridge völlig heißlaufen. Adam wusste, dass Ronan dieses Wochenende kam, aber nicht von den Wohnungsbesichtigungen. Ronan konnte nicht einschätzen, wie er darauf reagieren würde »Wir hatten ja wohl einen Deal.«
»Einen Ein-Dollar-Deal«, witzelte Matthew.
»Als ob ich dich zwischen diesen ganzen Massachusioten ans Steuer meines Wagens lassen würde.« Die Autotür fiel zu wie ein Schlusspunkt. Matthew zuckte mit den Schultern. Ronan spuckte auf den Boden.
Nachdem alle wieder eingestiegen waren, lehnte Matthew sich nach vorn und schnappte sich triumphierend das AUX-Kabel. Kurz darauf umpfte der Dubstep-Remix eines Popsongs aus den Boxen.
Das würden lange zwei Stunden werden.
Ronan zog sich seine Jacke über den Kopf, um sowohl die Musik als auch seine aufkeimende Nervosität zu dämpfen. Er spürte seinen Puls bis in den Kiefer. Hörte ihn in den Ohren. Klingt wie ein ganz normaler Herzschlag, dachte er. Wie Adams Herzschlag, wenn Ronan den Kopf auf seine Brust legte. So anders war Ronan gar nicht. Oder zumindest konnte er es so aussehen lassen. Er konnte dem Mann, den er liebte, in einen anderen Bundesstaat folgen, so, wie viele andere es auch taten. Er konnte in einer Stadt leben, so, wie viele andere es auch taten. Es könnte funktionieren.
Er fing an zu träumen.
3
Eine Stimme hallte durch Ronans Traum.
Du weißt, dass die Welt nicht ist, wie sie sein sollte.
Sie war überall und nirgends.
Früher war der Himmel voller Sterne. Bei Nacht konnten wir sehen in ihrem Licht. Wie ein Geflecht von Hunderten Scheinwerfern, so hell, dass man darin eintauchen wollte, so faszinierend, dass wir Legenden über sie schrieben, so verlockend, dass wir Menschen in Raketen zu ihnen hochschossen.
Du bist zu spät auf die Welt gekommen, um dich daran zu erinnern.
Die Stimme war unentrinnbar; sie war wie eine Urgewalt, wie Luft oder das Wetter.
Vielleicht unterschätze ich dich auch. Dein Kopf ist voller Träume. Die müssten sich daran erinnern.
Tut es manchmal noch weh, wenn du zum Himmel hochschaust?
Ronan lag mitten auf der Interstate. Drei Spuren in beide Richtungen, keine Autos, nur Ronan. Ihm war traumtypisch bewusst, dass die Straße an den Schobern anfing und in Harvard endete und er sich irgendwo dazwischen befand. Neben dem Seitenstreifen kämpften sich ausgemergelte Bäume durch das spärliche Gras. Der Himmel hatte die Farbe abgefahrenen Asphalts.
Früher konnten wir die Sterne sogar hören. Wenn niemand redete, herrschte einfach Stille. Heute könnten alle Menschen auf dem Planeten gleichzeitig den Mund halten und trotzdem wäre immer noch ein Grundrauschen zu hören. Die Klimaanlage in der Wand. Der Sattelschlepper auf dem meilenweit entfernten Highway. Ein Flugzeug, das in Tausenden Metern Höhe über dich weglamentiert.
Stille ist ein ausgestorbenes Wort.
Wurmt dich das nicht auch?
Doch in dem Traum war es vollkommen still, abgesehen von der Stimme. Ronan wusste nicht, wann er das letzte Mal vollkommene Stille erlebt hatte. Ob überhaupt schon mal. Sie wirkte friedvoll, nicht tot. Als hätte er eine Last abgelegt, die er unbewusst die ganze Zeit mit sich herumgeschleppt hatte, die Last von Geräuschen, die Last anderer Menschen.
Magie. Noch so ein Wort, das heute nichts mehr wert ist. Wirf eine Münze ein und kauf dir und deinen Freunden einen billigen Trick. Die meisten Leute wissen überhaupt nicht mehr, was Magie bedeutet. Es geht nicht darum, ein Kaninchen aus einer zersägten Frau hervorzuzaubern. Es geht nicht um das Ass im Ärmel. Es geht nicht um: »Sehen Sie auch genau hin?«
Hast du schon mal ins Feuer gestarrt, bis du den Blick nicht mehr abwenden konntest? Darum geht es. Hast du schon mal die Berge betrachtet, bis es dir den Atem verschlagen hat? Darum geht es. Hast du schon mal zum Mond hochgeguckt, bis dir die Tränen kamen? Darum geht es. Es geht um den Stoff zwischen den Sternen, um den Raum zwischen den Wurzeln, dieses Ding, das morgens die Elektrizität aus dem Bett lockt.
Dieses Ding, das uns verdammt noch mal hasst.
Ronan war nicht ganz sicher, wem die Stimme gehörte. Oder was. In einem Traum war derlei Physisches nicht von Belang. Vielleicht gehörte die Stimme einfach der Straße unter ihm. Oder dem Himmel. Oder irgendjemandem, der knapp außer Sichtweite war.
Das Gegenteil von Magie ist nicht das Alltägliche. Das Gegenteil von Magie sind die Menschen. Die Welt ist eine Leuchtreklame für MENSCHHEIT, und die letzten vier Buchstaben sind ausgebrannt.
Verstehst du, was ich damit sagen will?
Ronan spürte ein Rumpeln unter seinem Hinterkopf: Lastwagen, die aus der Ferne auf ihn zugerollt kamen, während er hier mitten auf der Straße lag.
Er weigerte sich, den Traum zum Albtraum werden zu lassen.
Sei Musik, forderte er den Traum auf.
Das Rumpeln ging in die Bässe von Matthews Dubstep über.
Die Welt tötet dich, aber SIE töten dich schneller. Du kennst SIE noch nicht, aber das wird sich bald ändern.
Bryde. Der Name ploppte so unvermittelt in Ronans Kopf auf wie zuvor der Verlauf der Interstate. Eine unumstößliche Wahrheit: Der Himmel war blau, der Asphalt war warm, die Stimme gehörte jemandem mit dem Namen Bryde.
Es gibt zwei Lager in dem Kampf, der uns bevorsteht, und eins davon sind Black-Friday-Angebote, Wi-Fi-Hotspots, das neuste Modell, nur für Abonnenten, jetzt mit noch mehr Stretch, Noise-Cancelling-Kopfhörer mit eingebautem Hörschaden, Kostendämpfungspauschalen, Reißverschlussverfahren.
Im anderen ist die Magie.
Mit einiger Mühe rief Ronan sich in Erinnerung, wo sein realer Körper sich befand. Im Auto mit seinen Brüdern, auf dem Weg zu Adam und einem neuen Leben, in dem er seine Träume unter Kontrolle hatte.
Bring ja nichts mit, beschwor Ronan sich selbst. Keinen Lastwagen, kein Verkehrszeichen, keinen Dubstep-Song, den man im Garten verbuddeln muss, damit man ihn nicht mehr hört. Lass deine Träume in deinem Kopf. Beweise Declan, dass du dazu in der Lage bist.
Bryde flüsterte:
Du bist aus Träumen gemacht und gehörst nicht in diese Welt.
Ronan wachte auf.
4
Aufwachen, Leute! Jemand sollte die Behörden verständigen«, verkündete TJ Sharma, der Gastgeber, lachend. »Unter uns weilt eine junge Frau mit Superkräften.«
Sämtliche Köpfe in der Fertigvilla irgendwo im Speckgürtel von D.C. wandten sich Jordan zu, einer jungen Frau mit kleinen Wundern anstelle von Augen und einem kernschmelzegleichen Lächeln. Die anderen Partygäste waren leger bis unauffällig gekleidet; beides Attribute, mit denen Jordan sich so gar nicht identifizieren konnte. Sie selbst trug eine Lederjacke über einem Schnürkorsett und ihr krauses Haar war zu einem riesigen Bausch von Pferdeschwanz hochgebunden. Die Blumentattoos an ihrem Hals und ihren Fingern leuchteten vor dem Hintergrund ihrer dunklen Haut wie ihr Enthusiasmus vor dem der dunklen Vorstadtnacht.
»Schhh«, machte Jordan. »Superkräfte sind wie Kinder …«
»Jede amerikanische Familie hat im Durchschnitt zwei Komma fünf davon?«, fragte TJ.
»Nee, man sollte sie sehen, aber nicht hören«, korrigierte Jordan.
Aus den Boxen greinte eine Neunzigerband über ihre verflossene Jugend. Die Mikrowelle machte ping – noch mehr billiges Popcorn. Die Stimmung auf der Party war gleichermaßen ironisch wie nostalgisch; TJ hatte gewitzelt, das Motto würde Entwicklungsgestört lauten. Auf dem Tisch stand eine Punschschale voller Cini Minis und auf dem Flachbildschirmfernseher, neben dem sich PlayStation-2-Spiele stapelten, lief eine Folge SpongeBob. Die meisten der anderen Leute im Raum waren weißer, älter und gesetzter als Jordan. Sie fragte sich, wer diese Party am Laufen halten würde, wenn sie es nicht täte.
»Nur keine falsche Bescheidenheit, Schlangestehen ist was für Loser«, sagte sie. Dann zeigte sie auf das Schmierpapier, das TJ zur Verfügung gestellt hatte. »Zeit für die Hausaufgaben. Und keine Ausreden. Jeder schreibt ›Bei jedem klugen Wort von Sokrates rief Xanthippe zynisch: Quatsch!‹ und dann in Schönschrift seinen Namen drunter.«
Jordan wohnte dieser Party als Hennessy bei. Niemand kannte die echte Hennessy, darum konnte auch niemand behaupten, sie wäre jemand anders. Selbst TJ hielt sie für Hennessy. Jordan war es gewohnt, fremde Identitäten zu benutzen – tatsächlich wäre es für sie seltsamer gewesen, wenn jemand sie unter ihrem echten Namen gekannt hätte.
»Wartet’s ab, das wird der Hammer.« TJs Stimme überschlug sich leicht vor Euphorie. Jordan mochte ihn – er war trotz seines jungen Alters Vizegeschäftsführer einer kleinen Bank, Typ feingliedriger Peter Pan, ein ewiger Junge in einer erwachsenen Welt, oder vielleicht auch umgekehrt. Er überhäufte sich selbst mit Spielzeug und ließ sich jeden Abend von seinem Handy ins Bett schicken. Er teilte sich diesen seelenlosen Kasten mit ein paar Mitbewohnern, und zwar nicht, weil er es sich nicht hätte leisten können, allein dort zu leben, sondern weil er schlicht nicht wusste, wie das ging.
TJ und Jordan hatten sich nur ein paar Wochen nachdem Hennessy und sie in die Gegend gezogen waren kennengelernt. Es war ein Uhr morgens gewesen, die Nacht erleuchtet von gespannter Erwartung und Quecksilberdampf, Jordan hatte ein gestohlenes Auto zurückbringen wollen, bevor sie deswegen noch abgeknallt wurden, und TJ kam von einem mitternächtlichen Langeweileeinkauf bei Walmart.
Er: in einem aufgemotzten Toyota Supra, den er in einer YouTube-Serie gesehen und gleich darauf bei eBay ersteigert hatte.
Sie: in einem aufgemotzten alten Dodge Challenger, den Hennessy wenige Stunden zuvor geklaut hatte.
An einer Tankstelle hatte er sie zum Rennen herausgefordert. Der Gewinner bekam das Auto des jeweils anderen. Jordan war nicht komplett verrückt, aber sie hatte gerade genug mit Hennessy gemein, um einzuwilligen.
Kurz und gut: Jordan fuhr jetzt Supra. Eine Weile war sie auch TJ Probe gefahren, aber Beziehungen waren einfach nicht so ihr Ding. Immerhin waren sie noch Freunde, soweit das bei zwei Menschen möglich war, von denen einer sich als jemand anders ausgab.
»Die perfekte Fälschung«, erklärte Jordan ihrem gebannten Publikum, »erreicht man niemals durch Abmalen, also der Unterschrift. Dann wirken nämlich sämtliche Kurven und Schnörkel zu bemüht und die Enden wie abgehackt, anstatt sanft auszulaufen. Okay, sagt ihr jetzt, dann pause ich sie eben ab. Vergesst es. Wenn ihr eine Unterschrift abpaust, torkeln die Linien vom Bett in die Kneipe und wieder zurück. Jeder Amateur, der auch nur ein bisschen genauer hinguckt, erkennt, ob eine Unterschrift abgepaust wurde. Aber Hennessy, fragt ihr, wie sollen wir es denn dann machen? Die Antwort ist: Ihr müsst euch die organische Struktur der Schrift einprägen, ihre Architektur verinnerlichen, das komplette System, das den Formen zugrunde liegt. Und das hat nichts mit Logik zu tun, sondern mit Einfühlungsvermögen.«
Während sie redete, kritzelte sie unentwegt Namen und willkürliche Buchstabenfolgen aufs Papier. Dabei sah sie kaum hin, sondern hielt den Blick permanent auf die Mustersätze der Partygäste gerichtet. »Ihr müsst ein Stück weit zu der Person werden, deren Unterschrift ihr fälscht.«
Im nächsten Schritt nahm Jordan eine einzelne der Schriftproben ins Visier. Bei jedem klugen Wort von Sokrates rief Xanthippe zynisch: Quatsch!, gefolgt von dem ungewöhnlichen Namen Breck Myrtle. Die Schrift war eckig und damit leichter zu fälschen als eine geschwungen dahinfließende. Außerdem hatte sie ein paar hübsche Eigenheiten, die das Ganze für Zuschauer interessanter gestalteten.
Kurz darauf drehte sie den Zettel um und schrieb, ohne zu zögern, einen einzigen finalen Satz auf die Rückseite: Hiermit vermache ich an diesem heutigen Tage im Oktober meinen gesamten Besitz der wundervollen Hennessy. Und unterzeichnete formvollendet mit Breck Myrtle.
Jordan präsentierte den anderen ihr Werk.
Überraschtes Luftschnappen. Lachen. Hier und da ein Anklang gespielter Empörung.
Breck Myrtle selbst zeigte eine eher gespaltene Reaktion. »Wie hast du …«
»Du bist am Arsch, Breck«, sagte eine der Frauen. »Das sieht absolut perfekt aus.«
»Ist sie nicht gruselig?«, kommentierte TJ.
Dabei hatte keiner von ihnen eine Vorstellung davon, wie gruselig Jordan wirklich war. Nicht mal annähernd. Wenn Breck Myrtle noch ein bisschen mehr redete, könnte Jordan sich zusätzlich nämlich seine persönliche Ausdrucksweise aneignen und damit Briefe, E-Mails und Chatnachrichten in seinem Namen verfassen, ohne sich dabei mit irgendwelchen Standardfloskeln behelfen zu müssen. Die Kunst der Fälschung ließ sich auf alle möglichen Kommunikationsmedien anwenden, auch wenn Jordan sie eher zu privaten als geschäftlichen Zwecken nutzte.
»So jung und schon so ausgekocht«, merkte eine andere Frau kichernd an.
»Und dabei schöpft sie ihre Begabung noch längst nicht voll aus«, sagte TJ.
Doch Jordan schöpfte schon seit einer ganzen Weile aus dem Vollen. Sowohl sie als auch die echte Hennessy waren professionelle Kunstfälscherinnen. Auch die anderen Mädchen bei ihr zu Hause waren in diesem Bereich tätig, aber die fertigten in erster Linie Kopien an. Fälschen und kopieren – diese beiden Begriffe wurden gern durcheinandergebracht oder ungerechtfertigterweise zusammengefasst. In der Kunstbranche gab es jede Menge Leute, die berühmte Gemälde bis zur letzten Ärmelfalte replizieren konnten. Aber Kopien, schnaubte Hennessy stets abfällig, zählten nicht als Kunst. Eine ernst zu nehmende Fälschung war ein komplett neues Gemälde im Stil des Originalkünstlers. Einen existierenden Matisse nachzubilden war Pipifax. Alles, was man dafür brauchte, waren ein Raster und ein gutes Händchen für Technik und Farben. Um jedoch einen neuen Matisse zu erschaffen, musste man nicht nur malen können wie Matisse, man musste auch denken können wie Matisse. Und das, davon war Hennessy überzeugt, war die wahre Kunst.
Jordan stimmte ihr uneingeschränkt zu.
Die Türklingel übertönte die Neunzigerjahremusik.
Jordans Herz machte einen aufgeregten Hüpfer.
»Bernie!«, rief TJ. »Je später der Abend, desto schöner die Gäste, was? Komm rein, du brauchst doch nicht zu klingeln!«
Jordan verstand sich gut mit TJ, dennoch hatte sie sich nicht gänzlich ohne Grund bereit erklärt, einen Abend im Kreis seiner eher farblosen Freunde zu verbringen. Und dieser Grund marschierte soeben ins Zimmer: eine Frau in einem smarten weinroten Hosenanzug und mit einer runden getönten Brille. Bernadette Feinman. Mit ihrem silbergrauen, straff von einer glitzernden Klammer zurückgehaltenen Haar wirkte sie wie die einzige Erwachsene im Raum. Wenn auch keine gewöhnliche Erwachsene, sondern eine, die sich, ohne mit der Wimper zu zucken, einen Pelzmantel aus hundertundein Dalmatinern schneidern lassen würde. Wie vermutlich niemand sonst auf der Party wusste, war Feinman eine der Schirmherrinnen des hiesigen Feenmarkts, eines internationalen Schwarzmarkts für allerlei exquisite, illegale Waren und Dienstleistungen. Mit Betonung auf exquisite.
Es war nämlich nicht so, als könnte auf diesem Markt jeder dahergelaufene Verbrecher seine Waren verschachern. Dafür musste man schon ein hochklassiger Verbrecher sein.
Jordan wollte auf diesen Markt. Sie musste auf diesen Markt.
Und das hing von Bernadette Feinman ab.
Feinman kam näher. Sie hatte einen irgendwie markanten, staksigen Gang, fast wie eine Gottesanbeterin, aber wenn sie sprach, war ihre Stimme sanft und melodisch. »Ich würde ja sagen, tut mir leid, dass ich so spät dran bin, aber wie du weißt, lege ich großen Wert auf Ehrlichkeit.«
TJ brachte ihr einen Drink und sah dabei aus wie ein kleiner Junge, der mit der Aufgabe betraut worden war, für das Wohl der ehrwürdigen Großmutter zu sorgen. Alle anderen tranken Bier, fiel Jordan auf. Nur Feinman bekam ein langstieliges Glas Weißwein in die eine Hand gedrückt und eine Nelkenzigarette in die andere.
»Leute, das hier ist Bernie. Sie ist meine Mentorin, mein persönlicher Yoda, also lasst uns auf unsere großen Vorbilder anstoßen.« TJ gab Bernie einen Kuss auf die Wange, die Partygäste stießen auf ihre großen Vorbilder an und dann schalteten sie die PlayStation 2 ein.
Feinman beugte sich über den Tisch und begutachtete die Unterschriften. Dann sah sie hoch zu Jordan. »Sie müssen Hennessy sein. Ich darf wohl davon ausgehen, dass Sie mehr zu bieten haben als das hier?«
Jordan schenkte ihr ein breites Grinsen. Ihr »Was kostet die Welt?«-Grinsen, voller Selbstvertrauen und Verbindlichkeit, ohne dabei ihre Nervosität preiszugeben oder die Tatsache, dass ihr diese Begegnung wichtig war.
TJ runzelte leicht die Stirn. »Wieso das jetzt, Bernie?«
»Hennessy hat sich auf eine Stelle in der Agentur beworben.« Der Satz ging Feinman so glatt über die Lippen, dass Jordan sich fragte, ob sie sich die Lüge vorher zurechtgelegt hatte.
»Ihr wollt doch wohl auf meiner Party nichts Geschäftliches besprechen, oder?«, entgegnete TJ. »Sonst muss ich euch nämlich leider ’ne Konferenzraumgebühr berechnen.«
Feinman reichte ihm ihr noch immer volles Glas. »Hol mir doch noch ein bisschen Wein, Kleiner.«
TJ trollte sich, leise und folgsam wie ein Kind.
Feinman tippte mit ihren silbern lackierten Fingernägeln auf Brecks gefälschte Unterschrift und kam direkt zur Sache. »Jedenfalls hoffe ich, wir reden hier über mehr als Partytricks.«
»Das da sind nur die Kräcker zum Aperitif«, erwiderte Jordan. »Nicht zu verwechseln mit dem Hauptgang.«
Feinmans Zähne waren eine feine Perlenschnur hinter angespannten Lippen. »Dann servieren Sie mir gern das volle Menü.«
»Bin gleich wieder da.«
Als Jordan kurz darauf in die kalte Oktoberluft hinaustrat, war ihr Grinsen verschwunden. Ein Blick auf den Supra, der an seinem alten Platz am Bordstein parkte, als hätte sie ihn niemals dort weggewonnen, verlieh ihr neuen Mut. Auf die Vorstadthäuser, getaucht in den Schein von Veranda- und Garagenbeleuchtung, auf die skelettartigen Herbstbäume und im Halbdunkel schlummernden Autos. Sie überlegte, wie sie dieses Wohngebiet malen würde, wo sie den Fluchtpunkt setzen würde, welche Details sie hervorheben und welche sie mit dem Hintergrund verschmelzen lassen würde. Sie überlegte, wie sie es in ein Kunstwerk verwandeln konnte.
Dann holte sie sechs Gemälde aus ihrem Auto und ging zurück ins Haus.
Drinnen arrangierte sie ihre Ausstellungsstücke auf dem Esszimmertisch, damit Feinman, die mittlerweile wieder ihr Weinglas in ihren Gottesanbeterinnenfingern hielt, sie sich ansehen konnte. Es waren Kopien. Pure Machtdemonstrationen. Eine Mary Cassatt, ein Hockney, ein Waterhouse, ein Whistler und eine Mona Lisa mit Jordans Tattoos, denn ein bisschen Spaß musste schließlich sein.
Waren die Partygäste zuvor amüsiert gewesen, zeigten sie sich nun ernsthaft beeindruckt. Selbst Jordans Fälschungsopfer Breck Myrtle wagte sich wieder näher heran und staunte.
»Ich sag’s ja, gruselig«, konstatierte TJ. »Du könntest dich echt als jeder ausgeben, stimmt’s?«
Feinman beugte sich vor, um die wesentlichen Details in Augenschein zu nehmen. Die Kanten der Leinwände und Holzplatten, die Markierungen auf den Rückseiten, Texturen, Pinselführung, Wahl der Farbpigmente, Verarbeitung der Keilrahmen. Sie würde keinen Grund zur Beanstandung finden.
»Wie ist Ihr eigener Stil?«, erkundigte sich Feinman.
Jordan hatte keine Ahnung. Sie hatte sich immer nur des Stils anderer bedient. »Eine Dame genießt und schweigt.«
»Spektakulär, möchte ich meinen.« Feinman und ihre Nelkenzigarette bewegten sich in Richtung der Mona-Lisa-Parodie. Die Oberfläche war auf alt und brüchig getrimmt und verlieh dem Gemälde den Anstrich eines echten Museumsfundstücks, doch die unzeitgemäßen Tattoos verwiesen auf eine andere Entstehungsgeschichte. »Obwohl diese Spielereien ebenfalls ihren Reiz haben.«
Jordan hielt den Atem an.
Es musste klappen. Es musste einfach.
»Also hat sie den Job?«, fragte TJ.
Feinman wandte Jordan ihren Gottesanbeterinnenkörper zu und musterte sie mit demselben prüfenden Blick wie zuvor die Bilder. Ihre Augen hinter den getönten Brillengläsern blinzelten kein einziges Mal. Das Wort dieser Frau, dachte Jordan bei sich, war Gesetz, und das für Menschen wie TJ und sie gleichermaßen, worüber Feinman sich auch voll und ganz im Klaren war. Jordan drängte sich der Verdacht auf, dass mit der Herrschaft über diese beiden Welten – Tag und Nacht – eine Menge Macht einherging.
»Manchmal«, sagte Feinman, »muss man einen Bewerber auch ablehnen, weil er überqualifiziert ist. Weil man ihn nicht davon abhalten will, zu werden, wozu er bestimmt ist.«
Es dauerte einen Moment, ehe Jordan begriff, dass sie eine Absage kassierte.
»Oh, aber …«
»Ich tue Ihnen damit einen Gefallen«, sagte Feinman. Sie warf einen letzten Blick auf die Mona Lisa. »Wahrscheinlich haben Sie es selbst noch nicht erkannt, aber Sie, Hennessy, sind ein Original und sollten daher auch nur welche malen.«
Wenn an diesem Satz doch nur irgendetwas wahr gewesen wäre.
5
Adam Parrish.
So hatte es angefangen: mit Ronan, der halb aus dem Beifahrerfenster des knallorangefarbenen dreiundsiebziger Camaro von Richard Campbell Gansey III hing, weil ihn nun mal nichts halten konnte. Mit dem historischen Kleinstädtchen Henrietta, das sie eng umfing, den Bäumen und Straßenlaternen, die die Ohren spitzten, um das Gespräch im Auto zu belauschen. Was für ein Gespann, diese beiden. Gansey, permanent auf der Suche nach dem Sinn, und Ronan, überzeugt, dass es sowieso keinen gab. Der eine klar auf Erfolgskurs, der andere offensichtlich auf Abwegen. Damals war Gansey der Jäger und Ronan, sein bester Freund, der Falke, der mittels Haube und Glöckchen davon abgehalten werden musste, sich mit seinen eigenen Klauen zu zerfleischen.
So hatte es angefangen: mit einem Schüler, der sein Fahrrad den letzten Hügel Richtung Stadt hochschob und offensichtlich dasselbe Ziel hatte wie sie. Auch er trug die Uniform der Aglionby Academy, jedoch wirkte seine, das erkannte Ronan im Näherkommen, auf eine Art abgenutzt, wie Schuluniformen es nach nur einem Jahr nicht sein dürften. Was für secondhand sprach. Die hochgekrempelten Ärmel gaben den Blick auf ein Paar drahtige Unterarme frei, an denen sich schlanke Muskelstränge abzeichneten. Doch es waren seine Hände, die Ronans Aufmerksamkeit fesselten. Hübsche Jungenhände mit hervorstehenden Fingerknöcheln, ebenso lang und markant wie sein ungewöhnliches Gesicht.
»Wer ist das denn?«, fragte Gansey, doch Ronan antwortete nicht, sondern hing bloß weiter aus dem Fenster, während sie an ihm vorbeifuhren. Adams Miene war ein Widerspruch in sich: entschlossen und bang, schicksalsergeben und darüber erhaben, resigniert und renitent.
Ronan hatte damals nichts über Adam gewusst und vielleicht sogar noch weniger über sich selbst. Aber so hatte es angefangen: mit Ronan, der sich, während sie den Jungen auf dem Fahrrad hinter sich ließen, wieder auf seinem Beifahrersitz zurücklehnte und mit geschlossenen Augen ein stummes, unerklärliches, verzweifeltes Stoßgebet zum Himmel schickte:
Bitte.
Und jetzt war Ronan Adam nach Harvard gefolgt. Nachdem Declan ihn am Tor abgesetzt hatte (»Mach keine Dummheiten. Und schreib mir gleich morgen früh.«), stand er eine Weile auf dem schmiedeeisern umzäunten Innenhof und betrachtete die hübschen gepflegten Gebäude und die hübschen gepflegten Bäume. Alles erstrahlte in Rottönen: die Backsteinwohnheime und Backsteinpfade, Oktoberlaub und Oktobergras, die herbstlichen Schals der gemütlich dahinschlendernden Studierenden. Der Campus erschien ihm fremd, wie verwandelt durch den Wechsel der Jahreszeiten. Verrückt, dass manche Dinge nach nur wenigen Wochen kaum wiederzuerkennen waren.
Sechstausendsiebenhundert eingeschriebene Studierende. Davon neunundzwanzig Prozent, deren Eltern bereits ihren Abschluss hier gemacht hatten; sechzig Prozent, die finanzielle Hilfen erhielten. Durchschnittliche Höhe der Zuschüsse: vierzigtausend Dollar. Jährliche Studiengebühr: siebenundsechzigtausend Dollar. Durchschnittliches Gehalt eines Harvard-Absolventen zehn Jahre nach dem Abschluss: siebzigtausend Dollar. Aufnahmequote: vier Komma sieben Prozent.
Ronan kannte die Statistiken in- und auswendig. Nachdem Adams Zusage gekommen war, hatten sie Abend für Abend in den Schobern zusammengesessen und alles an Zahlen und Fakten analysiert, was sie über die Uni finden konnten. Diese Wochen hatte er mit zwei Adams verbracht, einem, der gern daran glauben wollte, dass er sich seinen Platz an einer Eliteuni verdient hatte, und einem, der die feste Überzeugung hegte, dass er dort absolut fehl am Platz sein würde. Ronan hatte alles duldsam ertragen. Wem sonst hätte Adam seine Sorgen auch anvertrauen sollen? Seine Mutter verwandelte sich mehr und mehr in einen Geist, und wenn es nach seinem Vater gegangen wäre, hätte Adam möglicherweise nicht mal bis zu seinem Highschoolabschluss überlebt. Also saugte Ronan Informationen, Angst und Vorfreude in sich auf und verdrängte so gut es ging den Gedanken, dass Adam und er vollkommen gegensätzliche Wege einschlugen. Den Gedanken an die Unibroschüren mit all den strahlenden, gebildeten, unbeschwerten Gesichtern, in die Adam Parrish sich an seiner statt verlieben könnte. Manchmal versuchte er, sich vorzustellen, er hätte selbst seinen Highschoolabschluss gemacht und ein Studium an irgendeinem College angefangen. Doch das war genauso undenkbar wie ein Adam, der die Highschool geschmissen und sich dazu entschlossen hätte, in Henrietta zu bleiben. Sie beide kannten die Realität. Adam war ein Akademiker. Ronan ein Träumer.
Gibt es irgendeine Version von dir, die mit mir nach Cambridge ziehen könnte?
Vielleicht. Vielleicht.
Es dauerte einen Moment, bis Ronan den Namen von Adams Wohnheim aus den Tiefen seines Handys heraufbefördert hatte – Thayer House –, und dann einen weiteren, bis er einen Campusplan fand. Natürlich hätte er Adam einfach schreiben können, dass er da war, aber die Aussicht auf die kleine Überraschung gefiel ihm. Adam wusste zwar, dass er heute kam, aber nicht, wann. Ronan kannte sich aus mit Abschieden und Wiedersehen, jenem gezeitenhaften Rhythmus, in dem ein geliebter Mensch in See stach und zurückkehrte, wann immer der Wind günstig stand. Wie oft hatte sein Vater mit einem Kofferraum voller Träume die Schober verlassen, um Monate später mit einem Kofferraum voller Geld und Geschenke wieder aufzutauchen? Wie oft hatte seine Mutter ihn ziehen lassen, um ihn nach all der Zeit wieder zu Hause willkommen zu heißen? Ronan konnte sich noch gut erinnern, wie es war, wenn die beiden einander endlich zurückhatten. An Auroras Lächeln, das Niall behutsam auswickelte wie die Kinder die Pakete aus seinem Auto. An Nialls Lächeln, das Aurora behutsam von dem Regal nahm, auf dem sie es aufbewahrte, und abstaubte.
In den vergangenen Tagen hatte Ronan sein Wiedersehen mit Adam immer wieder durchgespielt, hatte sich alles bis ins Detail auszumalen versucht. Überwältigtes Schweigen, gefolgt von einer Umarmung auf der Eingangstreppe? Ein Lächeln, das sich langsam auf beiden Gesichtern ausbreitete, gefolgt von einem Kuss im Flur? Ronan, sagte Ronans Fantasie-Adam, als die Tür zu seinem Zimmer sich öffnete.
Stattdessen: Ronan, der endlich den Weg zum Thayer House fand, Ronan, der durch die Trauben von Studierenden und Touristen irrte, als er plötzlich ein überraschtes »Ronan?« vernahm.
Ronan, der sich umdrehte und begriff, dass Adam ihm auf dem Backsteinpfad entgegengekommen war.
Dass er an Adam vorbeigelaufen war.
Und als sie sich so gegenüberstanden, eine Armlänge voneinander entfernt, sodass alle anderen einen Bogen um sie schlagen mussten, wurde ihm auch klar, warum. Adam sah aus wie immer, aber gleichzeitig auch nicht. Sein hageres Gesicht hatte sich nicht verändert, seit Ronan ihn vor ein paar Wochen zum letzten Mal gesehen hatte. Er war noch immer der Junge mit dem Fahrrad. Auch sein staubfarbenes Haar war genau, wie Ronan es in Erinnerung gehabt hatte, liebenswert ungleichmäßig geschnitten, als hätte er selbst vor dem Badezimmerspiegel zur Schere gegriffen.
Was fehlte, waren das Motoröl, der Schweiß, der Dreck.
Adam war makellos gekleidet. Das Hemd faltenfrei, die Ärmel lässig hochgekrempelt, Vintage-Tweedjacke, gut sitzende braune Chino, knapp über den stilvollen Schuhen umgeschlagen. Seine Körpersprache war so zurückhaltend und präzise wie immer, höchstens noch einen Hauch glatter, unnahbarer. Er wirkte, als gehörte er voll und ganz hierher.
»Ich hab dich gar nicht erkannt«, sagten sie beide wie aus einem Mund.
So ein Blödsinn. Ronan hatte sich schließlich nicht verändert. Kein bisschen. Er hätte sich gar nicht verändern können, selbst wenn er gewollt hätte.
»Ich wäre fast an dir vorbeigelaufen«, fügte Adam gelinde verwundert hinzu.
Er klang sogar anders. Von seinem leichten Virginia-Akzent war keine Spur mehr. In der Highschool hatte Adam verbissen versucht, ihn sich abzutrainieren, es jedoch nie ganz geschafft. Und jetzt war er einfach verschwunden. Seine Stimme war die eines Fremden.
Der Boden unter Ronan schien zu schwanken. Für so etwas war in seinen Tagträumen kein Platz gewesen.
Adam warf einen Blick auf die Uhr, und Ronan sah, dass es seine Uhr war, ein edles Stück, das er Adam zu Weihnachten geträumt hatte und das die Zeit an jedem Ort der Welt anzeigte, an dem Ronan sich gerade aufhielt. Das Schwanken ließ ein wenig nach.
»Ich hatte noch gar nicht mit dir gerechnet«, fuhr Adam fort. »Ich dachte, du … Okay, eigentlich hätte ich’s mir wohl denken können bei deinem Fahrstil. Aber ich dachte …«
Er starrte Ronan auf eine seltsame Art an, und es dauerte einen Moment, ehe Ronan klar wurde, dass er auf exakt dieselbe seltsame Art zurückstarrte.
»Alter, ist das krampfig«, brummte Ronan und Adam stieß ein abgehacktes Lachen aus. Sie umarmten sich stürmisch.
Das entsprach schon eher Ronans Erinnerungen. Adams Rippen, die sich perfekt an seine fügten. Adams schmale Statur, die sich mühelos umschließen ließ. Adams Hand, die fest an Ronans Hinterkopf lag. Und auch ohne seinen Akzent klang Adam nun wieder ganz wie der Alte, als er an Ronans Hals murmelte: »Du riechst nach zu Hause.«
Zu Hause.
Ronan fand wieder festen Stand. Alles war gut. Er war bei Adam, Adam liebte ihn noch immer und das hier würde funktionieren.
Dann lösten sie sich voneinander und Adam fragte: »Willst du meine neuen Freunde kennenlernen?«
Freunde waren ein ernst zu nehmendes Thema für Ronan Lynch. Er tat sich schwer damit, passende zu finden, aber wenn er welche hatte, dann fürs Leben. Ronan gab alles für seine Freunde. Und das war seiner Meinung nach nur bei einer begrenzten Anzahl von Menschen möglich, sonst war einfach schnell nichts mehr übrig. Zudem belasteten Geheimnisse jede Art von Beziehung – ein weiterer Grund, warum sein Freundeskreis klein und exklusiv blieb. Dazu gehörte Gansey, der Goldjunge, der Ronan in der Highschool vielleicht nicht direkt das Leben gerettet, aber es zumindest sicher außerhalb seiner Reichweite verwahrt hatte, damit Ronan es nicht kaputt machte. Dazu gehörte Blue Sargent, die Wahrsagerinnentochter im Taschenformat mit ihrem extrem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Ronans und ihre Annäherung war im Zeitlupentempo verlaufen, sie hatten sich Schicht um Schicht vorarbeiten müssen und waren erst zum Kern des jeweils anderen vorgedrungen, als ihre Highschoolzeit fast vorbei war. Dazu gehörten Adam und Ronans Brüder. Und das war’s. Natürlich hätte Ronan sich jede Menge lockere Bekannte suchen können. Aber wozu?
»Pfändung! Du musst Pfändung sagen.«
»Was?« Ronan spielte ein Kartenspiel. Ein ziemlich verwirrendes Kartenspiel mit haufenweise Regeln, einem hoch komplizierten Ablauf und einer beunruhigend offenen Spieldauer. Ronan hätte darauf gewettet, dass es von Harvardstudierenden erfunden worden war. Um genauer zu sein, von genau den Harvardstudierenden, die gerade zusammen mit ihm am Tisch saßen: Fletcher, Eliot, Gillian und Benji. Neben ihm saß Adam, das hörende Ohr ihm zugewandt (auf dem anderen war er taub).
Adams Schuh presste sich unter dem Tisch an seinen.
»Damit die Mitspielenden gewarnt sind«, erklärte Eliot.
»Wovor?«
Sein Tonfall ließ Eliot stutzen, dabei hatte Ronan nicht das Gefühl, schroffer gewesen zu sein als sonst. Aber vielleicht war sein Sonst auch schon ausreichend. Der erste Kommentar, den der nonchalante Eliot zu Ronan abgegeben hatte, als sie einander vorgestellt wurden, hatte »Du bist ja noch Furcht einflößender, als ich dachte« gelautet.
Freut mich auch, dich kennenzulernen, du Arsch, hatte Ronan gedacht.