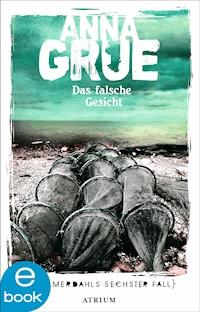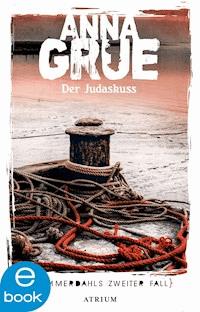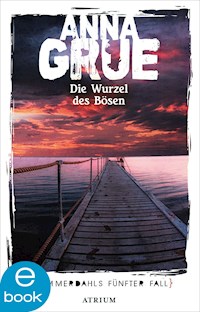Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Atrium Verlag AG Zürich
- Kategorie: Krimi
- Serie: Dan Sommerdahl
- Sprache: Deutsch
Im beschaulichen Christianssund wird die Leiche eines Rennradfahrers gefunden. Zunächst deutet alles auf einen Sturz mit tödlichen Folgen hin. Bis einige Wochen später der beste Freund des Radfahrers ebenfalls tot aufgefunden wird. Gibt es einen Zusammenhang zwischen den beiden Todesfällen? Privatdetektiv Dan Sommerdahl hat eigentlich keine Zeit, dieser Frage nachzugehen, denn er ist gerade dabei, ein ganz persönliches Geheimnis zu lösen: Er versucht, seinen Vater zu finden, den er nie getroffen hat und von dem er nicht einmal den Namen kennt. Doch dann muss er feststellen, dass die Fragen, vor denen er steht, auf gefährliche Weise zusammenhängen …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 579
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anna Grue
Wie der Vater, so der Sohn
Aus dem Dänischen von Ulrich Sonnenberg
Für Jesper. Wie immer.
Die wichtigsten Personen
Lars-Erik Snapp
toter Fotohändler und Rennradfahrer
Eva Nielsen
seine Witwe, Gesundheits- und Krankenpflegerin
Josefine Nielsen
ihre Tochter
Uffe Hjortbjerg
Immobilienmakler
Lisbeth Hjortbjerg
Gesundheits- und Krankenpflegerin
Lukas Hjortbjerg
Bankangestellter und Rennradfahrer
Emma Hjortbjerg
Schülerin der Handelsschule
Bent Gørding
Rechnungsprüfer, Kassenwart des Radsportclubs Christianssund (RCC)
Jytte Gørding
seine Frau
Moheem Naqvi
Fotohändler
Leilah Naqvi
seine Frau
Fatma Naqvi
seine Cousine
Dan Sommerdahl
Werbefachmann und Detektiv
Marianne Sommerdahl
seine Exfrau
Laura und Rasmus Sommerdahl
ihre Kinder
Birgit Sommerdahl
Dans Mutter
Bente Petri
Dans Schwester
Flemming Torp
Leiter der Ermittlungsabteilung
Pia Waage
seine Stellvertreterin
Juli 2015
Der Unfall war am frühen Morgen passiert. Ausnahmsweise war es sonnig, die Sicht perfekt, die Straße trocken, und die Baugrube neben dem Fahrrad- und Fußgängerweg hatte man deutlich mit orangefarbenen Leitkegeln und weißen Holzschranken abgesperrt. Der Verunglückte, ein dreiundfünfzigjähriger routinierter Rennradfahrer, kannte seine tägliche Route durch Vestervangen zudem gut. Alles deutete darauf hin, dass er den letzten steilen Hügel vor dem südöstlichen Ausgang des Parks in hohem Tempo hinuntergefahren war, dennoch blieb unerklärlich, wie er die Absperrung hatte übersehen können, die schon aus über hundert Metern Entfernung zu erkennen war.
Eine Joggerin hatte Lars-Erik Snapp gefunden. Er lag am Boden der zwei Meter tiefen und anderthalb mal vier Meter großen Baugrube. Das Loch hatten am Vortag ein paar Arbeiter der Gemeindeverwaltung ausgehoben, die ein altes Abflussrohr austauschen wollten, mit dem die öffentliche Toilette in der Hütte am Eingang des Parks an die Kanalisation angeschlossen war. Eigentlich sollten die Arbeiten nur einen Tag dauern, doch es gab Probleme, und die Baugrube wurde, nach Rücksprache mit der Verwaltung, nicht gleich wieder aufgefüllt. Die Arbeiter sicherten die Baustelle ordnungsgemäß ab und gingen nach Hause.
Gegen sieben Uhr war die Joggerin, eine zwanzigjährige Handelsschülerin, vom Parkplatz in den Park gelaufen und hatte sich mit Pharrell Williams’ Happy in den Ohren, das auf ihrem Smartphone lief, mental auf den »Teufelshügel« vorbereitet, wie die örtlichen Jogger die Anhöhe nannten. Zweifellos wäre sie an der Baugrube vorbeigelaufen, ohne den Toten zu bemerken, wenn ihr nicht ausgerechnet in dem Moment, als sie die Absperrung passierte, einer der Ohrstöpsel ihres Headsets herausgefallen wäre. In den wenigen Sekunden, in denen sie langsamer lief und das weiße Ding wieder an seinen Platz steckte, streifte ihr Blick den Boden der Grube und blieb an etwas Unerwartetem hängen. Einem Bein. Einem braun gebrannten, behaarten Männerbein mit einem schwarzen Fahrradschuh.
Olivia war stehen geblieben und langsam an die Absperrung herangetreten. Die Leiche lag an der Südwand der Grube, der Körper hing in einem völlig falschen Winkel auf einem mattschwarzen Carbon-Rennrad, das eine schwere Acht im Vorderrad hatte. Auf dem Kopf saß noch immer der stromlinienförmige Fahrradhelm. Der Tote trug ein enganliegendes Fahrradtrikot, dessen schrilles Neongrün angesichts der ernsten Situation gänzlich unangemessen schien.
Olivia wurde später von allen für ihre Besonnenheit gelobt, instinktiv hatte sie die unpassend fröhliche Musik ausgeschaltet und die Notrufzentrale angerufen. Sie war bis zum Eintreffen der Polizei und eines Krankenwagens bei dem Toten geblieben und machte dann bei einem netten Beamten mit großen Ohren eine Aussage. Als die Formalien überstanden waren, setzte sie sich in das Auto ihres Vaters und ließ sich nach Hause fahren. Die Polizei hatte darauf bestanden, ihren Vater anzurufen. Olivia war zunächst der Ansicht gewesen, es sei albern – als wäre sie nicht in der Lage, die paar Hundert Meter nach Hause zu gehen –, als sie dann jedoch auf dem Beifahrersitz gesessen hatte, war sie zusammengebrochen. Ihre Hände hörten erst einige Stunden später auf zu zittern.
Die Körpertemperatur des Toten betrug noch über dreißig Grad, als der Gerichtsmediziner eine erste Untersuchung vornahm, er hatte also nicht lange in der Grube gelegen. In der hinteren Tasche seines Fahrradtrikots fand die Polizei ein Mobiltelefon und eine Kreditkarte, und wenige Minuten später waren Name und Adresse ermittelt. Lars-Erik Snapp, Præstevænget 17. Ein paar Beamte informierten dort die Witwe.
Die Obduktion hatte als Todesursache einen Genickbruch ergeben. Auch alle weiteren Verletzungen hatte Snapp sich bei dem Sturz zugezogen. Es deutete nichts auf einen Schlaganfall, Herzversagen oder irgendetwas anderes hin, das ein plötzliches Unwohlsein hervorgerufen haben könnte. Und nach einer gründlichen polizeitechnischen Untersuchung stand fest, dass auch Lars-Erik Snapps Fahrrad einwandfrei gewesen war. Mit anderen Worten, es gab keine vernünftige Erklärung für den Unfall. Es war ein Rätsel, das sich niemals lösen lassen würde. Ein unerklärlicher Unfall, wie der Polizeisprecher es ausdrückte.
Der Unfall war am Tag darauf der Aufmacher der Christianssund Tidende. Lars-Erik Snapps Fotogeschäft am Bahnhofsplatz war in der ganzen Stadt bekannt, allein schon wegen seines einprägsamen Namens: Snapp-Shot. Zwei Tage nach dem Unfall veröffentlichte die Zeitung einen längeren Nachruf und eine Woche später eine Notiz über die Untersuchungsergebnisse der Polizei zur Unfallursache.
Auch über die Beerdigung berichtete ein Journalist der Tidende. Die Mitglieder des Radsportclubs Christianssund hatten für einen auffallenden Sargschmuck zusammengelegt. Weiße Lilien, die um ein Rad mit dünnen Leichtgewicht-Speichen zu einem Kranz geflochten waren. Was die Witwe von diesem Einfall hielt, meldete der Bericht nicht. Eva Nielsen hatte sich gegenüber der Zeitung nicht geäußert, auch bei der Beerdigung blieb sie für sich und wehrte jeden Versuch eines Interviews ab.
Aus ihrem Gesicht ließ sich unmöglich irgendetwas ablesen. Blass und verschlossen. Keine einzige Träne. Der Mangel an öffentlicher Trauer hatte unweigerlich zu Gerede geführt, und als der Trauergemeinde dann auch noch auffiel, dass Lars-Eriks und Evas Tochter nicht zur Beisetzung gekommen war, kursierten alle möglichen Gerüchte.
Was war das nur für eine Familie?
Montag, 28. September 2015
1
»Auf den ersten Blick scheinen Ihre Blutwerte in Ordnung zu sein, aber ich möchte Sie bitten, im Labor in der Hökergyden noch eine genauere Untersuchung machen zu lassen.« Torben Pedersen wandte den Blick von seinem Computerbildschirm ab und sah Dan Sommerdahl an, der auf der anderen Seite des Schreibtischs im Sprechzimmer des Arztes saß. »Ich möchte ganz sichergehen, dass Sie körperlich völlig gesund sind.«
Dan nickte. »Gut.« Nachdem er und Marianne sich vor drei Jahren definitiv getrennt hatten, wollte er nicht mehr bei seiner Exfrau in Behandlung bleiben und hatte sich auf gut Glück sofort einen anderen Arzt gesucht, tatsächlich war es das erste Mal, dass er ihn aufsuchte.
»Wie ich sehe, hatten Sie diese Symptome schon früher.«
»2006 hatte ich eine leichte Depression«, erwiderte Dan. »Stressbedingt. Ich habe ein Jahr lang Cipralex genommen.«
»Keine Gesprächstherapie?«
»Na ja, ich habe mit einem Psychiater gesprochen, wenn das Rezept erneuert werden musste. Ich weiß nicht, ob man das Therapie nennen kann.«
Torben Pedersen nickte. »Und diesmal? Fühlen Sie sich zurzeit wieder gestresst?«
Dan zuckte mit den Schultern. »Nein, eigentlich nicht. Ich bin Freiberufler, das heißt, ich kann das Tempo selbst bestimmen.«
»Selbstständig zu sein kann ja auch stressen.«
»Also, es ist nicht so, dass ich überarbeitet bin, wenn Sie das meinen. Eigentlich ist es in der letzten Zeit fast schon ein bisschen zu ruhig. Ich werde nicht gerade mit Aufträgen aus der Werbung überschüttet und musste ein paar Detektivjobs annehmen, die nicht besonders inspirierend waren.« Erneutes Achselzucken. »Aber sie haben mir zur Butter auf dem Brot verholfen.«
»Detektivjobs? Klingt spannend.« Torben Pedersen lehnte sich auf seinem Bürostuhl zurück.
»Überhaupt nicht. Ich habe einer Frau nachspioniert, deren Arbeitgeber überzeugt war, sie hätte sich zu Unrecht sehr lange krankschreiben lassen und eigentlich nur keine Lust zu arbeiten. Für einen anderen Kunden habe ich unglaublich viele Stunden damit verbracht, Videoaufzeichnungen aus Überwachungskameras auszuwerten, weil er wissen wollte, welcher seiner Angestellten im Lager Diebstähle beging. So etwas. Wirklich langweilig.«
»Hätten Sie diese Aufgaben vor einem halben Jahr auch schon langweilig gefunden?«
Dan sah aus dem Fenster, während er über die Frage nachdachte. »Vielleicht nicht ganz so langweilig«, räumte er ein.
»Okay«, sagte der Arzt, als ihm klar wurde, dass Dan das Thema nicht vertiefen wollte. »Klingt nicht so, als läge es diesmal an der Arbeit. Ist in Ihrem Privatleben etwas vorgefallen, das Sie gestresst haben könnte?«
»Meine Mutter hatte vor ein paar Wochen eine Hirnblutung und liegt im Krankenhaus. Morgen kommt sie ins Pflegeheim, dann müssen meine Schwester und ich ihr Haus ausräumen und verkaufen.«
»Ja, das ist zweifellos eine Belastung.«
»Ich habe ohnehin den Eindruck, von Krankheiten umgeben zu sein. Mein bester Freund hat vor anderthalb Jahren einen Rückfall bei seiner Leukämie erlitten.«
»Auch das ist ein heftiger Stressfaktor, Dan.«
»Schon, aber er ist inzwischen wieder gesund. Eine Knochenmarktransplantation hat ihm geholfen.«
»Gut.«
Alles andere, was mit Flemmings Krankheit zu tun hatte, erwähnte Dan nicht. Es war einfach zu kompliziert, es Außenstehenden zu erklären.
»Haben Sie Kinder?«
»Zwei. Einen dreißigjährigen Sohn und eine sechsundzwanzigjährige Tochter.«
»Sehen Sie sich oft?«
»Rasmus arbeitet zurzeit an einem Film in London. Aber wir skypen ab und zu.« Wieder blickte Dan aus dem Fenster auf den Platz, auf dem eine neue zweistöckige Fahrradparkstation aufragte und teilweise die Sicht auf den Bahnhof versperrte.
»Laura studiert in Kopenhagen. Früher habe ich sie ziemlich häufig gesehen, aber seit sie mit ihrem Freund zusammengezogen ist …« Er hielt inne.
»Und Ihre Exfrau? Haben Sie Kontakt zu ihr?«
»Manchmal.«
»Haben Sie eine Freundin?«
»Zurzeit nicht.« Dan blickte erneut auf den hochgelobten Fahrradschuppen, bis ihm bewusst wurde, dass es einige lange Sekunden still im Raum gewesen war. Er begegnete Torben Pedersens Blick. »Was ist?«
»Sie sind einsam, Dan.«
»Natürlich nicht«, entgegnete Dan gereizt. »Ich komme zu Ihnen und erzähle Ihnen, dass ich Schlafprobleme habe – und sofort glauben Sie, ich sei gestresst, deprimiert, einsam und alles Mögliche mehr.«
Der Arzt beugte sich vor. »Sie können nicht schlafen, obwohl Sie müde sind. Sie sind offensichtlich gereizt, und Sie sind selten mit Ihren Kindern zusammen. Sie leben in keiner stabilen Zweierbeziehung. Ihre Mutter und Ihr bester Freund haben oder hatten ernsthafte gesundheitliche Probleme. Sie finden Ihre Arbeit langweilig, obwohl sie Ihnen sonst Spaß macht. Das klingt unweigerlich so, als befänden Sie sich in der Gefahrenzone, Dan.«
Dans Gesicht verzog sich zu einer irritierten Grimasse. »Als ich damals eine Depression hatte, ist sie von Stress ausgelöst worden. Und ich habe ja gerade gesagt, dass ich nicht gestresst bin.«
»Man muss nicht unbedingt gestresst sein. Alles deutet darauf hin, dass Sie depressionsgefährdet sind, Ihre Reaktion ist deshalb auch nicht ungewöhnlich …«
»Mir fehlt nichts«, unterbrach Dan den Arzt. »Ich schlafe nachts schlecht und leide deshalb unter chronischem Schlafmangel. Das ist nicht unbedingt die beste Voraussetzung für ein abwechslungsreiches gesellschaftliches Leben und glänzende Laune, oder?«
»Ich glaube, Sie sind auf dem direkten Weg in eine Depression, Dan.« Als Dan nichts erwiderte, fuhr er fort: »Ich würde Sie gerne an einen Psychiater überweisen, damit Sie gemeinsam mit ihm herausfinden, was …«
»Diese Glückspillen werde ich nicht wieder nehmen«, fiel Dan ihm ins Wort.
Nun verzog der Arzt das Gesicht. »Der Ausdruck ist ziemlich unangemessen, Dan.«
»Einverstanden. Dann eben Antidepressiva. Ich will sie nicht.«
»Was wollen Sie dann?«
»Keine Ahnung. Können Sie mir nicht etwas verschreiben, damit ich schlafen kann?«
»Das könnte ich schon, nur …«
»Hauptsache, ich komme aus dieser Käseglocke, dann werde ich mich schon zusammenreißen und wieder anfangen zu joggen. Ich weiß, dass es sofort hilft, wenn ich mich bewege, aber ich habe einfach nicht die Energie dazu, wenn ich jeden Tag nur ein paar Stunden Schlaf bekomme.«
Der Arzt sah ihn an, nickte. »Ich kann Sie nicht zwingen, mit einem Psychiater zu reden«, erklärte er. »Ich verschreibe Ihnen für die nächsten zehn Tage Schlaftabletten. Dann kommen Sie wieder, damit wir uns unterhalten, wie es Ihnen geht, und um uns die Laborergebnisse anzusehen. Einverstanden?«
*
Dan besorgte sich die Tabletten in der Apotheke und kaufte auf dem Heimweg ein. Kaffee, Rotwein und ein Schawarma von dem Imbiss an der Ecke Hafenpromenade und Bagergade.
Er aß vor dem Fernseher und blieb, nachdem er aufgegessen hatte, noch eine Viertelstunde sitzen und kämpfte mit dem Schlaf, während er sich eine Diskussion beunruhigter Politiker über die katastrophale Flüchtlingssituation in Europa ansah. Dan meinte, sämtliche Argumente schon einmal gehört zu haben. Es war erst kurz vor sechs, aber er hatte das Gefühl, ins Bett gehen und schlafen zu können. Um zehn, dachte er und stand auf. Um zehn gehe ich ins Bett – nicht eine Sekunde früher. Wenn die Schlaftabletten ihm zu einem vernünftigen Schlafrhythmus verhelfen sollten, durfte er nicht schon am frühen Abend einnicken.
Entschlossen stellte er den Fernseher ab, blieb mit der Fernbedienung in der Hand stehen und ließ seinen Blick durchs Zimmer schweifen. Hier sieht’s aus wie bei einem Teenager, dachte er. Pizzaschachteln, benutztes Geschirr, zerlesene Zeitungen, Stapel ungeöffneter Post, ein Haufen Wäsche. An der Wand lehnte ein Ib-Andersen-Plakat, in einem Rahmen ohne Glas. Es war kaputt gegangen, als der Rahmen im letzten Sommer von der Wand fiel, und er hatte noch immer kein neues Glas einsetzen lassen.
Eigentlich war Dan ein fast schon übertrieben ordentlicher Mensch. Er bezahlte seine Rechnungen pünktlich, ernährte sich vernünftig, trieb Sport, räumte hinter sich auf und war stolz darauf, immer frisch gebügelte Hemden im Schrank zu haben. Doch in den letzten Monaten war ihm alles entglitten. Wie hatte sich nur dieses Chaos entwickeln können, ohne dass es ihm aufgefallen war? Objektiv betrachtet bestätigte der Zustand der Wohnung die Theorie des Arztes, dass er auf eine neue Depression zusteuerte, das musste er zugeben. Und dann wurde ihm plötzlich noch etwas klar: Man sah genau, dass seit mehreren Wochen – vielleicht sogar seit mehreren Monaten – niemand mehr in seiner Wohnung zu Besuch gewesen war. Hatte Torben Pedersen recht? War er einsam?
Ein bisschen, ja. Ein wenig einsam war er tatsächlich. Dan setzte sich wieder aufs Sofa und goss sich noch ein Glas ein. Einundfünfzig Jahre alt und verdammt oft alleine, ging ihm durch den Kopf. Die Kinder lebten ihr Leben, und das war auch gut so. Kollegen hatte er schon lange nicht mehr, und die Menschen, mit denen er beruflich zu tun hatte, waren Kunden, keine Freunde. Vor allem nachdem er wegen seiner schwierigen finanziellen Verhältnisse den Platz in der Bürogemeinschaft in der Garverstræde aufgeben musste, gab es niemanden aus seinem professionellen Umfeld mehr, mit dem er regelmäßig Kontakt hatte. Und schon gar nicht außerhalb der Arbeitszeit.
Seit dem endgültigen Bruch mit Marianne hatte er einige kurze Affären gehabt, aber nichts hatte sich zu etwas Ernsthaftem entwickelt. Den Frauen gefiel er noch immer, und Dan war auch weiterhin ein Freund der Frauen, an mehr oder weniger offenen Angeboten, zusammenzuziehen, hatte es nicht gefehlt, er hätte leicht eine neue Frau, eine neue Familie haben und von vorn beginnen können. Doch das wollte er auf keinen Fall. Normalerweise behauptete er, das Junggesellenleben zu schätzen, das war jedoch nicht die ganze Wahrheit. Dan war immer wählerisch gewesen, und daran hatte sich mit dem Alter nichts geändert. Erst vor ein paar Monaten hatte er die Beziehung zu einer vierunddreißigjährigen Anwältin beendet, die keinen Hehl aus ihrem Wunsch gemacht hatte, zu heiraten und Kinder zu bekommen. Die unterschiedlichen Erwartungen an ihre Beziehung waren irgendwann so offensichtlich gewesen, dass Dan das Verhältnis nur beenden konnte. Er bereute es nicht, sein Privatleben war seitdem jedoch weniger erfüllt, das musste er zugeben.
Und es gab Flemming Torp, Dans besten Freund seit ihrer gemeinsamen Zeit auf dem Gymnasium. Sie waren noch immer befreundet, nur hatte sich ihr Verhältnis in den letzten Monaten, na ja, verkompliziert, das war wohl das richtige Wort, dachte Dan und trank einen Schluck Wein. Als Flemming vor anderthalb Jahren einen Rückfall seiner AML – Akute Myeloische Leukämie – erlitten hatte, versuchten Dan und seine Exfrau Marianne, ihn so gut es ging zu unterstützen. Sie vergaßen ihr ganzes nacheheliches Gezänk und arbeiteten zusammen, um ihrem todkranken Freund das Leben so leicht wie möglich zu machen. Flemming hasste es, im Krankenhaus zu liegen, um aber als Patient der hämatologischen Abteilung des Rigshospitals zu Hause übernachten zu dürfen, war es notwendig, mit jemandem zusammenzuwohnen. Dan hatte, ohne zu zögern, zugestimmt, als Marianne Flemming in ihre alte gemeinsame Wohnung in der Gørtlergade einziehen ließ. Nach der Knochenmarktransplantation war Flemming gezwungen, im Krankenhaus zu bleiben, doch in den langen Phasen der Chemotherapie und der Reha wohnte er bei Marianne, die in ihrer Doppelrolle als enge Freundin und praktizierende Ärztin die optimale Mitbewohnerin war.
Zunächst hatte Flemming sein eigenes Haus nur vermietet, er ging wie alle anderen davon aus, wieder dort einzuziehen, wenn er die Krankheit überlebte. Als die Krise dann überstanden und er geheilt war, verkaufte er sein gelbes Backsteinhaus dann aber doch. Flemming und Marianne fühlten sich zusammen wohl. Ein bisschen zu wohl, wenn man Dan fragte.
Allerdings hatte er selbst sich vor etwas mehr als drei Jahren aus der sowieso nur noch fragmentarischen Beziehung zu Marianne verabschiedet. Schon deshalb war es vollkommen unangemessen, sich darüber zu beklagen, dass es ihr ohne ihn offensichtlich ausgezeichnet ging. Sie brauchte Dan nicht mehr. Ebenso wenig wie Flemming ihn brauchte, immer wieder musste Dan die Initiative ergreifen und ein Treffen vorschlagen. Rasmus und Laura liebten ihren Vater natürlich auch weiterhin, dennoch hatten beide nicht unbedingt das Bedürfnis nach einem engeren Kontakt. Seine kranke Mutter, ja, sie brauchte ihn, nur war ihr Verhältnis seit der Hirnblutung eine reine Einbahnstraße, eine Situation, aus der sich weder Energie noch Lebenslust ziehen ließ. Alles in allem hatte der Arzt wohl recht: Dan war ein wenig einsam.
Er richtete sich auf. Saß er tatsächlich hier und schwelgte in Selbstmitleid? Er, Dan Sommerdahl? Das darf doch nicht wahr sein, dachte er und stand auf. Er ging in die Küche und holte einen schwarzen Müllsack. Er würde den Abend nutzen, um auszumisten, damit er nicht in diesem Chaos aufstehen musste, wenn er hoffentlich zum ersten Mal seit Monaten eine ganze Nacht durchgeschlafen hatte. Morgen wird alles schon wieder sehr viel heller aussehen, beschloss er.
Dienstag, 29. September 2015
2
Lars-Erik Snapps Witwe fuhr auf dem Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad durch Vestervangen. Es war erst kurz vor sieben, die Fahrradlampe leuchtete nur ein kleines Stück des asphaltierten Weges aus und ließ den Wald zu beiden Seiten noch dunkler aussehen, doch für Eva Nielsen war das kein Problem: Sie war diese Strecke den größten Teil ihres Leben und zu jeder Tageszeit gefahren, sie kannte jeden Meter des Waldwegs so gut wie ihren Gemüsegarten.
Die Luft war kühl, aber Eva schwitzte, als sie das letzte Stück den Hügel hinauf aus dem Sattel steigen und ihr ganzes Gewicht in die Pedale legen musste. So spare ich mir das Fitnessstudio, dachte sie wie gewöhnlich, als sie an der Sitzbank auf der Anhöhe vorbeifuhr. Jeden Morgen am selben Ort dieselbe Assoziation. Merkwürdig, wie sklavisch so ein Gehirn funktionierte. Eva setzte sich erleichtert wieder auf den Sattel, nun ging es bergab, und sie bremste, um nicht zu sehr zu beschleunigen, denn sie wusste nur zu gut, wie gefährlich der steile Abhang sein konnte. Im Licht der letzten Straßenlaterne vor der Ausfahrt ließ der spärlichere Bewuchs auf dem Waldboden noch immer ein anderthalb mal vier Meter großes Rechteck erahnen. Hier war die Baugrube gewesen. Eva fuhr schneller, ohne hinzusehen, sie war spät dran.
Die Kolleginnen von der Nachtschicht warteten ungeduldig darauf, dass die Ablösung erschien und den Bewohnern des Pflegezentrums ihr Frühstück servierte. Am Vormittag würde eine neue Patientin kommen, Eva sollte sie begrüßen und Frau Sommerdahl beim Einzug helfen. Apartment 36 war nach dem letzten Bewohner gründlich renoviert worden, und Frau Sommerdahls Tochter, eine ältere Frau namens Bente Petri, hatte das bescheidene Zimmer gestern mit den Möbeln, den Bildern und dem Nippes der alten Dame eingerichtet. Ein altes Puppenhaus stand auf einer Kommode in einer Ecke, und mithilfe einer verblichenen Patchworkdecke und einiger handbestickter Kissen wurde die Krankenhausanmutung des hohen Pflegebetts kaschiert. Ein abgenutzter Sessel, laut Aussage der Tochter ein wertvoller Designklassiker, stand am Fenster. In Evas Augen war der Sessel ein hässlicher, sperriger Klotz, aber die Tochter hatte darauf bestanden. Sie wusste, dass ihre Mutter diesen Wegner-Sessel liebte, und selbstverständlich sollte er auch in ihrer letzten Wohnung stehen. Eva hatte mit einem Achselzucken nachgegeben. Letztlich entschieden die Bewohner und ihre Angehörigen über die Möblierung.
Sie hängte ihren Mantel an die Garderobe und wechselte die Schuhe. Die Arbeitskleidung – ein hellblauer Kittel und marineblaue Turnschuhe – hatte sie bereits zu Hause angezogen. Es gab keinen Dresscode für die Angestellten des Pflegezentrums, die meisten trugen in der Arbeitszeit ihre private Kleidung, Eva war in diesem Punkt altmodisch und bestand darauf, dass es auch bei der Kleidung einen Unterschied zwischen Arbeit und Freizeit geben musste. Sie ging in den Personalraum und goss sich eine Tasse Kaffee aus der Thermoskanne ein. Ein wenig Milch, eine Süßstofftablette. Sie sah ihr verdoppeltes, leicht verzerrtes Spiegelbild in der Thermoscheibe, während sie den Kaffee in kleinen Schlucken trank. Draußen wurde es allmählich hell. Eva stellte die Tasse in die Spülmaschine, bevor sie mit der täglichen Arbeit begann. Zusammen mit einer Kollegin half sie Frau Clausen aus Apartment 41 ins Bad und danach beim Anziehen. Die eigentlich recht selbstständige Dame im Nachbarzimmer hatte eine schlechte Nacht und brauchte ein wenig Ansprache, außerdem musste Eva einem verwirrten älteren Herrn aus einem der anderen Wohnhäuser des Zentrums nach Hause helfen. Medikamente waren zu dosieren, Windeln zu wechseln und verschwundene Wollknäuel unter Sofas hervorzuholen. Eine Aufgabe löste die nächste ab, die Zeit verging schnell.
Eva hatte die neue Bewohnerin fast vergessen, als die Abteilungsleiterin sie gegen elf Uhr abholte. Sie hatten sich bereits alle in dem kleinen Apartment versammelt: Birgit Sommerdahl in ihrem Rollstuhl, ihre Tochter Bente und ein großer, kahlköpfiger Mann, den Eva noch nie gesehen hatte.
»Ich bin Birgits Sohn, Dan Sommerdahl.« Sein Händedruck war fest, die Augen ungewöhnlich blau. »Und Sie müssen die … Krankenschwester sein. Heißt das auch so?«
»Gesundheits- und Krankenpflegerin, wenn Sie die genaue Berufsbezeichnung wissen wollen. Eva Nielsen.«
»Sie haben das Zimmer aber sehr schön eingerichtet.«
»Danke, aber das ist vor allem das Verdienst Ihrer Schwester.« Eva riss sich von den blauen Augen los und konzentrierte sich auf die alte Dame im Rollstuhl. »Guten Tag, Birgit«, sagte sie und griff nach der Hand der neuen Bewohnerin. »Willkommen im Birkenhaus. Ich hoffe, Sie werden sich hier wohlfühlen.«
»Ang«, sagte Birgit Sommerdahl. Die rechte Seite ihres Gesichts und ihres Körpers waren nach der Hirnblutung gelähmt, sie hatte die Fähigkeit zu sprechen verloren. »Ah ang.«
Eva betrachtete die Grimasse, bei der Brigit die gesunde Seite des Gesichts nach oben zog. Sie hielt es für ein Lächeln.
»Mutters Lähmung ist noch ziemlich schlimm«, erklärte Bente. »Aber die Ärzte sagen, dass es sehr viel besser werden kann. Wir trainieren jeden Tag, nicht wahr, Mutter?«
Eine neue Grimasse.
»Nur, dass wir uns recht verstehen«, fuhr Bente fort und wandte sich an Eva. »Mutter hat Probleme zu sprechen, aber sie versteht alles, was gesagt wird.«
»Daran habe ich keine Sekunde gezweifelt.« Eva lächelte Birgit zu. Etwas an der Erscheinung der alten Frau sagte ihr, dass sie nicht immer so schmächtig gewesen war. Die Schultern waren noch breit, ihre Statur schien kräftig genug, um ein gewisses Körpergewicht tragen zu können, das Alter und der lange Krankenhausaufenthalt hatten sie allerdings abmagern lassen, sodass sie nun aussah, als könnte man sie im Handumdrehen hochheben.
»Ziehen Sie doch die Mäntel aus«, sagte Eva und fing zusammen mit Bente an, Birgit aus einem großen gehäkelten Schal in klaren Farben zu wickeln. Die alte Dame half mit ihrer funktionierenden linken Hand mit, so gut sie konnte. Bente band die Schuhe ihrer Mutter auf, holte ein paar Wollpantoffel und zog sie ihr an.
Der Sohn sah ein wenig hilflos zu. So ist es ja oft, ging es Eva durch den Kopf. Die Männer fühlten sich durchweg ein wenig unwohl bei dem eher intimen Teil der Pflegearbeit. An- und auskleiden, zu Bett bringen, bei der persönlichen Hygiene halfen fast immer nur die Töchter. Dan Sommerdahl drehte sich um und schaute aus der nach Westen gelegenen Terrassentür. Vom Zimmer seiner Mutter konnte man die gesamte Anlage überblicken, in deren Mitte ein paar hundertjährige Linden mit ihren herzförmigen Blättern winkten. Auf der anderen Seite der Rasenfläche lagen das Eichenhaus und das Ulmenhaus, beide spezialisiert auf Bewohner mit Demenzkrankheiten, und noch weiter entfernt stand das Buchenhaus. In einem fünften Gebäude war – außer der gemeinsamen Verwaltung, dem Empfang, der zentralen Küche, dem Untersuchungsraum, dem Tageszentrum, der Physiotherapie und der Zentrale für die häusliche Pflege – auch ein Café untergebracht, in dem die Bewohner mit ihren Angehörigen essen konnten. Es war naheliegend, dass sich das größte und modernste Pflegezentrum von Christianssund Waldhof nannte.
Was geht diesem Dan Sommerdahl wohl durch den Kopf, wenn er so auf den Rasen starrt? Ist er traurig, dass seine Mutter hier wohnen soll? Oder will er sie nur schnell hier unterbringen, um dann unbelastet sein eigenes Leben weiterleben zu können? Eva Nielsen hatte in ihrem langen Arbeitsleben alle möglichen Reaktionen bei Angehörigen erlebt und es längst aufgegeben, verwundert oder verärgert über etwas zu sein. Es war so leicht, genau zu wissen, welche Gefühle andere Menschen gegenüber ihrem Vater oder ihrer Mutter haben sollten. Die Wahrheit war, dass die Konflikte, die manchmal seit Jahren in einer Familie schwelten, nicht einfach verschwanden, nur weil eine der Hauptpersonen allmählich das Ende des Weges erreicht hatte. Die gebrechliche Frau, die jetzt in einem Rollstuhl saß, außerstande, auch nur einer Fliege etwas zuleide zu tun, könnte durchaus eine dominante Xanthippe gewesen sein, als ihre Kinder aufwuchsen. Dann ließe sich jetzt nur schwer etwas dagegen sagen, wenn die Kinder eine gewisse Erleichterung darüber empfanden, die Verantwortung anderen überlassen zu können.
Hier ist es offenbar nicht so, stellte Eva fest, als sie in diesem Moment bemerkte, dass Dans Augen feucht waren. Er räusperte sich und lächelte ein wenig zu breit. »Es ist wirklich schön hier«, sagte er. »Was meinst du, Mutter?«
Die alte Dame nickte schief und verzog noch einmal ihr Gesicht zu einer Grimasse, die sicher ein Lächeln darstellen sollte. »Aahhh.«
»Möchtest du ein bisschen Musik hören?« Dan wandte das Gesicht ab und wischte sich mit dem Handrücken die Augen aus, bevor er zu dem CD-Player auf dem Nachttisch ging. »Was möchtest du hören? Beethoven?« Er betrachtete das Gesicht seiner Mutter. »Chopin? Ja?« Er suchte in der beachtlichen Sammlung von CDs im Regal. »Sag mir, wenn ich die richtige habe«, bat er.
Bente sah Eva an. »Könnten Sie mir zeigen, wo es eine Kaffeemaschine gibt? Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen stärken.«
Eva begleitete Birgits Tochter in die Bewohnerküche. Während der Kaffee durchlief, erklärte sie, dass man auch gern in der kleinen Küche des Apartments Kaffee kochen dürfe, außerdem gebe es dort auch einen Kühlschrank für eigene Lebensmittel der Bewohner. Aber man könne ebenso gut die Kaffeemaschine der Gemeinschaftsküche nutzen.
»Denken Sie daran, dass Birgits Apartment jetzt ihr privates Zuhause ist«, fuhr sie fort, als sie ein paar Tassen auf ein Tablett stellte. »Wir sorgen natürlich dafür, dass es sauber und aufgeräumt ist und im Kühlschrank nichts schlecht wird, sonst entscheidet Birgit selbst.«
Als sie keine Antwort bekam, drehte Eva sich um und sah, dass Bente weinte. Sie streckte spontan ihren Arm aus und legte eine Hand auf Bentes Schulter. »Ja, es ist schwer, ich weiß.«
Bente ließ sich ein Stück Küchenrolle geben. »Es ist …«, begann sie und tupfte die Tränen ab. »Es ist hart. Und es wird auch nicht besser, nicht wahr?«
»Ach, jetzt warten wir mal ab, wie es aussieht, wenn Birgit ernsthaft mit den Reha-Maßnahmen begonnen hat«, tröstete Eva. »Es wird natürlich einige Zeit dauern.«
»Ja, ja«, unterbrach sie Bente, »das sagen alle, aber wir reden über Marginalien, oder? Gesund wird sie nie wieder sein.«
»Nicht ganz gesund, aber …«
»Sie wird nie wieder sprechen können. Jedenfalls nicht richtig.«
»Wir werden uns alle Mühe geben.«
Bente nickte. Sie muss als junge Frau hübsch gewesen sein, dachte Eva. Dunkel, mit markanten Wangenknochen, ihre Körperhaltung war noch immer aufrecht, obwohl sie ein wenig müde und abgekämpft wirkte. Eva wusste nur zu genau, wie es dazu kam. Sie sah in letzter Zeit selbst ziemlich mitgenommen aus, obwohl sie schlank und in Form geblieben war. Ihr kurzes blondes Haar wirkte ausgeblichen, es hatte einen hässlichen grau-welken Farbton angenommen, und die Falten rund um ihre Augen waren tiefer als bei anderen Frauen von Anfang fünfzig. Lars-Eriks Tod und die ganze Situation zu Hause hatten ihre Spuren hinterlassen, das wusste sie genau.
»Ich habe solche Angst, dass meine Mutter sich langweilt«, sagte Bente, der erneut die Tränen kamen. »Sie ist immer so aktiv gewesen. Geschickt mit den Händen, patent in der Küche. Niemand konnte so gut kochen wie Mutter, niemand so gut stricken.« Ihre Stimme brach ab. Sie atmete tief durch und fügte dann hinzu: »Ihr Garten war der schönste von ganz Yderup. Sie hat jeden Tag Stunden darin verbracht.«
»Das klingt, als hätte Birgit ein gutes Leben gehabt.«
»Das hatte sie. Ich kenne niemanden, der sich für so viele Dinge interessiert hat wie sie. Sie hat immer viel gelesen. Obwohl sie meinen Bruder und mich allein großgezogen hat, hatte sie immer Zeit, ganze Stapel von Büchern zu verschlingen. Eine meiner frühesten Erinnerungen an meine Mutter ist, dass sie auf dem Spielplatz die Nase in ein Buch steckte, statt auf mich aufzupassen.«
Bente schüttelte den Kopf. »Und jetzt kann sie nicht mehr lesen. Ja, also sie kann schon, wenn das Buch auf einem Ständer steht, aber sie kann sich nicht mehr sehr lange konzentrieren. Sie ist schnell erschöpft, und es fällt ihr sichtlich schwer, den Sinn zu erfassen.«
»Haben Sie es mit Hörbüchern versucht? Viele unserer Bewohner sind sehr zufrieden damit.«
»Bisher nur einmal. Sie wird schnell zu müde.« Bente riss sich noch ein Blatt von der Küchenrolle ab. »Ich würde ihr die kleine Freude gern gönnen. Es wäre wirklich schade, wenn sie nur herumsäße und sich langweilte.«
»Das kommt schon, wenn sie wieder ein bisschen zu Kräften gekommen ist.«
Bente zuckte mit den Schultern. »Sie kann Musik hören, das ist alles.«
»Warten Sie’s ab. Welche Art Bücher mag Birgit denn besonders gern? Ich kann ihr ja ein Hörbuch leihen, wir könnten es jeden Tag mit ein paar Minuten versuchen.«
»Dänische Literatur. Ida Jessen, Thorstein Thomsen, Helle Helle. Und ich weiß, dass sie Svend Aage Madsen besonders gern gelesen hat, aber seine Bücher sind jetzt zu kompliziert für sie.«
Eva kannte keinen der Namen, die Bente aufgezählt hatte. »Keine Krimis?«
»Nein.« Bente putzte sich die Nase. »Ich habe übrigens eine Flasche Gammel Dansk dabei. Darf sie ein Gläschen?«
»Selbstverständlich. Es gibt hier doch kein Alkoholverbot, Sie müssen die Getränke nur selbst besorgen. Das Personal darf den Bewohnern keinen Alkohol kaufen.« Eva öffnete einen Hängeschrank. »Die kleinen Gläser stehen hier.« Sie öffnete einen weiteren Schrank. »Und die großen finden Sie hier.«
»Danke.« Bente nahm sich drei Schnapsgläschen. »Den Rest schaffe ich allein.«
Eva half Bente mit dem Tablett und der Kaffeekanne. »Sagen Sie Bescheid, wenn Sie gehen«, sagte sie zu Birgits Sohn, der sich in den Wegner-Sessel am Fenster gesetzt hatte. Aus der Stereoanlage kam klassische Klaviermusik. »Dann schaue ich hinterher herein und sorge dafür, dass es Ihrer Mutter gut geht.«
Dan bedankte sich. Seine Augen waren wirklich unverschämt blau.
3
»Fahren wir zusammen nach Yderup?« Bente sah Dan an. »Oder soll ich dich am Krankenhaus absetzen, damit du deinen eigenen Wagen nehmen kannst? Das wäre vielleicht am einfachsten, oder?«
»Ja. Wir müssen ja ohnehin jeder in eine andere Richtung, wenn wir fertig sind.«
Das Geschwisterpaar wechselte nicht viele Worte auf der kurzen Fahrt über die Umgehungsstraße zum Krankenhaus, aber als Bente hinter Dans betagtem Audi hielt, sah sie ihn an. »Du glaubst doch, dass es ihr dort gut gehen wird, oder?«
»Es scheint ein freundlicher Ort zu sein.« Dan tat sein Bestes, um entspannt zu wirken.
Es gab keinen Grund, das schlechte Gewissen seiner Schwester zu schüren. Bente kam ohnehin nicht gut damit zurecht, dass ihre Mutter in ein Pflegeheim musste. Irgendwann hatte sie sogar überlegt, mit ihrer Mutter in eine behindertengerechte Wohnung zu ziehen, aber Marianne hatte es ihr glücklicherweise ausreden können. Wie würde es Bente in einer Wohnung mit Personenlift, Toilettenstuhl, Badewannensitz und allen möglichen anderen unschönen Hilfsmitteln gehen? In einer Wohnung, in der alle Möbel so gestellt werden mussten, dass ein Rollstuhl sie umfahren konnte, einer Wohnung, die eher aussah wie ein Krankenhausflur? Außerdem musste man bedenken, dass Bente eine anspruchsvolle Vollzeitstelle hatte und umfassende Hilfe an häuslicher Pflege für ihre Mutter benötigen würde. Denk nur an all die Fremden – Krankenschwestern, Physiotherapeuten und Seniorenbetreuer –, die nahezu rund um die Uhr bei euch ein- und ausgehen würden, hatte Marianne gesagt. Und wie würde sich deine Mutter wohl fühlen, wenn sie ihrer Tochter zu Hause zur Last fiele?
Nein, als Birgits Hausärztin konnte Marianne dieses Projekt nicht unterstützen. Ihre Ex-Schwiegermutter brauchte zu viel Pflege, um in einem privaten Haushalt untergebracht werden zu können. Das Waldhof hatte dagegen den Platz und die notwendige Ausstattung. Schließlich hatte Bente eingewilligt, und als der Beschluss erst einmal getroffen war, konnte man ihr die Erleichterung anmerken, obwohl sie versuchte, es nicht zu zeigen. Dan verstand sie gut. Er hätte die Pflege seiner Mutter selbst niemals übernehmen können. Außerdem wusste er, wie sehr Bente ihr ruhiges Leben als Single in ihrer modernen, voll verglasten Wohnung im Sundværket schätzte, die aussah wie ein Aquarium. Es wäre ein großes Opfer gewesen, sich von dort zu verabschieden.
»Ich kaufe unterwegs etwas zu essen«, sagte Bente, als Dan die Wagentür öffnete. »Was hättest du gern?«
»Ich weiß nicht …« Dan wusste, dass es keine gute Idee wäre, das Mittagessen zu überspringen. »Bring mir einfach irgendetwas mit.«
»Okay.«
»Brot wäre gut.«
»Okay«, sagte sie noch einmal.
Er wich ihrem prüfenden Blick aus, als er aus dem Wagen stieg. »Wir sehen uns dort, Schwesterchen.«
Dan bereute es, dass er zugestimmt hatte, zum Haus ihrer Mutter zu fahren. Obwohl er zum ersten Mal seit Langem eine ganze Nacht durchgeschlafen hatte, war er todmüde. Als würde das Medikament noch wirken. Es war auch härter gewesen, als er es sich vorgestellt hatte, seine Mutter im Pflegeheim unterzubringen. Pflegezentrum, korrigierte er sich und setzte vorsichtig auf dem Parkplatz zurück. Er war mehr als einmal zurechtgewiesen worden, als er die offenbar nicht korrekte Bezeichnung verwendet hatte – allerdings verstand er, der eigentlich großes Interesse an sprachlichen Finessen hatte, nicht, was falsch daran sein sollte, wenn man »Pflegeheim« sagte. Er war sehr dankbar, dass das Personal des Waldhof nicht darauf bestand, die Bewohner als »Kunden« oder »Klienten« zu bezeichnen, wie es bei der ambulanten Pflege der Fall war. Er bekam Pickel bei dieser Art von Verwaltungssprache.
Bente hatte darauf bestanden, dass sie sich für den Rest des Tages noch einen Überblick verschafften, wie die Räumung des Hauses ihrer Mutter ablaufen sollte. »Ich habe schon jetzt fast meinen ganzen Urlaub dafür verbraucht, Mutters Angelegenheiten zu regeln«, hatte sie erklärt. »Wenn ich zwischen Weihnachten und Neujahr freihaben will, kann ich mir keine Zeitverschwendung erlauben.« Dan hatte es eingesehen. Sie konnten es ebenso gut sofort hinter sich bringen.
Die Straße nach Yderup führte durch eine der schönsten Gegenden Dänemarks, eine hügelige Eiszeitlandschaft, und trotz seiner schlechten Laune genoss Dan die Fahrt. Die Bäume verfärbten sich allmählich, und über die Felder zog sich ein ordentliches Muster aus fetten, tiefbraunen Ackerfurchen. Er bildete sich ein, den Geruch von frisch gepflügter Ackerscholle bis in sein Auto hinein riechen zu können, doch als er Yderup Hegn erreichte, verflog seine Hochstimmung ebenso schnell, wie sie gekommen war. In dem kleinen, unter Naturschutz stehenden Waldstück direkt außerhalb des Dorfes hatte man vor einigen Jahren die Leiche eines Mannes gefunden, an den Dan aus irgendeinem Grund immer wieder denken musste, vielleicht weil er einige schwierige Begegnungen mit ihm erlebt hatte. Der Todesfall und die Ereignisse, die damit zusammenhingen, hatten seine Vorstellung von dem idyllischen Dorf, in dem Birgit Sommerdahl viele Jahre gelebt hatte, ein für alle Mal zerstört.
Dan fuhr direkt hinter dem Friedhof eine steile Seitenstraße hinauf und parkte vor einem niedrigen, rot gestrichenen Bauernhaus. Der Briefkasten war voll. Ein Anzeigenblatt ragte mit einer flatternden Ecke aus dem Schlitz, als wollte es einen Fluchtversuch unternehmen. Der Garten, der immer ordentlich und gepflegt gewesen war, sah vernachlässigt aus. Dan hatte ein paar Mal den Rasen gemäht, als seine Mutter im Krankenhaus lag, aber es war nicht wie sonst gejätet worden, niemand hatte die Blumen hochgebunden oder beschnitten. Die Pflaumen waren nicht geerntet worden, sie verfaulten jetzt auf dem Boden. Gut, dass Mutter das nicht erleben muss, dachte Dan, als er den Garten betrat. Wer weiß, ob sie gerade in ihrem Rollstuhl saß und sich fragte, wie der Garten wohl aussah. Oder hatte sie mit diesem Kapitel bereits abgeschlossen – auch gedanklich?
Es war kühl im Haus, obwohl das Thermostat der Heizung irgendwo zwischen der zweiten und dritten Stufe stand. Dan drehte die Heizungen voll auf. Als er fertig war, zündete er im Wohnzimmer den Ofen an. Während er darauf wartete, dass das Holz brannte, schweifte sein Blick durch das Zimmer mit der niedrigen Decke. Es sah bereits einigermaßen gefleddert aus. Mehrere Möbelstücke hatten sie ins Waldhof mitgenommen, überall fehlten Bilder und Nippes, und auch in den Regalen gab es gähnende Leerstellen. Obwohl es unwahrscheinlich war, dass Birgit je wieder lesen würde, waren Bente und er der Meinung gewesen, dass sie ihre Lieblingsbücher um sich haben sollte. Die meisten CDs hatten sie ebenfalls mitgenommen. Dan legte ein Holzscheit auf das jetzt munter knisternde Feuer aus Anfeuerholz und Zeitungspapier und schloss die Luke des Ofens.
In diesem Moment hörte er, wie die Haustür geöffnet wurde. Bente erschien, in der Hand hielt sie eine Tüte des kleinen Supermarkts von Yderup. »Hej«, grüßte sie.
»Hej.«
»Du hast Feuer gemacht? Wie schön.« Sie hatte dunkles Brot und Leberpastete und ein paar Äpfel gekauft. »Und noch ein bisschen was Süßes für später«, sagte sie und stellte eine Marzipantorte auf den Küchentisch.
Sie setzten sich zum Essen aufs Sofa und versuchten, einen Schlachtplan zu entwerfen.
»Ein Nachmittag wird nicht reichen«, meinte Dan. »Es gibt wirklich viel zu entscheiden.«
»Wahrscheinlich nicht«, bestätigte seine Schwester. »Aber wir können uns ja heute einen Überblick verschaffen und uns dann am Sonntag wieder hier treffen. Glaubst du, von den Kindern könnte uns jemand helfen?«
»Laura ist bestimmt gern dabei, wenn sie es irgendwie einrichten kann. Mit Rasmus können wir allerdings kaum rechnen, wie du weißt.«
»Ich bin sicher, dass Kit kommt, aber bei Lea weiß ich es auch nicht genau. Ihre Kleine hat wieder irgendeinen Virus, und ihr Mann ist nicht gern mit den Kindern allein, wenn sie krank sind.«
»Muttersöhnchen.«
»Ach, Frederik ist sehr nett.« Bente trank einen Schluck Wasser. »Ich schlage vor, wir gehen heute einmal alles durch. Wir packen nichts ein, wir schauen bloß. Dann können wir uns die Sachen aussuchen, die wir haben wollen, und die Kinder können es sich später ansehen.«
»Und der Rest? Was weder die Kinder noch wir brauchen können?« Dan sah sich um. »Was machen wir damit? Soll es aufbewahrt werden?«
»Weg damit!«, entschied Bente. »Wenn es niemand von uns will, kommt es auf den Trödel. Ich weiß, dass es Firmen gibt, die auf Nachlässe spezialisiert sind.«
»Es ist kein Nachlass.«
»Nein, aber Mutter kommt nicht wieder zu …«
»Das weißt du doch gar nicht«, unterbrach sie Dan. »Stell dir mal vor, Mutter wird eines Tages wieder gesund und fragt nach ihren Sachen. Erzählst du ihr dann, dass wir einfach alles weggeschmissen haben?«
»Dan, zum Teufel.« Bente zog die Augenbrauen zusammen. »Sei mal ein bisschen realistisch. Ich weiß, es ist schwer, aber du hast gehört, was der Oberarzt gesagt hat. Mit diesen schweren Hirnschädigungen und in ihrem Alter ist es unrealistisch zu glauben, sie könnte …«
»Sie ist erst einundachtzig! Sie kann noch viele gute …« Dans Stimme brach ab, er räusperte sich. »Noch viele gute Jahre haben.«
»Dan.« Bente beugte sich vor und legte eine Hand auf seinen Arm. »Ach, Dan.«
Er riss sich los, ging in die Küche und trank ein Glas Wasser.
Seine Schwester folgte ihm. »Bist du okay?«, erkundigte sie sich. »Dass du dich so aufregst, sieht dir gar nicht ähnlich.«
Dan nickte. »Entschuldige«, sagte er. »Ich bin zurzeit etwas dünnhäutig. Ich schlafe nicht besonders gut.«
»Geht dir die Sache mit Mutter so nahe?«
»Vermutlich.« Er versuchte zu lächeln. »Ich war doch immer Mutters kleiner Junge, oder?«
»Ja.« Ihr Blick war prüfend.
Dan richtete sich auf. »Natürlich hast du recht mit der Haushaltsauflösung. Du warst ja schon immer praktischer veranlagt als ich, Schwesterchen.«
»Wenn es dir so viel bedeutet, können wir ja das eine oder andere einlagern lassen«, meinte Bente.
Er zuckte mit den Schultern. »Kümmer dich nicht um mich. Es ist nur ein bisschen heftig, oder? Das Haus zu räumen, obwohl sie noch am Leben ist.«
»Schon. Aber sie ist einverstanden, dass wir damit anfangen. Sie weiß, dass sie nicht zurückkommen wird.« Bente sah ihn weiter mit ihrem prüfenden Blick an. »Wir können ein paar Wochen warten, wenn du meinst. Oder ein paar Monate. Wir haben es nicht eilig.«
»Nein«, entgegnete er, »bringen wir’s hinter uns.«
Sie begannen im Schlafzimmer. Abgesehen von einigen Kristallflakons, die Bente gern haben wollte, gab es nichts von Interesse. Birgit hatte ihren Schmuck und ihre besten Kleidungsstücke ins Pflegezentrum mitgenommen. Der Rest hatte für niemanden irgendeinen Wert. Sie überprüften rasch die Schubladen und Schränke für den Fall, dass ihre Mutter Bargeld oder Wertgegenstände versteckt hatte, fanden aber nichts.
»Ich glaube, Lea sagte, dass sie und Frederik vielleicht gern das Bett hätten.« Bente schaute unschlüssig auf das voluminöse Eichenholzmonstrum mit den geschnitzten Kopf- und Fußenden. »Obwohl ich mir nur schwer vorstellen kann, wie sie das in den dritten Stock transportieren wollen.«
»Das lässt sich bestimmt auseinanderbauen.« Dan hob die Matratze an und betrachtete die Eckverbindungen. »Wenn Frederik mir hilft.«
»Ich frage sie noch mal.«
Das große Arbeitszimmer war schon weniger überschaubar. Hier hatte Birgit an ihren verschiedenen Projekten gearbeitet – an der kleinen Hobelbank, mit der sie Möbel für ihre Puppenhäuser gebaut hatte, an dem großen Handwebstuhl und der Nähmaschine mit einem eigenen Tisch. Man sah, dass ihre Mutter ihr ganzes Leben Handarbeitslehrerin gewesen war. Nun ja, Dänisch, Englisch und Handarbeit hatte sie unterrichtet, wenn man genau sein wollte. Handarbeit hatte sie allerdings immer am meisten interessiert.
»Laura hätte gern die Nähmaschine«, teilte Dan mit.
»Kann sie haben.« Bente trat an das große Metallregal, das sich über die gesamte hintere Wand zog. »Was machen wir damit?« Sie wies mit dem Kopf auf Regalbretter voller Stoffrollen, Tapetenmusterbücher und Schachteln mit Kleinkram, von dem nur Birgit wusste, wozu er nützlich war.
»Schwierig.« Dan nahm eine Schachtel heraus und blickte auf eine Unmenge Wollknäuel in allen denkbaren Farben. Die nächste Schachtel war voller kleiner Holzstückchen. »Vielleicht können wir das gesamte Material einem Kindergarten schenken.«
»Gute Idee. Das würde Mutter gefallen. Den Webstuhl können wir verkaufen.« Bente öffnete die Türen eines großen Doppelschranks in der Ecke. »Oh nein!«
»Was ist?« Dan stellte sich hinter sie und sah, dass der Schrank voller Archivkästen war, jeder mit einem Etikett versehen, auf dem ein Stichwort zum Inhalt stand. Fotos, Rechnungen, Korrespondenzen, Kinderzeichnungen. Auf den obersten beiden Regalbrettern lagen Stapel von Notizbüchern, Skizzenblöcken und alten Spiralkalendern. »Das können wir nicht einfach wegwerfen«, sagte er und öffnete eine der Fotoschachteln. »Sieh mal.« Er nahm das oberste Foto heraus. »Das bist du.« Ein achtjähriges Mädchen mit dunkler Pagenfrisur stand neben einer sichtbar schwangeren Birgit. »Wer hat das aufgenommen?«
»Vielleicht dein Vater«, vermutete Bente.
Dan drehte das Foto um. Kein Text. Er legte es zurück in die Schachtel und griff nach einem anderen Bild. Darauf waren Dans eigene Kinder im Teenageralter zu sehen. Geistesabwesend starrte er auf die beiden wohlbekannten Gesichter. »Kannst du dich an ihn erinnern?«
»An wen?«
»Meinen Vater.«
»Schwach. Er sprach so gut wie kein Dänisch, unser Kontakt war deshalb nur sehr oberflächlich. Außerdem verschwand er ja ziemlich schnell wieder, ich glaube, du warst noch nicht einmal geboren.«
»Auf meiner Geburtsurkunde steht ›Vater unbekannt‹.«
»Das war wohl die Absprache. Vielleicht wollte er nicht für dich zahlen. Wer weiß. Zusammengelebt haben sie jedenfalls nie.«
»Woher kam er?«
»Keine Ahnung. Hast du Mutter nie gefragt?«
»Sehr oft. Als ich jünger war, habe ich versucht, es aus ihr herauszubekommen, aber sie hat sich immer geweigert, darüber zu reden. Ich weiß nicht einmal seinen Namen.«
Bente schüttelte den Kopf. »Sie ist schon eine besondere Marke, unsere Mutter.«
»Das kann man wohl sagen. Aber ich hätte ihn schon gern mal kennengelernt«, sagte Dan. »Du weißt ja wenigstens, wer dein Vater war.«
»Ja, vielen Dank.« Bente lachte trocken. »Darauf hätte ich auch verzichten können. Mein Vater war mit einer anderen verheiratet, als ich zur Welt kam. Es gab viel Geheimnistuerei und Gerede. Ich habe ihn einmal besucht. Kannst du dich noch erinnern?«
»Nein.«
»Als ich fünfzehn oder sechzehn war. Er wollte mich nicht mal in die Wohnung lassen. Hinterher habe ich tagelang geheult.«
»Wieso hast du mir nie davon erzählt?«
»Du warst noch viel zu klein, und ich wollte das am liebsten so schnell wie möglich wieder vergessen.« Bente zog ein weiteres Foto aus der Schachtel und betrachtete sich geistesabwesend als Neugeborene. »Vielleicht lag es daran, dass Mutter dir nie von deinem Vater erzählt hat. Vielleicht wollte sie dich schonen, damit du nicht die gleiche Enttäuschung erleben musstest wie ich.«
»War mein Vater auch bereits verheiratet?«
»Ich weiß nur, was ich dir schon erzählt habe, Dan. Er hat eine andere Sprache gesprochen, ich glaube, es war Englisch – und er hat nicht bei uns gewohnt. Hin und wieder war er für ein paar Tage zu Besuch bei uns, dann ist er wieder weggefahren. Irgendwann war er dann ganz verschwunden. Mutter hat ihn seitdem nie wieder erwähnt.« Sie legte das Foto zurück in die Schachtel und stellte sie zurück in den Schrank. »Vielleicht hieß er Peter«, sagte sie nach einer Pause. »Ich habe eine frühe Erinnerung, dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe, warum ein ganz gewöhnlicher Name in zwei Sprachen so unterschiedlich klingen kann. Peter auf Dänisch und Pi-i-iter auf Englisch. Aber ob er wirklich so hieß oder nur jemand, von dem er erzählt hat, weiß ich einfach nicht mehr.«
»Hm.« Dan betrachtete noch eine Weile den Inhalt des Schranks. »Weißt du was?«, sagte er dann. »Ich werde mir das alles ansehen und zwei Haufen machen: Einen mit dem, was weggeschmissen werden kann, und einen damit, was aufbewahrt werden muss. Danach können wir die Fotos verteilen.«
»Ernsthaft?«
»Ja, natürlich. Vielleicht habe ich Glück und finde ein Foto von meinem Vater, wenn ich tief genug grabe. Würdest du ihn erkennen, wenn du ein Foto von ihm sehen würdest?«
»Ich glaube schon.«
4
In einem anderen Haus, etwa vierzehn Kilometer nordöstlich, gab es noch jemanden, der überlegte, was mit einem größeren Nachlass geschehen sollte. Eva Nielsen stand mit einem Glas Wein in der Hand an der Tür zum Büro ihres verstorbenen Mannes und rauchte, während sie die vollen Regale betrachtete. Hier hatte Lars-Erik Snapp seit mehr als einem Vierteljahrhundert alles mögliche Treibgut aufbewahrt, das bei seiner Arbeit angefallen war. Alte Belege, abgegriffene Nikon-Kataloge, Ringbücher mit Kontaktdaten von Kunden und Lieferanten. Dazu kamen ganze Stapel von Zeitschriften, in denen er Fotos veröffentlicht hatte. Man sollte alles wegschmeißen, überlegte Eva. Sie konnte sich nur nicht zusammenreißen. Noch nicht, dachte sie. Ihr Blick fiel auf den Computer. Dafür bekam man vielleicht ein bisschen Geld. Aber, gab es überhaupt jemanden, der einen so klobigen, stationären PC haben wollte? Er war ja schon eine Antiquität gewesen, als Lars-Erik ihn vor einigen Jahren von Bent Gørding übernommen hatte, der sich für seine Einmannfirma als Rechnungsprüfer ein moderneres Modell mit Flachbildschirm angeschafft hatte.
Bent. Sie seufzte. Sie hatte schon genug von ihm, wenn sie nur an ihn dachte. Natürlich war es schlimm für den älteren Herrn, dass sein bester Freund tot war, aber war es nicht allmählich an der Zeit, dass er darüber hinwegkam? Oder wenigstens mit seinen Verschwörungstheorien aufhörte? Bent hatte sich in den Kopf gesetzt, dass Lars-Eriks Tod kein Unfall gewesen sein konnte, und egal, was die Polizei, die Techniker und der Gerichtsmediziner sagten, er ließ sich nicht davon abbringen. Eva glaubte jedoch nicht einen Moment an sein Gefasel. In den letzten Wochen im Leben ihres Mannes hatte es zwar ein paar Fälle von Sachbeschädigung und einige anonyme Anrufe gegeben, und Bent hatte vermutlich recht, dass es sich um ein seltsames Zusammentreffen handelte. Doch Lars-Erik hatte nie den Eindruck vermittelt, sich in irgendeiner Weise bedroht zu fühlen, und es gab einfach nichts, das darauf hindeutete, dass sein Unfall nicht selbst verschuldet war. Wenn sie als seine Witwe die Ergebnisse der polizeilichen Untersuchung akzeptieren konnte, warum konnte Bent es nicht auch?
Eva drückte die Zigarette in einem übervollen Aschenbecher auf Lars-Eriks Schreibtisch aus. Es war ihre kleine Rache an ihm, der immer ein hysterischer Nichtraucher gewesen war, sie hatte ja kaum eine Zigarette unter dem Halbdach auf der Terrasse rauchen dürfen. Nach seinem Tod qualmte sie auch in der Wohnung – und besonders gern in seinem Privatbereich, ob hier im Büro oder in der Fahrradwerkstatt hinter der Garage. Die Rennräder und die teure Ausrüstung, die dazugehörte, sollten natürlich verkauft werden. Lars-Eriks Kameraden vom RCC hatten angeboten, alles auf der jährlichen Auktion des Clubs zu versteigern, aber es dauerte offenbar, bis die Auktion organisiert war.
Die Kleidung ihres Mannes hatte sie schon weggeworfen, ein ganzer Oberschrank in der Küche stand leer, nachdem sie sein Proteinpulver und die ganzen Nahrungsergänzungsmittel entsorgt hatte. Das Geschäft am Bahnhofsplatz hatte sie an einen Pakistaner namens Moheem Naqvi verkaufen können. Eigentlich gehörten viele der Unterlagen hier aus dem Büro zum Laden. Vielleicht sollte sie Herrn Naqvi fragen, ob er etwas davon haben wollte. Nein, dachte Eva, nachdem sie sich den Gedanken durch den Kopf hatte gehen lassen. Wozu sollte er sie brauchen? Es war mehrere Jahre her, seit das Fotogeschäft eine Metamorphose durchlaufen hatte, heute gab es dort Smartphone-Hüllen, einen Passfoto-Automaten und einen Apparat, mit dem man digitale Fotos selbst ausdrucken konnte. Sie hatte Herrn Naqvi so verstanden, dass er das Geschäft noch um einen Reparaturservice für Smartphones und Tablets erweitern wollte. Er überlegte sogar, den Namen zu ändern – ihr war es recht. Sie hatte den Namen Snapp-Shot immer für idiotisch gehalten.
Früher war es eines der am besten sortierten Fotofachgeschäfte in der ganzen Gegend gewesen. Lars-Erik, der selbst ein guter Studiofotograf war, hatte viele professionelle Kunden, sein Marktanteil in der Stadt lag bei über sechzig Prozent, doch die Zeit, in der man mit dem Verkauf von Filmen und Kameras noch Geld verdienen konnte, war unwiderruflich vorbei. Heute hatte fast jeder ein Kamera-Smartphone. Noch nie wurde so viel fotografiert, und noch nie hatten die Leute dafür einen so geringen Bedarf an guter Ausrüstung und fachlichem Rat. Die Anzahl von Fotogeschäften war innerhalb weniger Jahre auf ein Minimum zurückgegangen, nicht nur hier in der Stadt, sondern überall auf der Welt. Lars-Eriks Versuche, das Boot über Wasser zu halten, waren verzweifelt und nicht sonderlich effektiv gewesen. Eva schloss die Tür hinter sich.
Das Zimmer ihrer Tochter war so verwaist wie immer. Nach Josefines Abreise vor über einem Jahr hatte Eva aufgeräumt, seitdem war außer ihr hier niemand mehr gewesen. Lars-Erik hatte das Zimmer nie betreten, aber Eva saugte einmal im Monat den Teppichboden und wischte mit einem Lappen über die Oberflächen. In gewisser Weise stand das Zimmer bereit, sollte das Mädchen plötzlich – und gegen jede Wahrscheinlichkeit – eines Tages wiederauftauchen.
Josefine besuchte in England eine private Sprachschule, die Fremdsprachenkorrespondentinnen ausbildete. Ursprünglich wollte sie nur ein Jahr bleiben, doch dann hatte sie sich entschieden, ein weiteres Jahr dranzuhängen. Anfangs hatte sie noch hin und wieder zu Hause angerufen oder eine Postkarte geschickt, doch mit der Zeit war der Kontakt verebbt. Sie beantwortete nur selten Anrufe oder Mails, und als Lars-Erik und Eva sie einmal besuchen wollten, hatte Josefine den Termin so oft verschoben, bis ihre Eltern es schließlich aufgaben. Zu Besuch nach Hause kommen wollte das Mädchen auf gar keinen Fall, nicht einmal in den Ferien hatte sie Zeit. Auch als Eva sie anflehte, wenigstens zur Beerdigung ihres Vaters zu kommen, weigerte sie sich und behauptete, sie hätte zu viel in der Schule zu tun. Eva war so wütend und gekränkt darüber, dass sie daraufhin keinen Kontakt mehr zu ihrer Tochter gesucht hatte, seit der Beerdigung herrschte totale Funkstille zwischen den beiden.
Vielleicht war es an der Zeit, das Schweigen zu brechen. Zumindest würde es Eva das Gefühl geben, das Leben ginge weiter. Sie wollte hier nicht alleine wohnen bleiben. Auf Dauer wäre es sowieso zu teuer, obwohl das Haus fast schuldenfrei war. Am liebsten hätte Eva einen Müllcontainer bestellt und mit Lars-Eriks und Josefines Habseligkeiten gefüllt. Aber bevor sie so drastisch zu Werke ging, wollte sie ihre Tochter wenigstens informieren – egal, wie unmöglich sie sich benommen hatte. Eva ging zurück ins Wohnzimmer, setzte sich aufs Sofa und zündete sich eine weitere Mentholzigarette an. Dann griff sie entschlossen zum Telefon. Die Nummer sei nicht vergeben, teilte ihr eine englische Frauenstimme mit. Eva versuchte es noch einmal. Dasselbe Ergebnis. Keine Verbindung zu Josefines Mobiltelefon.
Sie dachte einen Moment nach. Dann goss sie sich noch ein Glas Wein ein und ging in Lars-Eriks Büro, um den Computer hochzufahren. Eva war technisch nicht sonderlich versiert, doch sie konnte immerhin auf die Homepage ihrer Bank gehen, googeln und im Netz finden, was sie benötigte. Sie öffnete den Internetbrowser und gab Josefines Postadresse ein. Ein weiterer Klick, und eine Telefonnummer stand auf dem Bildschirm, registriert auf den Namen Ute Oppermann. Eva wusste, dass Josefine sich ein Reihenhaus mit vier anderen Studentinnen teilte, aber sie hatte überhaupt keine Vorstellung, wie es dort aussah und wer Ute Oppermann war. Die Vermieterin? Eines der anderen Mädchen?
Eva wählte die lange Nummer.
»Hello?« Eine helle, sehr junge Stimme.
»Hello«, antwortete Eva und gab sich besondere Mühe mit der englischen Aussprache. »I’m Eva Nielsen. Josefine’s mother.«
»Yes?« Das Mädchen nannte keinen Namen, Eva wusste nicht, mit wem sie es zu tun hatte.
»Bist du Ute?«
»Nein.«
Als immer noch kein Name genannt wurde, fuhr Eva fort: »Ich würde gern mit meiner Tochter sprechen.«
»Sie ist nicht da«, sagte die Stimme mit ausländischem Akzent.
»Weißt du, wann sie wiederkommt?«
»Augenblick.« Ein Poltern verriet, dass der Hörer etwas unsanft auf einen Tisch gelegt wurde. Dann: »Das hat sie nicht gesagt. Vielleicht ist sie verreist.«
»Seit wann ist sie denn fort?«
»Seit ein paar Tagen.«
»Sie besucht doch noch diesen Kurs, oder?«
»Sorry. I don’t know.«
»Kannst du eine Nachricht entgegennehmen?«
Tiefes Seufzen. »Soll ich mir was zum Schreiben holen?«
»Ja, danke.«
Erneutes Poltern. Diesmal dauerte es länger, bis Evas unwillige Gesprächspartnerin zurückkam. »Ja?«
»Könnt ihr Josefine bitten, zu Hause anzurufen? Es ist wichtig.«
»Is that all? Wieso musste ich dafür einen Kugelschreiber holen?«
»Wie heißt du?«
»Chiara.«
»Bist du Italienerin?«
»Nein, ich habe nur einen italienischen Namen. Ich bin Französin. I have to leave now.«
Was für eine unverschämte Person, dachte Eva, als sie kurz darauf den Computer ausgeschaltet hatte. Noch abweisender als Josefine. Und dazu gehörte schon etwas. Irgendjemand sollte dieser kleinen Göre Manieren beibringen.
Eva machte sich Abendbrot, aß am Couchtisch im Wohnzimmer und sah sich dabei die lokalen Nachrichten an. Eine Frikadelle, Bratkartoffeln, ein Spiegelei. Eigentlich hätten ihr abends auch nur ein paar Scheiben Brot mit Käse gereicht, zumindest an den Tagen, an denen sie bei der Arbeit ein warmes Mittagessen bekam, aber dazu war sie dann doch zu altmodisch. Ein richtiges Abendessen hatte warm zu sein.
Sie dachte noch einmal über einen eventuellen Umzug nach. Wie lange sollte sie warten, bis sie mit gutem Gewissen das Haus räumen konnte? Wenn Josefine nicht zurückrief? Durfte sie die Sachen ihrer Tochter dann sortieren – wegschmeißen oder irgendwo einlagern? Eigentlich war es ja ein Eingriff in Josefines Privatleben, aber sie konnte ihr eigenes Leben schließlich nicht monatelang in den Pausenmodus versetzen, nur weil es dem Fräulein Tochter nicht passte, sich zu melden.
Eva holte einen karierten Block und einen Kugelschreiber.
Liebe Josefine,
ich habe versucht, Dich am Telefon zu erreichen, aber Dein Handy ist tot, und als ich es auf dem Festnetz versuchte, habe ich erfahren, dass Du verreist bist – niemand wusste, wohin. Sei doch bitte so lieb und ruf mich mal an oder schreib eine Mail. Ich muss wissen, was ich mit Deinen Sachen machen soll, weil ich das Haus verkaufen möchte. Wenn Du nicht innerhalb der nächsten vierzehn Tage Kontakt zu mir aufnimmst, werde ich aus Deinem Zimmer alles wegwerfen, was Du meiner Meinung nach nicht mehr brauchst. Und ich will hinterher keinen Ärger mit Dir.
Ich hoffe, es geht Dir gut und ich höre bald von Dir.
In Liebe
Mutter
Sie las den kurzen Brief noch einmal durch, faltete ihn zusammen und steckte ihn in einen Umschlag. Natürlich hätte sie eine E-Mail schreiben können, aber Josefine hatte ihr schon lange nicht mehr geantwortet. Außerdem hatte sie das Gefühl, dass ein altmodischer Brief viel eher dem Ernst der Situation entsprach. So viele andere Dinge hätte Eva schreiben können, es gab so viele Fragen, auf die sie gern eine Antwort gehabt hätte. Aber der kurz angebundene, etwas unsanfte Ton half ihr, Distanz zu bewahren. Eva war längst über den Punkt hinweg, wo der Kummer über die Unversöhnlichkeit ihrer Tochter ein konstanter Schmerz war, der sie zu den am wenigsten erwarteten Zeiten übermannen konnte. Inzwischen war es ihr egal, mit der Zeit hatte sie gelernt, Kälte mit noch größerer Kälte zu beantworten.
Josefines Reaktion auf Lars-Eriks Tod hatte es ihr definitiv leichter gemacht, so gefühllos zu reagieren. Als Eva vor ein paar Monaten anrief, um eine Nachricht über den Tod ihres Vaters zu hinterlassen, hatte Josefine wenigstens zurückgerufen. Eva hatte gehofft, die Tochter würde alles stehen und liegen lassen, um ihre Mutter zu unterstützen und bei der Beerdigung dabei zu sein, aber sie wurde nur einmal mehr enttäuscht. Als Eva sie schließlich fragte, ob Lars-Erik nicht wenigstens einen Kranz von seinem einzigen Kind verdient hätte, wollte Josefine nicht einmal das. »Du kannst doch unsere beiden Namen auf deinen Kranz schreiben lassen, oder?« Nicht einen Moment hatte sie geklungen, als wäre sie traurig über den Tod ihres Vaters oder hätte wenigstens Mitleid mit ihrer Mutter, die jetzt allein war.
Eva steckte den Umschlag in ihre Tasche. Morgen würde sie die Sekretärin des Pflegezentrums bitten herauszufinden, wie viel Porto sie auf einen Brief nach England kleben musste. Vielleicht bekam sie bei ihr auch eine Briefmarke.
Ihr Mobiltelefon klingelte. Eva schaute aufs Display. Es war Uffe.
»Hej.«
»Ich bin’s.«
»Ja, das habe ich gesehen.«
»Ich dachte … hast du heute Abend schon etwas vor?«
»Nö.«
»Hättest du gern Besuch?«
»Oh, Uffe.«
»Lisbeth arbeitet, und Emma ist mit einer Freundin in der Stadt.«
»Wir waren uns doch einig, damit aufzuhören.«
»Sag jetzt Ja.« Seine Stimme wurde sanft. »Ich hab solche Lust auf dich.«
Eva antwortete nicht. Sie betrachtete die Sofagruppe vor dem lächerlich großen Fernseher, Lars-Erik hatte vor einigen Monaten, zu Beginn der Tour de France, darauf bestanden, ihn zu kaufen. Sie sah sich mit der Fernbedienung davor sitzen, bis es Zeit war, schlafen zu gehen. Sie stellte sich vor, wie der letzte Tropfen der Weinflasche allzu schnell getrunken sein würde.
»Du«, sagte Uffe, als ihr Schweigen sich einige Sekunden hinzog. »Ich habe mir etwas überlegt.«
»Hm?«
»Ich möchte etwas mit dir besprechen.«
»Was denn?«
»Vielleicht ist es an der Zeit, dass ich es Lisbeth erzähle.«
»Bist du wahnsinnig, Uffe? Lisbeth ist meine Freundin.«
»Du kannst diese Heimlichtuerei doch auch nicht leiden, oder? Wäre es nicht besser, reinen Tisch zu machen?« Als sie nicht antwortete, fügte er hinzu: »Meine Ehe ist tot, Eva.«
»Ja, das hast du schon einmal gesagt.«
»Ich finde, wir sollten von vorn anfangen. Wenn ich ihr erzähle, dass ich dich liebe, dann wird sie verstehen …«
»Hör auf!« Eva brüllte beinahe. »Du musst wahnsinnig sein.«
»Ich dachte, wir sind uns einig«, sagte er. »Dass wir uns lieben.«
»Uffe.« Eva seufzte. »Siehst du denn nicht, dass sich alles verändert hat? Als Lars-Erik noch lebte, waren wir in einer ähnlichen Situation, beide verheiratet, beide sind wir fremdgegangen. Doch jetzt …«
»Jetzt gibt es nur noch eine, die verletzt sein wird«, argumentierte er. »Siehst du nicht, dass das viel besser ist?«
»Du verstehst nicht, was ich meine.«
»Dann lass uns vernünftig darüber reden. Ich komme zu dir.«
Ein weiterer Seufzer. »Dann komm.«
Freitag, 2. Oktober 2015
5
Seit vier Tagen nahm Dan Sommerdahl Schlaftabletten – bisher ohne Erfolg. Nachts schlief er zwar tief und fast ohne Unterbrechungen, doch tagsüber fühlte er sich keineswegs so ausgeruht, wie er es sich erhofft hatte. Die Vormittage kamen ihm schwerfällig und stumpfsinnig vor, die Nachmittage nebulös und verschwommen. Erst gegen Abend lebte er ein wenig auf. Dan überlegte, den Arzt anzurufen und ihn um ein harmloseres Präparat zu bitten, obwohl er vermutete, dass Torben Pedersen sich weigern würde, ihm ohne weitere Konsultation am Telefon ein Rezept auszustellen.