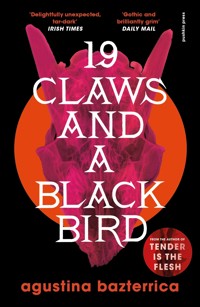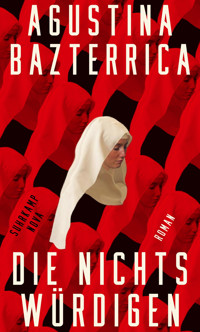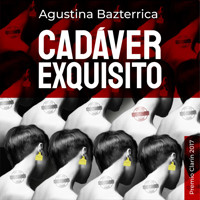13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Marcos verantwortet die Produktion einer Schlachterei. Er kontrolliert die eingehenden Stücke, kümmert sich um den korrekten Schlachtvorgang, überprüft die Qualität, setzt die gesetzlichen Vorgaben um, verhandelt mit den Zulieferern … Alles Routine, Tagesgeschäft, Normalität. Bis auf den Umstand, dass in der Welt, in der Marcos lebt, Menschen als Vieh zum Fleischverzehr gezüchtet werden.
Dieser Roman hält uns Fleischfressern kompromisslos den Spiegel vor. Er stellt Fragen in den Raum - nach Moral, Empathie, den bestehenden Verhältnissen. Und er verschafft, was nur die Literatur verschafft: neue Einsichten, neue Gefühle, nachdem alle Argumente längst ausgetauscht sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 237
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Agustina Bazterrica
Wie die Schweine
Aus dem Spanischen von Matthias Strobel
Suhrkamp
Für meinen Bruder Gonzalo Bazterrica
Eins
... und sein Gesichtsausdruck war so menschlich, dass er mir Entsetzen einflößte ...
Leopoldo Lugones
1
Rumpfhälfte. Betäubungsapparat. Schlachtstraße. Zeckenbad. Diese Wörter kommen ihm in den Sinn, suchen ihn heim. Zermürben ihn. Denn diese Wörter sind nicht nur Wörter. Sie sind Blut, Gestank, Automatisierung, Gedankenlosigkeit. Hinterrücks fallen sie nachts über ihn her. Dann wacht er schweißgebadet auf, weil er weiß, dass ihn ein weiterer Tag erwartet, an dem er Menschen schlachten muss.
Niemand nennt sie so, denkt er, während er sich eine Zigarette anzündet. Auch er nennt sie nicht so, wenn er einem neuen Mitarbeiter den Prozess der Fleischverarbeitung erklären muss. Denn dafür könnte er verhaftet werden, könnte selbst zum Städtischen Schlachthof gebracht und verarbeitet werden. Ermordet, wäre das korrekte, wenn auch verbotene Wort. Er zieht sein durchgeschwitztes T-Shirt aus und versucht den Gedanken zu verscheuchen, dass sie genau dies sind, Menschen, gezüchtet zum Verzehr. Er geht zum Kühlschrank und schenkt sich Wasser ein. Trinkt es langsam aus. Es gibt Wörter, die die Welt verschleiern, denkt er.
Es gibt Wörter, die bequem sind, hygienisch. Legal.
Er öffnet das Fenster, die Hitze erstickt ihn schier. Er atmet die stille Nachtluft ein, raucht. Mit Kühen und Schweinen war es einfach. Es war Handwerk, erlernt im Schlachthof Zypresse, dem Schlachthof seines Vaters, den er geerbt hat. Ja, das Quieken eines Schweins konnte einem durch Mark und Bein gehen, aber dafür gab es Ohrschützer, und nach einer Weile war es nur noch irgendein Geräusch. Jetzt, da er die rechte Hand des Chefs ist, muss er die neuen Angestellten einarbeiten und kontrollieren. Jemandem beizubringen, wie man tötet, ist schlimmer, als selbst zu töten. Er streckt den Kopf zum Fenster hinaus. Zieht die stehende, brennend heiße Luft in die Lungen.
Am liebsten würde er sich betäuben, leben, ohne etwas fühlen zu müssen. Auf Automatik schalten, schauen, atmen, sonst nichts. Alles sehen, wissen und nichts sagen. Doch die Erinnerungen sind da, gehen nicht weg.
Viele Leute haben sich an das gewöhnt, was die Medien den »Übergang« nennen. Er nicht, denn er weiß, dass aus dem Wort »Übergang« nicht hervorgeht, wie kurz und erbarmungslos sich dieser Prozess vollzogen hat. Ein Wort, das etwas fassbar machen soll, was eigentlich unfassbar ist. Ein leeres Wort. Veränderung, Wandel, Wende: Synonyme, die alle das Gleiche zu bedeuten scheinen, die aber eine je eigene Sicht auf die Welt verraten. Alle machen den Kannibalismus hoffähig, denkt er. Kannibalismus, noch so ein Wort, das ihn in große Schwierigkeiten bringen könnte.
Er erinnert sich an die Zeit, als zum ersten Mal vom GBK die Rede war. Die Massenhysterie, die Selbstmorde, die Angst. Nach dem GBK konnte man keine Tiere mehr essen, weil sie sich mit einem für den Menschen tödlichen Virus infiziert hatten. So zumindest die offizielle Version. Worte mit dem nötigen Gewicht, um uns zu formen, um jede Diskussion im Keim zu ersticken, denkt er.
Er geht barfuß in der Wohnung umher. Nach dem GBK war die Welt eine andere. Impfstoffe wurden getestet, Gegenmittel, aber das Virus erwies sich als resistent und mutierfreudig. Er erinnert sich an Artikel über die Rache der Veganer, über Gewaltakte gegen Tiere, an Ärzte, die im Fernsehen erklärten, wie man den Proteinmangel ausgleichen konnte, Journalisten, die bestätigten, dass es nach wie vor kein Heilmittel gegen das Virus gebe. Er seufzt und zündet sich eine weitere Zigarette an.
Er ist allein. Seine Frau ist zu ihrer Mutter gezogen. Er vermisst sie nicht mehr, aber das Haus wirkt so leer, dass er nicht schlafen kann, dass er unruhig ist. Er nimmt ein Buch aus dem Regal. Ist jetzt hellwach. Schaltet das Licht an, um zu lesen, schaltet es wieder aus. Er ertastet die Narbe auf seiner Hand. Sie ist alt, tut nicht mehr weh. Ein Schwein hat sie ihm zugefügt. Er war sehr jung damals, ein Anfänger, der dachte, man müsse das Fleisch nicht respektieren, bis ihm das Fleisch fast die Hand abgebissen hätte. Der Vorarbeiter und die anderen hatten sich schiefgelacht. Jetzt bist du getauft, sagten sie. Der Vater sagte nichts. Nach diesem Biss war er für sie nicht mehr der Sohn des Chefs, sondern ein Teil der Belegschaft. Doch diese Belegschaft gab es nicht mehr, genauso wenig wie den Schlachthof Zypresse.
Er holt sein Handy hervor. Drei Anrufe seiner Schwiegermutter. Keiner seiner Frau.
Weil er die Hitze nicht mehr aushält, beschließt er, unter die Dusche zu gehen. Er dreht den Hahn auf und hält den Kopf unters kalte Wasser. Er will die fernen Bilder wegspülen, die Erinnerungsreste. Die Stapel der bei lebendigem Leib verbrannten Katzen und Hunde. Ein Kratzer bedeutete den Tod. Wochenlang hing der Geruch nach verbranntem Fleisch in der Luft. Er erinnert sich an die Trupps in den gelben Schutzanzügen, die nachts die Stadtviertel durchkämmten, um jedes Tier, das ihnen über den Weg lief, zu töten und zu verbrennen.
Das kalte Wasser plätschert ihm auf den Rücken. Er setzt sich auf den Duschboden. Schüttelt langsam den Kopf, kann nicht anders als sich erinnern. Einige Leute begannen heimlich Menschen zu töten und zu essen. Die Presse berichtete von einem Fall, bei dem zwei arbeitslose Bolivianer von Nachbarn angegriffen, zerlegt und gegrillt worden waren. Als er die Nachricht las, lief ihm ein Schauer über den Rücken. Es war der erste öffentliche Skandal, der Skandal, der einen Gedanken in alle Köpfe pflanzte, dass Fleisch Fleisch ist, egal, woher es stammt.
Er hält sein Gesicht in den Strahl. Will, dass das Wasser seine Gedanken wegspült. Doch er weiß, dass die Erinnerungen bleiben, immer bleiben werden. In einigen Ländern verschwanden massenweise Immigranten. Immigranten, Obdachlose, Arme. Sie wurden verfolgt und geschlachtet. Legalisiert wurde dieses Vorgehen, als die Regierungen unter Druck gesetzt wurden von einer milliardenschweren Industrie, die zum Stillstand gekommen war. Die Schlachthöfe und Regulierungen wurden entsprechend angepasst. Es dauerte nicht lange, da wurden sie wie Vieh gezüchtet, um die massive Nachfrage nach Fleisch zu stillen.
Er tritt aus der Dusche und trocknet sich flüchtig ab. Betrachtet sich im Spiegel, die Ringe unter seinen Augen. Er neigt einer Theorie zu, die anfangs die Runde machte, deren Verfechter jedoch, wenn sie öffentlich darüber sprechen wollten, zum Schweigen gebracht wurden. Ein renommierter Zoologe, der in seinen Artikeln behauptete, das Virus sei eine Erfindung, erlitt einen gelegen kommenden Unfall. Er selbst glaubt ebenfalls, dass alles nur inszeniert ist, um die Überbevölkerung zu stoppen. Seit er denken kann, heißt es, die Ressourcen seien knapp. Er erinnert sich an die Aufstände in Ländern wie China, wo die Leute sich vor lauter Platzmangel gegenseitig töteten, was aber von den Medien nie unter diesem Blickwinkel erörtert wurde. Wer von jeher behauptete, die Welt werde irgendwann explodieren, war sein Vater: »Die Erde wird irgendwann platzen. Du wirst schon sehen, mein Junge, entweder es knallt, oder wir sterben an einer Plage. In China bringen sie sich schon gegenseitig um, weil sie einfach zu viele sind, weil nicht mehr alle reinpassen. Hier, hier ist noch Platz genug, aber dafür wird uns das Wasser ausgehen, die Nahrung, die Luft. Alles wird vor die Hunde gehen.« Damals hatte er ihn mitleidig angesehen, weil er es für seniles Gerede hielt, aber heute weiß er, dass sein Vater recht hatte.
Die Säuberungsaktion brachte einige Vorteile mit sich: Reduzierung der Bevölkerung, der Armut, und endlich wieder Fleisch. Die Preise waren hoch, doch der Markt wuchs rapide. Es kam zu Massenprotesten, Hungerstreiks, einem Aufschrei der Menschenrechtsorganisationen. Gleichzeitig wurden Studien und Berichte lanciert, um die öffentliche Meinung zu manipulieren. Renommierte Universitäten behaupteten, tierische Proteine seien lebenswichtig, Ärzte argumentierten, pflanzliche Proteine enthielten nicht alle essenziellen Aminosäuren, Experten versicherten, die Emission von Treibhausgasen habe sich zwar verringert, dafür aber die Mangelernährung zugenommen. Der Protest schwächte sich ab, und es wurde weiterhin von Fällen berichtet, bei denen angeblich Menschen an dem Tiervirus gestorben waren.
Die Hitze setzt ihm nach wie vor zu. Nackt geht er hinauf zur Galerie. Die Luft steht. Er legt sich in die Hängematte und versucht zu schlafen. Immer wieder muss er an diese eine Werbung denken. Eine schöne Frau, zurückhaltend gekleidet, serviert ihren drei Kindern und dem Ehemann das Abendessen. Sie blickt in die Kamera und sagt: »Spezialkost für meine Familie, Fleisch, wie wir es kennen, nur schmackhafter.« Alle lächeln und essen. Die Regierung, seine Regierung, hatte beschlossen, dem Produkt einen anderen Namen zu geben. Von da an hieß es »Spezialfleisch«. Es war nicht mehr einfach nur »Fleisch«, sondern wurde zu »Spezialfilet«, »Spezialrippchen«, »Spezialniere«.
Er nennt es nicht Spezialfleisch. Er benutzt ein neutrales Wort, um das zu bezeichnen, was ein Mensch ist, aber nie eine Person sein wird, das, was immer nur ein Produkt ist. Er spricht von Stücken, die es zu verarbeiten gilt, von dem Posten im Hof, der abgeladen werden muss, vom Fließband, dessen Geschwindigkeit konstant zu halten ist, von Exkrementen, die als Dünger verkauft werden, von Innereiabteilung. Niemand darf Mensch sagen, weil ihnen dann etwas zugestanden werden müsste, also sagen alle Produkt oder Fleisch oder Nahrung. Nur er nicht, dem es am liebsten wäre, er müsste ihnen gar keinen Namen geben.
2
Der Weg zur Gerberei kommt ihm immer lang vor. Er verläuft kilometerweit geradeaus, vorbei an verlassenen Weiden. Früher grasten dort Kühe, Schafe, Pferde. Jetzt ist da nichts mehr, zumindest auf den ersten Blick nicht.
Das Handy klingelt, seine Schwiegermutter. Er fährt rechts ran und nimmt den Anruf entgegen. Er sagt, er könne jetzt nicht sprechen, er sitze gerade am Steuer. Sie spricht leise, flüstert fast. Sie sagt, Cecilia gehe es besser, aber sie brauche noch etwas Zeit, könne noch nicht zurück. Er sagt nichts. Seine Schwiegermutter legt auf.
Die Gerberei löst ein Gefühl der Beklemmung in ihm aus, wegen des Geruchs des Abwassers, in dem Haare, Erde, Öl, Blut, Abfälle, Fett und Chemikalien schwimmen. Und wegen Herrn Urami.
Die trostlose Landschaft zwingt ihm einmal mehr die Frage auf, warum er weiterhin dieser Arbeit nachgeht. Nur ein Jahr lang hat er im Schlachthof gejobbt, nach der Schule. Danach hat er zur großen Freude seines Vaters Tiermedizin studiert. Doch dann war die Virusepidemie ausgebrochen. Er war nach Hause zurückgekehrt, weil sein Vater verrückt geworden war. Die Ärzte hatten eine Altersdemenz diagnostiziert, aber er ist sich sicher, dass sein Vater den »Übergang« nicht ertragen hat. Viele Menschen verabschiedeten sich vom Leben in Form einer akuten Depression, andere kapselten sich von der Realität ab, wieder andere brachten sich einfach um.
Er sieht das Schild »Gerberei Hifu. 3 KM«. Sie gehört Herrn Urami, einem Japaner, der die Welt verabscheut, aber Leder liebt.
Während er dem einsamen Weg folgt, schüttelt er bedächtig den Kopf, weil er sich nicht erinnern will, doch er erinnert sich trotzdem. An seinen Vater, wie er ihm von Büchern erzählte, die ihn nachts beschatteten, seinen Vater, wie er die Nachbarn beschuldigte, bezahlte Auftragsmörder zu sein, seinen Vater, wie er mit seiner verstorbenen Frau tanzte, seinen Vater, wie er in Unterhosen umherirrte und einem Baum die Nationalhymne vorsang, seinen Vater im Altersheim, den Verkauf des Schlachthofs, um die Schulden zu begleichen und das Haus nicht zu verlieren, an seinen abwesenden Blick, auch heute noch, wenn er ihn besucht.
Er betritt die Gerberei, und es trifft ihn wie ein Schlag auf die Brust. Der Geruch nach den Chemikalien, die den Verwesungsprozess der Haut aufhalten. Ein Geruch, der einem den Atem nimmt. Alle arbeiten absolut lautlos. Auf den ersten Blick wirkt die Stille fast transzendental, wie eine Zen-Meditation, doch erzeugt wird sie von Herrn Urami, der alle von oben beobachtet. Er tritt nicht nur regelmäßig ans Fenster seines Büros und kontrolliert sie, er hat auch überall Kameras installiert.
Er geht die Treppe hinauf. Er muss nie warten. Stets wird er von zwei japanischen Sekretärinnen in Empfang genommen, die ihm, ohne zu fragen, ob er das will, in einer gläsernen Tasse roten Tee servieren. Herr Urami sieht die Leute nicht an. Er taxiert sie. Immer mit einem Lächeln um die Lippen. Wenn Herr Urami ihn ansieht, beschleicht ihn unweigerlich das Gefühl, dass er ausrechnet, wie viele Meter Leder er erhalten würde, würde er ihn hier jetzt schlachten, abhäuten und entfleischen.
Das Büro ist nüchtern eingerichtet, elegant, doch an der Wand hängt eine billige Reproduktion des »Jüngsten Gerichts« von Michelangelo. Er hat es schon oft gesehen, aber erst an diesem Tag fällt ihm auf, dass eine der dargestellten Figuren die abgezogene Haut eines Menschen in den Händen hält. Herr Urami betrachtet ihn, sein verdutztes Gesicht, und erklärt, weil er seinen Gedanken erraten hat, es handele sich um einen Märtyrer, den heiligen Bartholomäus, dem bei lebendigem Leib die Haut abgezogen worden sei, ein hübsches Detail, wie ihm scheine. Marcos nickt, ohne etwas zu sagen, weil ihm dieses Detail überflüssig erscheint.
Herr Urami redet, deklamiert, als offenbare er einem großen Publikum einige schwer verdauliche Wahrheiten. Seine speichelfeuchten Lippen glänzen, er hat die Lippen eines Fischs oder eines Froschs. Überhaupt hat Herr Urami etwas an sich, das schwer zu greifen ist. Er sieht Herrn Urami nur schweigend an, weil es im Grundsatz der immer gleiche Vortrag ist. Herr Urami, denkt er, muss sich mit Worten die Wirklichkeit bestätigen, als schüfen diese Worte die Welt, in der er lebt, als garantierten sie ihre Existenz. Er stellt sich vor, wie diese Welt verschwindet, wie die Wände zurückweichen, der Boden sich auflöst, die japanischen Sekretärinnen sich verflüchtigen. Er sieht es regelrecht vor sich, weil er es sich wünscht, aber es wird nicht geschehen, während Herr Urami weiterhin von Zahlen spricht, von neuen Chemikalien und Färbemitteln, die er gerade testet. Er erklärt ihm, als ob er das nicht selbst wüsste, wie schwer er es mit diesem Produkt habe, wie sehr er Kuhleder vermisse. Wobei er erklärend hinzufügt, dass keine Haut so weich sei wie Menschenhaut, wegen ihrer feinen Körnung. Er hebt den Hörer ab und sagt etwas auf Japanisch. Eine der Sekretärinnen kommt herein, in der Hand eine riesige Mappe. Herr Urami schlägt sie auf und zeigt ihm unterschiedliche Ledertypen. Berührt sie, als wären es zeremonielle Gegenstände. Erklärt ihm, wie sich Schäden vermeiden lassen, die durch Verletzungen beim Massentransport entstehen, wie empfindlich dieses Leder ist. Marcos betrachtet die Mappe. Das ist das erste Mal, dass sie ihm gezeigt wird. Herr Urami hält sie ihm hin, doch er berührt die Muster nicht. Herr Urami deutet nur mit dem Finger auf ein äußerst helles Leder, das Macken aufweist, und sagt, dies sei eines der teuersten Leder überhaupt, aber ein großer Teil sei wegen der Verletzungen unbrauchbar. Nur oberflächliche Wunden könne er kaschieren. Diese Mappe habe er eigens für ihn zusammenstellen lassen, erklärt er, er solle sie den Mitarbeitern des Schlachthofs und der Zuchtfarm zeigen, damit sie verstünden, welche Häute sie besonders behutsam zu behandeln hätten. Er steht auf und sagt, er habe bereits das neue Design in Auftrag gegeben, aber es müsse noch perfektioniert werden, weil es beim Abhäuten vor allem auf den Schnitt ankomme, weil ein schlecht ausgeführter Schnitt meterweise Ausschuss produziere, ein Schnitt müsse unbedingt symmetrisch sein. Herr Urami hebt noch einmal den Hörer an. Die andere Sekretärin tritt ein, mit einer gläsernen Kanne, und schenkt Tee nach. Er will keinen Tee mehr, trinkt ihn aber trotzdem. Die Worte von Herrn Urami sind wohl bedacht, in sich harmonisch. Sie schaffen eine kleine, kontrollierte Welt, mit unzähligen Rissen. Eine Welt, die bei der kleinsten Unbedachtsamkeit zerbrechen kann. Er spricht davon, wie wichtig die Enthäutungsmaschine sei, dass eine winzige Fehleinstellung die Haut zerfetzen könne, dass die frische Haut aus dem Schlachthof länger gekühlt werden müsse, damit das Entfleischen später nicht so mühselig sei, dass die Stapel unbedingt feucht gehalten werden müssten, damit die Haut nicht austrockne und breche, dass man mit den Mitarbeitern der Zuchtfarm sprechen müsse, weil sie es mit der Wasserversorgung nicht so genau nähmen, dass die Betäubung absolut präzise sein müsse, weil mangelnde Sorgfalt sich negativ auf die Haut auswirke, die hart werde, schwerer zu bearbeiten, denn, wie Herr Urami betont, »die Haut ist der Spiegel der Seele, das größte Organ überhaupt«. Er sagt diesen Satz übertrieben betont, ohne sein Dauerlächeln einzustellen. Mit diesem Satz schließt er alle seine Vorträge und schweigt dann wohlkalkuliert.
Er weiß, dass er nicht reden darf, nur nicken, doch es gibt Wörter, die seine Gedanken heimsuchen, sich anhäufen, verwunden. Er würde gern Gräueltat sagen, Unbarmherzigkeit, Exzess, Sadismus. Er hätte gern, dass diese Wörter das Lächeln von Herrn Urami zerfetzen, die bewusst gesetzte Stille durchbohren, die Luft verdichten, bis sie beide ersticken.
Aber er schweigt und lächelt.
Herr Urami begleitet ihn nie hinaus, doch diesmal geht er mit ihm hinunter. Bevor sie das Gebäude verlassen, bleiben sie an einem Tank mit Äscherchemikalien stehen. Herr Urami kontrolliert einen Angestellten, der gerade Häute hineinlegt, die noch Haare aufweisen. Die müssen von einem Züchter sein, denkt er, denn den Schlachthof verlassen nur vollständig enthaarte Häute. Herr Urami macht ein Zeichen. Der Bereichsleiter kommt herbei und schreit einen Arbeiter an, der eine frische Haut entfleischt. Offenbar erledigt der Mann seine Aufgabe nicht gut. Er will die Ineffizienz seines Mitarbeiters damit entschuldigen, dass die Walze der Entfleischungsmaschine kaputtgegangen sei und viele Neue nicht mehr wüssten, wie man Häute von Hand entfleische. Herr Urami bringt ihn mit einer Geste zum Schweigen, und der Bereichsleiter verbeugt sich und zieht sich zurück.
Anschließend begeben sie sich zum Gerbfass. Unterwegs bleibt Herr Urami stehen und sagt, er wolle schwarze Häute. Nur das, ohne weitere Erklärung. Marcos antwortet mit einer Lüge, sagt, es werde in Kürze ein Posten geliefert. Herr Urami nickt und verabschiedet sich.
Immer wenn er das Gebäude verlässt, überkommt ihn das Bedürfnis, eine Zigarette zu rauchen. Und immer gesellt sich irgendein Arbeiter zu ihm und erzählt ihm grauenvolle Dinge über Herrn Urami. Gerüchte besagen, dass er bereits vor dem »Übergang« Menschen getötet und abgehäutet hat, dass er sich zu Hause die Wände mit Menschenhaut tapeziert hat, dass er im Keller Leute gefangen hält und sich daran ergötzt, ihnen bei lebendigem Leib die Haut abzuziehen. Er begreift nicht, warum die Angestellten ihm dieses Zeug erzählen. Alles ist möglich, denkt er, aber mit Gewissheit weiß er nur eines, nämlich dass Herr Urami sein Geschäft betreibt, indem er Angst verbreitet, und dass es funktioniert.
Er fährt los und ist erleichtert. Wieder einmal fragt er sich, warum er sich das nach wie vor antut. Die Antwort lautet immer gleich. Er weiß, warum er diese Arbeit macht. Weil er der Beste ist und entsprechend bezahlt wird, weil er nichts anderes gelernt hat und weil der Gesundheitszustand seines Vaters es erfordert.
Manchmal muss man das Gewicht der Welt auf seinen Schultern tragen.
3
Sie arbeiten mit vielen Züchtern zusammen, aber er besucht auf seiner Tour nur die, die große Stückzahlen liefern. Früher war darunter auch der Zuchtbetrieb Guerrero Iraola, bis die Qualität des Produkts immer mehr zu wünschen übrigließ. Manche Stücke waren gewalttätig geworden, und je gewalttätiger ein Stück wurde, desto schwerer war es zu betäuben. Bevor er ihm den ersten Auftrag erteilte, hat er dem Züchter Todd Voldelig einen Besuch abgestattet, aber es ist das erste Mal, dass er ihn zum Teil seiner Tour macht.
Bevor er eintritt, ruft er im Altersheim an. Ans Telefon geht Nélida, die sich um all die Dinge kümmert, die ihn wahrlich nicht interessieren. Ihre Stimme ist energiegeladen, doch darunter nimmt er eine Müdigkeit wahr, die sie aushöhlt, sie aufzehrt. Seinem Vater gehe es gut, sagt sie. Sie nennt ihn Don Armando. Er werde ihn bald besuchen, erwidert er, das Geld für diesen Monat habe er bereits überwiesen. Keine Sorge, mein Lieber, sagt Nélida, Don Armando ist so weit stabil, das eine oder andere Wehwehchen, aber insgesamt stabil. Er fragt, ob sie mit Wehwehchen Anfälle meint. Sie sagt, er solle sich keine Gedanken machen, es sei nichts, was man nicht in den Griff bekommen könne.
Er legt auf und bleibt ein paar Minuten im Auto sitzen. Er sucht aus dem Adressbuch die Nummer seiner Schwester heraus. Will sie anrufen, überlegt es sich aber anders.
Er betritt die Zuchtfarm. Gringo, der Besitzer, bittet ihn um Entschuldigung, gerade sei ein Deutscher da, der eine große Stückzahl kaufen wolle, dem müsse er die Farm zeigen, ihm alles erklären, weil er keine Ahnung habe, er sei neu im Geschäft, sei einfach so hereingeschneit, er habe keine Zeit mehr gehabt, ihm Bescheid zu sagen. Schon gut, sagt er, er komme mit.
Gringo ist unbeholfen. Er bewegt sich, als wäre die Luft um ihn herum zu dicht. Marcos kann nicht richtig einschätzen, wie groß er ist. Stößt daher ständig gegen Leute und gegen Dinge. Schwitzt. Sehr.
Als er ihn zum ersten Mal getroffen hat, dachte er zunächst, es wäre ein Fehler, mit ihm zusammenzuarbeiten. Doch Gringo ist ein effizienter Züchter, einer der wenigen, der für bestimmte Probleme Lösungen gefunden hat. Er besitzt diese Art von Intelligenz, die man nicht schärfen muss.
Gringo stellt ihn dem Deutschen vor. Egmont Schrei. Sie geben einander die Hände. Egmont blickt ihm nicht in die Augen. Er trägt eine Jeans, die wie neu gekauft aussieht, dazu ein allzu sauberes Hemd. Weiße Turnschuhe. Mit diesem glattgebügelten Hemd und den blonden, nach hinten gegelten Haaren wirkt er deplatziert. Doch Egmont weiß Bescheid. Er sagt kein Wort, weil er Bescheid weiß, und dieses Outfit, dass den Ausländer verrät, der noch nie auf dem Land war, dient ihm dazu, genau die richtige Distanz zu wahren, um das Geschäft anzubahnen.
Gringo holt sein Handy hervor, startet die Übersetzungs-app. Er kennt diese Programme, hat aber noch nie wirklich eines benutzt. Zu reisen hatte er nie die Gelegenheit. Gringo spricht ins Handy, die Übersetzung folgt über den Lautsprecher. Er sagt, er werde ihm jetzt die Zuchtfarm zeigen, zuerst die Deckstation. Egmont nickt. Die Hände zeigt er nicht, hält sie hinter seinem Rücken.
Sie gehen an verhängten Käfigen entlang. Gringo erklärt Egmont, eine Zuchtfarm sei ein großes Lager für Lebendfleisch, und hebt dazu die Arme, als verrate er ihm das Geheimnis des Geschäfts. Der Deutsche scheint nicht zu verstehen. Gringo verzichtet nun lieber auf hochtrabende Definitionen und erklärt stattdessen Grundlegendes, zum Beispiel, dass bei ihm die Stücke strikt getrennt voneinander gehalten werden, jedes Stück in einem eigenen Käfig, um zu verhindern, dass sie sich gegenseitig verletzen oder gar auffressen. Das Handy übersetzt mit der mechanischen Stimme einer Frau. Egmont nickt.
Er kann nicht umhin, die Ironie zu erkennen. Fleisch, das Fleisch frisst.
Er öffnet den Käfig des Deckhengsts. Auf dem Boden liegt frisches Stroh, und vor den Gitterstäben stehen, von einem Mäuerchen umfasst, zwei Metalleimer. In einem befindet sich Wasser. In den anderen, der leer ist, kommt das Futter. Gringo erklärt, diesen Deckhengst habe er als kleiner Junge noch selbst aufgezogen, er sei der erste der reinen Generation. Der Deutsche sieht ihn fragend an. Er holt sein Handy heraus, öffnet eine andere App. Er fragt, was die reine Generation sei. Gringo erklärt ihm, die ERG seien Stücke, die in Gefangenschaft geboren und aufgezogen seien, ohne genetische Modifikationen und ohne Wachstumshormone. Der Deutsche scheint zu verstehen und fragt nicht weiter nach. Gringo nimmt seine vorigen Ausführungen wieder auf, die ihn mehr zu interessieren scheinen, und erklärt, es handle sich eigentlich nicht um einen Deckhengst, sondern um einen vasektomierten Suchbock, der die Weibchen besteige und so die Exemplare zu bestimmen helfe, die bereit seien zur Befruchtung. Die restlichen Deckhengste entleerten einfach ihren Samen in Dosen, der dann für die künstliche Befruchtung verwendet werde. Das Handy übersetzt.
Egmont will den Käfig betreten, doch er stoppt ab. Der Suchbock bewegt sich, sieht ihn an. Der Deutsche weicht einen Schritt zurück. Gringo bemerkt nicht, dass der Deutsche sich unwohl fühlt. Er redet weiter. Er kaufe Deckhengste nach Tageszunahme und Muskelqualität, aber zu seinem Stolz habe er diesen hier nicht gekauft, sondern selbst aufgezogen, erläutert er nun schon zum zweiten Mal. Die künstliche Befruchtung sei notwendig, um Krankheiten zu vermeiden, und garantiere homogenere Chargen, um nur einen Vorteil zu nennen. Gringo zwinkert dem Deutschen zu und schließt: Die Investition lohne sich erst ab hundert Stück, da der Unterhalt und das Fachpersonal teuer seien. Der Deutsche fragt, ob der Deckhengst wirklich nötig sei, schließlich seien das keine Schweine oder Pferde, sondern Menschen, und wieso der Deckhengst sie tatsächlich besteige, das sollte er lieber nicht tun, das sei unhygienisch. Die Stimme, die übersetzt, ist männlich. Klingt natürlicher. Gringo lacht etwas betreten. Niemand nennt sie Menschen, jedenfalls nicht hier, weil verboten. »Nein, klar, das sind keine Schweine, auch wenn sie genetisch sehr ähnlich sind, aber sie haben eben das Virus nicht.« Alle schweigen. Auch die Handys sind verstummt. Gringo drückt auf dem Display herum, worauf die Stimme wieder anspringt. »Wie gesagt, dieser Deckhengst entdeckt für mich, welches Weibchen stillbrünstig ist, und bereitet es optimal vor. Außerdem ist uns aufgefallen, dass Weibchen sich williger besamen lassen, nachdem er sie bestiegen hat. Natürlich wird er regelmäßig untersucht und gegen alle Krankheiten geimpft.«
Er sieht, wie sich der Ort mit den Wörtern aus Gringos Mund füllt. Es sind leichte Wörter, Wörter ohne Gewicht. Wörter, die sich mit den anderen Wörtern vermischen, den unverständlichen, mechanischen, ausgesprochen von einer künstlichen Stimme, einer Stimme, die nicht weiß, dass diese Wörter sich auf ihn legen können, ihn ersticken.
Schweigend betrachtet der Deutsche den Deckhengst. Es scheint fast so, als lägen in diesem Blick Neid oder Bewunderung. Er lacht und sagt: »Was für ein tolles Leben der hat.« Das Handy übersetzt. Gringo schaut ihn verblüfft an und lacht ebenfalls, um seine Mischung aus Ärger und Ekel zu überspielen. Er sieht die Fragen in Gringos Kopf auftauchen: »Wie kann er sich nur mit einem Stück vergleichen? Wie kann er sich wünschen, ein Tier zu sein?« Nach einer peinlichen Stille antwortet Gringo: »Aber nicht lange. Sobald er uns nichts mehr nützt, landet er ebenfalls im Schlachthof.«
Gringo redet weiter, als könnte er nicht anders. Er ist nervös. Er sieht, wie Gringo der Schweiß von der Stirn rinnt und die Tropfen in den Gesichtsgrübchen hängenbleiben. Egmont fragt ihn, ob die Stücke sprechen können. Sie seien so schweigsam. Gringo antwortet, sie würden isoliert gehalten, erst in Brutkästen, später in Käfigen. Außerdem würden ihnen die Stimmbänder entfernt, so seien sie besser zu kontrollieren. Fleisch spreche nun mal nicht. Kommunizieren würden sie schon, aber in einer primitiven Sprache. Dadurch wisse man, ob ihnen kalt sei, ob sie Hunger hätten, solche grundlegenden Dinge eben.
Der Deckhengst kratzt sich an seinen Eiern. In die Stirn gebrannt sind ihm, ineinander verschlungen, ein T und ein V. Er ist nackt, wie alle Stücke auf allen Zuchtfarmen. Sein Blick ist unruhig, als lauere hinter dem Unvermögen, Wörter zu sagen, der Wahnsinn.
»Nächstes Jahr präsentiere ich ihn auf dem Treffen des Viehzuchtverbands«, sagt Gringo in triumphierendem Ton und lacht, was klingt, als würde eine Ratte an einer Wand entlangscharren. Egmont sieht ihn verständnislos an, und Gringo erklärt ihm, dass auf diesem Treffen die besten Stücke ausgezeichnet würden, die reinrassigsten.
Sie gehen weiter an den Käfigen vorbei. Er schätzt, dass allein in dieser Halle über zweihundert Käfige sind. Und es ist nicht die einzige Halle. Gringo kommt zu ihm und legt ihm eine Hand auf die Schulter. Sie ist schwer. Und so verschwitzt, dass sein Hemd feucht wird. Gringo sagt leise:
»Tejo, hör zu, die neue Charge schicke ich dir nächste Woche. Premiumfleisch, Exportware. Darunter auch einige ERG.«
Er spürt den Atem an seinem Ohr, stoßweise.
»Letzten Monat hast du uns eine Charge mit zwei kranken Stücken geliefert. Die Ernährungsbehörde hat das Okay verweigert. Wir mussten sie den Aasfressern überlassen. Von Krieg soll ich dir ausrichten, dass er sich einen anderen Züchter suchen wird, sollte das noch mal passieren.«
Gringo nickt.
»Ich bringe das mit dem Deutschen noch zu Ende, und dann reden wir in Ruhe.«
Gringo führt sie ins Büro. Hier gibt es keine japanischen Sekretärinnen oder roten Tee, denkt Marcos. Es ist eng, die Wände sind aus Sperrholz. Gringo gibt ihm eine Broschüre und sagt, er solle sie lesen. Egmont erklärt er, er exportiere Blut einer Spezialcharge schwangerer Weibchen. Dieses Blut, erläutert er, hat ganz besondere Eigenschaften. In großen roten Buchstaben steht dort, dass dieses Verfahren die unproduktiven Stunden der Ware verringert.
Er denkt: Ware, noch so ein Wort, das die Welt verdunkelt.
Gringo redet weiter. Das Blut von Schwangeren sei vielseitig verwendbar. Früher habe man daraus kein Kapital geschlagen, weil es illegal gewesen sei. Heute zahlten die Leute gutes Geld dafür, weil die Stücke, denen man Blut abzapfe, unweigerlich eine Fehlgeburt erlitten, wegen der anschließenden Anämie. Das Handy übersetzt. Die Wörter fallen mit erschreckendem Gewicht auf den Tisch. Gringo sagt zu Egmont, es sei eine Investition, die sich auszahle.
Er sagt nichts. Der Deutsche auch nicht. Gringo wischt sich mit dem Ärmel seines Hemds den Schweiß von der Stirn. Sie verlassen das Büro.
Sie kommen zum Melkbereich. Dort befinden sich Maschinen, die an den Eutern saugen, wie Gringo sie nennt. »Diese Milch hat 1-A